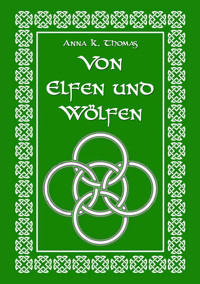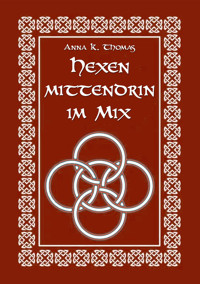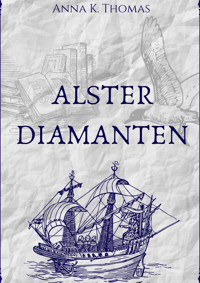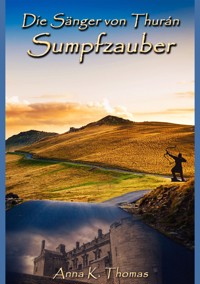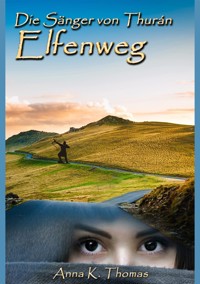
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Kinder der Engel
- Sprache: Deutsch
Thurán ist eine mittelalterliche Welt voller fremdartiger Geschöpfe und Zauberei. Sie untersteht der Obhut der Schwestern Weega und Cassiopeia, die allerdings nur auf bestimmte Art und Weise in das Schicksal ihrer Schutzbefohlenen eingreifen. Um auf Thurán überleben zu können, muss man manchmal zu ungewöhnlichen Mitteln greifen. Jann Deren ist dreizehn Jahre alt, als er bei einem Brand seine gesamte Familie verliert. Um den Erinnerungen zu entkommen, hängt er sich an die Fersen seiner Retterin, der Halbelfe Acanà von Anabellánien. Acanà nimmt ihn nur widerwillig mit, denn sie wird von einem ganz persönlichen Ziel getrieben, von dem sie sich nicht abbringen lassen will. In ihr steckt mehr, als man auf den ersten Blick vermutet – und Jann wird dies bald herausfinden. Elfenweg ist der erste Band der abgeschlossenen Fantasytrilogie „ Die Sänger von Thurán“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1203
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
© 2020 Anderland Books
12105 Berlin
ISBN 978-3-96977-000-9
3. Auflage
Alle Rechte vorbehalten
Tag der Veröffentlichung 24.08.2020
Titelbild: Aleksandra Galert
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Prolog: Der Anfang des Weges
1. Teil: Der Weg zum Weisen
2. Teil: Der Weg zum Drachen
3. Teil: Der Weg zur Sammlerin
4. Teil: Der Weg zu den Moris
5. Teil: Der Weg zu den Hexern
6. Teil: Der Weg zum Ziel
Anhang
Personenverzeichnis
Begriffsverzeichnis
Länder- und Gebietsverzeichnis
Karten
Widmung
Für Aruna,
die Acanà und Jann ins Leben rief;
für Susanne und Sigrid,
die an ihrem Abenteuer teilhatten;
für meine Eltern und Tanja,
die ihnen als Erste folgten;
und für alle, die mich auf diesem langen Weg begleiteten.
Prolog: Der Anfang des Weges
Die Alten sagten immer, früher war alles besser. Vielleicht lag das an der Glorie der eigenen Jugend, oder an dem Talent, schlechte Erinnerungen zu verdrängen, die Bürden der Vergangenheit als geringer zu betrachten und die eigene Kraft einst als größer. Früher war alles besser. Auch die Großmutter sagte es, wenn sie die ganz Kleinen in ihr Zimmerchen zog, um sie mit Geschichten von den Kämpfen draußen auf dem eigenen Hof abzulenken. Die ganz Kleinen kannten alle ihrer Geschichten, und sie erzählte sie immer und immer wieder, denn im Gebiet der rivalisierenden Bauern von Raja wurde oft gekämpft.
Wenn die Großmutter jedoch von den guten, alten Zeiten sprach, meinte sie nicht ihre eigene Jugend. Die Großmutter war nicht in Raja geboren worden, und wenn sie gewusst hätte, wie viele ihr liebgewordene Leute sie an die Fehden verlieren würde, hätte sie ihre Heimat vielleicht nie verlassen. Aber sie war auch schon alt, sehr alt, und falls sie früher mit ihrem Schicksal gehadert hatte, so hatte sie irgendwann vor der Geburt der ganz Kleinen damit aufgehört. Sie sprach nicht von Schicksal oder von dem Hader damit. Sie sprach von dem Hader der Irdischen untereinander, und wie sehr dies die Schwestern gestört hatte, damals, in der guten, alten Zeit, bevor Weega und Cassiopeia fortgegangen waren. Die ganz Kleinen waren schon in der Lage, ihre Geschichten mit den Gefechten draußen zu verbinden – was, wie die Großmutter wusste, nichts ändern würde. Und trotzdem erzählte sie von den Schwestern, und von Thonash dem Sänger, der auf ihrer Hochzeit gespielt hatte, so wie auf der ihrer eigenen Großmutter.
„Dann muss er aber sehr alt gewesen sein“, meinte ihr Liebling, ein kleines, blondgelocktes Mädchen, noch nicht einmal vier Jahre alt.
Die Großmutter schloss die Augen und sah wieder das Gesicht des Sängers vor sich, die zerzausten Haare und braungebrannten Wangen eines Vagabunden, die ernsten Augen. Oh nein, nicht alt, Thonash Illiad würde nie alt sein. Sie konnte ihren Enkeln erzählen, einmal den Schüler Weegas gesehen zu haben.
„Weegas Schüler ist blöd“, sagte der kleine Junge, „der Auserwählte Cassiopeias kämpft wenigstens. Weegas Schüler redet bloß.“
„Der Auserwählte Cassiopeias kämpft für die Gerechtigkeit“, erinnerte die Großmutter sanft, „Weegas Schüler bringt die Wahrheit. Beides ist wichtig.“
„Aber es gibt immer einen Auserwählten und nur ganz selten einen Schüler“, erwiderte das kleine Mädchen weise.
„Nur alle hundert Jahre“, nickte die Großmutter, „Thurán hat mit der Wahrheit mehr Schwierigkeiten als mit der Gerechtigkeit.“
„Wenn wir das nicht mehr haben, Großmutter, kommen dann die Schwestern zurück?“
„Ja, mein Schatz“, bestätigte sie, „dann kommen Weega und Cassiopeia zurück, und es wird wieder so wie früher. Es wird Frieden sein auf Thurán, und die Leute werden sich nicht mehr gegenseitig töten.“
Ein besonders lautes Krachen von draußen, gefolgt von einem Fluch, ließ sie zusammenfahren.
„Es ist allerdings noch ein weiter Weg dahin“, setzte sie seufzend hinzu.
Das blonde Mädchen auf ihrem Schoß ließ sich weder von dem Lärm noch von den aufgeregten Rufen des kleinen Jungen neben ihr beeindrucken. Wer in Raja aufwuchs, lernte, so etwas zu akzeptieren.
„Wann kommt denn der neue Schüler Weegas?“, fragte sie und legte ihren Kopf an den Arm der Großmutter.
Auf meiner Hochzeit hat er gesungen, dachte diese, und auf der meiner eigenen Großmutter. Sind das hundert Jahre?
„Vielleicht gibt es ihn schon“, sagte sie schließlich, „aber für Cassiopeia reitet Aruna die Waise über Thurán.“
Es krachte wieder draußen, diesmal bedrohlich nahe.
„Und es wäre gut, wenn sie hier mal vorbeikäme“, meinte die Großmutter.
„Aruna die Waise, die finde ich toll!“, begeisterte sich der kleine Junge, „sie soll ein Schwert haben, und ein Pferd, und niemand kann den Hajun so werfen wie sie!“
„Ich mag Thonash Illiad mehr“, beharrte das Mädchen, „er hat auf Großmutters Hochzeit gesungen!“
„Du dumme Liese, dann ist er doch längst tot“, schnaubte der Junge verächtlich.
Das Krachen kam allmählich näher und verwandelte sich langsam in unheilvolles Knistern, so dass die Kinder sich unwillkürlich dichter an die Großmutter drängten.
„Erzähl noch mal von den Schwestern!“, bat die Kleine.
Die Großmutter legte ihre Arme um sie und fing mit gleichmäßiger Stimme an, die alte, oft gehörte Geschichte zu rezitieren.
„Vor langer Zeit, als auf Thurán noch Frieden herrschte und die Wesen einander akzeptierten, regierten zwei überirdische Gestalten die Welt. Es waren die Schwestern Weega und Cassiopeia. Sie sorgten dafür, dass die Ordnung der Welt aufrechterhalten und ihre Geheimnisse bewahrt und weitergegeben wurden. Aber dann brach unter den Wesen Streit und Hader aus. Die Völker zogen in den Krieg, das Land wurde vom Blut überschwemmt. Die Schwestern waren von ihren Schutzbefohlenen zutiefst enttäuscht und zogen sich von Thurán ...“
Das Krachen stammte diesmal von der abrupt aufspringenden Tür. Darin stand der Bruder des blonden Mädchens. Er war dreizehn, ziemlich klein für sein Alter, und über seine Wange zog sich ein blutiger Streifen, kaum verdeckt von dem Ruß und den Rauchspuren auf seinem Gesicht.
Er wirkte erschöpft.
„Wir müssen hier raus“, sagte er kurz angebunden.
Die Großmutter zögerte nicht. Sie reichte ihm das Mädchen, nahm den kleinen Jungen hoch und eilte aus dem Zimmer, dem Ausgang zu.
„Nein“, sagte er und packte ihre Hand, „nicht da lang, da brennt es. Wir müssen vorne durch.“ Und er zog sie in die angegebene Richtung.
Ein heißer Windstoß kam ihnen entgegen. Rauch und Asche bliesen ihr ins Gesicht, nahmen ihr die Luft und machten es schwer, den richtigen Weg zu erkennen. Der Griff des Dreizehnjährigen um ihr Handgelenk war hart wie Eisen. Sie keuchte und versuchte, das Gewicht des Kindes auf ihrer Hüfte zu verlagern, betete voller Angst, jetzt nicht zu stolpern, fürchtete, nie wieder aufstehen zu können, und die Kinder, oh Himmel, die Kinder ... Dann krachte es wieder, ein brennender Balken stürzte neben ihnen herunter, und der Junge taumelte, als er getroffen wurde. Jemand versperrte ihnen den Weg.
„Bring sie zurück, Jann!“, sagte der Älteste der Geschwister herrisch, „hier geht es nicht weiter! Sie haben Vater erschlagen!“
Der kleine Enkel auf ihrer Hüfte heulte auf, aber das blonde Mädchen auf den Armen des Dreizehnjährigen gab keinen Laut von sich, als ihr Bruder sich ohne Worte umwandte und den Weg nach hinten suchte.
„Brich die Fenster auf, Jann!“, rief der Ältere ihnen nach, und der Dreizehnjährige nickte nur und zerrte die Großmutter hinter sich her. Das Feuer kam näher, der Rauch wurde dichter, und sie hustete. Noch nie war ihr der Weg so weit erschienen.
Das Zimmerchen der Großmutter selbst besaß keine Fenster, aber die Milchkammer ein paar Schritte weiter hatte eines, gegen die drohenden Angreifer mit groben Brettern verbarrikadiert. Der Dreizehnjährige ließ die Großmutter los. Sie sank erschöpft zu Boden, rang keuchend nach Atem. Der kleine Junge, den sie bis hierher getragen hatte, glitt stumm wie eine Puppe von ihrer Hüfte. Sie hatte nicht die Kraft, ihn festzuhalten, und sie hatte auch kaum die Kraft, nach ihrem Liebling zu greifen, den der Bruder ihr in die Arme stieß, damit er die Hände frei hatte. Hinter ihnen brach die Treppe zusammen, so dass, egal, was jetzt geschah, sie nicht mehr zurück konnten.
Ihr Sohn, ihr Sohn ...
Sie riss sich zusammen und zwang ein Lächeln auf ihr Gesicht, als sie hinunter auf das kleine Mädchen in ihren Armen schaute – und dann erstarrte sie. Die Haare des Kindes waren nicht mehr blond, sondern rot von Blut, die großen Augen zwar offen, aber blicklos. Einer der Balken vor dem Fenster gab nach, und etwas Licht kam in die Kammer. Sie hob zitternd die Hand, und dann sah sie auf, sah den Dreizehnjährigen, der all seine Kräfte noch einmal aufbot, um zu retten, wo es doch längst nichts mehr zu retten gab. Sie musste nicht einmal mehr nach dem kleinen Jungen tasten, um zu wissen, dass er nicht mehr atmete, dass er tot war, genau wie das Mädchen auf ihrem Schoß, chancenlos, rettungslos verloren in diesem Chaos aus Feuer, Hitze und Qualm. Der Rauch war so dick, dass ihre Augen brannten, und nur deshalb brannten ihre Augen, nur deshalb schlug ihr Herz so schnell, nur deshalb wurde ihr der Atem so knapp. Sie sank zurück und sah nicht mehr, wie die Hälfte der Zimmerdecke einstürzte, wie ein Teil der Wand nachgab, wie der Junge am Fenster zusammensackte, und wie dann, einem Wunder gleich, ein Arm durch das Fenster nach innen griff, ihren dreizehnjährigen Enkel am Kittel packte und hinauszog.
Als das brennende Haus zusammenbrach, war die Großmutter schon tot.
1. Teil: Der Weg zum Weisen
Wer im Gebiet der rivalisierenden Bauern von Raja aufwuchs, kannte sich aus mit Schmerz. Schmerz erschreckte niemanden, der einen Bogen in der Hand gehalten hatte, sobald er über den Schutzzaun blicken konnte. Aber wer im Gebiet von Raja aufwuchs, der kannte auch das Geräusch und den Geruch des schlimmsten Feindes in einem Land von Holzhäusern: Prasseln, Knistern, der brennende Rauch eines verheerenden Feuers – sie waren schlimmer als alles andere. Jann Deren, dreizehn Jahre alt und einziger Überlebender seiner Familie – was er aber noch nicht wissen konnte – fuhr erschrocken hoch und riss die Augen auf.
Einen Moment später sank er stöhnend zurück. Er hatte die Kraft seines Körpers überschätzt. Lähmender Druck entstand hinter seiner Stirn, und Übelkeit stieg in ihm auf. Dann registrierte er, dass jemand ein kühles Tuch über seine Augen gelegt hatte. Er war folglich nicht allein – und es war wichtig zu wissen, in wessen Gesellschaft er sich befand.
Etwas vorsichtiger geworden öffnete Jann seine Augen erneut und schob das Tuch langsam zur Seite. Blätter – er lag unter einem Baum. Es war kühl, nicht heiß, also war er ein Stück von dem Feuer entfernt, und die Luft roch zwar verbrannt, war jedoch nicht dick vor Qualm. Er drehte den Kopf weiter. Ein kräftiges graues Pferd, ein paar Meter von ihm entfernt, friedlich weidend. Ein Bündel, daneben eine Tonflasche mit Wasser, und eine Hand, die danach griff. Jann wandte den Kopf zurück.
Seine größte Angst verschwand sofort. Er kannte seinen Retter nicht; es war niemand aus der Horde feindlich gesinnter Bauern. Also war er vermutlich nicht gerettet worden, um sofort versklavt oder grausam hingerichtet zu werden. Jann, mit seinen dreizehn Jahren, fand diesen Gedanken außerordentlich beruhigend. Dann jedoch sah sein Retter ihn an, und seine Angst kam zurück, wenn auch anders.
Eine Weile fiel kein Wort. Große blaue Augen sahen in rätselhaft dunkle, nahezu schwarze, die ihn durchdringend musterten.
Schließlich seufzte sie und sagte: „So. Du bist also wach.“
Sein Retter war eine Frau. Sie war zierlich, die pechschwarzen Strähnen straff nach hinten gebunden, ein Tuch lag fest wie ein Haarbeutel darüber. Bekleidet war sie mit einem langen grünen Hemd sowie einer dunklen Hose und hohen Stiefeln. An ihrem Gürtel hingen ein paar Waffen – ein Dolch, ein Messer, ein Bündel Wurfkugeln. Jann, dem klar wurde, dass er unhöflich starrte, schluckte einmal trocken.
Wer wusste schon, ob er vom Regen in die Traufe gekommen war?
„Hm, ja“, antwortete er deshalb vage. Seine Stimme klang rau vom Rauch, und er musste husten.
„Trink“, sagte die Frau.
Ihre Hand lag ruhig in seinem Nacken, die Tonflasche stieß kühl an seine Lippen. Er gehorchte und dachte währenddessen, dass jemand, der ihm zu trinken gab, vermutlich nicht an seinem sofortigen Tod interessiert war.
„Besser?“, fragte sie.
Er nickte, setzte sich auf und sah sich weiter um. Er kannte den Hügel, er kannte den Baum. Sie waren nicht weit vom Hof seiner Familie entfernt, und damit wurde auch klar, was da mit so verheerender Wucht brannte. Schlagartig erinnerte er sich an die letzten Momente im Haus.
Seine Augen weiteten sich entsetzt.
„Meine Familie!“, stieß er hervor.
Die Frau hinderte ihn daran, voller Panik aufzuspringen.
„Umsonst“, sagte sie, „ich war dort. Niemand ist mehr lebend hinausgekommen. Das heißt, niemand außer dir.“
Und so erfuhr Jann Deren, dass er völlig allein in der Welt stand.
Es war ein herber Schlag für einen Dreizehnjährigen, und er war später stolz darauf, dass er nicht sofort in Tränen ausbrach. Die Stimme der Frau klang unmissverständlich, räumte jegliche Zweifel aus. Es war nicht notwendig, aufzustehen, hinzugehen und nachzuschauen.
Er tat es trotzdem. Schweigend, steif wie ein alter Mann, suchte er sich vorsichtig den Weg zurück, über den so gut bekannten Hügel, den so oft gelaufenen Pfad. Die fremde Frau blieb stumm an seiner Seite, bis er die Kuppe erreichte und auf die brennenden Gebäude hinunter blickte, dieses flammende Inferno, das sein Zuhause gewesen war. Von den feindlichen Bauern war niemand zu sehen, aber es war ja schließlich auch offensichtlich, dass es auf Derens Hof nichts mehr zu holen gab. Die Angreifer waren längst fort.
„Komm“, sagte die Frau, und anders als vorher klang ihre Stimme jetzt freundlich. Jann folgte ihr wortlos zurück und hockte sich wieder unter den Baum, legte den Kopf auf die Arme und vergrub das Gesicht. Er reagierte nicht, als sie sich neben ihn setzte.
„Möchtest du etwas essen?“
Er schwieg und hörte, wie sie nach einer Weile wieder seufzte.
„War deine ganze Familie dort?“
Er konnte nicht antworten. Wenn er jetzt sprach, würde der Damm in ihm zusammenbrechen, den er so mühsam aufrechterhielt. Sie wartete wieder ein Weilchen, dann sagte sie leise: „Mein Name ist Acanà. Wie lautet deiner?“
Es war umsonst, der Damm ließ sich nicht halten, er spürte es. Er sah hoch, sah ihre Augen, jetzt viel sanfter als zuvor, würgte seinen Namen heraus und fiel ihr in die Arme, um in heftiges Schluchzen auszubrechen.
Und Acanà von Anabellánien, die mit einer Menge seltsamer Dinge auf ihrer Suche gerechnet hatte, stellte plötzlich verwirrt fest, dass sie einen bitterlich weinenden Jungen am Hals hatte.
Janns hemmungsloser Gefühlsausbruch war zum Glück nicht von Dauer. Nach wenigen Minuten beruhigte er sich, zog sich verlegen zurück und wischte über sein Gesicht.
„Ich habe niemanden mehr“, stellte er fest und bemerkte erschrocken, wie sehr seine Stimme wackelte, „kein Zuhause, nichts. Alles ist fort!“
„Das ist schlimm, natürlich“, erwiderte sie, „aber immerhin bist du noch am Leben. Gibt es keinen, der dich aufnehmen wird? Verwandte, Freunde?“
Er schüttelte stumm den Kopf, Tränen würgten wieder in seiner Kehle.
„Du musst doch Leute hier kennen!“, setzte sie mit Nachdruck hinzu.
„Wie die, die unseren Hof angesteckt haben?“, stieß er bitter hervor.
„Ist etwa ganz Raja hinter euch her?“, fragte sie ungläubig.
„Nein“, gab er zu, „ich weiß nicht genau, wer es war. So etwas ... so etwas geschieht hier halt.“
„Hm“, meinte sie nachdenklich, „dann stimmt es wohl, was man über die Bauern sagt. Kein Ort, an dem ich bleiben würde, wenn ich die Wahl hätte.“
Er sah verdutzt auf, als ein plötzlicher Gedanke durch seinen Kopf fuhr.
Von hier fortgehen, diese Fehden verlassen, nie wieder so ein Feuer erleben zu müssen ...
Der Gedanke war völlig neu, völlig ungewohnt – und überraschend verführerisch.
„Es ist nicht überall auf Thurán so wie hier, nicht wahr?“, fragte er leise.
„Glücklicherweise nicht“, sagte sie trocken, „Raja ist schon einzigartig.“
„Wie ist es außerhalb von Raja?“, hakte er nach.
„Ein bisschen friedlicher, würde ich sagen“, erklärte sie, „hast du deine Heimat noch nie verlassen?“
„In Raja reist man nicht.“
„Verstehe“, murmelte sie, „wie sollte man auch dazu die Zeit finden, wenn man fremde Höfe anstecken muss.“
Das tat weh, er zuckte schmerzlich zusammen. Sie holte tief Luft.
„Wir sollten fort von hier“, sagte sie energisch, „ich schätze, die werden irgendwann wiederkehren, und dann möchtest du vermutlich nicht mehr da sein, oder?“
„Nein“, flüsterte er, „lieber nicht.“
„Also komm“, sagte sie und erhob sich.
Acanà von Anabellánien hatte wirklich mit einer Menge seltsamer Dinge auf ihrer Suche gerechnet, jedoch, wie bereits gesagt, ganz bestimmt nicht damit, plötzlich die Verantwortung für einen verwaisten Halbwüchsigen zu tragen.
Sie war sich ziemlich sicher, dass ihr das überhaupt nicht gefiel.
Rasch und präzise räumte sie ihre Sachen zusammen, nicht ohne dabei einen gelegentlichen Blick auf diesen Jungen zu werfen, der da so unvermutet in ihrem Leben aufgetaucht war. Innerlich schüttelte sie mehr als einmal den Kopf, während sie ihr Lager abbrach und Larissa sattelte. Der Junge wirkte ziemlich benommen, rührte kaum eine Hand, um ihr zu helfen, sondern saß apathisch auf seinem Platz. Aber das erstaunte sie nicht sehr. Immerhin hatte er gerade alles verloren, was er besessen hatte, und nach seinem Äußeren zu schließen, war er noch ein Kind.
Was sollte sie jetzt bloß mit ihm tun?
Zunächst einmal schien es eine gute Idee zu sein, möglichst schnell den brennenden Hof hinter sich zu lassen. Sie setzte den Jungen auf ihr Pferd und lief den Rest des Tages, Larissa am Zügel führend. Erst, als die Sonne unterging, hielt sie wieder an. Eine kleine Lichtung bot ausreichend Schutz, und es war warm genug, so dass sie kein Feuer anzünden musste, was ihr aus vielerlei Gründen nur recht war. Der Atem des Jungen klang mittlerweile schwerer – er hatte bestimmt eine ordentliche Portion Rauch eingeatmet. Aber er ging ihr schweigend beim Bereiten des Abendessens zur Hand und schien kein Bedürfnis zu haben, über irgendetwas zu sprechen. Sie gab ihm ihre Ersatzdecke und sah zu, wie er sich darunter einrollte und rasch einschlief, erschöpft von den Ereignissen des Tages. Sie selbst hingegen saß noch ein Weilchen da, hörte auf seine angestrengten Atemzüge und machte sich bewusst, dass auch andere Leute auf Thurán Sorgen hatten.
Am nächsten Morgen war sie vor ihm auf, und bevor sie ihm etwas zu essen gab, schickte sie ihn energisch zum Waschen, denn er stank nach Rauch und hatte Ruß und Aschespuren überall.
Ein tropfender, aber leidlich sauberer Jann saß ihr beim Frühstück gegenüber. Er schwieg so lange, dass sie schon glaubte, er habe durch das Geschehene die Sprache verloren, bis er schließlich doch noch den Mund aufmachte.
„Du kommst nicht von hier, oder?“, fragte er vorsichtig.
„Nein“, antwortete sie, „ich bin nur auf der Durchreise. Ich will nach Norden.“
„Und du bist ganz allein?“
„Ja.“
„Warum? Ich meine, willst du denn niemanden bei dir haben?“
Er sah sie eindringlich an, und sie zuckte mit den Schultern.
„Daran liegt es nicht“, erwiderte sie nachlässig, „der Grund ist wohl eher, dass niemand mit mir kommen kann.“
Das war ein Fehler. Sie begriff es sofort, als seine Augen bei ihren Worten aufleuchteten. Bei den Schwestern! Glaubte er etwa, er könne mit ihr gehen?
„Wir müssen jetzt wohl einen Platz finden, an dem du bleiben kannst, was?“, sagte sie knapp.
Das Licht in seinen Augen erlosch, er senkte den Kopf. Acanà verspürte den Hauch eines schlechten Gewissens und räusperte sich.
„Erst sollten wir zu Ende essen“, setzte sie hinzu, „dann brechen wir auf. Ich will nicht länger als unbedingt nötig hierbleiben.“
Er antwortete nicht mehr, während sie entschlossen ihr Frühstück in Angriff nahm. Es kam nicht in Frage, dass sie ein Kind mitnahm. Sie wusste ja nicht einmal, wohin sie überhaupt ging!
Es kam allerdings auch nicht in Frage, ein frisch verwaistes Kind einfach so auf einer Lichtung zurückzulassen, und so packte sie nach der Mahlzeit ihre Sachen zusammen, setzte den erneut verstummten Jungen auf Larissa und machte sich auf die Suche nach einer Unterkunft. Er sprach nicht mit ihr, und das störte sie mehr, als sie erwartet hätte. Sie fühlte sich unwohl, gab nach wenigen Versuchen auf, ein harmloses Gespräch beginnen zu wollen, und stapfte schweigend einher. Wenn er nicht reden wollte, nun gut. Sie würde ihn nicht dazu zwingen.
Der Rest des Tages verging, bis sie letztendlich entschlossen einen der Höfe ansteuerte. Ihr kleiner Begleiter reagierte praktisch nicht, als sie an das Tor klopfte und die Bewohner um ein Nachtquartier bat. In Raja war man Fremden gegenüber misstrauisch, doch wenn man sich mit seinen Nachbarn bekriegte, konnte man nicht sonderlich wählerisch sein, sobald es darum ging, Neuigkeiten zu erfahren, die einen eventuellen Vorteil verschafften. Man ließ sie nach einer kurzen Diskussion ein.
Im Stall zeigte sich Jann ein wenig nützlicher. Er half Acanà beim Abladen des Gepäcks, versorgte mit ihr Larissa und folgte schweigend ins Haupthaus, wo schon das Abendessen auf sie wartete. Mit dem Abendessen kamen auch die Fragen, und sie hasste diesen Teil, obwohl sie allmählich lernte, den Antworten auszuweichen.
„Kommt Ihr von weit her?“, wollte die Hausherrin höflich wissen.
Acanà lächelte so offen wie möglich.
„Ich reise viel“, sagte sie vage, und als sie an dem erwartungsvollen Schweigen merkte, dass das nicht ausreichte, setzte sie mit Bedacht hinzu: „Bevor ich durch Raja kam, war ich im Osten, nahe der Berge.“
„Das ist ein langer Weg“, erwiderte der Hausherr erstaunt, „wohin seid Ihr unterwegs?“
Gute Frage, dachte sie grimmig, lächelte erneut und antwortete ausweichend, um die Leute danach mit einigen Erzählungen abzulenken. Das hatte Erfolg, wie es zu erwarten war, denn schließlich trafen Bauern aus Raja relativ selten Fremde. Hier gäbe es eine Menge zu tun, überlegte sie im Stillen, während sie die Gesichter mit den leuchtenden Augen betrachtete, aber sie schob den Gedanken rasch beiseite.
Sie schickte Jann voraus, als man später am Abend zu Bett ging.
„Ihr habt ja schon viel gesehen“, sagte der Hausherr, „eine Menge Erlebnisse für so ein junges Ding, wie Ihr wohl seid!“
Sie ignorierte die Anspielung auf ihr Alter und lächelte nichtssagend.
„Hattet Ihr den Jungen schon immer bei Euch?“, fügte der Hausherr hinzu.
Und da ließ sie die Tür los, die sie schon in der Hand gehabt hatte, und drehte sich zu ihm herum, um ihn einen Moment lang durchdringend zu mustern.
„Wegen des Jungen ...“, begann sie.
Jann schlief schon, unruhig und mit gekrauster Stirn, als sie sich neben ihn ins Stroh legte.
Es kommt nicht in Frage, dass du ein Kind mitnimmst, sagte sich Acanà am nächsten Morgen streng, zudem noch eines, das hier zu Hause ist und das du nur per Zufall gefunden hast. Du bist nicht verantwortlich für ihn! Du hast genug zu tragen!
Sie schnürte ihr Bündel und sattelte Larissa, wie sie es seit einiger Zeit tat, mit ruhigen, sicheren Händen. Der Junge, dem sie direkt nach dem Aufstehen gesagt hatte, dass der Bauer ihn aufnehmen wollte, schaute ihr schweigend dabei zu. Sie ließ sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Jann Derens Schicksal ging sie nichts an, und es war absolut sinnlos, dass er sich wie ein Entenküken verhielt, welches der erstbesten Person nachrannte, die es beim Schlüpfen entdeckte.
Die weißen Enten vor dem Palast in Anabellánien ...
Sie holte tief Luft und konzentrierte sich auf ihre Arbeit. Sobald sie fertig war, nahm sie Abschied von der Bauernfamilie, dankte für die Unterkunft und schwang sich auf Larissa. Jann hielt ihr den Zügel.
„Jetzt trennen sich unsere Wege“, sagte sie, mit Absicht die alte Formel nutzend.
Er nickte nur und sah sie weiterhin stumm an.
„Hab Acht auf deinen Weg“, setzte sie schroff hinzu und wandte sich ab.
Jann antwortete nicht. Er schaute ihr durch das Hoftor nach, beobachtete, wie das kleine graue Pferd bedächtig ausschritt, betrachtete die zierliche Gestalt darauf, die ihn aus dem Feuer gezogen hatte.
„So, mein Junge“, sagte der Bauer neben ihm und räusperte sich, „ganz schön ärgerliche Situation für dich, was? Nichts für ungut. Ich kannte den alten Deren. Hat mir auch mal geholfen, deshalb nehme ich dich auf. Von nun an gehörst du zu uns und wirst für uns arbeiten, und wenn du das tust, soll es dir an nichts fehlen. Mein Sohn wird dir sagen, wo du anfangen kannst.“
„Danke, Bauer“, erwiderte er, ohne den Blick von der immer kleiner werdenden Reiterin zu nehmen.
Der alte Deren, das war Janns Großvater gewesen, in ganz Raja bekannt und schon vor Jahren gestorben. Jann selbst hatte nur noch eine dumpfe Erinnerung an ihn. Er wusste, dass der Großvater sehr charismatisch gewesen sein musste – und zwar charismatisch genug, um die Großmutter zur Aufgabe ihrer Heimat zu bewegen. Der Großvater war der einzige ihm bekannte Mensch, der Raja jemals verlassen hatte, aber was er da so erlebt hatte, wusste Jann nicht mehr. Er erinnerte sich lediglich daran, dass Cris Deren einmal einen Drachen gesehen hatte, was starken Eindruck auf seine Enkelkinder gemacht hatte.
Er drehte den Kopf und musterte den Hof – dem sehr ähnlich, auf dem er noch einen Tag vorher zu Hause gewesen war. Er würde sich schnell eingewöhnen. Die Arbeit würde dieselbe sein, die Risiken die gleichen, der Tagesablauf identisch, wenn man einmal davon absah, dass er nicht mehr Sohn des Hofes war. Von Derens Hof war nichts mehr übrig – und es würde noch viel weniger sein, sobald dieser Tag vorüber war. Wenn er sich nicht irrte, machte sich dort drüben bereits eine Gruppe von Männern mit Werkzeugen auf den Weg zu der Unglücksstätte, um sich ein paar Parzellen abzustechen. Dasselbe würden heute vermutlich alle Bauern der Umgebung tun, und sich dann noch gehörig darum zanken. Er, Jann, würde nie eine Krume von Derens Hof und Äckern erhalten. Er konnte froh sein, dass er ein anständiges Dach über dem Kopf gefunden hatte und einen Bauern, der ihn nicht misshandeln wollte.
Er konnte froh und dankbar sein, dass er überhaupt lebte.
Jann wandte das Gesicht wieder dem offenen Hoftor zu. Von der Fremden, die ihn gerettet hatte, war nichts mehr zu sehen – sie verließ Raja so rasch, wie sie gekommen war. Sie erlebte Abenteuer, das hatte er aus ihren Geschichten herausgehört. Sie würde ihr Leben nicht damit verbringen, um ein paar Meter Land zu streiten und darüber zu sterben, wie es seiner Familie ergangen war.
Sie verließ Raja, wie einst sein Großvater.
Sein Großvater hatte einen Drachen gesehen.
Jann Deren traf seine Entscheidung ruhig und sicher. Ohne Eile löste er sich vom Hoftor, machte einen großen Bogen um den Bauernsohn und besorgte sich in der Küche eine Tonflasche und etwas zu essen. Dann holte er die Decke aus dem Stall, in der er nachts geschlafen hatte, ließ einen Stab mitgehen und sattelte ohne Hast ein kräftiges, kleines Maultier.
Er ritt zum Hoftor hinaus, als hätte man ihm den Auftrag erteilt.
Erst am Abend bemerkten sie, dass er fort war.
***
Jann war dreizehn, und demzufolge waren seine Entscheidungen noch nicht sonderlich durchdacht. Natürlich fiel es ihm zunächst leicht, Raja zu verlassen. Was sollte ihn denn hier noch halten, bei den Mördern seiner Familie, in einem Land, in dem sich niemand mehr um ihn scherte?
Aber er kannte nur Raja, und er hatte eine mehr als vage Vorstellung davon, was er in der großen, weiten Welt anstellen sollte und wovon er leben wollte. Er folgte Acanàs Spuren, ohne großartig darüber nachzudenken. Das gestohlene kleine Maultier war freundlich, kräftig und ließ sich auch zu einem gelegentlichen Trab überreden, so dass er langsam aufholte. Zwar hatte seine Lebensretterin deutlich gemacht, dass sie ihn gar nicht mitnehmen wollte, doch da sie die erste Person von außerhalb Rajas war, der er je begegnet war, konnte er genauso gut ihr folgen, wie sich allein durchschlagen. Er hatte zwar überhaupt keine Ahnung, was er ihr sagen sollte, sobald er sie eingeholt hatte, aber darüber machte er sich zu diesem Zeitpunkt auch wenig Gedanken. Vielleicht lag Acanà mit ihrer Vorstellung von einem Entenküken gar nicht so falsch.
Als die Nacht kam, sah er von weitem, dass sie sich unter einem Baum niederließ und ihr Lager bereitete. Jetzt wurde ihm doch unbehaglich zumute.
Er verspürte nicht das geringste Interesse, sich wieder den seltsamen dunklen Augen auszusetzen. Stattdessen band er sein Maultier an, hüllte sich in die Decke und versicherte sich, dass sein altes Messer griffbereit war. In der anderen Hand hielt er den Stock. Rajas Bauern blieben in der Dunkelheit zwar grundsätzlich lieber hinter ihren Palisaden, aber man wusste ja nie.
Jann Deren verbrachte eine äußerst ungemütliche erste Nacht alleine.
Er war schon wach, als Acanà ihr Lager zusammenpackte, doch er wartete ihren Aufbruch ab, um ihr in einigem Abstand zu folgen. In der Stille der Nacht war ihm ein unangenehmer Gedanke gekommen: Was, wenn sie ihn fand und sofort zurückbrachte?
Ein zweites Mal würde er nicht so leicht davonlaufen können.
So folgte er ihr die nächsten Tage vorsichtig. Allmählich verließen sie das Gebiet von Raja, die Pflanzen änderten sich, die Felsen wurden zerklüfteter und die Luft rauer. Man sah weniger Menschen, aber das war ihm nur recht. Mittlerweile musste sich herumgesprochen haben, was auf dem Hof seiner Familie geschehen war, und er wollte nicht erkannt werden. So machte er lieber einen großen Bogen um alle Menschen, was es natürlich wiederum erschwerte, Acanà nicht aus den Augen zu verlieren.
Aber zu seinem Glück hielt sie ebenfalls recht selten bei Leuten an und schlief stets im Freien, so dass er langsam zu dem Schluss kam, dass sie den Bauernhof lediglich aufgesucht hatte, um ihn loszuwerden.
Nun, sie ahnte ja nicht, dass er ihr folgte!
Am Morgen des siebten Tages hatten sie Raja endgültig hinter sich gelassen. Es gab keine Felder mehr, keine mit Palisaden umbauten Höfe, kein Vieh auf den Weiden. Hier würde allerdings auch niemand Vieh weiden lassen, dachte Jann mit Kennerblick, viel zu schlechte Kräuter und viel zu steiniges Gelände. Sie mussten die Ebene von Nordam erreicht haben.
Er gewöhnte sich daran, unter freiem Himmel zu schlafen. Eine Hand hatte er stets am Messer, eine auf dem Stock, und das Maultier, inzwischen von ihm auf den Namen Richa getauft, lag dicht neben ihm, damit sie sich ihre Körperwärme teilen konnten. Er stellte sogar fest, dass er ein Dach über dem Kopf gar nicht vermisste. Der Himmel über ihm konnte nicht brennen, und die fremden Laute der wilden Tiere waren immer noch besser als Prasseln und Knistern.
Acanà hingegen entzündete an diesem Abend ein Feuer, denn es wurde frisch, und sie hatte Hunger auf etwas Warmes. Sie rieb ihre klammen Finger über den Flammen und dachte lange nach. Es war empfindlich kühl in den Nächten, so dass sie morgens ihren Umhang anbehielt. Anders als Jann fasste sie ihre Entschlüsse meist erst, wenn sie sich über die Konsequenzen im Klaren war, und sie konnte sich lange zu keinem durchringen.
Es steht geschrieben ... überlegte sie, und dann: Vor langer Zeit, als auf Thurán noch Frieden herrschte...
Sie stand auf und lief um das Feuer herum, um sich durch die Bewegung etwas aufzuwärmen. Während sie ihr Essen verzehrte, dachte sie noch einmal an die Kälte, und an die Wölfe, die sie letzte Nacht viel zu nah hatte heulen hören. Sie grübelte über Sklaventreiber und Räuber nach, erinnerte sich an die Moris.
Nur an Drachen verschwendete sie keinen Gedanken.
Jann hätte in dieser Nacht ebenfalls gerne ein Feuer gehabt, trotz des Prasseln und Knistern. Ihm war verdammt kalt, als er am Morgen aufwachte. Richa schien genauso wenig davon angetan zu sein, ohne ihren gewohnten, warmen Stall auskommen zu müssen. Erst, nachdem er seine kärgliche Frühstücksration aus getrocknetem Brot und Nüssen mit ihr geteilt hatte, bequemte sie sich, ihn weiter zu tragen.
Und nun ging ihm allmählich auf, wie wenig er seine Entscheidung durchdacht hatte. Einfach fortzulaufen war ja gut und schön, aber mittlerweile neigte der Proviant sich dem Ende zu, und er war sich gar nicht sicher, wie er sich weiterhin verpflegen sollte. Außerdem wusste er nichts über diese Frau, der er folgte. Es war schließlich durchaus möglich, dass sie ihn geradewegs in sein Verderben führte! Konnte er sich nicht eigentlich genauso gut seinen eigenen Weg suchen und hoffen, auf Leute zu treffen, die ihm helfen würden, bevor er in der Wildnis verhungerte?
Aber wenn er auf besagte Leute traf, was dann? Was konnte er Fremden sagen, was anbieten? Woher wusste er, ob sie ihn nicht gleich töten oder als billige Arbeitskraft einsperren würden?
Vielleicht hätte er doch in Raja bleiben sollen. Es machte wenig Sinn, einfach einer unbekannten Frau zu folgen, er musste schließlich von etwas leben. Vielleicht wäre es wirklich besser, schlicht und ergreifend umzukehren und zu hoffen, dass der Bauer ihm verzeihen würde.
Jann erinnerte sich an den Hof in Raja und schauderte unwillkürlich. Nein, er wollte nicht zurück, auf gar keinen Fall! Es musste eine andere Möglichkeit geben, auch wenn diese Frau nichts von ihm wissen wollte. Mit dreizehn war man doch kein kleines Kind mehr, man würde überleben!
Er redete sich selber Mut zu, doch als die Mittagszeit kam und er im Weiterreiten den letzten Rest Nüsse aufaß, geriet sein Entschluss erneut heftig ins Wanken. Ein paar Tage konnte man ohne Essen auskommen, das wusste er, und Wasser hatte er bisher ebenfalls immer wiedergefunden. Aber ewig konnte er so nicht weitermachen. Wenn er auf Thurán überleben wollte, brauchte er dringend Hilfe!
Und so grübelte er intensiv über seine Lage nach. Die verschiedensten Möglichkeiten spielte er in seinem Kopf durch, während er sich vorsichtig seinen Weg über die steinige Ebene suchte, gedankenverloren Richa um den nächsten Felsen lenkte – und plötzlich erstarrte.
Vor ihm stand das graue Pferd, und daneben lehnte besagte Frau, mit einem säuerlichen Ausdruck im Gesicht.
„Du bist eine verdammte kleine Nervensäge!“, sagte sie zornig, „wie kann man nur so stur sein!“
Er zog die Zügel an, schluckte das drohende Gefühl der Angst und erwiderte ihren Blick trotzig. Sie musterte ihn so wütend, dass er schon insgeheim damit rechnete, gepackt und zurückgezerrt zu werden, und er fing an, sich zu fragen, ob er sich gegen sie wehren sollte und wie erfolgsversprechend das wohl sein würde.
Doch dann erschien plötzlich so etwas wie ein halbes Lächeln um ihren Mund, und sie fügte fast wie gegen ihren Willen hinzu: „Aber wenn du unbedingt fort willst, dann – na gut, dann komm halt eben erst mal mit mir.“
Jann war unglaublich erleichtert.
Am Abend saß er dicht neben dem Feuer und zog die Decke um sich. Acanà musterte seine Kleider.
„Die Stiefel sind gut“, sagte sie, „du brauchst allerdings dringend einen warmen Umhang und ein dickeres Oberteil. Wir nähern uns Tadschinin, dort werden wir wohl etwas für dich finden. Weißt du eigentlich, worauf du dich einlässt?“
„Nein“, sagte er wahrheitsgemäß, froh bei dem Gedanken an einen Umhang, „woher auch? Ich habe keine Ahnung, wer du bist.“
Tadschinin war eine Stadt nördlich der Ebene, zumindest so viel war ihm bekannt.
„Und trotzdem hängst du dich einfach so an meine Fersen?“, fragte sie, „du kennst Thurán nicht sehr gut, oder?“
„Ich will aus Raja fort“, gab er zurück und biss sich auf die Lippen, um nicht wieder in Tränen auszubrechen, „es hat nichts mit dir zu tun – ich würde auch allein gehen!“
„Hm“, machte Acanà, „das hast du wohl bewiesen. Weißt du denn, was du willst?“
„Was ich ...“ Jann stockte unwillkürlich.
Dann holte er tief Luft.
„Ich würde gerne was erleben“, sagte er mutig, „und ich glaube, du erlebst was. Mein Großvater hat Raja auch mal verlassen, und er hat sogar einen Drachen gesehen! Alles ist besser als die Kämpfe in Raja!“
„Drachen sollen besser sein? Du hast ja seltsame Vorstellungen, mein Kleiner“, erwiderte sie spöttisch, „aber nun gut, ich kann durchaus verstehen, wenn du hier weg willst. Ich nehme dich mit bis nach Tadschinin, und dann sehen wir weiter.“
„In Tadschinin lässt du mich wieder zurück?“, fragte er unwillkürlich.
Sie sah ihn streng an.
„Man kann nichts zurücklassen, was einem nicht gehört“, erklärte sie kühl, „und nein, ich lasse dich nicht in Tadschinin. Es ist kein Ort für kleine Jungs wie dich.“
„Ich bin nicht klein!“, begehrte Jann empört auf.
„Du bist alles andere als groß“, entgegnete sie, „und du musst wissen, was du willst, Abenteuer erleben genügt nicht. Du kannst eine Weile mit mir kommen, Kleiner, wenn es sich nicht ändern lässt – aber ich bin nicht gerade die richtige Gesellschaft für dich.“
„Was wäre denn die richtige Gesellschaft für mich?“, erwiderte er wütend.
Und darauf schien ihr zu ihrem eigenen Erstaunen keine Antwort einzufallen.
Acanà hatte wesentlich mehr Talent als Jann, wenn es darum ging, etwas zu essen zu besorgen. Von Larissas Rücken aus erlegte sie mit ihren Wurfkugeln einen Hasen für das Abendessen. Er selbst konnte lediglich ein bisschen Gemüse und Nüsse beisteuern. Immerhin schien es ihr zu schmecken, was er gesammelt hatte, so dass er insgeheim beschloss, dies weiterzuführen, zumal er in den letzten Tagen die Kunst entwickelte hatte, deswegen kaum anhalten zu müssen. Sie war schweigsam, und obwohl er ihr gerne hundert Fragen gestellt hätte – wer sie war, woher sie kam, was sie wollte, wohin sie ging – stellte er sein Glück nicht auf die Probe. Vielleicht käme sie sonst doch noch auf die Idee, in Tadschinin einen weiteren hervorragenden Unterschlupf für ihn ausfindig zu machen. Wenn es ein Ort war, den sie ungeeignet für kleine Jungs hielt, dann wollte er dort erst recht nicht bleiben. Außerdem fing das Reisen an, Spaß zu machen. Er hatte Gesellschaft, musste sich nicht mehr um sein leibliches Wohl sorgen und kam immer weiter von Raja fort.
Ihn interessierte es nicht, wohin es ging.
Als sie Tadschinin erreichten, war es Jann, der schweigsam wurde, denn er hatte noch nie zuvor eine Stadt gesehen. Mit großen Augen nahm er die Massen an Leuten wahr, betrachtete die kleinen Stände an den Straßenrändern und starrte einer Truppe auffällig gekleideter Jungen in seinem Alter nach, die lachend und schnatternd dahinschlenderten und offensichtlich keiner besonderen Arbeit nachgingen.
Acanà musterte sie ebenfalls und sah ihn danach stirnrunzelnd an.
Auf Nachfragen hin landeten sie schließlich als erstes bei einem Schneider. Obwohl mittlerweile die Sonne schien, war es noch immer recht kühl. Jann fror, denn er hatte nicht eine Decke eingewickelt in die erste Stadt seines Lebens reiten wollen. Sobald sie den kleinen Laden betraten, stürzte ein dicklicher Mann auf sie zu.
„Wir brauchen etwas Warmes für den Jungen“, sagte Acanà kurz angebunden.
Oh, er habe genau das Richtige, beteuerte der Mann. Sein Blick glitt an Jann auf und nieder, schätzte die Größe, funkelte, und der konnte sich plötzlich des unangenehmen Gefühls nicht erwehren, er bräuchte mehr anzuziehen als bloß einen Umhang. In kürzester Zeit hatte der Schneider diverse Hosen, Hemden und andere Kleidungsstücke hervorgekramt.
Acanà jedoch lehnte die bunten Kleider kategorisch ab. Sie wählte stattdessen einen schlichten braunen Wollumhang, der ihm ein bisschen zu lang war, und ein viel zu großes, ungefärbtes Hemd aus dickem Leinen. Jann akzeptierte ihre Entscheidung schweigend – immerhin war sie diejenige mit dem Geld, ganz im Gegensatz zu ihm.
„Ein Jammer, ein Jammer!“, seufzte der dicke Mann, der ihm beim Anprobieren behilflich war.
„Er wächst noch“, erwiderte Acanà ungerührt und bezahlte.
„Gut“, sagte sie, als sie aus dem Laden wieder hinaustraten, „du hast aufgehört zu zittern. Wie wäre es jetzt mit etwas zu essen?“
Er zögerte einen Moment mit der Antwort. Natürlich, ihm war endlich wieder warm, aber er kam sich auch ziemlich lächerlich in den zu großen Kleidern vor, fast so, als wäre er wirklich noch ein Kind. Er hatte die Ärmel zweimal umschlagen müssen, und egal, wie sehr er sich streckte, der Mantel schleifte hinter ihm her. Auf der anderen Straßenseite stand ein Mädchen in hübschen, leuchtenden Gewändern und betrachtete ihn spöttisch, und zwei Jungen, die vorbei gingen, folgten ihrem Blick und grinsten.
Wollte Acanà ihm damit deutlich machen, wo sein Platz war? Er zupfte an dem Umhang und wandte sich verlegen ab.
„Komm schon, Kleiner“, sagte sie mit einem brüsken Unterton, „du wirst in die Sachen reinwachsen. Es ist guter Stoff, und das ist wichtiger als Farben oder Bänder.“
Er hob den Kopf, sah sie verwirrt an, und ein plötzlicher Gedanke kam ihm. Vielleicht hatte sie die Sachen ja auch gekauft, eben weil er noch wuchs, sie ihn doch bei sich behalten und eine weitere Ausgabe in naher Zukunft sparen wollte?
Diese Vorstellung munterte ihn unwillkürlich auf.
„Was ist jetzt mit Essen?“, hakte sie nach, und er grinste und antwortete: „Eine tolle Idee!“
Die Taverne, die sie aufsuchten, war dunkel und relativ gut gefüllt. Mittlerweile hatte Janns Magen zu knurren begonnen, und er setzte sich erwartungsvoll, als der Wirt auf sie zukam.
„Was wollt Ihr?“, fragte der Mann mürrisch.
„Brot, Fleisch und etwas zu trinken“, erwiderte Acanà, „das werdet Ihr wohl haben, oder?“
Der Wirt musterte sie abschätzend. Weder Janns zu große Kleider noch Acanàs schlichtes Äußeres entgingen seinem argwöhnischen Blick.
„Wie wollt Ihr zahlen?“, setzte er unwirsch hinzu.
Jann hob stolz das Kinn. Er hatte den Beutel an Acanàs Gürtel gesehen und war ihrer Antwort sicher. Doch anstatt ihr Geld zu zücken, erklärte sie gelassen: „Ich erzähle Geschichten.“
„Geschichten?“, wiederholte der Wirt, halb amüsiert und halb zornig.
Jann warf ihr einen überraschten Blick zu. Gut, sie hatte ebenso in Raja Geschichten erzählt, und gut, die waren nicht unbedingt schlecht gewesen – aber damit ihr Essen bezahlen zu wollen, auf die Idee wäre er nie gekommen!
Der Wirt ebenfalls nicht.
„Geschichten sind keine Währung“, sagte er.
Acanà lächelte ihn an.
„Ich erzähle Euch eine umsonst“, lockte sie, „dann könnt Ihr selbst urteilen, ob ich weiter machen soll oder nicht. Meinen Preis kennt Ihr jetzt.“
Mittlerweile waren einige der Leute auf sie aufmerksam geworden, und mehrere neugierige Blicke streiften sie. Der Wirt schien kurz zu überlegen und zuckte schließlich mit den Achseln.
„Meinetwegen“, sagte er, „aber dann verschwindet Ihr, verstanden?“
„Natürlich“, entgegnete sie sanft, betrachtete ihn einen Moment lang durchdringend und begann.
Jann folgte ihrer Erzählung zunächst nur mit halbem Ohr. Diese Art, mit der sie den Mann angeschaut hatte, die erinnerte ihn fatal an jenen Moment, wo er sie selber zum ersten Mal gesehen hatte – tiefschwarze Augen, bodenlos, unergründlich, so seltsam forschend. Ein kleiner Schauder lief über seinen Rücken, er schluckte krampfhaft und musste sich bemühen, ihren Worten zu lauschen.
Was sie erzählte, war nichts Besonderes – eine harmlose kleine Geschichte über zwei junge Männer, welche dieselbe Frau liebten und sich aus diesem Grunde zerstritten. Acanà erzählte sie relativ spannend, ein bisschen amüsant, und stellte die Gedanken der beiden Männer so präzise dar, dass sich am Ende auf ihre Frage, wer denn nun die Frau eigentlich verdient hatte, eine lebhafte Diskussion anschloss. Also gut, dann war sie keine schlechte Geschichtenerzählerin – und doch war Jann mehr als nur verblüfft, als der Wirt sich plötzlich abwandte, einmal kurz über sein Gesicht fuhr und mit herrischer Geste der Dienstmagd bedeutete, zwei Teller mit Essen heranzuschaffen.
Damit hatte er nun wirklich nicht gerechnet.
„Esst, und dann erzählt weiter“, sagte der Wirt kurz angebunden.
Jann machte sich lieber hastig seine Mahlzeit her, bevor es sich irgendjemand anders überlegen konnte. Acanà hingegen aß sauber und manierlich, ließ sich Zeit und ihre Augen dabei immer wieder durch den Raum schweifen. Er konnte es nicht ganz begreifen.
Nach dem Essen erzählte sie wieder eine Geschichte, diesmal für eine Frau, und wieder fand Jann nichts Herausragendes daran – keine Drachen oder Prinzen, keine Hexen oder Elfen, die darin vorkamen. Die Frau jedoch wurde ganz still, und sobald Acanà geendet hatte, bat sie um eine Zugabe, und danach schlossen sich weitere Leute an. Irgendetwas an dieser Sache war merkwürdig, fand er, niemand konnte mit solch simplen Erzählungen einen derartigen Erfolg verbuchen.
Aber es schien unklug, unerwünschte Fragen zu stellen, denn er hatte ein warmes Essen im Bauch und die Aussicht auf einen überdachten Schlafplatz im Stall. So schwieg er, lauschte ihren Worten, bis sie schließlich um eine Pause bat, weil sie einen ganz trockenen Mund hätte. Ein Mann kaufte ihr einen Krug Bier, und da sie nur trank und nichts mehr sagte, schloss sich eine Diskussion über ihre zuletzt erzählte Geschichte an, in der es endlich mal um Zauberei gegangen war, und die Jann viel mehr als alles vorherige interessiert hatte. Er fand es spannend, was die Leute so zu sagen hatten. In Raja begegnete man Magie nicht gerade auf Schritt und Tritt, und eine Weile war er ganz damit beschäftigt, ihnen zuzuhören und das Gehörte zu speichern. Erst nach einer gewissen Zeit erinnerte er sich wieder an seine Begleiterin, drehte sich zu ihr um – und erschrak.
Zuvor, als sie erzählt hatte, hatte sie ihren Umhang zurückgestreift und mit ihren erstaunlichen Augen den gesamten Raum dominiert. Jetzt saß sie ganz still da, hatte die Lider halb gesenkt und schien mit den Gedanken weit weg zu sein. Doch ihm ging plötzlich auf, dass sie lauschte, den Gästen lauschte, die sich unterhielten, selber Geschichten erzählten oder diskutierten. Er hatte das dumme Gefühl, dass sie nicht nur den Worten der Leute zuhörte, sondern auch ihren Gedanken, und er fühlte sich mit einem Mal sehr unwohl, wie damals, als er das erste Mal in ihre Augen gesehen hatte. Für einen Moment hoben sich ihre Lider, ihr Blick traf seinen, und er wandte sich hastig ab.
„Hab keine Angst, mein Kleiner“, hörte er ihre Stimme leise neben sich, „ich werde dir nicht wehtun, wenn du das befürchtest.“
Aber als er den Mut aufbrachte, sie wieder anzusehen, hatte sich an ihrer Position nichts geändert, und nichts deutete darauf hin, dass sie eben mit ihm gesprochen hatte.
Sie verbrachten die Nacht im Stall der Schenke, ohne dafür zu bezahlen. Jann war schweigsam, und auch Acanà machte keine Anstalten, ein Gespräch zu beginnen. Er hätte geglaubt, sie habe ihn völlig vergessen, hätte sie nicht darauf bestanden, dass er sie begleitete, sobald sie sich zurückzog – obwohl mehr als einer der Gäste ihm etwas zu trinken anbot und er gar nicht begierig darauf war, in ihrer Nähe zu bleiben. Aber er hatte sich stumm gefügt, denn immerhin hatte sie ihm Kleider gekauft, und so ganz wohl hatte er sich bei einigen Blicken der Gäste auch nicht gefühlt. Er schlief unruhig und war müde, als sie ihn am nächsten Morgen früh weckte.
Sie nahmen Larissa und Richa mit und ließen sie am Rande des Marktes zurück. Acanà erstand einige Kleinigkeiten von den Händlern, etwas Proviant, ein paar notwendige Utensilien, die man unterwegs nicht fand, und sie feilschte so erbittert um jeden Artikel, dass Jann seine Einstellung, sie wäre reich, rasch korrigierte. Vielleicht hatte sie ihm die zu großen Kleider lediglich gekauft, weil sie billiger gewesen waren.
Gegen Mittag suchten sie wieder ein Gasthaus auf, und hier wiederholte sich die Szene vom Vorabend. Acanà bot Geschichten gegen Essen an, und sie hatte erneut Erfolg, denn was sie der Tochter der Wirtin erzählte, bewegte diese dazu, sich vehement für sie einzusetzen. Danach kamen immer mehr Leute, die ihr mit großen Augen lauschten und dafür manchmal einen Apfel oder einen Krug Bier oder auch ein paar Münzen gaben. Jann kam zu dem Schluss, dass sie so ihren Lebensunterhalt verdiente, und damit war geklärt, was sie war – sie gehörte zu den Sängern, den fahrenden Leuten, die mit Geschichten, Liedern und Neuigkeiten die Menschen amüsierten. Die Großmutter hatte von den Sängern erzählt, denn nach Raja hatte sich wegen der Kämpfe nie einer verirrt, zumindest nicht, solange Jann lebte.
Zumindest nicht, bis Acanà gekommen war.
Eine Weile haderte er im Stillen mit seinem Schicksal. Fein, ein Sänger kam durch ganz Thurán, sah bestimmt auch das eine oder andere, aber die Art von Abenteuer, die Drachen mit einschloss, würde ein Sänger wohl kaum erleben. Er würde höchstens davon erzählen, und Jann zog es vor, seine Drachen mit eigenen Augen zu sehen. Schweigend grübelte er darüber nach, bis er feststellte, dass sie wieder aufgehört hatte zu reden. Wie am Tag zuvor saß sie still da und lauschte, und er erinnerte sich erneut an das ungemütliche Gefühl, welches ihm ihre Augen vermittelt hatten.
Waren alle Sänger so?
Am späten Nachmittag wechselten sie das Gasthaus, fanden ein anderes, und auch hier vollzog sich dieselbe Szenerie. Jann wäre gerne losgezogen und hätte die Stadt auf eigene Faust erkundet, aber Acanà ließ ihn nicht von ihrer Seite. Erst spät am Abend, als wieder die Gäste redeten und nicht mehr diese seltsame Frau, begriff er den Grund und was die Leute, die ihm Getränke anboten, in Wirklichkeit von ihm wollten. Die bunt gekleideten Jungen fielen ihm ein, und er wurde blass. Danach wich er von selbst nicht mehr aus ihrer Nähe.
„So hübsche blaue Augen“, hatte die Frau mit der Hakennase gesäuselt.
„Und so kräftige Arme“, hatte der dicke Mann neben ihr zugestimmt, „etwas zu trinken, mein Kleiner?“
Sein Blick war wie der des Schneiders, seine Finger legten sich liebkosend auf besagten Arm, und Jann wurde übel. Doch dann kam Acanàs Hand, schob die des Mannes weg und zog ihn an ihre Seite. Er hörte ihre Stimme, die freundlich, aber bestimmt sagte: „Danke, wir sind versorgt.“
„Schade“, seufzte der Mann, „seid Ihr sicher?“
„Absolut“, erwiderte sie, und Jann begriff ganz plötzlich, warum Tadschinin kein Ort für einen Jungen wie ihn war.
„Du trittst mir gleich auf die Hacken“, sagte sie amüsiert, als sie schlafen gingen und er an ihrem Rücken klebte, als wolle ihn jemand am Genick packen und wegzerren.
„Mach nicht so ein Gesicht“, fügte sie spöttisch hinzu, „du wolltest doch Abenteuer, oder? Ganz Tadschinin ist eines.“
„Ich wollte andere Abenteuer“, erwiderte er mit blutroten Wangen.
Sie musterte ihn stirnrunzelnd, und dann seufzte sie.
„Du bist wirklich noch ein Kind“, sagte sie, „obwohl das in dieser Stadt alles andere als ein Schutz ist. Leute aus ganz Thurán kommen aus einzig und allein diesem Grund hierher. So was weiß man wohl auch in Raja.“
Jann ärgerte sich zwar über ihren herablassenden Tonfall, aber da ihm keine gute Antwort einfiel, fragte er einfach nur leise: „Bleiben wir lange hier?“
Seine Worte hörten sich nicht so sicher an, wie er es gewünscht hätte, und als Acanà erst nicht antwortete, befürchtete er schon das Schlimmste. Vielleicht hatte sie hier ebenfalls eine Unterkunft für ihn gefunden; vielleicht wäre er wirklich besser in Raja aufgehoben, dort wäre ihm zumindest dieses Schicksal erspart geblieben. Er schluckte und kämpfte mit den Tränen.
Dann erklang ihre Stimme, und sie war freundlich.
„Nein“, erwiderte sie, „wir reisen morgen ab.“
Acanà war im Stillen auf sich selber wütend, als sie am nächsten Morgen frühzeitig Tadschinin verließen. Ihr kleiner Begleiter hingegen wurde mit jedem Meter gelöster, den sie zurücklegten, was sie unwillkürlich zum Lächeln brachte, obwohl sie sich auf die Lippen biss. Sie hatte nicht erreicht, was sie sich von der Stadt erhofft hatte.
Siehst du, sagte sie sich streng, du wusstest, es war ein Fehler, den Jungen mitzunehmen. Er hält dich nur von deinen Aufgaben ab!
Doch als er später schnell und geräuschlos mit seinem Messer einen Hasen erlegte und danach vor Stolz glühend zu ihr kam, bereute sie ihren hastigen Aufbruch erstaunlicherweise gar nicht mehr.
Jann hingegen hatte natürlich keine Ahnung von ihren Gedanken.
„Wohin reisen wir jetzt?“, fragte er beim Essen und kaute eifrig.
„Nach K’Landen“, erwiderte sie, „es ist nur ein paar Tage entfernt.“
„Was ist es? Wieder eine Stadt?“
„Nicht so wie Tadschinin, guck nicht so ängstlich“, sagte sie amüsiert, „Tadschinin ist auf Thurán einzigartig. K’Landen ist eine Burg, und der Burgherr kennt einen Freund von mir. Vielleicht gibt es dort Nachricht für mich.“
„Nachricht wovon?“, wollte er neugierig wissen.
„Über etwas, das ich suche“, entgegnete sie knapp.
Jann war klug genug, nicht weiter zu fragen. Er schluckte und sagte wie beiläufig: „Hast du vor, mich in K’Landen zurückzulassen?“
Sie stockte, als ob sie noch gar nicht darüber nachgedacht hatte.
„Es ist nur so“, fügte er mit neutraler Stimme an, „ich wüsste gerne, woran ich bin.“
„K’Landen ist nicht wie Tadschinin“, wiederholte sie langsam, „vielleicht würde es dir gefallen.“
„Hm“, sagte er bloß.
„Vielleicht hast du jetzt ja auch genug von mir“, meinte sie bedächtig, „vielleicht weißt du jetzt ja eher, was du willst – oder was du nicht willst.“
„Ich will nicht nach Tadschinin, und ich will nicht nach Raja“, erwiderte er fest.
„Aber K’Landen kennst du noch nicht“, gab sie zu bedenken.
Erlebt man auf einer Burg Abenteuer? fragte er sich unwillkürlich. Er sah auf sein Brot, ohne davon abzubeißen.
„Ich bin nicht verletzt, wenn du nicht bei mir bleiben willst“, hörte er ihre spöttische Stimme, und er dachte an das merkwürdige Gefühl ihrer Augen. Er dachte an ihre seltsamen Geschichten, an die Wirkung, die sie auf die Leute gehabt hatte.
„Du brauchst keine Angst vor mir zu haben“, setzte sie hinzu, „ich weiß, dass du aus Tadschinin hinaus wolltest, und ich hätte dich dort auch nicht gelassen. Du bist zu hübsch dafür, mein Kleiner, und zu naiv. Aber nicht jeder Ort außerhalb Rajas ist so, und ich weiß ebenfalls, wenn es anders gewesen wäre, wärst du vielleicht lieber dort geblieben, anstatt mit mir zu kommen. Ich könnte etwas für dich finden ...“
„Bist du eine Hexe?“, stieß er hastig hervor.
Acanà hielt verblüfft inne.
„Eine ... was?“
„Eine Hexe!“ Er war rot geworden und starrte weiter auf sein Brot.
„Wie ... wie kommst du darauf?“, fragte sie erstaunt.
„Ich bin nicht blind und auch nicht taub. Du tust etwas mit diesen Leuten ... Es ist in deinen Augen. Es ist, als ob du bis auf den Grund ihres Geistes gucken kannst, als ob du ihre Gedanken hörst.“ Er sprach hastig und brachte nun doch den Mut auf, sie anzusehen.
„Deine Geschichten sind ganz alltägliche Sachen“, fügte er tapfer hinzu, „nicht das, was man von einem fahrenden Sänger erwartet. Aber diese Leute ... diese Leute, die hängen an deinen Lippen, und sie geben dir Geld und Essen, und dann hörst du ihnen zu, und ich ... ich glaube, du hörst ihre Gedanken und ...“
Er brach ab, bevor er noch mehr ins Stammeln geriet. Acanàs Augen waren jetzt zwar dunkel, jedoch bloß nachdenklich und ohne diese bedrückende Intensität.
„Du denkst also, ich bin ein Sänger“, sagte sie schließlich langsam, „und du fürchtest, ich wäre eine Hexe, die die Leute verzaubert und ihnen ihre Gedanken raubt.“
„So ungefähr“, schwächte er ab.
Er konnte sein ungutes Gefühl aus den Gasthäusern nicht ganz in Worte fassen. Ihm war schlecht. Wenn er Recht hatte, dann war es vielleicht dumm gewesen, sie hier darauf anzusprechen, wo sie ganz allein waren, wo niemand ihm helfen würde, wenn sie ihn dafür bestrafte, dass er sie durchschaut hatte. Er biss sich auf die Lippen, aber er senkte den Blick nicht.
Zu seinem Erstaunen fing Acanà plötzlich an zu lachen. Es klang verblüffend freundlich.
„Bei den Schwestern!“, sagte sie und fing sich rasch wieder, „ich bin keine Hexe. Ich wollte, ich wäre es“, setzte sie düster hinzu, „aber ich kann nicht zaubern. Vielleicht bin ich so etwas wie ein Sänger. Himmel!“, meinte sie dann ärgerlich, „ich weiß ja selbst nicht genau, was ich bin, nur, was ich sein sollte. Das ist zu kompliziert, mein Kleiner. Du brauchst keine Angst zu haben, ich werde dir weder deine Gedanken noch deinen Geist rauben.“
„Aber du kannst das, nicht wahr? In die Gedanken der Leute sehen?“, beharrte er.
„Nicht so, wie du denkst“, erwiderte sie vorsichtig, „ich kann ein bisschen hinter ihre Masken schauen und sehe, was sie dort bewegt. Deshalb mögen sie meine Geschichten, weil sie etwas davon widerspiegeln.“
Er hatte es gewusst!
„Sind alle Sänger so?“, fragte er.
Sie lachte wieder kurz auf.
„Sicherlich nicht“, meinte sie amüsiert.
„Aber ... wie machst du das? Wieso kannst du das?“
Kann man es lernen? hing unausgesprochen in der Luft, und Acanà schien seine Frage nicht zu gefallen.
„Einen Teil davon konnte ich schon immer“, sagte sie schroff, „es gehört zu dem, was ich bin. Einen Teil habe ich gelernt, und ehe du fragst, du wirst es nicht lernen. Es ist nicht gerade ein Geschenk, mein Kleiner, also guck nicht so enttäuscht.“
Jann war eher verwirrt als enttäuscht.
„Was soll das heißen – was du bist?“, fragte er.
Darauf schwieg sie zunächst, und er wartete geduldig. Es schien eine Ewigkeit zu vergehen, bevor sie endlich antwortete.
„Ich bin eine Tisenit.“
Jann fuhr auf.
„Eine ... eine Halbelfe? Du bist eine Halbelfe? Aber Elfen können zaubern!“
„Eine Tisenit ist keine Elfe, sondern bloß zur Hälfte“, erklärte sie sachlich, „und auch nicht alle Elfen können gleich gut zaubern. Meine Mutter war nur mittelmäßig begabt, und selbst davon hat sie mir praktisch nichts vererbt. Ich kann nicht zaubern, Kleiner, aber manchmal kann ich sehen. Und das sollte jetzt reichen.“
Jann senkte den Blick nach ihrer abweisenden Antwort und schaute wieder auf sein Brot. Eine Tisenit, dachte er, vielleicht würde er ja doch noch seinen Drachen kriegen. Vielleicht, wiederholte er im Stillen, als ihm ein unangenehmer Gedanke kam. Sie mochte es wohl ganz und gar nicht, ausgefragt zu werden.
„Wirst du mich jetzt in K’Landen zurücklassen?“, fragte er leise.
„Wenn du es willst“, erwiderte sie.
„Und wenn ich es nicht will?“
Daraufhin schwieg sie wieder.
Je länger Jann darüber nachdachte, desto entschlossener wurde er, nicht in K’Landen bleiben zu wollen. Offensichtlich war Acanà mehr als sie zugab, und offensichtlich erlebte sie auch mehr, als es zunächst den Anschein gehabt hatte. Seine Großmutter hatte Geschichten über die Elfen erzählt und über die Tisenit, ihre Abkömmlinge, die so selten waren, da Elfen in der Regel lieber für sich blieben. Je älter Jann wurde, umso mehr hatte er angefangen, an den Geschichten der Großmutter zu zweifeln. Nun war er seit Tagen in der Gesellschaft einer Tisenit und hatte es nicht gewusst. Vielleicht gab es ja noch mehr zu sehen, noch mehr zu erleben, wenn er bei ihr blieb!
Acanà hingegen kam zu dem Schluss, dass Jann in K’Landen mit Sicherheit besser aufgehoben war als bei ihr. Sie hatte seine Reaktion auf ihr Bekenntnis gesehen und wusste, sie hätte besser nichts gesagt. Jetzt würde er vermutlich noch schwerer davon zu überzeugen sein, zurückzubleiben.
Ein Entenküken, dachte sie ärgerlich, ein nicht abzuschüttelndes Entenküken, um das man sich Sorgen machen musste.
Die weißen Enten vor dem Palast in Anabellánien ...
Den Rest des Tages war Acanà still, und das gab Jann zu denken. Ihm war klar, dass er eigentlich nur eine Last für sie war. Er war bei weitem nicht so geschickt wie sie darin, Wild zu erlegen, der Hase zum Mittag war eher ein Glückstreffer gewesen. Er konnte zwar Tiere gut versorgen, aber das hatte sie bisher auch ohne ihn geschafft, und von seinen Kräutern und Beeren war sie ebenfalls nicht gerade abhängig. Wenn er bei Acanà bleiben wollte, musste er etwas finden, was ihn unentbehrlich machte.
Ein gesprächiger Mensch war sie allem Anschein nach nicht, denn sie schwieg die meiste Zeit des Tages, und er hätte auch gar nicht gewusst, womit er sie hätte unterhalten sollen. Geschichten aus Raja würden sie wohl kaum interessieren. Abgesehen davon spürte er bei dem Gedanken an seine Familie einen Kloß im Hals und hatte kein Bedürfnis, lang und breit darüber zu reden. Wenn sie ihn also nicht für alltägliche Dinge brauchte, nicht zur Unterhaltung und auch nicht bei der Ausübung ihrer Tätigkeit – was auch immer es nun genau war – was blieb dann noch?
Er grübelte den Rest des Tages darüber nach und fand keine befriedigende Antwort. Am Abend, als sie ihr Lager aufschlugen, war er deshalb besonders eifrig, sammelte Holz und Gemüse, versorgte die Tiere, holte Wasser und bemühte sich, ihr nicht im Wege zu sein. Wenn sie es bemerkte, so schwieg sie darüber. Er achtete ebenfalls darauf, ihr keine unangenehmen Fragen mehr zu stellen und wollte stattdessen etwas über K’Landen wissen.
„Es ist eine Burg am Ufer des Stillen Rash“ berichtete Acanà erwartungsgemäß, um ihm die Sache schmackhaft zu machen, „die Burg ist eine Zollstation, denn viele fahren lieber den Stillen Rash hinunter, als sich den Tücken des Wilden Rashs anzuvertrauen. Der Burgherr heißt Manaro. Es legen oft Schiffe am Hafen unterhalb der Burg an, um ihre Zölle zu bezahlen und Neuigkeiten zu bringen. Es geschieht viel auf K’Landen, es gibt immer neue Leute und Sachen zu erfahren. Manaro ist ein mächtiger Mann.“
Jann sagte dazu nur etwas Ausweichendes und wollte Genaueres über die Burg erfahren. Acanà musste zugeben, dass sie nie zuvor in K’Landen gewesen war.
„Ich dachte, du kennst den Burgherrn“, sagte er unvorsichtig.
„Nein“, korrigierte sie, „ich kenne einen Freund des Burgherrn.“
Sie brach ab, und er machte seinen Schnitzer rasch wett, indem er erzählte, was seine Großmutter von den Burgen berichtet hatte, die einst sein Großvater gesehen hatte. Acanà hörte ernst zu, bestätigte ein oder zwei Sachen und berichtigte ein paar andere, ohne dass das Gespräch wieder auf etwas kam, was sie persönlich betraf. Jann passte genau darauf auf.
Und falls sie das bemerkte, so sagte sie auch dazu nichts.