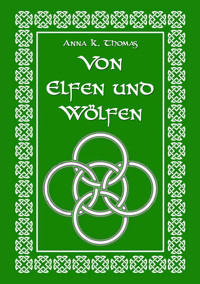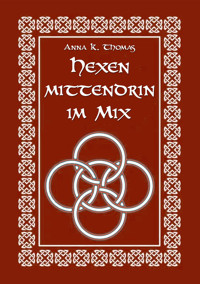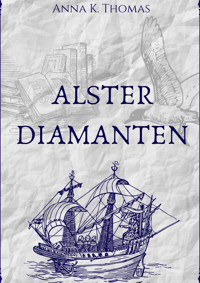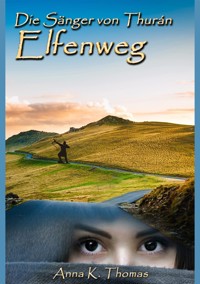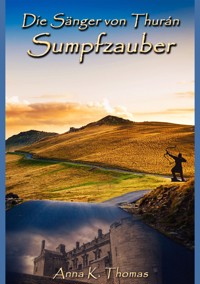2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Zeitreisende zieht durch die Geschichte der Menschheit, begleitet vom toten Alexander dem Großen. Ihr gemeinsamer Weg führt sie von den Ursprüngen des sichtbaren Lebens bis in die Neuzeit – beobachtend, manchmal auch teilhabend und dabei Antworten suchend auf Fragen, die sie sich selber gar nicht stellen mag: Wer ist sie, und warum ist sie weder an Zeit noch Raum gebunden? Novelle über die Entstehung der Welt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
© 2020 Anderland Books
12105 Berlin
https://anderlandbooks.com/
2. Auflage
Alle Rechte vorbehalten
Tag der Veröffentlichung 23.08.2020
Titelbild: Anderland Books
ISBN 978-3-96977-022-1
Interesse an Hintergrundinfos, Übersichten und Bonuskapitel?
All dies und mehr auf: www.annakthomas.de
Einstieg: Babylon
Schnitt 1: Antikes Griechenland
Schnitt 2: Ein Plan und Oxford im Sommer
Schnitt 3: Erdaltertum, Erdmittelalter
Schnitt 4: Menschwerdung
Schnitt 5: Alte Kulturen
Schnitt 6: Rückkehr in die antike Welt
Schnitt 7: Der Weg voran
Schnitt 8: Von Göttern und Propheten
Schnitt 9: Auf zum Ende
Anhang
Übersicht Weltgeschichte
Übersicht „Menschheitsgeschichte“, Fokus Europa
Einstieg: Babylon
Ich bin gekommen, um dem Tod eines Fürsten beizuwohnen. Das ist nicht das erste Mal. Zu meinen Zeiten habe ich so manch einen Tod erlebt, von so manch einer hochgestellten Persönlichkeit. Um diesen ranken sich Legenden und Sagen, und so war ich neugierig. Nach einer Weile jedoch war ich es müde. Und jetzt das.
„Wer bist du?“
Ich blinzele. In der Sonne sitze ich, auf einer Art Balkon oder Empore des alten Palastes. Drinnen ist allerlei Volk zusammengelaufen, sie jammern und weinen, werfen sich über den Verstorbenen, und ich habe nicht damit gerechnet, dass jemand hierherkommt. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich schaue ihn verwirrt an.
Er, das ist einer dieser kriegerisch und reich aussehenden jungen Männer, mit hellem Gewand, an den Rändern besetzt. Er ist bewaffnet, und er mustert mich drohend.
„Wer bist du?“, will er wissen, „was tust du hier?“
„Wieso kannst du mich sehen?“, sage ich das erste, was mir einfällt.
Jetzt blinzelt er, und macht noch einen Schritt auf mich zu. Das ist mir zu nahe. Ich stehe auf.
„Wer bist du?“, fragt er zum dritten Mal, „wie bist du überhaupt hierhergekommen? Was hast du hier verloren?“
Er sollte mich nicht sehen können. Er sollte gar nicht wissen, gar nicht bemerken, dass ich da bin. Jetzt ist er nur noch drei Fußlängen entfernt, so dicht, dass ich die Falten an seinen Augen sehen könnte, wenn da welche wären. Das ganze Gesicht ist glatt. Und da fällt mir etwas auf.
Die blonden Haare, die durchdringenden Augen, die gerade Nase ... Ich weiß, wer das ist. Wer das sein sollte. Und wer vor allem nicht hier sein sollte, ist er.
„Du hast hier nichts verloren!“, zischt er, streckt den Arm aus und packt mein Handgelenk. Und ich, ich verliere die Kontrolle. Er sollte mich nicht sehen können, geschweige denn anfassen!
Ich drehe meine Hand, ergreife seine, und dann sind wir unten, mitten in dem Gedränge, Geheule und Gewühle, direkt neben dem Lager, und er starrt mich erschrocken an, verängstigt, und dann, wie durch Zwang, auf sein eigenes Gesicht.
Sein totes Gesicht.
Es ist schrecklich anzusehen, wie seine Miene sich verändert, zu schrecklich. Instinktiv reagiere ich. Im Staub vor dem Gebäude lasse ich ihn wieder los. Jetzt ist er bleich, und keine Rede ist mehr von drohenden Gebärden. Er ist erschüttert.
Was habe ich getan? Ich sollte nicht hier sein. Ich bin nicht hier.
Ich verschwinde.
***
Ein paar Tage sind vergangen. Der Leichenzug zieht durch die Stadt. Prächtig geschmückt ist der Sarg, laut sind die Wehklagen. Ich habe mir einen guten Platz zum Zuschauen gesichert, und niemand stört mich. Das ist eines dieser seltsamen Dinge: Obwohl sie mich nicht sehen können, obwohl sie durch mich hindurchschauen, laufen die Menschen nie gegen mich oder setzen sich auf mich drauf. Ich bin seit einer Ewigkeit nicht mehr angerempelt worden. Es ist, als nähme ein Teil ihres Wesens mich wahr und gestände mir meinen Platz zu, auch wenn alles andere sich weigert, mich zu bemerken.
Ich genieße die Ruhe – bis er mich plötzlich wieder packt, dieser Arm. Da schrecke ich auf.
„Nein! Warte!“
Er ist es. Er hat sich verändert. Wie, mag ich nicht sagen, sein Äußeres ist unberührt. Aber dennoch ist da ein Ausdruck in seinen Augen, der besagt, er ist die letzten Tage durch die Hölle gegangen. Er ist erschöpft. Und verzweifelt.
Flehend.
„Bitte“, sagt er heiser, „hilf mir.“
Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. So etwas habe ich noch nie erlebt, und so warte ich stumm. Er lässt meinen Arm los, vorsichtig, als habe er Angst, ich würde verschwinden. Die Angst ist nicht ganz unberechtigt, aber ich entscheide zu bleiben. Noch nie hat mich einer sehen können, wenn ich es nicht wollte.
„Hilf mir“, wiederholt er, „bitte. Ich will ... ich verstehe nicht, was passiert ist. Was ist mit mir geschehen?“
Mein Mund ist trocken. Wie soll ich antworten? Ich weiß es doch selber nicht.
„Bitte“, flüstert er.
Aber ich weiß das, was er im Inneren ebenfalls bereits gesehen hat. Ganz dünn ist der Schleier zwischen ihm und dieser Wirklichkeit, unfähig scheint er, diese letzte Barriere zu zerreißen. Ich könnte es. Ich könnte Löcher hineinschneiden, und ihn sehen lassen.
Ich schlucke.
„Weißt du, wen sie da zu Grabe tragen?“, frage ich.
Er schweigt.
Ich hole tief Luft.
„Alexander tragen sie zu Grabe“, fahre ich fort, „den Großen, den Unbesiegbaren, den, dessen Name unsterblich wird. Kaum einer wird sein Kind in den kommenden Jahrtausenden Hephaistion nennen, oder Aristoteles. Aber Alexander ... Alexander bleibt bestehen. Und die Großen, die Großen der Welt werden immer davon träumen, so zu sein wie er, so viel zu schaffen, so unsterblich zu sein – auch wenn sie natürlich insgeheim hoffen, länger zu leben. Alexander ist es, der Fürst, der Eroberer, den sie den Großen nennen werden.“
Er schweigt noch immer, starrt mich an. Sein Gesicht ist so weiß.
Ich räuspere mich.
„Und sie tragen Alexander zu Grabe“, flüstere ich fast, „den einzigen Sohn, den Mann, den Freund, den Geliebten. Sie tragen den Menschen zu Grabe, den sie geliebt, und vielleicht auch verehrt haben, und manchmal gehasst. Sie tragen den Menschen zu Grabe, ohne den all das hier hohl wird, schal, und zerfallen. Ein riesiges Reich hat Alexander geschaffen – es stirbt mit ihm. Ein Fieber war es. Sie können noch nicht fassen, dass es vorbei ist. Erst, wenn man jemanden verliert, weiß man wirklich, wie sehr man ihn geliebt hat. Und sie haben Alexander geliebt.“
Kein Wort kommt über seine Lippen. Seine Haut ist blass, seine Augen groß und dunkel. Aber er hat mich verstanden.
„Wer bist du?“, wispere ich.
Als er antwortet, ist seine Stimme ebenso leise wie zuvor meine.
„Alexander“, sagt er.
Schnitt 1: Antikes Griechenland
„Ist es, weil ich ein Gott bin?“, fragt er.
Ich starre ihn an. Dann sage ich trocken, bevor ich nachdenke: „Süßer, du bist ganz bestimmt kein Gott. Du bist ein Mensch, wie ich. Du wurdest von menschlichen Eltern gezeugt, Olympias und Philipp. Ich weiß es. Ich habe es gesehen.“
Sein Gesicht ist wieder bleicher geworden, nachdem er sich kurzzeitig erholt hatte.
„Du hast es gesehen?“, flüstert er.
Ich verfluche mich innerlich.
„Nicht genau“, sage ich schnell, „ich bin gegangen, bevor ... ich war neugierig. Ich wollte wissen, ob es Leidenschaft war, oder eine Ver…“ Diesmal breche ich rechtzeitig ab.
Er starrt mich immer noch an.
„Was bist du?“, keucht er, „wie kannst du ...?“
Ich seufze und beiße mir auf die Lippen.
„Keine Ahnung“, gebe ich zu, „keine Ahnung.“
Er mustert mich, und ich weiß, dass er gleich Fragen stellen wird, die ich nicht hören will. Die ich nicht beantworten will. Und so komme ich ihm zuvor.
„Ich bin aus der Zukunft“, sage ich rasch und brutal, „ich werde fast zweieinhalbtausend Jahre von heute an geboren. Ich habe ein ganz normales Leben geführt. Und eines Tages wachte ich auf und konnte dies.“
Ich packe seine Hand und springe durch den Raum – nicht weit, nur auf die andere Straßenseite, damit er versteht. Ein seltsames Gefühl des Triumphes durchläuft mich. Bis ich ihm begegnet bin, wusste ich nicht, dass ich dazu fähig bin – andere mit mir zu ziehen. Aber dann, vielleicht geht es auch nur bei ihm.
„Und ich kann dies“, setzte ich hinzu, noch bevor er sich von seiner Überraschung erholt hat, umklammere seine Hand und springe durch die Zeit – eine Stunde nur, so dass er den Leichenzug sieht, der wieder durch die Straßen zieht. Dann springe ich zurück.
Seine Augen sind riesig, mein Triumph ist es auch. Ich stelle fest, dass ich schwer atme – vor Aufregung oder vor Anstrengung weiß ich nicht. Und dann überkommt mich ein anderes Gefühl, Mitleid vielleicht, oder sanfter ausgedrückt, Verständnis. Ich lege meine Hand an seine Wange.
„Ich bin eine Zeitreisende“, sage ich leise, „Geschichte hat mich immer fasziniert. Ich wandere durch die Zeit und schaue mir an, was ich nur aus Büchern kenne. Ich wollte dich sehen.“
„Meinen Tod“, sagt er, und seine Stimme klingt schwer.
„Niemand lebt ewig“, flüstere ich.
***
Er schweigt lange. Sitzt da und starrt zu Boden. Ich sitze still neben ihm. Mitgefühl hat mich erfasst, und eine verwirrende Empfindung, die ich nicht in Worten fassen will. Er geht mir nahe. Niemand ist mir mehr nahegekommen, seit langem. Ich will nicht zu weit zurückdenken.
Schließlich stellt er die Frage, die ich fürchte.
„Bin ich so wie du?“
Ich muss erst schlucken, bevor ich sprechen kann.
„Auch das weiß ich nicht.“
Er sieht auf, in meine Augen, und er muss das Verbot, das ultimative, drohende Nein darin erkannt haben, denn er fragt nicht das, was offensichtlich wäre. Stattdessen lächelt er plötzlich.
„Ausprobieren“, sagt er.
Diesmal ist es seine Hand. Und ja, er kann es. Wie ich es wusste, wie ich ohne fremde Hilfe herausfand, was ich tun muss, so tut jetzt er es. Wir fliegen förmlich durch die Stadt, springen von Platz zu Platz, und Straße zu Straße, bis mir schwindlig und er vor Lachen atemlos ist. Dann gibt es einen Ruck, und plötzlich sind wir ganz woanders.
Ich halte still, erschrocken. Konzentriere mich.
Vor uns stehen weiße Säulen, die Vegetation ist reicher als zuvor, aber anders. Olivenbäume, Menschen in weißen Tüchern. Ein alter Mann, umgeben von vielen Jüngeren. Die Sonne brennt heiß, nicht weit entfernt glitzert das Meer.
Ich drehe mich um, sehe ihn mit offenem Mund an.
„Sokrates?“, keuche ich.
Sein Blick gleitet über das Land und die Stadt vor uns. Es ist Athen, ein altes Athen. Wann hat Sokrates gelebt?
„Sokrates“, flüstert er.
Dann kommt sein Blick zu mir, und der Wechsel in seinen Augen berührt mich zutiefst. Ich muss nicht mehr viel erklären.
***
Ich halte seine Hand, während wir durch die Straßen gehen. Uns beiden scheint dieser körperliche Kontakt wichtig. Er will mich nicht verlieren, sein einziger Halt bin ich jetzt, und auch ich bin nicht bereit, ihn loszulassen. Ich berichte ihm die wenigen Dinge, die er noch nicht verstanden hat.
„Die Leute sehen uns nicht“, sage ich, „dennoch weichen sie uns aus, dennoch behelligen sie uns nicht. Wenn ich so bin wie jetzt, habe ich keinen Hunger, keinen Durst, muss nicht schlafen. Ich verletze mich nicht und werde nicht krank.“
„Aber es geht auch anders?“, hakt er nach.
Schlaues Kerlchen. Nun, ein Idiot wäre nicht Herr über ein Weltreich geworden.
„Es geht auch anders“, bestätige ich, „wenn ich mich konzentriere, kann ich sichtbar werden, und die Leute erkennen mich. Zu Anfang ist es anstrengend. Wenn ich sichtbar bin, habe ich manchmal Hunger und Durst, und schlafe auch hin und wieder, aber viel weniger als ... daheim. Und noch etwas – ich kann nichts mitnehmen, wenn ich springe. Doch meine Kleider passen sich immer an, und ich verstehe jede Sprache. Was sprechen die Leute hier?“
„Griechisch“, sagte er, verwirrt.
„Ich habe nie griechisch gelernt“, erkläre ich, „aber ich habe kein Problem, sie zu verstehen. Und du ebenfalls nicht.“
„Ich habe griechisch gelernt“, widerspricht er.
Wie viele Jahre liegen zwischen Sokrates und Alexander? Ich krame in meinem Gedächtnis. Sehr viel wird es nicht gewesen sein. Also anders.
„Und wenn wir in Persien gelandet wären, du würdest es ebenfalls verstehen“, behaupte ich.
„Natürlich“, sagte er und grinst „schließlich spreche ich auch persisch!“
Aber dann gibt er nach.
„Einiges klingt anders“, gesteht er, „und ich weiß dennoch ... ich weiß einfach, was es heißt.“
„Das meine ich“, murmele ich befriedigt.
Er lauscht den Leuten um uns herum. Wir sind auf einen Marktplatz gekommen. Ich bin noch nicht am Ende meiner Ausführungen.
„Pass auf“, meine ich und trete um eine Ecke in einen dunklen Torbogen, „ich zeige dir etwas. Lass mich los.“
Er tut es, mit einer Zögerlichkeit, die mich berührt. Ich lächele ihn aufmunternd an, konzentriere mich und trete wieder hinaus in das Leben. Jetzt sehen mich die Leute, sie grüßen mich. Ich gehe zu einem Stand, spreche die Verkäuferin an, feilsche ein wenig und erstehe dann einen der bronzenen Kämme. Lächelnd komme ich zurück.
Sein Blick ist aufmerksam, er hat vermutlich nicht eine meiner Gesten verpasst. Vorsichtig nimmt er den Kamm in die Hand, dreht ihn hin und her.
„Anfassen kann ich ihn“, murmelte er.
„Ja“, sage ich, „aber niemand sieht es.“
„Woher hattest du das Geld?“, fragt er plötzlich, „ich habe die Münzen gesehen. Sie sind alt.“
Ich klopfe auf die Tasche an meiner Seite.
„Hier ist Geld drin“, sage ich, „immer ein wenig, nie zu wenig, wenn auch keine Reichtümer. Die Währung ist stets passend. Ich brauche es kaum, aber wenn, ist es da.“
Er sieht mich an, dann an sich herunter. Auch er hat eine Tasche. Er fasst hinein. Seine Hand zieht ein paar Münzen hervor.
Ich sage nichts, sondern lächele nur. Sein Blick ist konzentriert, als würde er eine ungeheure Aufgabe lösen. Plötzlich beugt er sich vor, steckt den Kamm in meine Haare, und holt tief Luft. Bevor ich etwas sagen kann, ist er ins Sonnenlicht getreten.
Er ist sichtbar. Ein wenig schwer fällt es ihm, ich sehe, wie seine Konturen manchmal verschwinden. Das ist mir neu – obwohl ich ihn immer sehen kann, erkenne ich diesen Unterschied. Er tritt an denselben Stand, spricht mit der Frau. Und kurz darauf ist er zurück, mit einem zweiten Kamm, identisch zu dem, den ich gekauft habe.
Er sagt nichts, sondern schiebt ihn mir einfach nur auf der anderen Seite in die Haare. Und ich, ich bin auf einmal so glücklich und stolz, wie ich es mehr nicht sein könnte.
***
Wir sitzen auf der Treppe zwischen den Säulen, am Rande von Sokrates’ Schülern. Alexander lauscht mit einer Inbrunst, die ich nicht nachvollziehen kann. Philosophie hat mich nie interessiert, ich bin pragmatisch veranlagt. Aber ihn fasziniert es, und ich kann das irgendwie verstehen. Aristoteles hat ihn erzogen, hat ihm dies hier auf eine Art und Weise nahegebracht, wie man mir vielleicht die Weltgeschichte nahebrachte. Alexander, so erkenne ich, möchte in diesem Moment nirgendwo anders sein als hier.
Und ich, ich bin es zufrieden, neben ihm zu sitzen. Wir sind nicht sichtbar, um nicht für Unruhe zu sorgen. Ich sehe auch keine Frauen, und mit meiner mangelnden klassischen Bildung weiß ich nicht, ob sie hier zugelassen waren. Plato habe ich nie gelesen. Also nicht sichtbar sein. Ich sitze ganz ruhig, spüre die Wärme der Sonne und genieße meine innere Ruhe. Leise seufze ich zufrieden. Alexanders Arm schiebt sich um meine Schultern, er sieht mich an, und in seinen Augen sehe ich pulsierendes Glück.
Ich lege meinen Kopf an seine Schulter.
***
Nicht sichtbar zu sein bedeutet aber auch, keine Fragen stellen zu können. Das frustriert ihn zunehmend – ich merke es, als die Gespräche vorbei sind und die Leute aufstehen. Wir erheben uns ebenfalls, und ich kann spüren, wie es in ihm brennt, wie er vortreten und all die Fragen stellen will, die ihm gekommen sind.
Ich drücke spontan seine Hand.
„Wir wäre es, wenn wir ein wenig hierblieben?“, höre ich mich selber sagen, „wir werden sichtbar. Wir mieten eine Wohnung. Du kannst sein Schüler sein. Und ich lebe ein wenig das Leben im alten Griechenland. Das könnte interessant werden.“
Ein verhaltenes Lächeln bricht sich auf seinen Zügen Bahn. Dennoch runzelt er die Stirn.
„Du willst nicht mitkommen?“, fragt er.
Frauen sind nicht verboten, aber unüblich, das habe ich im Laufe des Nachmittags begriffen. Ich zucke mit den Schultern.
„Ich werde mir andere Dinge ansehen“, meinte ich.
Seine Hand drückt meine, in seinem Gesicht sind plötzlich Zweifel, und ja, Unsicherheit.
„Was, wenn ich dich verliere?“, fragt er.
Es sollte mich nicht so treffen. Himmel, es sollte mich nicht so treffen. Ich muss schlucken, blinzeln, während es mich wie ein Donnerschlag erwischt. Das ist so unerwartet.
Er sieht meine Rührung, Sorge zeichnet sich in seiner Miene ab. Ich finde ein Lächeln.
„Wenn wir uns verlieren“, sage ich mit fester Stimme, „finden wir uns hier wieder, genau hier und jetzt, zu dieser Zeit.“
Er sieht sich um. Das Stirnrunzeln ist noch da.
„Wir sind bereits hier“, erinnert er mich, „wenn wir immer wieder hierher ...“
Ich schüttele den Kopf.
„Egal, wo ich war, und wie oft ich dort war“, kläre ich ihn auf, „ich habe mich selbst nie gesehen. Ich bin mir nie begegnet. Vielleicht, weil ich für die Menschen unsichtbar bin. Vielleicht bin ich es dann auch für mich. Vertrau mir. Sollten wir uns verlieren, finden wir uns hier wieder.“
Jetzt lächelt er, frei und offen.
„Also gut“, sagte er, „suchen wir uns ein Haus.“
***
Ich kann ihn, den Fürsten, davon überzeugen, dass es sinnvoller ist, bescheiden aufzutreten. Zum Glück ist er nicht nur Fürst, sondern auch Soldat und kennt die Kargheit der Unterkünfte. Wir finden eine kleine ebenerdige Wohnung, ein Zimmer nur, aber was braucht es mehr. Ein schmales Lager gehört dazu, eine Kochstelle, ein Tisch und zwei Hocker. Die Nacht verbringen wir stumm nebeneinander auf dem Lager, aneinandergeschmiegt, ohne zu sprechen, ohne zu schlafen.
Ich glaube, wir haben beide viel, über das wir nachdenken müssen.
***
Der nächste Morgen. Alexander macht sich auf, um sich an Sokrates’ Spuren zu heften. Ein bisschen flirren seine Konturen noch, während er geht, aber er wird besser. Ich hingegen bleibe noch ein wenig unsichtbar und nutze diesen Zustand, mich in den Wohnungen nebenan umzusehen. Ich kenne dieses Leben nicht. Ich will es kennenlernen.
Als der späte Nachmittag kommt, bin ich auf dem Markt gewesen. Ich habe ein paar Lebensmittel gekauft, ein paar Kleidungsstücke, und ein paar hübsche Kleinigkeiten für diese Wohnung. Nichts von alldem werde ich behalten können, wenn ich gehe, aber das stört mich nicht. Das hier und jetzt zählt.
Ich bin unruhig. Seit dem Tag zuvor, seit unserer zweiten Begegnung sind wir das erste Mal getrennt. Vielleicht war es dumm. Was weiß ich denn schon? Was habe ich verstanden? Vielleicht kommt er nicht wieder. Vielleicht ist er nicht wie ich. Vielleicht bin ich jetzt wieder allein.
Der Gedanke schnürt mir fast die Luft ab.
Ich versuche, mich abzulenken, koche auf der Feuerstelle vor der Wohnung ein Abendessen. Nebenan ist eine junge Frau mit einem Kleinkind, das zu mir herübertorkelt. Wir kommen ins Gespräch, tauschen uns ein wenig aus über unser Leben aus, beziehungsweise das, welches ich zu leben vorgebe.