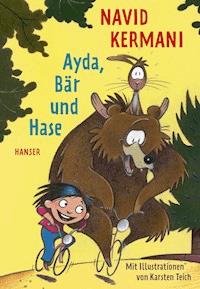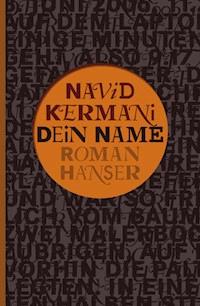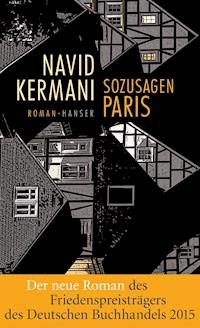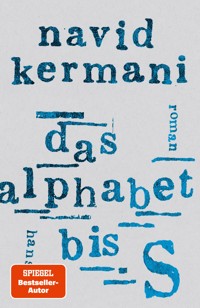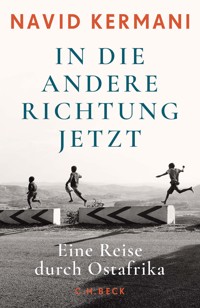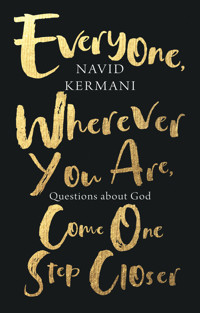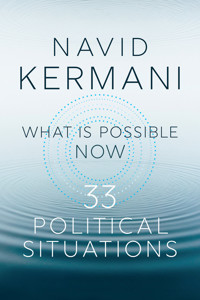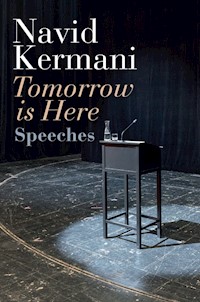12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein immer noch fremd anmutendes, von Kriegen und Katastrophen zerklüftetes Gebiet beginnt östlich von Deutschland und erstreckt sich über Russland bis zum Orient. Navid Kermani ist entlang den Gräben gereist, die sich gegenwärtig in Europa neu auftun: von seiner Heimatstadt Köln nach Osten bis ins Baltikum und von dort südlich über den Kaukasus bis nach Isfahan, die Heimat seiner Eltern. Mit untrüglichem Gespür für sprechende Details erzählt er in seinem Reisetagebuch von vergessenen Regionen, in denen auch heute Geschichte gemacht wird. Navid Kermani ist im Auftrag des SPIEGEL von seiner Heimatstadt Köln durch den Osten Europas bis nach Isfahan, die Heimat seiner Eltern, gereist. Die Reise führte ihn mitten durch den jüdischen «Ansiedlungsrayon» der Zarenzeit, die «Bloodlands» des Zweiten Weltkriegs, am Riss zwischen Ost und West entlang, wo der Kalte Krieg längst nicht zu Ende ist und im Donbass zum heißen Krieg wird. Er hat die Trümmer zerstörter Kulturen und die Spuren alter wie neuer Verwüstungen gesehen. Vor allem hat er Menschen getroffen, die innerlich zerrissen sind, weil sie sich auf der Suche nach Heimat und Wohlstand auf eine Seite schlagen müssen. Mit wenigen Strichen lässt er das Nachtleben der Großstädte lebendig werden, Geschäfte wie zu Sowjetzeiten, hippe Cafés, die Gelassenheit in Frontnähe und die Angst vor den anderen, wer immer das ist. "Das Beispiel von Navid Kermani zeigt, wie voraussetzungsreich eine Autorschaft gemacht sein muß, wie vielfach gebrochen, marginalisiert, davon betrübt und zugleich euphorisiert, wie sehr, bei aller Kritik, weltbegeistert sie sein muß, daß sie sich die Rolle des politischen Schriftstellers, die auch besonders schön leuchtet, zutrauen darf." Rainald Goetz, Dankesrede zur Verleihung des Büchner-Preises 2015
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Navid Kermani
EntlangdenGräben
Eine Reise durch das östliche Europabis nach Isfahan
C.H.Beck
ÜBER DAS BUCH
Ein immer noch fremd anmutendes, von Kriegen und Katastrophen zerklüftetes Gebiet beginnt östlich von Deutschland und erstreckt sich über Russland bis zum Orient. Navid Kermani ist im Auftrag des SPIEGEL entlang den Gräben gereist, die sich gegenwärtig in Europa neu auftun: von seiner Heimatstadt Köln nach Osten bis ins Baltikum und von dort südlich über den Kaukasus bis nach Isfahan, die Heimat seiner Eltern.
Die Reise führte ihn mitten durch den jüdischen «Ansiedlungsrayon» der Zarenzeit und die «Bloodlands» des Zweiten Weltkriegs, dicht vorbei an den Sperrgebieten des Supergaus von Tschernobyl, am Riss zwischen Ost und West entlang, wo der Kalte Krieg längst nicht zu Ende ist und im Donbass zum heißen Krieg wird. Er hat die Trümmer zerstörter Kulturen und die Spuren alter wie neuer Verwüstungen gesehen. Vor allem hat er Menschen getroffen, die innerlich zerrissen sind, weil sie sich auf der Suche nach Heimat und Wohlstand auf eine Seite schlagen müssen. Mit wenigen Strichen lässt er das Nachtleben der Großstädte lebendig werden, Geschäfte wie zu Sowjetzeiten, hippe Cafés, die Gelassenheit in Frontnähe und die Angst vor den anderen, wer immer das ist.
«Das Beispiel von Navid Kermani zeigt, wie voraussetzungsreich eine Autorschaft gemacht sein muß, wie vielfach gebrochen, marginalisiert, davon betrübt und zugleich euphorisiert, wie sehr, bei aller Kritik, weltbegeistert sie sein muß, daß sie sich die Rolle des politischen Schriftstellers, die auch besonders schön leuchtet, zutrauen darf.»
Rainald Goetz, Dankesrede zur Verleihung des Büchner-Preises 2015
ÜBER DEN AUTOR
Navid Kermani lebt als freier Schriftsteller in Köln. Für seine Romane, Essays und Reportagen erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den Kleist-Preis, den Joseph-Breitbach-Preis, den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels sowie den Princess Margriet Award for Culture 2017. Im Verlag C. H.Beck erschienen zuletzt «Ausnahmezustand» (8. Aufl. 2016), «Zwischen Koran und Kafka» (6. Aufl. 2016), «Einbruch der Wirklichkeit» (4. Aufl. 2016) sowie «Ungläubiges Staunen. Über das Christentum» (13. Auflage 2016; Edition C. H.Beck Paperback 2017).
INHALT
Köln
Eine Reise durch das östliche Europa bis nach Isfahan
Erster Tag: Schwerin
Zweiter Tag: Von Berlin nach Breslau
Dritter Tag: Auschwitz
Vierter Tag: Krakau
Fünfter Tag: Von Krakau nach Warschau
Sechster Tag: Warschau
Siebter Tag: Warschau
Achter Tag: Von Warschau nach Masuren
Neunter Tag: Kaunas
Zehnter Tag: Vilnius und sein Umland
Elfter Tag: Über Paneriai nach Minsk
Zwölfter Tag: Minsk und Chatyn
Dreizehnter Tag: In die Sperrzone von Tschernobyl
Vierzehnter Tag: Kurapaty und Minsk
Fünfzehnter Tag: In die Sperrzone hinter Krasnapolle
Sechzehnter Tag: Von Minsk nach Kiew
Siebzehnter Tag: Kiew
Achtzehnter Tag: Von Kiew nach Dnipro
Neunzehnter Tag: An die Front im Donbass
Zwanzigster Tag: Über Mariupol ans Schwarze Meer
Einundzwanzigster Tag: Am Schwarzen Meer entlang nach Odessa
Zweiundzwanzigster Tag: Odessa
Dreiundzwanzigster Tag: Abflug aus Odessa
Vierundzwanzigster Tag: Über Moskau nach Simferopol
Fünfundzwanzigster Tag: Über Bachtschyssarai nach Sewastopol
Sechsundzwanzigster Tag: Entlang der Krimküste
Siebenundzwanzigster Tag: Von der Krim aufs russische Festland
Achtundzwanzigster Tag: Nach Krasnodar
Neunundzwanzigster Tag: Von Krasnodar nach Grosny
Dreißigster Tag: Grosny
Einunddreißigster Tag: In den tschetschenischen Bergen
Zweiunddreißigster Tag: Von Grosny nach Tiflis
Dreiunddreißigster Tag: Tiflis
Vierunddreißigster Tag: Tiflis
Fünfunddreißigster Tag: Nach Gori und an die georgisch-ossetische Waffenstillstandslinie
Sechsunddreißigster Tag: Von Tiflis nach Kachetien
Siebenunddreißigster Tag: Von Kachetien nach Aserbaidschan
Achtunddreißigster Tag: Entlang der aserisch-armenischen Waffenstillstandslinie
Neununddreißigster Tag: Mit dem Nachtzug nach Baku
Vierzigster Tag: Baku
Einundvierzigster Tag: Baku und Qubustan
Zweiundvierzigster Tag: Abflug aus Baku
Dreiundvierzigster Tag: Eriwan
Vierundvierzigster Tag: Eriwan
Fünfundvierzigster Tag: Zum Sewansee und weiter nach Bergkarabach
Sechsundvierzigster Tag: Durch Bergkarabach
Siebenundvierzigster Tag: An die armenisch-aserische Waffenstillstandslinie und weiter nach Iran
Achtundvierzigster Tag: Über Dscholfa nach Täbris
Neunundvierzigster Tag: Über Ahmadabad zur Festung Alamut
Fünfzigster Tag: Ans Kaspische Meer und weiter nach Teheran
Einundfünfzigster Tag: Teheran
Zweiundfünfzigster Tag: Teheran
Dreiundfünfzigster Tag: Teheran
Vierundfünfzigster Tag: Abflug aus Teheran
Mit der Familie in Isfahan
Aufbruch
Dank
Köln
Ich laufe jeden Tag durch mein Viertel hinterm Bahnhof. Ich höre hier etwas Arabisches, dort Polnisch, links etwas, was nach Balkan klingt, Türkisch sowieso, vereinzelt Persisch, das mich aufhorchen läßt, Französisch von Afrikanern, asiatische Sprachen, auch Deutsch, gesprochen in den unterschiedlichsten Färbungen und Qualitäten, von Blonden ebenso wie von Orientalen, Schwarzen oder Gelben. Das ist nicht immer nur angenehm, die Penner, die vielen schwarzen Kunstlederjacken (vielleicht auch aus echtem Leder, was weiß ich denn), o Gott, die goldenen Vorderzähne der schwarzhaarigen Frauen, die lange bunte Röcke und ein Baby im Tuch tragen, die zweiten und dritten Kinder an der Hand und vorneweg, die Jugendlichen, die herumlungern, die Drogenabhängigen und die mit einem Hau, die ihr Wohnheim «Unter Krahnenbäumen» haben, wie die Straßen in meinem Viertel wirklich heißen, dazwischen einige Muslime mit verdächtig langen Bärten. Nicht nur hinterm Kölner Bahnhof breitet sich diese Wirklichkeit aus. Wahrscheinlich in allen großen Städten Westeuropas findet man die Mischung aus türkischen Gemüseläden, chinesischen Lebensmitteln, die iranischen Spezialitäten beim Händler, der vor der Revolution Regisseur beim iranischen Staatsfernsehen war, die traditionellen und Selbstbedienungsbäckereien, die Aneinanderreihung von Handyshops und Internetcafés, Iran neunzehn Cent, Türkei neun, Bangladesch vierundzwanzig, die Billighotels, Sexshops, Brautmoden, die Szenekneipen und Tee- oder Kaffeehäuser für Türken, Albaner, Afrikaner, Türken mit und ohne Alkohol, die schicken und die schäbigen Restaurants, Thaimassageläden, Wettbüros mit und ohne Alkohol, zwischen Im- und Export das eine oder andere Uraltgeschäft für Haushaltswaren oder Stempel, an der Hauptstraße das Flüchtlingshaus mit Roma, die die Glasscheiben abmontiert haben, um Satellitenschüsseln in die offenen Fenster zu stellen, dazwischen im Winter immer wieder ein Stoßtrupp blau oder rot uniformierter älterer Herren mit Spitzhut und Degen, eine Schar von Indianern oder eine Horde halbnackter Hunnen – Karnevalsgesellschaften. Von was leben die Händler, die in ihren überdimensionierten Läden alle die gleichen zwanzig Batterien für einen Euro fünfzig anbieten? Bestimmt nicht von den Batterien, wenn gleichzeitig die alten, gutbesuchten Fachgeschäfte eines nach dem anderen die steigenden Mieten nicht mehr bezahlen können. Die Völkerverständigung findet am Anfang und Ende des Viertels statt bei Humba und Täterä an vier langen Theken, an denen die erprobtesten Nutten Kölns bei immer offenen Fenstern mit dicken Deutschen genauso wie mit trunkenen Türken singen. Das sind die neuen Zentren, hinterm Kölner Bahnhof weit weniger aggressiv als anderswo, nein, oft sogar idyllisch übers Sagbare und hier Gesagte hinaus. Sie sind nichts weniger als rein. Sie haben mit der Geschichte des Ortes nichts zu tun, doch radieren sie die Geschichte auch nicht aus, schon gar nicht die zweitausendjährige von Köln. Als wollten sie den Namen Colonia auf seine wörtliche Bedeutung zurückführen, sind sie wie Kolonien von Fremden, aber von vielen unterschiedlichen Fremden, die sich auch gegenseitig fremd sind, wie sie in den Internetcafés zwischen zwei Sichtblenden sitzen oder in Gruppen vor den Callshops stehen. Oft denke ich, ob sie wohl ebenfalls nahe Tanger ins Boot gestiegen sind, nachts unterhalb einer Böschung, nur daß ihr Boot weder untergegangen ist noch abgefangen wurde – lauter Erfolgsgeschichten also, auch wenn sie immer noch zu fünft ein Zimmer teilen und Angst haben vor der Polizei? Iran neunzehn Cent, Türkei neun, Bangladesch vierundzwanzig. Das sind keine Randgesellschaften. Sie wabern aus von der Mitte der Stadt. Die Ränder sind es, die noch den Anschein der Gleichartigkeit wecken. Dort ist die Stadt aufgeteilt nach Einkommen. In der Mitte ist alles übereinandergestürzt. Ich gehe durch das Viertel, ich höre hier etwas Arabisches, dort Polnisch, links eine Sprache, die nach dem Balkan klingt, Türkisch sowieso, vereinzelt Persisch, das mich aufhorchen läßt, sonst Französisch von Afrikanern, Asiatisch, Deutsch in den unterschiedlichsten Färbungen und Qualitäten. Ich verstehe die Hälfte nicht, wirklich die Hälfte. Und von der Hälfte, die ich verstehe, versteh ich meist nur die Hälfte, weil es schon wieder hinterm Fenster oder der Ladentür verschwunden ist, schlecht artikuliert oder zu weit entfernt, ich zu schnell vorbei oder die anderen zu schnell vorbei an mir. Ich führe die Sätze selbst zu Ende oder denke mir ihren Anfang, ich stelle mir Geschichten vor, die nicht in Deutz oder im Zweiten Weltkrieg spielen, sondern in chinesischen Provinzstädten, an nigerianischen Universitäten, in Booten, Containern und Abflughallen, in denen das Herz rast.
Aus Dein Name
Eine Reise durch das östliche Europa bis nach Isfahan
Erster Tag: Schwerin
«Gibt es denn überhaupt keine Probleme?» frage ich ungläubig die Frau, die in der Plattenbausiedlung die Sonntagsschule für syrische Kinder leitet.
«Nein», antwortet die Frau, «nicht wirklich.» Ab und zu mal ein unschönes Wort wegen ihres Kopftuchs, aber was sei das schon gegen das, was ihre Familie in Syrien durchgemacht habe, im Krieg. Das Kind, das sie im Bauch trage, werde in Frieden geboren.
Vierzig Jahre alt ist Ghadia Ranah und war bereits in Syrien Lehrerin von Beruf. Jetzt ist sie für einhundertsechsunddreißig syrische Kinder verantwortlich, die jedes Wochenende auf dem Dreesch, der größten Plattenbausiedlung Schwerins, Arabisch üben, um mit der Heimat verbunden zu bleiben. Die Kinder, die ich in der Pause auf dem Spielplatz des Sozialzentrums befrage, denken allerdings nicht daran zurückzukehren. Ich kann es kaum fassen, wie gut sie bereits Deutsch beherrschen, acht, neun Monate hier und verwenden bereits den Konjunktiv, um zu erklären, wie ihr Alltag aussähe, wenn sie noch immer in Syrien lebten, keine Schule, keine Spiele draußen, Angst vor Bomben, Panzern, Kämpfern. Hier in Deutschland seien alle nett zu ihnen.
Kaum hat meine Reise im September 2016 begonnen, bemerke ich bereits meine Scheuklappen: Meine Idee war, mit den Flüchtlingen selbst zu sprechen, bevor ich nachmittags höre, wie bei der AfD über sie gesprochen wird. Natürlich nahm ich an, wer weiß wie schreckliche Zustände kennenzulernen, als Westdeutscher stellt man sich die ehemalige DDR schließlich als Strafe für jeden Flüchtling vor: ausländerfeindliche Nachbarn, überforderte Behörden, Isolation, womöglich Übergriffe. Tatsächlich treffe ich auf gut aufgelegte Helfer, strebsame Flüchtlinge, spielende Kinder, als würde mir die Willkommensgesellschaft ausgerechnet in der Plattenbausiedlung einen Werbefilm vorführen.
Es habe sich unter den Syrern herumgesprochen, erklärt mir einer der freiwilligen Arabischlehrer, daß die Verhältnisse in Schwerin besonders günstig für Flüchtlinge seien. Wie bitte? Ja, nach zwei, drei Monaten erhalte man hier seine Papiere und könne arbeiten, vielleicht noch nicht im gelernten Beruf, noch nicht als Apotheker oder Ingenieur, aber etwa als Übersetzer bei der Arbeiterwohlfahrt oder auf dem Bau. Außerdem würden die Flüchtlinge bei so viel leerstehenden Wohnungen nicht in Heimen untergebracht, seien die Sprachkurse nicht überfüllt und bildeten sich vor den Ämtern keine Schlangen. Demnächst böte der Verein, den die Syrer gegründet haben, interessierten Nachbarn kostenlosen Arabisch-Unterricht an; auch in der Kleingärtnersiedlung hätten sie schon ausgeholfen, um ihre Dankbarkeit zu zeigen.
So einfach sei es mit den Nachbarn dann doch nicht, berichtet Claus Oellerking, der in seinem früheren Leben selbst Schuldirektor war und auf dem Dreesch die Flüchtlingshilfe mitgegründet hat. Die Syrer seien schon sehr speziell, Mittelschicht, hochmotiviert, gute Ausbildung, da gehe die Eingewöhnung schneller als bei den Problemfällen, die es unter den Flüchtlingen natürlich auch gebe, erst recht, wenn der Zustrom völlig unkontrolliert sei, weil keine regulären Fluchtmöglichkeiten existierten. Einerseits hätten die meisten Bewohner der Plattenbausiedlung selbst einmal ihre Heimat aufgegeben, als Vertriebene, als Rußlanddeutsche oder als Arbeiter, die nach Schwerin zogen, als in den siebziger Jahren die Fabriken gebaut wurden. Entsprechend sei die Bereitschaft zu helfen durchaus ausgeprägt, gerade bei den Älteren – anfangs hätte sich die Flüchtlingshilfe kaum retten können vor Geschenken. Andererseits hätten viele Deutsche hier den Eindruck, abgehängt worden zu sein, die plötzliche Arbeitslosigkeit, als die Industriebetriebe nach der Einheit dichtmachten, eine karge Rente oder Hartz IV, die Zahl der Single-Haushalte überproportional hoch, das Alter vierzig aufwärts, zu wenige Kinder, dazu die Versorgungsmentalität noch aus der DDR – und nun zögen Hunderte Syrer in die Siedlung ein, junge Männer und vor allem junge Familien, die ihr Leben entschlossen in die Hand nehmen, nachdem sie es so glücklich gerettet haben, und vielleicht auch etwas temperamentvoller sind, andere Sitten haben, eine andere Sprache sprechen, dazu die Kopftücher. Natürlich erzeuge das Ablehnung, wenn auch eher im stillen. Gewalt gebe es auf dem Dreesch so gut wie nicht, egal was die Zeitungen über den sogenannten Brennpunkt schrieben, nicht einmal Graffiti oder demolierte Spielplätze. Aber ob jemand zum Arabisch-Unterricht kommt oder auch nur zum Internationalen Grillen – da hat Herr Oellerking doch Zweifel.
Ich frage nach den Kleingärtnern. Ja, das sei lustig gewesen, erinnert sich Herr Oellerking sofort, lustig und ein wenig traurig. Wie so viel anderes Leben hier gingen auch die Kleingärten allmählich ein; die alten Gartenfreunde stürben, neue kämen nicht ausreichend hinzu, so daß die Gebühren stiegen, was wiederum junge Familien abhalte, einen Garten zu übernehmen – ein Teufelskreis. Schlimmer noch, das Gemeinschafsgefühl lasse nach, der Zusammenhalt. Früher habe ein Aushang genügt, dann hätten zur angegebenen Zeit die Nachbarn mit angepackt. Doch nun habe der Vorstand dazu aufgerufen, den Garten eines kranken Rentners auf Vordermann zu bringen – und außer einem einzigen Kleingärtner, der auch noch AfD-Mitglied war, seien nur die syrischen Flüchtlinge angerückt, die seit der Kölner Silvesternacht jede Gelegenheit ergriffen, um sich auf dem Dreesch nützlich zu machen. Der Mann von der AfD habe unglücklich umhergeschaut, dann habe er hektisch telefoniert, um deutsche Helfer zu finden, aber die deutschen Kleingärtner, die hülfen sich nicht mehr. Dem kranken Rentner freilich seien die Syrer schon recht gewesen, Hauptsache, das Laub wurde gekehrt, die Äste geschnitten.
Durch die blumengeschmückte Altstadt, in der jeder Ziegel sorgsam restauriert scheint, fahre ich an den großen Plakaten der AfD vorbei, die vor der «Zerstörung Deutschlands» warnen. Kaum habe ich den holzgetäfelten Festsaal des Restaurants «Lindengarten» betreten, in dem die Partei zu «Kaffee und Kuchen zum Thema Rente» einlädt, höre ich eine Frau klagen, daß deutsche Mädchen «entweiht» würden. Das geht ja schon mal gut los, denke ich und schaue mich um. Etwa fünfzig, vielleicht sechzig Menschen stehen in dem Saal oder sitzen bereits an den Tischen, die an die beiden Längswände gerückt sind, als solle die Mitte freibleiben zum Tanz. Nichts Außergewöhnliches an ihnen, keine Embleme, keine Glatzen, keine Stiefel, auch das Alter buntgemischt. Eine junge Frau, die als einzige deutsche Tracht trägt, sieht eher verloren aus. Als ich mich an einen der Tische setze, wird mir ebenfalls Kaffee und Kuchen gereicht.
Zunächst stellen sich die Direktkandidaten für die anstehende Landtagswahl vor, die der Reihe nach versichern, ganz normale Bürger zu sein. Am häuslichsten gibt sich die blonde Dame, die bis vor kurzem einen Escort-Service für arabische Kunden betrieb, wie wohl jeder im Saal weiß, weil sie deswegen von der Landesliste gestrichen worden ist. Im Wahlkreis hat sie sich dennoch durchgesetzt und lächelt nun auf den Plakaten, die auch auf dem Dreesch hängen, im Trachtenrock oder von einem prächtigen Pferd herab, womöglich einem Araber. Der Redner, Andreas Kalbitz, stellvertretender Fraktionschef in Brandenburg, soll am rechten Rand der AfD stehen, Burschenschafter; auch Verbindungen zu einem rechtsextremen Verein sagt ihm die Lügenpresse nach. Ich selbst habe ihn bereits am Telefon kennengelernt, als wir uns in Schwerin verabredeten, da wirkte er – sorry, meine lieben linken Freunde, das schreiben zu müssen – kein bißchen aggressiv.
Auch in seiner Rede betont Kalbitz ein ums andere Mal, daß man natürlich differenzieren müsse – allerdingst folgt dann keine Differenzierung, vielmehr die nächste pauschale Aussage über die Systemparteien, die Medien und die Asylanten. Auch die Beispiele beleuchten strikt nur eine Seite der Wirklichkeit: der Plattenbau in seinem Wahlkreis, der für die Flüchtlinge saniert würde, während die Deutschen weiter in ihren verfallenen Wohnungen hausten, die zweihundert Millionen jährlich, die zur Angleichung der Renten im Osten fehlten, während für den Asylwahnsinn 90 Milliarden Euro bereitgestellt würden, die zwölftausend Euro Rente der Rundfunkintendantin und die Hilflosigkeit der Behörden im Umgang mit schwarzfahrenden Flüchtlingen, die in Berlin jetzt kostenlose Fahrscheine erhielten, während Rentner und Hartz IV-Bezieher ihre Sozialtickets kaufen müßten. Und so weiter: die Parallelgesellschaften, islamischen Friedensrichter und unsere deutschen Frauen, die sich nachts nicht mehr auf die Straße trauten, aber natürlich müsse man differenzieren. Ausgangspunkt für jedes Argument ist die Rente: In Würde altern möchte jeder, gleich, wo er sonst politisch steht. Und die Schlußfolgerung ist jedesmal: Irgendwer bekommt das Geld, das euch im Alter fehlt. Offen gesagt kommt mir das ein bißchen zu simpel vor, so einfach gestrickt sehen die Zuhörer gar nicht aus.
Erst in der Fragestunde geht mir auf, was die neue Partei aus dem Stand auf 20 Prozent bei den Landtagswahlen bringen wird – nicht das, was sie sagt, sondern das, was hier Menschen endlich sagen dürfen. Jeder im «Lindengarten» hat eine eigene Sorge, der eine seine Rente, der andere die private Krankenversicherung, die er im Alter nicht mehr kündigen darf, ein dritter die Fremden im Straßenbild, außerdem die hohen Gebühren im Kleingärtnerverein, und alle lesen die gleichen Bestseller, die vor dem Islam warnen. Nicht Haß, Furcht ist es, die aus den Sätzen spricht, Furcht, daß sie Verlierer sind im eigenen Land und wie nach der Wende alles über sie hereinbricht. Das hier ist nicht die NPD; ein Skinhead würde mehr auffallen und wahrscheinlich mehr stören als jemand mit schwarzen Haaren wie ich. Das hier sind tatsächlich ganz normale Bürger mit ganz normalen Berufen oder zu geringen Renten, soweit ich nach der Veranstaltung mit ihnen ins Gespräch komme, Handwerksmeister, Computerfachleute, gar ein ehemaliger Wahlbeobachter der OSZE mit internationaler Erfahrung; ein älterer Herr, der es zuletzt bei den Piraten versucht hat, sieht mit seinem langen Bart mehr wie ein Hippie aus. Allenfalls Andreas Kalbitz hat etwas, nein, nicht von einem Nazi, sondern mit der kleinen Nickelbrille, dem blonden Schnurrbart und der schneidigen Diktion mehr etwas Wilhelminisches. Und dieses Deutschland, das alte Deutschland, das nationalbewußt war, aber nicht von Adolf Hitler ins Verderben getrieben, ist es vielleicht am ehesten, was für einen Burschenschafter ein Bezug wäre, als alles noch seine Ordnung hatte.
«Wir wollen, daß alles so bleibt», sagt mir ein junger Mann mit Trekkinghose, der genauso freundlich, neugierig ist wie alle anderen, die nach der Veranstaltung mich ansprechen statt umgekehrt ich sie. «Sie können sich wünschen, was Sie wollen», erwidere ich, «Sie können für Ihre Vorstellungen kämpfen – aber ich kann das genauso, Sie haben kein Vorrecht vor mir.» Da fällt ihm die Kinnlade herunter, dieser Punkt, daß der, dessen Eltern zugezogen sind, das gleiche Recht haben soll wie ein Einheimischer, das leuchtet ihm nicht ein. Dem Herrn, der früher bei der OSZE war, freilich schon, und sofort ergibt sich eine Diskussion unter den Anhängern der AfD selbst. Sogar das Recht auf politisches Asyl wird nun verteidigt und wiederholt daran erinnert, daß Deutschland ein Einwanderungsgesetz benötige, so stehe es schließlich auch im Parteiprogramm. Nur wie im letzten Herbst, so chaotisch, das gehe doch nicht, sind sich alle einig, auch mit Herrn Oellerking von der Flüchtlingshilfe Schwerin. Daß offenbar niemand je mit einem Flüchtling gesprochen, geschweige denn einmal die Sonntagsschule besucht hat, so nahe sie auch liegt, das versteht sich allerdings von selbst. Aber gut, wer aus meinem eigenen, dem «links-rot-grün versifften 68er-Deutschland», wie es der AfD-Vorsitzende nannte, spricht je mit den Anhängern seiner Partei?
Als sich der Saal leert, setze ich mich zu Kalbitz an den Tisch; er ist erschöpft, die Hitze, die vielen Auftritte im Wahlkampf, jetzt auch noch eine Erkältung im Anflug – er wäre an einem sonnigen Sonntag auch lieber bei seiner Familie, bei seinen drei Kindern, aber zu sehr treibe ihn die Passivität der Menschen um, die Resignation, die geringe Wahlbeteiligung. Mit der AfD führe man die Leute zurück in die Politik, gebe ihnen eine Stimme, darüber müsse sich doch jeder Demokrat freuen, oder etwa nicht? Komme es ihm denn nicht selbst absurd vor, frage ich, wenn die AfD groß plakatiert, daß Deutschlands Zerstörung droht? In Deutschland wisse man schließlich, was Zerstörung bedeutet, und wenn man es vergessen habe, könne man sich die Bilder aus Syrien oder dem Irak anschauen. Aber hier in der schmucken Altstadt Schwerins, im holzgetäfelten Veranstaltungssaal – Deutschlands Zerstörung? Ehrlich gesagt wüßte ich gerade nicht, welches Land so viel sicherer, wohlhabender und freier sei, Schweden vielleicht oder Norwegen.
Der Slogan sei nicht von ihm, sagt Kalbitz, und drücke außerdem nur eine Sorge aus, kein bereits eingetretenes Faktum. Ach so? frage ich. Ja, natürlich, beteuert Kalbitz, eine Sorge, kein Faktum, und beginnt dann im Gespräch tatsächlich eine Differenzierung nach der anderen, die im Vortrag nur eine Ankündigung blieb. Plötzlich gibt es nicht mehr nur die Silvesternacht, sondern die wirklich Verfolgten, die selbstverständlich ein Recht auf Asyl hätten, nicht nur die Terroranschläge, sondern auch die vielen gut integrierten Muslime. Am Ende ist vom schwarzen Nationalspieler Boateng, den Deutsche nicht gern als Nachbarn hätten, bis zum Schießbefehl an den deutschen Außengrenzen all das abgeräumt, was am meisten provoziert, und bleibt mehr oder weniger nur das Minarettverbot als Alleinstellungsmerkmal, obwohl Kalbitz mir nicht recht begreiflich machen kann, wie sich Menschen mit einem Land identifizieren sollen, wenn sie nicht auch mit ihrem Glauben heimisch werden.
Genau dieser Vorwurf ist der AfD oft gemacht worden: daß ihre Vertreter provozieren, um anschließend zu beteuern, es sei alles nicht so gemeint; die Grenzen zum Skandalösen würden so Stück für Stück nach hinten verschoben. Aber da ich Andreas Kalbitz gegenübersitze, wüßte ich tatsächlich nicht zu sagen, ob der echt ist, der in seiner Rede Flüchtlingshelfer wie Claus Oellerking als «Kuscheltierwerfer» verhöhnt, oder jener, der kein Problem mit einem türkischstämmigen Vizekanzler hätte, sofern er gut integriert sei – Cem Özdemir lehne er aus rein politischen Gründen ab. Neulich hätten ihm ein paar kroatische Geschäftsleute gesagt, daß sie eigentlich alles gut fänden, was die AfD vertrete, aber die Partei schlecht unterstützen könnten, weil sie doch gegen Ausländer sei. Irgendwie habe er den Eindruck – der wohlgemerkt ganz falsch sei! – dennoch nachvollziehen können, meint Kalbitz und wünscht mir eine gute Weiterreise.
Zweiter Tag: Von Berlin nach Breslau
Am Rosa-Luxemburg-Platz leuchten drei Buchstaben auf dem Dach der Volksbühne in riesigen Lettern rot auf: «OST». Das allein ist bereits eine Aussage, nein, soll ein Widerspruch sein im wiedervereinigten Berlin, vielleicht sogar im einigen Europa: «OST». Viele der großen, aufgrund ihrer Länge – fünf, sechs, sieben Stunden – schon physisch kraftraubenden Aufführungen der letzten zwei Jahrzehnte waren Adaptionen russischer Romane, und die Diskussionsreihe hieß «Kapitalismus & Depression», später «Politik & Verbrechen». Gerade hat der Senat beschlossen, aus dem bedeutendsten Sprechtheater Deutschlands eine multimediale Spielstätte des internationalen Festspielbetriebs zu machen, in der vornehmlich Englisch gesprochen wird. Bestimmt wird es auch um Flüchtlinge gehen.
Das Taxi Richtung Hauptbahnhof fährt an einem Kubus aus Plastik vorbei, der alle anderen Gebäude Unter den Linden an Größe übertrifft, den Dom, die Universität, die Oper, das Brandenburger Tor. Immer noch fällt es schwer zu glauben, daß hinter den Planen Ziegel für Ziegel die Fassade des Hohenzollernschlosses nachgebaut wird, als könne man Geschichte revidieren. «Do Bigger Things» fordert die Reklame auf, die die gesamte Vorderfront bedeckt. Ob die Werbeagentur das Poster mit Bedacht gewählt hat? Geradezu subversiv zeigt es eine Landschaft, die durch den Bildschirm eines Smartphones eingerahmt wird, darauf ein Stift, um die Wirklichkeit zu frisieren. Künftig sollen ausgerechnet in einem Imitat preußischer Herrlichkeit die Weltkulturen präsentiert werden, und niemand weiß, wie’s geht. Eine Etage wurde bereits umgewidmet, um viel passender die eigene Lokalgeschichte zu feiern. Jetzt müßte nur noch das goldene Kreuz, das nach der gescheiterten Revolution von 1848 das Gottesgnadentum des Königs demonstrieren sollte, wieder aufs Schloß gestellt werden, also wie eine Fahne aus den kolonialen Sammlungen herausragen, dann wäre die Weltläufigkeit vollends demaskiert.
Vor dem Reichstag, dessen Kuppel nach dem Fall der Mauer ebenfalls nachgebaut wurde, aber nicht rückwärtsgewandt als eine Kopie, steige ich aus dem Taxi. Weil ich ein paar Minuten zu früh bin, rolle ich meinen Koffer nicht rechts zum Hauptbahnhof, sondern links zum Denkmal für die ermordeten Juden Europas. So richtig ich den zentralen Ort, auch die Dimensionen fand, so fatal erschien mir die begehbare Landschaft aus Betonquadern, weil sie eine Einfühlung herzustellen sucht, die es niemals geben kann. Nun nähere ich mich erstmals vom Norden dem Denkmal und bin überrascht, wie sich die Stelen zu einem schwarzgrauen Hügel aus Gräbern erheben, hinter dem der Tiergarten zu einem Friedhofsgarten wird, die umliegenden Bürogebäude sich in Verwaltungstrakte verwandeln, deren Linien und Farben mit den Betonquadern kongruieren, das Brandenburger Tor plötzlich ein Portal ist, durch das man nicht aus freien Stücken gegangen ist. Der Blick, der das Verbrechen in die Abstraktion überführt, da es die Vorstellungskraft übersteigt, versöhnt mich ein paar Minuten lang mit dem Denkmal. Dann jedoch trete ich zwischen die Stelen und bin sofort wieder konsterniert. Je höher sie werden, je ferner die Stadt rückt, je verlorener ich mich fühlen soll, desto mehr ärgere ich mich über den billigen Effekt. Geradezu unverfroren erscheinen mir die betont unebenen Böden, die wohl das schwankende Lebensgefühl der Opfer simulieren sollen, aber zumal mit Rollkoffer das denkbar banalste Erschwernis sind. Ehrlicher erscheinen mir da schon die Sicherheitszäune, wo steile Treppen zu unterirdischen Türen führen, auf denen «Notausgang» steht.
Sind die Züge nach Osten immer so leer? Peinlich es zu gestehen, aber ich war noch nie in Polen. Tief im Westen Deutschlands geboren und aufgewachsen, schauten wir immer nach Frankreich, Italien, zu den Vereinigten Staaten; selbst den Orient kannten wir besser als den Osten des eigenen Landes. Jetzt fährt der Zug über die Oder, die noch ein richtiger Fluß zu sein scheint, nicht so verbaut und begradigt, die Ufer sich selbst überlassen. Keine dreißig Sekunden in Polen, und schon sieht der Osten urwüchsig aus wie in den Büchern von Andrzej Stasiuk. Aber klar, die Plattenbauten kommen auch sofort, dreißig Sekunden später.
In Posen verpasse ich beinah den Anschluß nach Breslau, weil ich mich trotz aller Reiseerfahrung am Bahnhof nicht zurechtfinde und niemanden verstehe, dem ich mein Ticket hinhalte. Und dann bleibe ich auch noch an der Bahnhofsbäckerei stehen: Wenn ich etwas für typisch deutsch hielt, war es das Vollkornbrot, und nun geht mir auf, daß die Polen oder jedenfalls die Posener das Brot genauso dunkel backen und Deutschland kulinarisch mehr dem Osten angehört als dem Westen oder gar dem Süden Europas, der erst in den letzten Jahrzehnten in die deutsche Küche Einzug gehalten hat. Nicht die Weißwurst-, sondern die Weißbrotgrenze ist es, die den Kontinent historisch teilt. Vor den Weltkriegen ordnete man Deutschland zusammen mit Polen, Tschechien oder Ungarn wie selbstverständlich Mitteleuropa zu und legten deutsche Intellektuelle Wert darauf zu erklären, was ihr Land vom Westen trennt. Als ich endlich wieder im Zug sitze, wundere ich mich, daß selbst in der ersten Klasse kein Platz frei ist, als ob die Polen sich nur innerhalb des eigenen Landes bewegten.
In Breslau erklärt mir der Leiter des Willy-Brandt-Zentrums, der Historiker Krzysztof Ruchniewicz, Helmut Kohl sei in Polen weitaus beliebter als das Vorbild meiner westdeutschen, friedensbewegten Generation. Richtig, Brandt habe zwar die Oder-Neiße-Grenze anerkannt, aber später die antikommunistische Opposition nicht unterstützt und sich beim Polenbesuch 1985 geweigert, den Friedensnobelpreisträger Lech Wałęsa zu treffen. Würde ich mich auf dem Platz vor der Synagoge umhören, wo wir in einem der Cafés sitzen, wüßte kaum jemand etwas mit dem Namen des Bundeskanzlers anzufangen, und das wären die Gebildeten. Von dem Kniefall hatte 1970 schließlich kaum ein Pole gehört, merkt Ruchniewicz an; das Photo wurde ein einziges Mal in einer jüdischen Zeitung und danach nur retuschiert oder zur Hälfte veröffentlicht – Brandt ohne Knie.
Überhaupt, so elementare Tatsachen, die man nicht im Kopf hat, wenn man ein paar Kilometer weiter westlich aufgewachsen ist –, daß ausnahmslos jeder Breslauer den ominösen «Migrationshintergrund» hat und es 1945 zu einem vollständigen Bevölkerungsaustausch kam, alle sechshunderttausend Deutsche vertrieben wurden oder genaugenommen mehr, weil Schlesien als Luftschutzkeller Deutschlands galt und viele Flüchtlinge aus den Westgebieten hier lebten. Die Juden wurden gleich zweimal vertrieben, nein, dreimal: das erste Mal von den Deutschen in die Züge gepfercht, die nach Auschwitz, Theresienstadt oder Majdanek fuhren; die wenigen Juden, die in Breslau überlebt hatten, nach dem Krieg als Deutsche; schließlich diejenigen, die mit den anderen Polen in die Stadt umgesiedelt wurden, wiederum als Juden. Man weiß das alles nur vage, weil wir im Schulunterricht, wenn überhaupt, nur verschämt über die Gebiete sprachen, die nicht mehr deutsch sind. Aber auch in Polen selbst, bemerkt Ruchniewicz, erinnere man sich an die eigene Vergangenheit nur schemenhaft und sehe Polen ausschließlich als Opfer. Zumal die neue, konservative Regierung jedes Wort über die Vertreibung der Juden, geschweige denn der Deutschen, vermeide.
Ich versuche mir vorzustellen, wie die Polen, die ihrerseits zum größten Teil aus der heutigen Ukraine vertrieben worden waren, in Breslau eintrafen, wie sie die eilig verlassenen Wohnungen der Deutschen betraten, die Kleiderschränke und Schubladen öffneten, wie der Schuster nach einer Schusterwerkstatt Ausschau hielt, der Arzt sich eine passende Praxis suchte, in den Schulen vielleicht noch die Zeichnungen der vorigen Klassen hingen, der Kittel des Hausmeisters, der Hut des Direktors, mit deutschem Etikett – und wenn er dem neuen Direktor paßte? Man denkt, das Leben kann gar nicht weitergehen, wenn eine Stadt alle ihre Bewohner und mit den Bewohnern ihre Geschichte verliert, und dann sieht es ein paar Jahrzehnte später doch so aus, als hätten niemals andere Menschen in Breslau gelebt.
Krzysztof Ruchniewicz erzählt, wie einmal deutsche Vertriebene im Dorf seiner Frau in der Nähe von Habelschwerdt vorfuhren, eine weitverzweigte Familie oder vielleicht auch mehrere Familien im Bus. Die deutsche Großmutter, die sich hartnäckig nach den Preisen für Immobilien erkundigte, wurde jedes Mal von ihren Töchtern nach hinten gezogen und schließlich in den Bus gedrängt. Der Bus drehte eine Runde, bevor er wieder vor dem Haus von Ruchniewiczs Schwiegereltern anhielt. Jemand reichte ein kleines Präsent aus der Fahrertür, ein Päckchen Kaffee, bevor der Bus davonfuhr. «Das war ein seltsames Gefühl», sagt der Leiter des Willy-Brandt-Zentrums, «ganz komisch: Hätten wir ihnen auch etwas geben müssen, fragten wir uns – aber wofür?»
Als ich abends eine Mail an Andreas Kalbitz schicke, um mich für die freundliche Aufnahme zu bedanken, grüße ich – zugegeben etwas naseweis, aber manchmal sind die Finger schneller als der Verstand – «aus Breslau, wo nicht die Weltoffenheit, sondern der Nationalismus dazu geführt hat, daß kein Deutscher mehr hier lebt».
Dritter Tag: Auschwitz
Der Vorgang, der mich ohne Wenn und Aber zum Deutschen macht, dauert keine Sekunde. Aufgrund des Andrangs kann man Auschwitz nur in einer Gruppe besuchen, muß sich vorher anmelden, am besten online, und sich für eine Sprache entscheiden, Englisch, Polnisch, Deutsch et cetera. Die Prozedur ist nicht viel anders als auf einem Flughafen: Die Besucher, die meisten mit Backpacks, kurzen Hosen oder anderen Signalen, auf der Durchreise zu sein, halten den Barcode hin, um einzuchecken, nehmen einen Aufkleber für ihre Sprache in Empfang und passieren eine Viertelstunde vor Beginn ihrer Führung eine Sicherheitsschleuse. In einer engen Halle verteilen sie sich auf zu wenige Sitzbänke, bis ihre Gruppe aufgerufen wird. Nachdem ich das Ticket unter einen weiteren Scanner gehalten habe, stehe ich von einem Schritt auf den anderen im Konzentrationslager, vor mir die Baracken, die Wachtürme, die Zäune, die jeder von Photos, Dokumentationen, Filmen kennt.
Die Gruppen haben sich bereits gesammelt, obwohl die Führer noch nicht da sind. Während die israelischen Jugendlichen – oder bilde ich mir das nur ein? – etwas lauter und selbstbewußter sind, drücken sich die Deutschen – nein, das bilde ich mir nicht nur ein – stumm an die Mauer des Besucherzentrums. Und dann hefte ich den Aufkleber an die Brust, auf dem schwarz auf weiß ein einziges Wort steht: deutsch. Das ist es, diese Handlung, von da an wie ein Geständnis der Schriftzug auf meiner Brust: deutsch. Ja, ich gehöre dazu, nicht durch die Herkunft, durch blonde Haare, arisches Blut oder so einen Mist, sondern schlicht durch die Sprache, damit die Kultur. Ich gehe zu meiner Gruppe und warte ebenfalls stumm auf unsere Führerin. Im Tor, über dem «Arbeit macht frei» steht, stellen sich nacheinander alle Gruppen zu einem bizarren Photo auf. Nur wir schämen uns.
Die dreistündige Führung ist so angelegt, daß sich der Schrecken kontinuierlich steigert, von den Wohntrakten über die verschiedenen Hinrichtungsstätten, Folterkammern, Labors für die Menschenversuche bis in die Gaskammern hinein, an deren Wänden sich die Kratzer von den Fingernägeln abzeichnen. Wenn nach zwanzig Minuten die Gaskammer wieder geöffnet wurde, seien die Leichen häufig ineinander verkeilt gewesen, erklärt die Führerin im Kopfhörer, den jeder Besucher trägt – als hätten sich die Lebenden zum Schluß noch einmal umarmt, denke ich. Tatsächlich dürfte selbst im Gedränge nichts einsamer sein als der Todeskampf und hatten die Körper wohl in Schmerz, Panik und Trauer unkontrolliert in alle Richtungen ausgeschlagen. Aber auch das ist nur eine Vermutung, denn wer immer Auschwitz überlebte, hat das tiefste Schwarz nicht selbst geschaut. Die jüdischen Arbeiter, die die Kammer nach jeder Vergasung als erste betraten, wateten durch Blut, Kot und Urin. Sie zerrten die Leichen auseinander und legten sie auf den Rücken, um die Goldzähne zu entfernen, die das Deutsche Reich als sein Eigentum betrachtete. Die Münder zu öffnen war harte körperliche Arbeit, bedurfte Werkzeuge sogar, so fest waren viele Kiefer zusammengepreßt – als hätten die Sterbenden mit ihrer letzten Regung zu schweigen beschlossen. Daß nach Auschwitz kein Gedicht mehr geschrieben werden könne, ist so häufig mißverstanden, verlacht, abgetan worden; dabei hat Adorno selbst sich nach dem Krieg vehement für die avancierte Poesie eingesetzt. In der Gaskammer bekommt der Satz eine natürliche Evidenz, nicht als Bannstrahl, vielmehr als Ausdruck der unmittelbaren Empfindung – wie soll Zivilisation nach so etwas überhaupt noch weitergehen, was hat sie für einen Wert? Was soll der Mensch noch sagen, wo er solches Menschenwerk sieht? Es ist auch der eigene Kiefer, der sich zusammenpreßt. Und gerade als wir meinen, die Dimensionen des Lagers einigermaßen zu erfassen, werden wir mit dem Bus ein paar Kilometer weiter nach Birkenau gefahren, dessen Ausmaße schier unübersehbar sind. Himmler hatte Auschwitz zu einem Modell für so etwas wie eine Sklavenökonomie machen wollen, das Besucher beeindrucken sollte; es weckte zumindest den Anschein eines Arbeitslagers, von Ordnung und Funktionalität. In Birkenau hingegen war klar, daß man sich in einer Todesfabrik befand.
Die Wege der einzelnen Besuchergruppen kreuzen sich immer wieder, aber zu Wartezeiten vor den verschiedenen Gebäuden kommt es trotz des Andrangs so gut wie nie. Ziemlich routiniert fügt sich Auschwitz in die Reihe der europäischen Top-Besucherziele ein und bietet die obligatorischen Stellplätze für Selfies. Natürlich habe ich ständig den Eindruck des Unangemessenen, ohne daß mir einfällt, wie man die Massen anders durch das Lager schleusen könnte. Es gibt nun einmal keinen touristischen Umgang mit der industriellen Vernichtung von Menschenleben, der angemessen wäre. Gern möchte ich einmal aus der Gruppe ausscheren, möchte allein sein und den Kopfhörer ablegen, so hilfreich die Erklärungen unserer Führerin auch sind. Nur muß sich jeder halbwegs an die Ordnung halten, damit sie nicht zusammenbricht. Und man muß sich doch wünschen, daß Auschwitz von möglichst vielen Menschen besucht wird.
Am hinteren Ende des ehemaligen Vernichtungslagers Birkenau entdecke ich die israelischen Gruppen zu einer Versammlung vereint, mehrere hundert Jugendliche in weißen T-Shirts mit ihren Betreuern auf einer Freilichttreppe. Breitschultrige Wachleute, die wohl mitgeflogen sind, sorgen dafür, daß kein Außenstehender zu nah herantritt. Einzelne Jugendliche stellen sich vor einer wandgroßen Israelflagge auf, um Lieder zu singen oder Texte zu rezitieren. Am Ende steht ein gemeinsames Gebet.
Als die Jugendlichen Richtung Ausgang gehen, komme ich mit einigen ins Gespräch. Acht Tage dauere die Reise, die zu den wichtigsten Stätten der europäischen Judenvernichtung führt. Sie sei nicht obligatorisch, werde aber bezuschußt und von den meisten Israelis gegen Ende ihrer Schulzeit einmal absolviert.
«Und macht das etwas mit euch?» frage ich etwas ungeschickt.
«Natürlich macht das etwas mit uns», antwortet ein junges Mädchen, siebzehn oder achtzehn Jahre alt: «Vorher war der Holocaust nur eine Schullektüre wie andere. Ehrlich gesagt hat mich das nicht mehr interessiert als Algebra. Aber hier wird es für uns real.»
Die ersten drei, vier Tage sei es noch eine fast normale Klassenfahrt gewesen, da habe sie das alles gar nicht richtig kapiert. Aber dann habe es irgendwann Klick gemacht, und sie habe begriffen, wo ihre Wurzeln liegen, wie wenige ihrer Vorfahren überlebten und welche Rettung Israel ist.
«Ich begreife einfach, was es bedeutet, Jüdin zu sein, Israelin zu sein; das war mir vorher gar nicht richtig bewußt.»
Als die Jugendlichen ihrerseits fragen, was Auschwitz mit mir gemacht habe, erzähle ich von dem Aufkleber, auf dem nur das eine Wort steht: «deutsch». Es fällt ihnen schwer nachzuvollziehen, daß ich mich in dem Moment schuldig fühlte, oder vielleicht nicht schuldig, aber doch den Tätern zugehörig, nicht den Opfern. Ich versuche ihnen zu erklären, was für mich der Kniefall bedeutet, muß allerdings erst einmal referieren, wer Willy Brandt war. Die Geschichte zu tragen, von ihrer Last auf die Knie zu sinken, sei keine Frage der persönlichen Täterschaft – Brandt habe gegen Hitler gekämpft –, sondern der Verantwortung für den Ort, an dem man nun einmal lebt.
Auschwitz, wendet einer der Jugendlichen ein, Auschwitz verpflichte doch jeden Menschen, egal welchem Land er angehört. Erst recht wundert er sich, als ich erwähne, daß meine Eltern nicht einmal deutsch sind. In Auschwitz ist auf deutsch gemordet worden, antworte ich; alle Befehle, die an die Wände geschrieben wurden, und alle Dienstpläne, die in den Vitrinen ausgestellt sind, selbst die Gebrauchsanweisungen auf den Chemikalien, die vor den Gaskammern stehen, seien deutsch. Wer diese Sprache spricht, als Schriftsteller gar von ihr, mit ihr, dank ihr lebt, verstumme instinktiv, wenn er die Aushänge der damaligen Lagerleitung – «Ihr seid hier in einem deutschen Konzentrationslager» – liest. Und er begreife, warum keines der heutigen Hinweisschilder auf deutsch ist. Man werde als Deutscher in Auschwitz niemals ein unbeteiligter Besucher sein. In Gedanken füge ich hinzu, daß der Satz über die Gedichte, die nach Auschwitz nicht mehr geschrieben werden können, für diejenige Literatur noch einmal eine andere, eigene Bedeutung hat, die in der Tätersprache geschrieben ist. Bei Primo Levi las ich, daß es selbst für die Häftlinge existentiell gewesen sei, Deutsch zu sprechen, damit sie die Vorschriften, herausgebrüllten Befehle und sonderbaren Anordnungen auf Anhieb verstanden. «Es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, daß die sehr hohe Sterblichkeitsrate unter Griechen, Franzosen und Italienern in Konzentrationslagern auf deren Mangel an Sprachkenntnissen zurückzuführen ist», schreibt Levi. «So war es zum Beispiel nicht leicht zu erraten, daß der Hagel von Fausthieben und Tritten, der einen plötzlich zu Boden streckte, auf die Tatsache zurückzuführen war, daß man vier oder sechs Knöpfe an der Jacke hatte statt fünf, oder daß man mitten im Winter mit der Mütze auf dem Kopf im Bett erwischt wurde.»
Die Jugendlichen fragen, warum sie keine einzige deutsche Schulklasse angetroffen hätten. Die Jahreszeit, die Entfernung, irgendeinen Grund werde es geben, antworte ich. Wenn Auschwitz selbst für sie, die israelischen Jugendlichen, nur eine Schullektüre war, könnten sie sich vorstellen, wie das in deutschen Klassen sei, da heute so viele Jugendliche aus anderen Ländern stammten. Das mache es natürlich noch leichter, Auschwitz nicht als Teil der eigenen Geschichte zu sehen.
Ich denke zurück an meinen Besuch in Schwerin, die zuversichtlichen Flüchtlinge und die aufgebrachten Bürger: Wenn etwas spezifisch deutsch wäre an der Leitkultur, die alle Jahre wieder eingefordert wird, wären es nicht Menschenrechte, Gleichberechtigung, Säkularismus und so weiter, denn diese Werte sind alle europäisch, wenn nicht universal. Es wäre das Bewußtsein seiner Schuld, das Deutschland nach und nach gelernt und auch rituell eingeübt hat – aber just die eine Errungenschaft, die nicht Frankreich oder die Vereinigten Staaten, sondern die Bundesrepublik für sich reklamieren darf neben guten Autos und Mülltrennung, möchte das nationale Denken abschaffen. Umgekehrt gilt allerdings auch: Wer sich gegen ein völkisches Verständnis der Nation wendet, kann die historische Verantwortung nicht ethnisch engführen. Wenn sie ankommen möchten, werden die Syrer oder zumindest ihre Kinder, die im Deutschen bereits den Konjunktiv beherrschen, auch die Last tragen müssen, Deutsche zu sein. Spätestens in Auschwitz werden sie die Last spüren, sobald sie aus dem Besucherzentrum treten.
Vierter Tag: Krakau
Im Krakauer Museum für Moderne Kunst, das auf dem Gelände der ehemaligen Emaillefabrik von Oskar Schindler steht, ist das Photo einer sympathischen, auch sehr schönen jungen Besucherin ausgestellt, die am Zaun des ehemaligen Vernichtungslagers Birkenau frohgemut lacht. In ihrem Gesicht zeichnet sich der Schatten des Stacheldrahtes ab.
Das Photo rief einen lokalen Skandal hervor; die jüdische Gemeinde forderte, es abzuhängen. Dabei zeigt es eine Situation, wie man sie jeden Tag in Birkenau beobachten kann: Besucher, die vor dem Zaun, den Wachtürmen oder dem Eisenbahnwaggon in die Kamera lächeln, wenn sie sich nicht gleich selbst photographieren. Ist es ein Triumph über die Barbarei oder Verhöhnung ihrer Opfer, wenn heute in Birkenau eine Frau ihre Schönheit beschwingt und selbstbewußt zeigt? Wie zur Rechtfertigung hebt der Katalog hervor, daß die Abgebildete eine Jüdin sei – aber hängt es von der Zugehörigkeit ab, ob das Lachen am Zaun des Konzentrationslagers statthaft ist? Im Katalog sind auch Bilder eines Videos von 1999 abgedruckt, in dem Menschen, alte und junge, nackt in der Gaskammer tanzen und herumtollen. Seinerzeit war der Protest nicht nur lokal. Kaum zu ertragen, und doch oder eben deshalb prägen sich mir die Bilder ein, wie es Videokunst selten gelingt.
Aus dem Schindler-Museum, das dreidimensional die Einfühlung in die Zwangsarbeit herzustellen versucht, stürze ich nach zwanzig Minuten hinaus. In einem beigegrau ausgefärbten, als Mine ausstaffierten Raum laufen die Besucher sogar über originale Kiesel. Wahrscheinlich ziehen manche Besucher die Schuhe aus, um die Fron nachzuempfinden. Vor dem Museumsgelände werben Taxifahrer mit Plakaten für einen Ausflug: «Auschwitz Salt Mine Cheap!»
Wie schön Krakau ist, steht in jedem Reiseführer und läßt sich eindrücklicher bei Adam Zagajewski lesen, der unter den vielen Dichtern dieser Stadt der berühmteste ist. Gänzlich unbeschadet hat die Kulisse aus Renaissance, Barock, Jugendstil und Neogotik den Krieg und die kommunistische Abrißbirne überstanden. Und doch ist es nur eine Kulisse, scheint mir, je länger ich durch die Altstadt schlendere, eine Kulisse, in die die gleichen coffee shops, quality hamburger und Filialen der einschlägigen Modeketten wie in Sevilla, Pisa oder Avignon eingefügt sind, die verkehrsberuhigten Zonen und getrennten Müllcontainer, eine identische Auswahl von Restaurants mit eingesprenkeltem local food, dieselben Fahrradverleihstationen und rollenden Bretter mit Festhaltestange, auf denen helmbewehrte Touristen durch die Gassen rollen, dieselben Fußballtrikots, Real, Barcelona, Bayern, Manchester, die Kinder aus ganz Europa tragen. Selbst die Popsongs, Opernarien und Zaubertricks der fahrenden Künstler sind überall in Europa gleich. Ein reguläres Stadtleben mit Geschäften, deren Auslagen sich an Einheimische richten, mit Handwerkern, Geschäftsleuten oder eilenden Passanten findet man in den Freizeitparks hingegen nicht, in die sich viele europäische Innenstädte verwandelt haben, statt dessen carfour express mit exakt der gleichen Wegzehrung wie in jedem spanischen Badeort sowie die notorischen jungen Männer aus England, die sich barbrüstig betrinken – seltsam, daß sie gleichzeitig auch in Sevilla, Pisa oder Avignon sein können.
Aus einer unscheinbaren Kirche höre ich einen weiblichen Chor und öffne die Tür: Es sind Nonnen, gar nicht so alt wie sonst in Europa, im weißen Habit verteilt auf die Bänke, jede einzeln und doch gemeinsam. Von hinten sehen sie alle gleich aus – und tatsächlich, ihre Kleidung ist schließlich auch eine Art Uniform. Wahrscheinlich kommt mir die Szenerie, die ich nicht erwartet hatte – obwohl sie, wenn irgendwo in der Welt, dann in Polen zu erwarten war –, vielleicht kommt sie mir deshalb so eigen vor, weil der klösterliche Alltag der größtmögliche Gegensatz zum polyglotten Vergnügen ist, das ringsum herrscht. Für einen Augenblick erscheint mir der Tagesablauf der Nonnen individueller als der Lebensstil in jedem organic cafe.
Wie überall, wo keine Juden überlebt haben, ist in Krakau das jüdische Viertel besonders angesagt. Sechzig Kilometer entfernt von Auschwitz koscher zu essen ist vielleicht auch eine Art Einfühlung, nur mit der Illusion eines Happy-End. Neben den hebräischen Schriftzeichen finden sich hier auch die meisten Signets für vegane Küche und freies W-Lan: feel good, wie inzwischen selbst die Zigarettenwerbung den Lebensstil anpreist, der schadstoffarm, polyglott und gewissensberuhigt ist. Natürlich hat man in diesem Easy Jet, der die Städte so gleich macht, wie es weltweit bereits die Strandressorts sind, nichts gegen Schwule, gegen Behinderte, gegen Schwarze, gegen die Kopftücher der arabischen Touristinnen, deren Männer die gleichen Bermudas tragen wie alle Touristen auf der Welt, verständigt sich auf englisch, weist die Wickelräume für beide Geschlechter aus und trinkt nach dem Besuch des Schindler-Museums erst mal einen Smoothie, während man gleichzeitig durch die weite Welt des Web surft. Kein Wunder, daß Europa manchen Menschen die Heimat fremdgemacht hat.
Aber Krakau hat enorm von Europa profitiert, hält der Dichter Adam Zagajewski dagegen, besonders vom Tourismus und den Fördermitteln aus Brüssel. Früher sei die Stadt schwarz gewesen vom Giftruß der Stahlwerke, schwarz von der Kohle, die sich mit jedem Herbstbeginn vor den Häusern türmte und mit jedem Regen auf die Bürgersteige ergoß, schwarz auch die Weichsel vor Schmutz. Und nicht nur das Straßenbild war trist. Mit dem Kommunismus erstarrte die Stadt «in der Grimasse der Langeweile», wie es in einem von Zagajewskis Büchern heißt, «in katatonischer Reglosigkeit eines Psychiatriepatienten, der im blaugestreiften Pyjama geduldig das Weltende erwartet».
Adam Zagajewski war der Protestpoet der Jahre nach 1968, kämpfte gegen die Diktatur und hatte Veröffentlichungsverbot, siedelte nach Paris und später in die Vereinigten Staaten über. In seinen Gedichten, Essays und Tagebüchern legte er so etwas wie ein europäisches Bewußtsein frei, ein Reich des Geistes, das sorglos und vielsprachig nationale Grenzen ignoriert und frei von ideologischen Rücksichtnahmen auf die immer schon blutige Vergangenheit blickt. Heute, über siebzigjährig und in viele Sprachen übersetzt, möchte er sein Krakau kein weiteres Mal mehr verlassen, auch wenn er mit Grauen auf die neue, nationalreligiöse Regierung blickt, die an das kommunistische Regime erinnere, indem sie ebenfalls einen ideologischen Schleier über die wirklichen Probleme der Gesellschaft ausbreitet: Nation, Kirche, Familie, Tradition. Alle Kultur wolle sie auf den Patriotismus einschwören, nur noch patriotische Theaterstücke, patriotische Filme, patriotische Museen finanzieren. Heraus komme natürlich nur unsäglicher Kitsch.
«Gegen den Kommunismus zu sein, das war noch etwas», seufzt er beim Mittagessen in einem der alten, jetzt vornehmen Literatencafés: «Das war nicht nur riskant, das war auch intellektuell lohnend. Da mußte man sich mit einem ganzen Gebäude aus Gedanken auseinandersetzen.»
Die neue Rechte hingegen biete lediglich Fetzen eines Weltbilds. Die Nation genüge doch nicht als politisches Programm, schließlich sei sie überall eine andere, so daß die Polen, die nach Großbritannien ausgewandert sind, Opfer der gleichen Rhetorik würden, mit der in Polen Stimmung gegen Einwanderer gemacht werde – mit der lächerlichen Note freilich, daß es in Polen kaum Einwanderer gebe.
«Und dann noch ein katholischer Nationalismus – das ist doch ein Widerspruch in sich. In diesem Denken wird ja sogar der Papst selbst zum Häretiker!»
Die Renationalisierung habe viele Ursachen, meint Zagajewski, da gebe es die ärmere Bevölkerung, die an dem wachsenden Reichtum der Mittel- und Oberschicht nicht partizipiere, da gebe es die Sehnsucht nach Gemeinschaft, die durch die Atomisierung des liberalen Systems aufgekommen sei. Zugleich spielten sehr alte Konflikte eine Rolle, Konflikte noch des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts, als die Landadligen den Sarmatenrock trugen, um sich gegen die französische Mode aufzulehnen. Heute gehe es nicht mehr um den Schnitt des Mantels, niemand in Polen wolle sich orientalisch kleiden, am wenigsten die Nationalisten, die vor dem Orient geradezu obsessiv warnten; aber wieder greife die Furcht um sich, durch die Modernisierung und den Einfluß des Westens die Substanz des «Polentums» zu verlieren.
«Und was soll diese Substanz sein?»
«Tja», seufzt Zagajewski: «Ein volkstümlicher Katholizismus in Verbindung mit Piroggen und Barszcz, sehr viel mehr eigentlich nicht.»
Gewundert habe ich mich schon oft, indes nie darüber nachgedacht, warum so viele Polen den typisch persischen Namen Dariusch tragen. Erst bei der Vorbereitung der Reise ging mir auf, daß mit den Sarmaten, auf die sich die polnischen Romantiker ständig bezogen, die iranische Volksgruppe gemeint ist, die lange vor den Griechen die Krim besiedelte und von dort nach Norden gewandert sein soll. In Wirklichkeit waren es vor allem turksprachige Tataren und Mongolen, die sich vom Schwarzen Meer aus im ganzen östlichen Europa ausbreiteten, und das erst seit dem zwölften oder dreizehnten Jahrhundert. Während sich die Moskowiter vor den Mongolen in den Wäldern des Nordens versteckten, öffneten sich die Polen den orientalischen Einflüssen. So könnte die Aufteilung der Gesellschaft in Herby oder Klans ebenso nomadische Ursprünge haben, wie sich im Verhältnis zwischen polnischen Herrschern und Kolonien ausländischer Kaufleute die Koexistenz von Iraniern und Griechen am Schwarzen Meer widerspiegelt. Traditionell wurde Sarmatien als ein mythischer Begriff mit der polnisch-litauischen Rzeczpospolita und dem Lebensstil des altpolnischen Adels in Verbindung gebracht, um den grundlegenden Unterschied zur westlichen Kultur zu erklären – daher die Röcke der Männer auf alten Gemälden, der orientalische Prunk, die reichgeschmückten Waffen, die buschigen Haarschöpfe und Schnurrbärte, daher die persischen Namen. Das Sarmatentum wurde dabei im Sinne einer Überlegenheit gemeint, nicht der Minderwertigkeit. Für die aufgeklärten westlichen Herrscher und Philosophen hingegen stand Sarmatien für Rückständigkeit, Anarchie, Intrigen und Irrationalität.
Es war insbesondere der polnische Nationaldichter Adam Mickiewicz, der im neunzehnten Jahrhundert den Sarmatenkult wiederbelebte. Wann immer in den folgenden Jahrzehnten die Germanisierung durch das Habsburgerreich und den deutschen Bildungskanon überhandzunehmen drohte, wurde in der Literatur die alte polnische Adelskultur glorifiziert und drängten die Sarmatenkleider die Pariser und Wiener Mode zurück. Ob sich diejenigen, die Polen heute zu seinen Wurzeln zurückführen wollen, noch daran erinnern, daß ihre Vorfahren diese Wurzeln in Iran gesucht haben, wenn es, zugegeben, auch ein mythisches Land war? Daß ihre Könige von einer Massenversammlung von Aristokraten gewählt wurden, gilt vielen Polen heute als Vorstufe des parlamentarischen Systems und Ausweis der westlichen Identität ihres Landes, das sich immer schon vom Despotismus der Russen unterschieden habe. Tatsächlich dürfte der Brauch, der mit dem Sejm Verfassungswirklichkeit geworden ist, im späten sechzehnten Jahrhundert nach dem Muster des Quriltai entstanden sein, der Versammlung der tatarischen Edlen und Stammesoberhäupter, die einen neuen Khan wählten. Noch der letzte von Wien ernannte Bürgermeister von Lemberg, der den schönen deutschen Namen Franz Kröbl trug, stellte seine polnische Identität heraus, indem er sich im orientalischen Gewand begraben ließ. Das käme Jarosław Kaczyński, dem Führer der regierenden PiS, wohl nicht in den Sinn.
«Nein, niemand mehr erinnert sich an die Sarmaten», bestätigt Adam Zagajewski und rührt im Kaffee, der … na, selbst ein Jarosław Kaczyński wird wissen, wo der Kaffee herkommt.
Nach dem Wahlsieg der Nationalreligiösen verfaßte Zagajewski nach vielen Jahren noch einmal ein Protestgedicht, satirisch, wütend, ätzend, schlug der neuen Regierung vor, einige Regisseure zu erschießen und wieder Isolierungslager zu errichten, «aber dezente, um die Vereinten Nationen nicht zu reizen». Da war er für einen Moment wieder ein Aktivist, zog den Zorn der Nationalisten auf sich, wurde für die pro-europäische Bewegung zum Helden. Doch seitdem hält Zagajewski sich mit politischen Äußerungen zurück. Man könne nicht ständig die Engstirnigkeit, die Borniertheit, die Angst bekämpfen, sagt er, das mache auf Dauer blöd. Vielmehr müsse man zeigen – in der Gesellschaft, in der Kultur, in Büchern, im alltäglichen Miteinander –, daß sich die Offenheit lohnt, daß sie Spaß macht, daß sie schön ist, daß sie einen weiterbringt als der Rückzug. Mit Langeweile rette man Europa nicht.
Abends führt mich Maria Anna Potocka, die sehr temperamentvolle und scharf denkende Direktorin des Museums für Moderne Kunst, in ein echt polnisches Restaurant, wo sie sich darüber amüsiert, daß für meinen iranischen Geschmack alles Polnische ziemlich deutsch schmeckt, Eisbein, Rotkohl und so weiter. Und die berühmten Piroggen hält ein Ignorant wie ich auch nur für Maultaschen.
Wir sprechen lange über die Frage, was ein angemessener musealer Umgang mit dem Holocaust wäre, und streiten uns über Berlins Jüdisches Museum, dessen «Holocaust-Turm», indem er die Beklemmung der Opfer simuliere, in meinen Augen lächerlich, ja geradezu unanständig ist. Für Anna Maria Potocka, die mich für ziemlich dogmatisch hält, bleibt die Schoah die interessanteste Aufgabe für die Kunst. Und Auschwitz selbst? frage ich. Dort könne man nicht viel anders machen, antwortet sie, dafür seien die Besucher zu zahlreich, die Organisation zu komplex, wenn man allein an die vielen älteren Menschen denke, die nicht mit den regulären Gruppen gehen können. «Die Nazis standen vor der Herausforderung, im Konzentrationslager anderthalb Millionen Juden zu ermorden», fügt sie mit dem herausfordernden Ton ihrer Ausstellung an: «Aber es ist auch eine Herausforderung, jedes Jahr anderthalb Millionen Touristen durch Auschwitz zu führen.»
Ich nehme den Gedanken Adam Zagajewskis über die Gefahr der Langeweile auf und frage, ob Krakau früher nicht aufregender war.
«Ach was, in der Altstadt sind wir Krakauer sowieso nur einmal im Jahr.»
Fünfter Tag: Von Krakau nach Warschau
Nach Warschau nehmen wir den langen Weg über die Dörfer, die so gar nicht dem Bild herb-herzlicher Ärmlichkeit entsprechen, das ich mir als Stasiuk-Leser von Polen gemacht habe. Nicht nur entlang der Weichsel, die viele Ausflügler anzieht, sind die Straßen hervorragend ausgebaut, die Häuser frisch gestrichen, so gut wie alle Haustüren neu, die Fensterrahmen aus Kunststoff, die Rasen akkurat gemäht und mit Hollywoodschaukeln, schmucken Gipsfiguren, manche sogar mit deutschen Gartenzwergen bestückt, fast alle Autos aktuelles westliches Fabrikat, die Tankstellen blitzblank und supermodern. Und die Grillgeräte erst, die an den Tankstellen verkauft werden! Keine Billigware, sondern durch die Bank hochwertiges Design, die Preise hundert Euro aufwärts. Fleisch ißt man hier also auch oft und gern. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber blühender als weite Teile der ehemaligen DDR sehen Polens Landschaften allemal aus. Die blauen Schilder, die auf eine Förderung der Europäischen Union verweisen, gehören zu den Landschaften dazu.
«Die Polen wissen genau, was sie an Europa haben», sagt der Publizist Igor Janka, den ich am Abend in Warschau treffe. Ich habe ihn angeschrieben, weil er eine wohlwollende, fast huldigende Biographie über den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán verfaßt hat, die auch ins Deutsche übersetzt worden ist. Ich nahm an, er könne mir am besten erklären, was so viele Polen an der Europäischen Union stört.
«Stört?» fragt Janka in hervorragendem Englisch: «Wenn es hier ein Referendum gäbe, würden mindestens 70 Prozent für den Verbleib in der Union stimmen. Mindestens.»
Auch die PiS sei keineswegs gegen Europa; sie sei vor allem gegen Rußland, fährt Janka fort – anders als die FPÖ, die AfD oder Le Pen, die mit Putin sympathisierten, anders selbst als Victor Orbán, der Europa ebenfalls nach Osten rücken wolle. Die Polen hätten die «Polenaktion» nicht vergessen, die eines der blutigsten Kapitel des Stalinistischen Terrors war: Etwa einhunderttausend Polen wurden allein in den Jahren 1937 und 1938 unter dem Vorwurf der Spionage hingerichtet – bei einer Gesamtzahl von sechshunderttausend sowjetischen Polen.
«Ist das der Grund, warum sich Polens Rechtspopulisten weder nach Westen noch nach Osten orientieren?» frage ich.
Was die PiS vertritt, sei nicht rechtspopulistisch, stört sich Janka an meiner Wortwahl. Es sei konservativ und im Unterschied zu FPÖ, AfD oder Le Pen tatsächlich religiös: gegen Abtreibung und kulturelle Diversität, für die traditionelle Ehe und ein frommes Christentum. Er persönlich sei gegen die Todesstrafe, aber wenn die Mehrheit nun einmal die Todesstrafe wieder einführen wolle, bringe es nichts, das Thema zu tabuisieren. Polen bestehe nicht nur aus weltläufigen Dichtern wie Adam Zagajewski; zumal auf dem Land würden die wenigsten Menschen Fremde überhaupt kennen. Also schätzten sie den Wohlstand, den Europa gebracht hat, aber sähen im Alltag nicht die positiven Aspekte der Vielfalt, statt dessen die Nachrichten, in denen Vielfalt nur Konflikte erzeugt. Das sei provinziell und rückwärtsgewandt, ja, aber ohne dieses Beharren auf seiner unverwechselbaren Identität hätte Polen nicht die deutsche Besatzung überlebt, nicht als Staat und nicht einmal als Sprache und Kultur.
«Wir sind nicht gegen Europa», wiederholt Janka: «Wir reagieren nur allergisch, wenn jemand uns bevormunden will, wenn jemand herablassend zu uns spricht, erst recht, wenn es jemand Deutsches ist. Wir haben diese Sprache im Ohr, selbst wir Jüngeren aus den Filmen. Und dann spricht Martin Schulz! Ganz ehrlich, ich ertrage das nicht, wenn Martin Schulz über Polen herzieht, in diesem aggressiven, belehrenden Ton, mit diesem strengen Gesicht und, achten Sie mal darauf, mit diesen vorgeschobenen Lippen.»
Ich schätze Martin Schulz, den Präsidenten des Europäischen Parlaments, gerade das Kämpferische, die Leidenschaft, mit der er über Europa spricht. Aber plötzlich stelle ich mir vor, ich wäre Pole und verstünde kein Deutsch, wenn er sich aufregt.
Und die Gartenzwerge? Andrzej Stasiuk ist gerade im Ausland, deshalb kann ich ihn nicht in seinem Dorf besuchen und trage nur seine Bücher bei mir. «Hier lebte man immer im Schatten anderer», stoße ich im Hotel auf eine Stelle, die komprimiert sowohl die Gartenzwerge als auch Polens Angst vor Rußland erklärt: «Die Polen lebten im Schatten der Deutschen und Russen, die Slowaken im Schatten der Tschechen und Ungarn, die Ungarn im Schatten der Österreicher und Türken, die Ukrainer im Schatten der Polen und Russen und so weiter und so fort bis zum Wahnsinn des Balkans, bis hin zu Serbien, das bisweilen glaubt, alle Nationen ringsum seien Verräter, die ihr Serbentum leugnen. Aber was reden wir vom Balkan. Mein Land ist kein bißchen schlechter. Es wäre gern mindestens so groß und stark wie Amerika, damit sich endlich Rußland vor ihm zu fürchten beginnt. Leider ist es das nicht. Statt dessen fährt mein Land nach Deutschland, um Geld zu verdienen, obwohl es die Deutschen waren, die mein Land in Schutt und Asche legten und einen bedeutenden Teil seiner Bevölkerung ermordeten. Dennoch fährt mein Land zur Arbeit nach Deutschland. Zu allem Überfluß bringt es von dort nicht nur Geld, sondern auch Anregungen mit, wie ein besseres Leben aussehen könnte. Von dort kommt die Idee, das Gras im Garten müsse immer gemäht werden und auf dem gemähten Rasen müßten Plastikzwerge, gipserne Hunde und Miniaturmühlen stehen. In diesem Bereich ist es sogar zu einer eigentümlichen Symbiose gekommen, denn wir sind im Moment der größte Produzent von Gartenzwergen und exportieren diese auch nach Deutschland.» Das klingt wie Galgenhumor, dabei ist das Erstaunliche – man spricht immer über die unglaublichen Verbrechen im zwanzigsten Jahrhundert, aber nicht über die ebenso unglaubliche Selbstbehauptung der Völker – das Erstaunliche ist gerade, daß Polen als Nation, als Kultur, als Sprachgemeinschaft immer noch existiert. Denn nach dem Hitler-Stalin-Pakt und der Besatzung gingen die Sowjets gegen alle vor, die Polens Elite bildeten, um die Gesellschaft zu «enthaupten». Wer außer den Offizieren dazu gehörte, machte die politische Geheimpolizei, der NKWD, unter anderem am polnischen Who’s who fest. Das gleiche geschah im deutsch besetzten Teil, wo Hitler aus den Polen eine formbare Masse machen wollte, die versklavt und nicht regiert werden sollte: «Was wir jetzt an Führerschicht in Polen haben, ist zu liquidieren.» Zwischen September 1939 und Juni 1941 ermordeten die Verbündeten Sowjetunion und Deutschland weitere zweihunderttausend polnische Bürger, größtenteils Akademiker, Offiziere, Politiker, Literaten, Musiker, Künstler. Und dann kam erst der eigentliche Krieg, die Zerstörung der Städte, der Holocaust, die Vertreibung. «Die Russen verachten wir dafür, daß sie unsere eigenen Charakterzüge zu monströsen, unmenschlichen Ausmaßen weiterentwickelt haben. Die Deutschen dagegen dafür, weil sie keine von unseren, das heißt, keine menschlichen Eigenschaften besitzen. Man kann die These riskieren, daß die Russen für uns ein bißchen wie Tiere oder Monster sind, während die Deutschen uns an Maschinen und Roboter erinnern. Dies beschreibt verkürzt und vereinfacht die komplizierte psychologische Situation der Nachfahren der Sarmaten im heutigen Europa.»
Sechster Tag: Warschau
Im Zentrum von Warschau, am größten Boulevard, steht auf einer Stele die Anweisung, die Heinrich Himmler nach dem Ausbruch des Aufstands 1944 gab: «Warschau ist dem Erdboden gleichzumachen, um Europa zu zeigen, was es bedeutet, einen Aufstand gegen die Deutschen zu unternehmen.» Systematisch und vollständig zerstörte die Wehrmacht Viertel für Viertel und folgte auch dem Befehl Himmlers, die Bewohner ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht zu erschießen. Allein im August und September 1944 wurden in Warschau hundertfünfzigtausend Zivilisten umgebracht. Insgesamt kam etwa die Hälfte der Vorkriegsbevölkerung von rund 1,3 Millionen im Krieg um. Daß die Altstadt wieder aufgebaut wurde, obwohl so gut wie kein Haus mehr stand, war nichts anderes als ein Akt der Selbstbehauptung, ja, des Trotzes, schließlich des Triumphes. In Wirklichkeit ist keines der Häuser alt. Um so mehr preist jeder Reiseführer sie an. Auf den übrigen Stelen sind Photos von getöteten Aufständischen zu sehen.
Noch nie bin ich durch eine Stadt mit so vielen Denkmälern gelaufen. Nur zweihundert Meter neben den Märtyrern des Kriegs zeigt eine andere Freilichtausstellung das Warschau der fünfziger und sechziger Jahre, die modernen Gebäude, das neue Lebensgefühl. Fünfzig Meter weiter – alles auf demselben, dem zentralen Boulevard – das Standbild eines Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich folge der Straße und lese auf einem gewöhnlichen Wegweiser, daß sechshundert Meter rechts das Monument des Warschauer Aufstandes steht, dreihundert Meter links das Monument der Helden im Ghetto und fünfhundert Meter weiter geradeaus das Monument der im Osten Gefallenen und Ermordeten. Ansonsten ist nur der Weg zur Nationalbibliothek und zur Botschaft von China angezeigt.