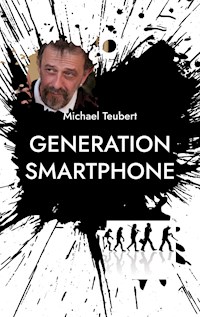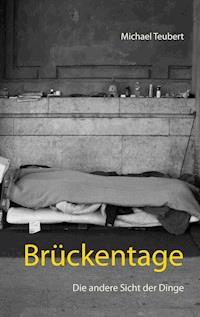Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Das siebte Buch des Autors Michael Teubert ist gleichzeitig sein erster Roman. Bisher hatte er sich immer den sozialkritischen Bereichen gewidmet. In der kanadischen Wildnis treibt sich ein gnadenloser Mörder umher. Er ist sehr schwer zu entdecken, weil er nebenbei ein gut getarntes und normales Leben führt. Erst als die Freunde ihm eine Falle stellen und dabei Jenny der Köder ist, können sie ihn endlich fassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 99
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich schulde mir selber wohl die größte Entschuldigung, da mich das Leben hat Dinge ertragen lassen, die ich einfach nicht verdient habe – und wenn die Schmerzen unerträglich werden … dann beginnt man zu überleben.
Michael Teubert
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
1.
„Also, wir sehen uns in vier 'Wochen,“ hatte er noch gesagt.
Er machte gar nicht den Eindruck eines schwachen Mannes. Hoch und groß gewachsen war er. Man hätte sagen können: „Ein Mann wie aus dem Bilderbuch“. Mit seinen breiten Schultern und diesem passenden Gesichtsausdruck hatte er alles, was einen echten Helden ausmachte. Dazu die sehr leicht gelockten, blonden Haare – er hätte aus diesen alten Filmen stammen können.
„Wenn Du wieder da bist, dann melde Dich einfach bei mir“, sagte Vincent, sein alter Freund und Bekannter. Ein wenig Sorgen machte er sich … mitten in die Wildnis und dann auch noch alleine. Es könnte ohne Weiteres etwas passieren. Dann wäre er alleine und nur auf sich gestellt. Aber er hatte es ja versucht. Es war einfach so an ihm abgeprallt. Vincent kannte ihn lange genug um zu wissen, dass alle seine Bedenken von ihm einfach weggewischt werden würden.
Sie hatten eine Menge zusammen erlebt. Manchmal war es gut gewesen und einige Male auch gefährlich.
„Weisst Du noch, als wir mit dem Kanu unterwegs waren? Wenn Du nicht dagewesen wärst, dann hätte wohl mein letztes Stündlein geschlagen.“
„Das weiss ich noch sehr genau,“ sagte Bill. „Aber es ist jetzt nicht die Zeit, um an diese Sachen zu denken.
Ich hätte es für jeden Anderen auch getan... na ja … einige Ausnahmen gäbe es da schon.“
Sie lachten beide und nahmen sich gegenseitig in den Arm... so, wie Freunde das eben tun.
„Pass auf Dich auf. Ich freue mich, wenn Du wieder hier bist.“
Bill nahm seinen Rucksack und die wenigen Dinge, die er zum Überleben brauchen würde in der Wildnis.
Darunter befand sich ein Messer und einige Werkzeuge.
Bis Fort Providence würde er das Auto benutzen können. Der Yellowknife – Highway war eigentlich bei jedem Wetter frei und dorthin konnte man immer recht problemlos.
Dort würde er es abstellen und zu Fuß weitergehen...
Fort Providence war als Ausrichter des jährlichen
„Mackenzie Daze-Festes“ bekannt. Dieses fand jedes Jahr im August statt. Jetzt war es ja bereits September und man konnte sich seiner Ruhe recht sicher sein. „Indian Summer“ eben... er freute sich auf die fantastischen Ausblicke, das bunt gefärbte Laub der Bäume und die Zeit für sich ganz alleine.
„Die paar Wölfe und Bären werde ich mir schon vom Leib halten“, sagte er.
„Außerdem ist das Wetter noch gut und die werden keinen Hunger auf mich haben.“
Im äußersten Notfall würde er das Gewehr benutzen.
Es war eine recht seltene „Browning“ mit zwei Backbored-Läufen für die optimale Ausnutzung und Streuwirkung des Schrots.
Er hatte eine Menge Geld dafür bezahlt und der Waffenhändler hatte sie extra bestellen müssen.
„Qualität kostet halt etwas mehr“, hatte er sich damals gesagt und für diese Bestellung die bewundernden Blicke des Händlers erhalten.
Ein gutes Zelt und einen echt wärmenden Schlafsack hatte er natürlich auch. Beides war sehr leicht und zu Fuß gut zu transportieren.
Dort oben galt das alte kanadische Sprichwort: „Die Wildnis beginnt direkt am Straßenrand“ und so war es wohl auch.
Eine grandiose Weite mit unendlicher Tundra, borealen Wäldern und zahllosen Seen. Die alten Goldsucher und Trapper hatten damals schon die dramatischen und wilden Landschaften dort geliebt.
Es konnte einem durchaus passieren, dass man oft wochenlang keine Menschenseele zu Gesicht bekäme und nur allein mit all den freilebenden Wildtieren, wie Bären, Wölfen und Raubvögeln ganz alleine war.
Das hatte er sich immer gewünscht.
Abends würde er ein Feuer machen und sich sein Abendessen aus einem dieser wunderbaren Seen selber fangen.
Die Lachse dort konnten ungefähr 1,50 m lang werden und schmeckten vorzüglich.
Das wussten die Bären allerdings auch. Sie fingen sich die Fische vorzugsweise an Stellen, die für sie leicht zugänglich waren.
Die beiden Männer verabschiedeten sich und bald schon war Bill unterwegs in Richtung des Nordwest-Territoriums.
2.
Tom McKenzie hatte endlich Urlaub. In seinem Job in der Großstadtwüste von New York war er es gewohnt, auch nachts gerufen zu werden.
Da sah er dann all diese Dinge, von denen man ja im Normalfall immer nur im Fernsehen hörte in natura.
„Die Menschheit ist eine verschwindend kleine und vollkommen unbedeutende Lachnummer im Universum“, war einer seiner beliebten Sprüche.
In seinem Job als Polizist hatte er natürlich schon so Einiges gesehen.
Männer, die ihre Frauen umbrachten und zerstückelten, Wasserleichen, eiskalte Mörder, Hochhausspringer und Heroinsüchtige, die sich auf den Straßen der Stadt prostituierten, nur um an das Geld für den nächsten und überlebenswichtigen Schuss zu kommen. Von diesen ganzen Schlägereien, Überfällen und Diebstählen der Kleinkriminellen einmal ganz abgesehen.
Seiner Frau und erst Recht seinen Kindern hatte er nur in den seltensten Fällen davon erzählt.
Liza hätte sich nur Sorgen gemacht und ihn inständig darum gebeten, doch endlich mit diesem Job Schluss zu machen.
Was hätte er sonst tun sollen? In dieser 8,3 Millionen-Stadt war es nicht leicht, einen wirklich guten Job zu finden.
Er hätte natürlich in einem der zahlreichen Cafes oder Restaurants ohne jegliche Sicherheit kellnern können, aber das war es nicht, was er wirklich wollte.
Außerdem war er, seitdem er denken konnte, bei der Polizei und hatte nichts anderes gelernt.
Dazu kam ja, dass man es als Schwarzer immer noch sehr schwer hatte. Die Zeit der Vorurteile war eben noch nicht vorbei.
Er hatte lange für diesen Urlaub gespart und so einige harte Diskussionen mit der Familie ausgefochten.
Jetzt war die Zeit gekommen und nichts und niemand hatte ihn von seinem Vorhaben abbringen können.
Auch Liza nicht.
Er liebte sie natürlich über alles in dieser Welt, aber ein Mann muss eben tun, was er tun muss. Schlussendlich hatte sie dafür Verständnis gezeigt.
Er hatte in den letzten Wochen ein Vermögen für die Ausrüstung ausgegeben. Alleine der Schlafsack hatte fast 400 Dollar gekostet und all die Kleinigkeiten, die man so brauchte, summierten sich in einer fast schon schwindelerregenden Höhe.
Knappe 5.300 Kilometer lagen jetzt vor ihm und eine Autofahrt von 52 Stunden. Es war ihm egal.
Er würde sicher eine Menge zu erzählen haben, wenn er wiederkäme und seine Bekannten und Freunde platzten vor Neid.
Aber deshalb machte er es ja nicht.
Es war tatsächlich das erste Mal, dass er ohne Frau und Kinder in den Urlaub fuhr. Einmal waren sie auf Hawaii in einem guten Hotel gewesen – so, wie es eben die meisten Amerikaner machten.
Es hatte regelmäßig gutes Essen gegeben und einen Pool, von dem die Kinder kaum wegzubekommen waren, wenn es wieder Zeit wurde.
Er würde unterwegs in einem der Motels übernachten. Davon gab es ja Einige auf dem Weg nach Fort Providence.
Je unbelebter die Gegend wurde, umso mehr dachte er daran, wie sich die ersten Auswanderer wohl gefühlt haben mussten.
Damals hatte es ja noch keine Fortbewegungsmittel, wie heute, gegeben.
Man war eben zu Fuß unterwegs oder hatte im besten Falle ein Pferd.
Die etwas besser Bemittelten besaßen sogar eine Kutsche, in der sie ihr Hab und Gut verstaut hatten.
In jedem Fall blieb es gefährlich, sich in diese Wildnis zu wagen. Die wilden Tiere und natürlich die Indianer, die vorher nur in den seltensten Fällen je einen Fremden gesehen hatten.
Heute hatte man ja diese Bevölkerungsgruppe so gut wie ausgelöscht. Die wenigen Restbestände lebten in Reservaten, waren sehr oft alkoholabhängig und ernährten sich ansonsten durch den Tourismus, in dem sie zum Beispiel die alten Tänze der Vorfahren ausführten.
Einmal – so hatte es ihm ein Freund erzählt – waren die Männer eines ganzen Stammes als Komparsen für einen Film verpflichtet worden.
Bei der Abrechnung waren plötzlich sogar die alten Frauen und Kinder erschienen und hatten stumm die Gage gefordert.
Der Filmemacher hatte zähneknirschend gezahlt, weil er das Risiko eines Aufstandes nicht eingehen wollte.
Es war ein gutes Gefühl, einmal nicht reden zu müssen – weder beruflich, noch privat. So ging er also seinen Gedanken nach und je weiter er sich von seinem Zuhause entfernte, umso besser ging es ihm auch körperlich.
Die Zeit verflog in rasender Geschwindigkeit.
3.
„Manchmal weiss ich einfach nicht mehr, was ich noch tun kann für Dich“, sagte sie und begab sich sofort wieder an den Abwasch.
Kate war eine Frau, die schon eine Menge erlebt hatte.
Irgendwann war sie der Liebe wegen hierher gezogen und seither niemals mehr wieder hier weggekommen.
Wohin hätte sie auch gehen können? Ihr Mann war gestorben und so war sie dann alleine geblieben mit den Kindern.
Selbst Yellowknife war fast 400 Km entfernt und so lebte sie ihr Leben eben ohne die Annehmlichkeiten der großen Stadt.
Einmal im Monat kam das Wasserflugzeug und brachte die Sachen, die sie bestellt hatte und natürlich auch die Post. Aber wer hätte ihr schon schreiben mögen?
Außerdem lag ja ihr Mann hier.
Sie hatte ihn damals in der Nähe des kleinen Blockhauses begraben lassen. Immer, wenn es ihr nicht gut ging, machte sie sich auf den Weg zu ihm. Dort saß sie dann und dachte zurück an die Zeiten, die sie gemeinsam gehabt hatten – es waren wirklich gute Zeiten gewesen.
Heute war wieder so ein Tag. Peter, ihr ältester Sohn,war manchmal tagelang verschwunden.
Sie konnte das eigentlich auch gut verstehen. Er hatte es eben nicht leicht.
Keine Freunde... keine Frau und meistens eben auf sich allein gestellt.
Die Chancen, hier in der Wildnis jemanden kennenzulernen gingen ja gegen Null und so hatte er sich eben ganz allein entwickelt.
Die einzige wirkliche Abwechslung brachte die Bahnlinie in der Nähe.
Immer, wenn ein Zug mit Gütern dort vorbeikam, dachte sie daran, was er wohl geladen haben könnte.
Meistens kamen sie von Yellowknife, verteilten die Güter an den nächsten Bahnhöfen oder transportierten das Gestein aus der Mine.
Die Menschen, die hier lebten, mussten ja versorgt werden.
Das Land hier oben in der Wildnis bekam man ja vom Staat geschenkt. Der war ja froh, wenn es Menschen gab, die dieses Stückchen urbar und bewohnbar machten.
Platz war ja genügend vorhanden. Es hätten also noch mehr Menschen kommen können. Aber wer wollte das schon?
Sicher – es gab schon ein paar seltsame Kauze hier in der Gegend- Aussteiger und immer noch echte Trapper, die während ihrer Besuche ein bis zweimal im Jahr die Stadt unsicher machten.
Der nächste Nachbar war einen Fußmarsch von ca 8 Stunden entfernt. Sie alle lebten meistens allein – wer hätte es schon mit ihnen ausgehalten?
„Wenn Du das nächste Mal unterwegs bist, wäre es zumindest gut, wenn Du mir sagen würdest, wann Du wiederkommst.“
Sie machte sich natürlich Sorgen um ihren „Großen“.
Die Ungewissheit während seiner regelmäßigen „Ausflüge“ brachte sie fast um.
Er erwiderte nichts. Wie eigentlich immer wollte er einfach nicht mit der Sprache heraus.
Einmal war er mit Teilen eines Elches wieder heimgekommen. Den hatte er unterwegs geschossen und so hatten sie für einige Wochen gutes und schmackhaftes Essen.
„Den Rest werden die Bären oder Wölfe längst gefressen haben“, hatte er kurz gesagt.
Sie hatten ihn selbst in den wichtigsten Fächern unterrichtet und manchmal wunderte sie sich, was da so offensichtlich Alles hängengeblieben war.
Ein Gewehr hatte hier jeder. Das war ja auch wichtig, um sich gegen Angreifer wehren zu können.
Aber er hatte auch einen Bogen. Wenn man damit nur richtig umgehen konnte, tötete diese Waffe effektiv und vollkommen lautlos. Den Bau und den Umgang hatte er von einem alten Indianer gelernt, der nur wenige Tagesmärsche entfernt lebte.