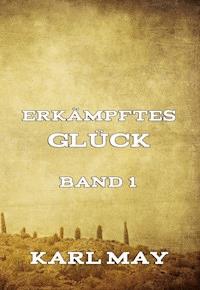
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Waldröschen oder Die Rächerjagd rund um die Erde (später auch: Das Waldröschen oder die Verfolgung rund um die Erde) ist der erste von fünf Kolportageromanen von Karl May, erschienen zwischen zwischen 1882 und 1884 in 109 Fortsetzungen. Dies ist Band 8.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erkämpftes Glück, Band 1
Karl May
Inhalt:
Karl May – Biografie und Bibliografie
Erkämpftes Glück, Band 1
1. Kapitel.
2. Kapitel.
3. Kapitel.
4. Kapitel.
5. Kapitel.
6. Kapitel.
7. Kapitel.
8. Kapitel.
9. Kapitel.
10. Kapitel.
11. Kapitel.
12. Kapitel.
13. Kapitel.
14. Kapitel.
15. Kapitel.
16. Kapitel.
17. Kapitel.
18. Kapitel.
19. Kapitel.
20. Kapitel.
21. Kapitel.
22. Kapitel.
23. Kapitel.
24. Kapitel.
25. Kapitel.
26. Kapitel.
27. Kapitel.
28. Kapitel.
29. Kapitel.
30. Kapitel.
Erkämpftes Glück, Band 1, Karl May
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849609580
www.jazzybee-verlag.de
Cover Design: © Can Stock Photo Inc. / javarman
Karl May – Biografie und Bibliografie
Am 25. Februar 1842 wird Karl May wird als fünftes Kind des Webers Heinrich May und dessen Ehefrau Wilhelmine (geb. Weise) in Ernstthal (Sachsen) geboren. Obwohl er kurz nach seiner Geburt erblindet wird er im Alter von 5 Jahren von der Krankheit geheilt. Bereits mit 14 Jahren beginnt er eine Ausbildung zum Volksschullehrer, die er 1861 besteht. Noch im gleichen Jahr verliert May seinen Arbeitsplatz als Lehrer wegen wiederholten Diebstahls. Ab 1863 wird es ihm verboten zu unterrichten.
Von 1865 bis 1869 wird May immer wieder straffällig und muss von 1870 bis 1874 ins Gefängnis. Danach beginnt May zu schreiben und in "Der Deutsche Hausschatz" erscheinen erste Erzählungen: "Reiseabenteuer in Kurdistan", "Die Todeskaravane" oder "Stambul". Seine Romane erfahren immer mehr Zuspruch und 1893 erscheint die Winnetou-Reihe. Bis 1898 veröffentlicht May über 30 Bände mit immer steigender Auflage.
Erst 1899 unternimmt May erstmals eine Reise in den Orient, 1908 sieht er zum ersten Mal die Vereinigten Staaten. Alles was er geschrieben hatte war pure Fiktion! Er stirbt am 30. März 1912 an einem Herzschlag.
Zu seinen wichtigsten Werken zählen Durch die Wüste und Harem (1892) ,Durchs wilde Kurdistan (1892), Von Bagdad nach Stambul (1892), In den Schluchten des Balkan (1892), Durch das Land der Skipetaren (1892), Der Schut (1892), Winnetou I (1893), Winnetou II (1893), Winnetou III (1893), Orangen und Datteln (1893), Am Stillen Ozean (1894), Am Rio de la Plata (1894), In den Cordilleren (1894), Old Surehand I (1894), Old Surehand II (1895), Im Lande des Mahdi I (1896), Im Lande des Mahdi II (1896), Im Lande des Mahdi III (1896), Old Surehand III (1897), Satan und Ischariot I (1896) ,Satan und Ischariot II (1897), Satan und Ischariot III (1897), Auf fremden Pfaden (1897), „Weihnacht!“ (1897), Im Reiche des silbernen Löwen I (1898), Im Reiche des silbernen Löwen II (1898), Am Jenseits (1899), Der Sohn des Bärenjägers (1887), Der Geist des Llano estakato (1888), Der blaurote Methusalem (1888), Die Sklavenkarawane (1889/90), Der Schatz im Silbersee (1890/91), Das Vermächtnis des Inka (1891/92), Der Ölprinz (1893/94) und Der schwarze Mustang (1896/97).
Erkämpftes Glück, Band 1
1. Kapitel.
Nach einem herzlichen Abschied setzten sich die vier auf und ritten davon. Sie hatten sich einen Vorrat von Proviant mitgenommen, um unterwegs nicht der Jagd obliegen zu müssen, da sie sich durch Schüsse hätten verraten können.
Erst als Juarez am dritten Tag darauf nach Coahuila kam, hörte er von der amerikanischen Freischar, die angekommen war. Er traf sofort Anstalt, sie an sich zu ziehen, und brach dann auf, um den Freunden nachzufolgen und Hilfe zu bringen, falls sie einen Mißerfolg gehabt.
Diese hatten einen Umweg eingeschlagen und sich in das weniger bewohnte Gebirge von Monclova hineingezogen. Darum brachten sie länger zu, als es sonst der Fall gewesen wäre, doch erreichten sie unbemerkt die Hazienda, auf der sie sich allerdings nicht sehen ließen. Sie umritten dieselbe in weitem Kreis und hielten auf den Berg El Reparo zu.
Es war dies jener Berg, in dessen Innern sich die Höhle des Königsschatzes befand und auf dessen Kuppe sich die grausigen Begebenheiten des Teiches der Krokodile zugetragen hatten.
Sie waren in seiner Nähe angekommen und ritten zwischen dünnen Büschen hin, als der voranreitende Büffelstirn plötzlich sein Pferd anhielt.
»Ein Reiter«, sagte er, den Arm ausstreckend.
Die anderen blickten in die angedeutete Richtung hin und erkannten einen Mann, der an der Erde saß, während sein Pferd in der Nähe graste.
»Wir müssen ihn umreiten, um nicht von ihm gesehen zu werden«, sagte Sternau.
Die Sonne war im Sinken, und der Berg warf seinen Schatten, aber man vermochte dennoch, eine ziemliche Strecke weit zu sehen.
»Wir reiten hin!« antwortete der Mixteka, nachdem er sich den Mann genauer betrachtet hatte. – »Kennt ihn mein Bruder?« – »Ein Vaquero.« – »Von del Erina?« – »Ja. Ich erkenne ihn wieder, obgleich er älter geworden ist.« – »Ob er treu ist?« – »Er war dem Häuptling der Mixtekas stets freundlich gesinnt.« – »So wollen wir sehen, ob er es noch ist.«
Sie setzten also ihren Weg, ohne sich im verborgenen zu halten, fort. Als der Mann sie erblickte, erhob er sich schnell, sprang auf sein Pferd und griff zur Büchse.
»Ämilio braucht sich nicht zu fürchten«, rief Büffelstirn ihm zu. »Oder ist er vielleicht ein Feind der Mixtekas geworden?«
Der Angeredete saß wie erstarrt auf seinem Pferd.
»O Dios!« rief er endlich. »Büffelstirn!« – »Ja, ich bin es!« – »Stehen die Toten auf?« – »Nein; aber die Lebenden kehren zurück.« – »So wart Ihr gar nicht gestorben?« – »Nein, wir lebten. Kennst du diese Männer?«
Ämilio ließ sein Auge von einem zum anderen gehen. Sein Gesicht nahm den Ausdruck eines immer größeren, freudigen Erstaunens an.
»Ist das möglich, oder sehe ich nicht recht?« – »Wen siehst du?« fragte Büffelstirn. – »Ist das nicht Señor Sternau?« – »Ja, er ist es.« – »Und dieser ist Bärenherz, der Häuptling der Apachen?« – »Ja, deine Augen sind noch gut.« – »Mein Erlöser! Und wir glaubten euch tot. Wo sind die anderen?« – »Sie leben auch und folgen uns baldigst nach.« – »So werden sie es sehr traurig auf der Hazienda finden.« – »Warum?« – »Die Feinde sind da.« – »Wieviel Mann?« – »Gegen sechshundert.« – »Wer ist der Anführer?« – »Cortejo. Aber er ist vor einiger Zeit fortgeritten, und nun befiehlt seine Tochter Josefa.« – »Was tun diese Leute?« – »Sie essen, trinken und schlafen. Sie martern die Vaqueros, indem sie auf die Rückkehr Cortejos warten.« – »Wo ist Señor Arbellez?« – »Gefangen.« – »Wo?« – »Sie haben ihn in einen Keller geworfen, nachdem er fast totgeprügelt worden war.« – »Ist er allein gefangen?« – »Señora Marie Hermoyes und Antonio sind bei ihm.« – »Antonio? Uff! Der auf Fort Guadeloupe war?« – »Ja.« – »Was gibt man den Gefangenen zu essen?« – »Ich weiß es nicht. Niemand sieht etwas davon, denn die Vaqueros gehen jetzt nicht nach der Hazienda.« – »Du auch nicht?« – »Nein.« – »So komm mit uns.«
Ämilio schloß sich ihnen mit Freuden an. Nun er diese Männer sah, glaubte er an eine baldige Verbesserung der Lage. Diese drei hatte er erkannt, den vierten aber doch nicht genau. Jetzt ritt er neben ihm.
»Verzeiht, Señor«, sagte er. »Ich habe Euch jedenfalls früher gesehen, weiß aber doch nicht, wie ich Euch nennen soll.« – »Habe ich mich denn so sehr verändert?« fragte Helmers lächelnd.
Infolge dieses Lächelns und dieser Stimme kehrte dem Vaquero die Erinnerung zurück.
»Ihr Heiligen, wäre das wahr?« fragte er. »Ihr seid Señor Helmers?« – »Ja.« – »Gott, welch eine Freude! Aber lebt auch Señorita Emma noch?« – »Sie lebt noch und kehrt sehr bald nach der Hazienda zurück.« – »Oh, man wird auch sie gefangennehmen.« – »Nein. Wir werden die Feinde vertreiben.« – »Sie vier?« fragte der Mann ungläubig. – »Das wirst du bald sehen. Doch sage mir vor allen Dingen, wer den Befehl gegeben hat, daß Señor Arbellez gepeitscht worden ist.« – »Ich glaube, die Señorita Josefa.« – »War ihr Vater da noch auf der Hazienda?« – Ja.« – »Es ist genug. Sie werden ihre Strafe erhalten.«
Helmers knirschte mit den Zähnen, und die Augen Büffelstirns leuchteten auf. Die beiden glühten vor Rachgier. Wehe Cortejo und seiner Tochter, wenn diese in ihre Hände gerieten!
Der Ritt ging jetzt an der Seite des Berges empor. Sie langten eben am Alligatorenteich an, noch ehe das letzte Tageslicht verglommen war. Noch stand der Baum, der schräg über das Wasser ragte. Die Fläche des Wassers war eben. Da aber hielt Büffelstirn an und stieß einen klagenden Ruf aus, mit dem man Krokodile anzulocken pflegt. Sofort tauchten eine Menge knorriger Köpfe aus der Tiefe auf. Sie kamen auf das Ufer zugeschossen und klappten die Kinnladen gegeneinander, daß es klang, als würden starke Pfosten aufeinandergeschlagen.
»Uff! Lange nichts gefressen!« meinte der Mixteka. »Werden bald ihren Hunger stillen können. Büffelstirn wird für die heiligen Krokodile der Mixtekas sorgen.«
Sie umritten den Teich und stiegen im Wald ab, wo sie die Pferde unter Aufsicht Ämilios stehenließen. Dann schritt Büffelstirn weiter.
Mitten auf der Spitze des Berges befand sich eine pyramidenförmige Erhöhung, die man ganz sicher für ein Werk der Natur gehalten hätte. Dort blieb der Häuptling der Mixtekas stehen.
»Das ist das Feuermal meines Stammes«, sagte er. – »Ah, ein verborgener Pechofen?« fragte Sternau. – »Ja. Er ist mit Pech, Harz, Schwefel und trockenem Gras angefüllt. Offnen wir ihn!«
Der Indianer trat an die eine Seite der Pyramide und nahm einen Stein fort, der mit Erde bedeckt und mit Gras überwachsen war.
»Das ist das Zugloch.«
Zu diesen Worten Sternaus nickte der Häuptling mit dem Kopf. Dann stieg er zur Spitze empor. Dort befand sich der Stamm eines nicht gar zu starken Baumes, der ganz das Aussehen hatte, als ob er durch einen Blitzschlag seine gegenwärtige Gestalt erhalten habe. Büffelstirn zog denselben hin und her, bis der Stamm sich lockerte und fortnehmen ließ. Dadurch entstand ein Loch, das Büffelstirn erweiterte, so daß es die Stärke eines Mannes erlangte.
»Es ist dunkel geworden«, sagte er. »Wir wollen das Zeichen des Krieges anbrennen. Büffelstirn ist jahrelang nicht bei den Seinigen gewesen, aber meine Brüder werden bald sehen, daß seine Anordnungen noch gelten.«
Er kniete nieder und schlug Feuer. Bald brannten einige trockene Splitter, die er aus dem Stamm geschlitzt hatte. Er warf sie in das Loch und stieg dann von der Pyramide herab.
Erst ließ sich ein Knistern und Prasseln hören, das bald in ein lautes Zischen überging. Eine vielleicht zwei Fuß hohe Flamme stieg empor.
»Das ist zu niedrig«, meinte Helmers. – »Mein Bruder warte ein wenig«, antwortete der Häuptling. »Die Söhne der Mixtekas verstehen es, Kriegsflammen zu erzeugen.«
Er hatte recht. Denn kaum eine Minute später begann die Flamme emporzusteigen, und nach fünf Minuten hatte sie eine ungeheure Höhe erreicht. Sie hatte die Gestalt einer Säule, die oben in gewaltigen Strahlen auseinanderging, und besaß eine solche Leuchtkraft, daß es auf der ganzen Spitze des Berges hell wie am Tag wurde.
»Ein Feuermal, wie ich noch keines gesehen habe!« bemerkte Sternau. – »Wir werden sehr bald Antwort haben«, antwortete Büffelstirn. – »Gibt es mehrere Orte mit solchen Öfen?« – »So weit die Mixtekas wohnen.« – »Und es sind Männer angestellt, die die Flamme anzünden?« – »Ja.« – »Wenn diese nun gestorben oder nicht zugegen sind?« – »So haben sie ihr Amt anderen übergeben. Mein Bruder sehe!«
Das Feuer hatte vielleicht eine Viertelstunde lang gebrannt. Der Häuptling zeigte nach Süden. Da erhob sich auch eine Flamme, und zwar in einer Entfernung, die man wegen der Nacht nicht genau schätzen konnte. Im Norden folgte eine zweite, und bald konnte man ringsum fünf gleiche Feuersignale sehen.
Da schritt Büffelstirn zu einem Stein, der in der Nähe lag. Er hob ihn trotz seiner Größe weg, und nun wurde eine Öffnung sichtbar, in der einige Kugeln von der Größe eines Billardballes lagen.
Er nahm drei davon, warf sie in die Flamme und deckte dann den Stein sorgfältig wieder auf das Loch.
»Warum diese Kugeln?« fragte Sternau. – »Mein Bruder wird es sogleich bemerken.«
Er hatte dies kaum gesagt, so schossen drei Flammen himmelhoch empor und bildeten dort drei große Feuerscheiben, die sich lange Zeit in gleicher Höhe hielten und dann langsam wieder niedersenkten.
Kurze Zeit darauf erblickte man bei jedem der fünf anderen Male dasselbe Zeichen.
»Was bedeutet das?« – »Jeder Ort hat sein Zeichen«, antwortete Büffelstirn. »Ich habe dasjenige des Berges El Reparo gegeben, damit die Mixtekas wissen, wo sie sich versammeln sollen.« – »Aber die Feinde werden diese Feuer auch bemerken.« – »Sie werden nicht wissen, was sie zu bedeuten haben. Jetzt brennt die Flamme nieder. Meine Brüder mögen noch einige Augenblicke warten, dann können wir diesen Ort verlassen.«
Das Feuermal sank mit eben derselben Schnelligkeit herab, mit der es gestiegen war; dann war es dunkel wie vorher.
Büffelstirn legte den Stein wieder sehr genau vor das Zugloch und brachte den Baum wieder an Ort und Stelle. Obgleich dies in der Dunkelheit geschah, verstand er es, jede Spur sorgfältig zu entfernen.
»Wenn ein Feind auf den Berg kommt«, sagte er, »um den Ort zu suchen, wo die Flamme war, so wird er ihn nicht finden. Wir aber werden ihn jetzt verlassen.« – »Wohin gehen wir?« – »Dahin, wo wir bis morgen verborgen bleiben können.« – »Bis morgen abend?« fragte Helmers. – »Ja.« – »Können wir am Tag nichts für die Hazienda und Arbellez tun?« – »Gar nichts. Aber am Abend wird die Hazienda unser sein.«
Sie kehrten zu den Pferden zurück, stiegen auf und ritten den Berg hinab, wo sie links umbogen und nach einer halben Stunde in eine Schlucht gelangten, deren Eingang fast ganz von Büschen verdeckt war.
»Hier werden wir warten«, sagte Büffelstirn.
Sie ritten bis an den hinteren Teil der Schlucht, banden ihre Pferde an und lagerten sich in das Moos. Ihre halblaute Unterhaltung bezog sich natürlich auf die bevorstehenden Ereignisse, dann suchten sie den Schlaf.
Die Nacht verging und ebenso der Tag in tiefster Ruhe. Ungefähr um sechs Uhr wurde es dunkel, doch wartete Büffelstirn noch zwei Stunden, ehe er zum Aufbruch mahnte. Sie bestiegen ihre Pferde und ritten fort.
Als sie an die Stelle gelangten, die nach oben führte, vernahmen sie erst vor sich und auch hinter sich Pferdegetrappel.
»Wer reitet da?« fragte Helmers leise. – »Mein Bruder sorge sich nicht«, antwortete Büffelstirn. »Es sind die Söhne der Mixtekas, die meinem Ruf folgen.«
Als sie oben anlangten, herrschte dort eine außerordentliche Ruhe, aber um den Teich der Krokodile konnte man, zwar undeutlich nur, Menschen und Pferde Kopf an Kopf erkennen. Sie waren gekommen, um zu erfahren, was das Feuersignal zu bedeuten habe.
Sie gelangten zwischen den Indianern hindurch bis an das Ufer des Teiches. Dort hielt der Häuptling, ohne abzusteigen, an und rief mit lauter Stimme:
»Ila! Na atui!«
Das heißt auf deutsch: »Ruhe, ich will sprechen!«
Ein leises Waffengeräusch ließ sich hören, dann fragte eine andere Stimme:
»Payn omi – wer bist du?« – »Na Mokaschi-motak – ich bin Büffelstirn!« – »Mokaschi-motak!« so ging das Wort ringsum von Mund zu Mund.
Es war trotz der Dunkelheit zu bemerken, welches ungeheure Aufsehen dieser Name machte. Die vorherige Stimme ließ sich hören:
»Büffelstirn, der Häuptling der Mixtekas ist tot.« – »Büffelstirn lebt. Er wurde von seinen Feinden gefangengehalten und ist jetzt zurückgekehrt, um sich zu rächen. Wer hat mit mir gesprochen?« – »Das wiehernde Pferd«, lautete die Antwort. – »Das wiehernde Pferd ist ein großer Häuptling, er ist der erste Mann nach Büffelstirn und wird bisher die verlassenen Kinder der Mixtekas befehligt haben. Er komme mit einer Fackel herbei, um mich zu sehen!«
Einige Augenblicke später sah man den Schein einer Fackel aufleuchten, und mehrere Männer drängten sich durch die Menge mit ihr bis zum Häuptling hindurch. Einer von ihnen, in die Tracht eines Büffeljägers gekleidet, gerade so, wie sie Büffelstirn früher getragen hatte, hielt dem Häuptling die Fackel nahe und blickte ihm in das Gesicht.
»Mokaschi-motak!« rief er dann laut. »Freut euch, ihr Söhne der Mixtekas! Euer König ist zurückgekehrt. Schwingt eure Messer und Tomahawks, um ihn zu rächen!« – »Ugh!«
Nur dieses eine Wort wurde gehört, es brauste um den Teich herum, dann wurde es wieder still. Jetzt erhob Büffelstirn abermals die Stimme:
»Die Wächter mögen sagen, ob wir hier sicher sind.« – »Es ist kein Fremder hier, außer vier Männern, die mit einem Mixteka gekommen sind!« rief es von weitem her. – »Ich selbst war es, mit dem sie kamen. Wie viele Männer wurden gezählt?« – »Elfmal zehnmal zehn und vierzig und zwei.«
»Meine Brüder mögen hören!« begann der Häuptling. »Morgen sollen sie erfahren, wo Büffelstirn so lange Zeit gewesen ist. Jetzt aber sollen sie vernehmen, daß Juarez, der Zapoteke, aufgebrochen ist, um die Franza aus dem Lande zu treiben. Büffelstirn wird ihm die Krieger zuführen, die mit ihm kämpfen wollen. Heute aber reiten wir nach der Hacienda del Erina, um die dort befindlichen Männer des Cortejo zu besiegen. Es befinden sich dort die schlimmsten Leute der Bleichgesichter, denen der Mixteka keine Gnade gewährt. Wer von ihnen nicht entkommt, muß sterben. Meine Brüder mögen sich in zehn und zehn teilen und mir folgen. Da, wo ich in der Nähe der Hazienda halten werde, bleiben die Pferde zurück und fünfmal zehn Männer bei ihnen. Der Häuptling wieherndes Pferd mag sie auswählen. Die anderen gehen leise um die Hazienda herum, bis die Krieger einen Kreis bilden, und wenn der erste Schuß fällt, dringen sie auf die Feinde ein. Der Sieg ist unser, denn ich habe den Fürsten des Felsens mitgebracht, Bärenherz, den Häuptling der Apachen, und Donnerpfeil, das tapfere Bleichgesicht.« – »Ugh!« ertönte es abermals rund um den Teich herum. Es war der Ausdruck der Freude über die Anwesenheit so berühmter Krieger.
Dann begannen die Massen, sich langsam in Bewegung zu setzen.
»Mein Bruder will keinen Pardon geben?« fragte Sternau. – »Nein.« – »Warum nicht?« – »Mein Bruder Arbellez ist geschlagen worden!« erklang es rauh. – »Aber doch nicht von allen!« – »Bei Cortejo ist kein wackerer Mann. Sie mögen sterben. Der Mixteka tritt das Ungeziefer mit den Füßen tot.«
Sternau merkte, daß hier keine Fürbitte helfen konnte, zumal es keine Zeit mehr gab, den bereits sich in Bewegung befindlichen Kriegern andere Befehle zu erteilen. Übrigens sagte sich Sternau selbst, daß Cortejo nur Gesindel angeworben haben könne, und vielleicht gelang es den meisten zu entkommen.
Büffelstirn mit seinen Freunden voran, schlängelte sich der lange Reiterzug langsam den Berg hinab, aber unten angekommen, wurden die Pferde in Galopp gesetzt. Als Berg und Wald hinter ihnen lagen, befanden sie sich in der weiten Ebene, kaum eine englische Meile von der Hazienda entfernt. Alle stiegen von ihren Tieren, nur Sternau blieb sitzen.
»Warum steigt mein Bruder nicht ab?« fragte Büffelstirn. – »Ich reite nach der Hazienda.« – »Warum? Willst du dich töten lassen?« – »Nein. Es könnte der Fall sein, daß die Angegriffenen, wenn sie sehen, daß es für sie keine Rettung gibt, Arbellez töten. Das werde ich verhindern.« – »Mein Bruder hat recht.« – »Und ich reite mit!« sagte Helmers. – »Gut, so sind wir zu zweien«, meinte Sternau. »Aber wir werden warten, bis die Hazienda umzingelt ist. Ich werde sehen, wie es in der Hazienda steht und den Schuß abgeben, der das Zeichen zum Angriff ist.«
2. Kapitel.
Während fünfzig Mann bei den Pferden zurückblieben, rückten die anderen jetzt lautlos vor. Sie hatten erwartet, Lagerfeuer zu sehen, aber die Mexikaner befanden sich alle im Hof und in den Zimmern der Hazienda, darum war es den Mixtekas möglich, sich ganz nahe anzuschleichen. Als dies geschehen war, setzten Sternau und Helmers ihre Pferde in lauten Trab, daß es den Anschein haben sollte, als ob sie von weit her kämen. Sie hielten vor dem Tor an und klopften. Eine Stimme im Innern fragte: »Wer ist da?« – »Ist das die Hacienda del Erina?« fragte Sternau. – »Ja«, antwortete es. – »Befinden sich da die Leute von Señor Cortejo?« – Ja.« – »Wir sind Boten, die zu ihm wollen.« – »Wie viele seid Ihr?« – »Zwei.« – »Wer sendet Euch?« – »Der Panther des Südens.« – »Ah, dann dürft Ihr herein.«
Die Tür öffnete sich, und die beiden verwegenen Männer ritten in den Hof, wo sie von den Pferden sprangen. Dort war es dunkel, darum führte man sie in eines der Zimmer, das erleuchtet war. Dasselbe war voller Menschen, alles wilde Gesichter, auch derjenige war dabei, der Arbellez mit geschlagen hatte. Er schien eine Art Befehlshaberstelle einzunehmen, denn er fragte den, welcher die beiden hereingebracht hatte:
»Was wollen diese Menschen?«
Anstatt des Gefragten nahm Sternau schnell das Wort:
»Menschen? Ihr habt es hier mit Señores zu tun. Merkt Euch das! Wir kommen vom Panther des Südens und haben notwendig mit Señor Cortejo zu sprechen. Wo befindet er sich?«
Der Mann sah die mächtige Gestalt Sternaus, die einen großen Eindruck auf alle Umherstehenden machte, dennoch hielt er es für seiner Würde gemäß, so zu tun, als ob er sich nicht einschüchtern lasse. Er antwortete:
»Erst habt Ihr Euch zu legitimieren.« – »Aber bei wem denn?« – »Bei mir!« klang die stolze Antwort. – »So! Wer seid Ihr denn?« – »Ich bin der, der die Meldungen macht.« – »Nun, so meldet mich bei Cortejo. Das übrige geht Euch nichts an.«
Der Mann stieß ein höhnisches Lachen aus und sagte: »Ich werde Euch beweisen, daß es mich gar wohl etwas angeht. Wir befinden uns hier auf dem Kriegsfuß. Ihr seid meine Gefangenen, bis Ihr bewiesen habt, daß Ihr wirklich vom Panther des Südens kommt.« – »Mensch! Was bildest du dir ein! Wirst du mich melden oder nicht?« donnerte Sternau ihm entgegen.
Der Mann aber glaubte, sich in Respekt setzen zu müssen, und antwortete:
»Oho! Jetzt redet man mich mit du an! Nehmt Euch in acht, daß es Euch nicht wie Arbellez ergeht!« – »Ah! Wie ist es diesem ergangen?« – »Ich habe ihn bis auf die Knochen gepeitscht.« – »Du selbst?« – »Ja. Und wenn Ihr Euch renitent betragt, geht es Euch ebenso!« – »Das wagst du mir zu sagen? Hier hast du meine Antwort, Bube!«
Sternau faßte den Mexikaner bei der Kehle und schlug ihm die Faust zweimal an den Kopf, dann schleuderte er den Besinnungslosen über den Tisch hinüber in einen Winkel.
Kein Mensch wagte ein Wort zu sagen. Sternau sah sich funkelnden Auges im Kreis um und drohte:
»So kann es einem jeden ergehen, der mich beleidigt, ohne mich zu kennen. Wo ist Cortejo?« – »Alle Teufel! Das ist jedenfalls der Panther selbst«, flüsterte es im Hintergrund.
Dies verdoppelte den Respekt, und einer antwortete:
»Señor Cortejo ist nicht hier.« – »Wo sonst?« – »Er hat die Hazienda für kurze Zeit verlassen. Wohin er ist, weiß ich nicht.« – »Aber die Señorita ist da?« – »Ja.« – »Wo?« – »In dem Zimmer, das gerade über diesem liegt.« – »Das finde ich auch selbst. Ihr braucht mich also gar nicht anzumelden.«
Es getraute sich wirklich keiner, Sternau zu folgen, als er die Stube verließ, um sich mit Helmers nach oben zu begeben.
Josefa Cortejo lag in einer Hängematte und stand große Schmerzen aus. Ihr Zustand hatte sich unter der schlechten Behandlung eher verschlimmert als gebessert. Doch der Gedanke an die Rückkehr ihres Vaters tröstete sie. Er kam jedenfalls als Sieger über seine Feinde und mit großen Reichtümern beladen.
Da erschallten draußen rasche, kräftige Schritte. Kam er vielleicht schon? Sie richtete sich erwartungsvoll auf. Zwei Männer traten ein, ohne vorher zu klopfen und dann zu grüßen. Wer war es? Hatte sie nicht die athletische Figur des einen bereits gesehen? Sein Bart machte, daß sie ihn nicht gleich erkannte.
»Wer seid Ihr? Was wollt Ihr?« fragte sie. – »Ah! Ihr kennt mich nicht mehr, Señorita?« fragte Sternau.
Ihre Augen wurden größer und ihre Wangen totenbleich.
»Wer ... O mein Gott, Sternau!« – »Ja«, antwortete er. »Und hier steht Señor Helmers, der Bräutigam von Emma Arbellez.«
Josefa nahm sich zusammen und fragte:
»Was wagt Ihr? Was wollt Ihr?« – »Oh, ich will Euch nur dieses Papier zurückgeben.«
Sternau griff in die Tasche und zog den Brief heraus, den er ihrem Boten abgenommen hatte. Sie nahm ihn entgegen und warf einen Blick darauf. Ihr eigener Brief. Sie war einer Ohnmacht nahe.
»Gott! Wie kommt Ihr zu diesem Schreiben?« hauchte sie. – »Wir haben es der Leiche Eures Boten abgenommen.« – »Der – Leiche ...?« – »Ja. Er fiel nämlich mit seiner Truppe in unsere Hände, wobei alle bis auf den letzten Mann niedergemacht wurden.«
Josefa war geistesabwesend. Die Angst vor diesem Manne macht ihr Herz erzittern. Sie brachte kaum die Worte hervor:
»Niedergemacht worden? Schrecklich!« – »Tröstet Euch. Es war nicht schade um sie. Übrigens wären sie mit dem Brief doch nicht zurecht gekommen, denn wir haben auch Euren Vater überfallen, als er dem Lord auflauerte. Von seinen Leuten lebt wohl keiner mehr. Ob er selbst entkommen wird, läßt sich noch nicht sagen.« – »O Gott, o Gott!« stöhnte sie. – »Pah! Ruft nicht den Namen Gottes an. Ihr seid eine Teufelin. Dieses Wort aus Eurem Mund ist der reine Frevel, die größte Gotteslästerung.«
Diese Worte gaben ihr einen Teil ihrer Tatkraft zurück.
»Señor«, sagte sie, »bedenkt, wo Ihr Euch befindet.« – »Auf der Hacienda del Erina, denke ich.« – »Ja; das heißt im Hauptquartier meines Vaters.« – »Ihr wollt mir bange machen?« lächelte Sternau. – »Es bedarf nur eines Wortes von mir, so seid Ihr mein Gefangener.« – »Da irrt Ihr Euch. Ich will Euch mitteilen, daß Juarez im Anzug ist. Euer Possenspiel hat heute seinen Schluß erreicht.« – »Pah! Noch ist Juarez nicht da.« – »Aber ich befinde mich hier. Das ist ebensogut. Oder glaubt Ihr etwa, daß ich zu Euch komme, ohne zu wissen, daß ich sicher bin? Die Hazienda ist von über tausend Mixtekas umzingelt. Jetzt ist das Verhältnis umgekehrt: Mich kostet es ein Wort, so seid Ihr meine Gefangene. Oder vielmehr, es kostet mich kein Wort, denn Ihr seid es ja schon.« – »Noch nicht!« rief sie.
Im Angesicht dieser großen Gefahr war sie die alte. Sie schnellte trotz ihrer Schmerzen von der Hängematte herab, riß eine Pistole vom nahe stehenden Tisch und drückte sie auf Sternau ab, zu gleicher Zeit laut um Hilfe schreiend. Der Schuß ging fehl, denn Sternau hatte sich blitzschnell zur Seite gewendet. Im nächsten Augenblick lag sie unter den Händen von Helmers am Boden. In demselben Moment ertönte aber auch rund um die Hazienda ein fürchterliches Geheul. Die Mixtekas hatten den Schuß gehört und für das verabredete Zeichen gehalten. Sternau sprang nach der Tür.
»Sie kommen«, sagte er. »Halten Sie dieses Weib fest und schließen Sie sich lieber mit ihr ein. Ich muß hinunter zu Arbellez.«
Sternau eilte hinaus. Das Innere des Hauses glich einem Ameisenhaufen. Überall drängten sich die Mexikaner nach unten. Sie waren so überrascht, so erschreckt, daß sie seine Gegenwart gar nicht beachteten. Er drängte sich mit ihnen hinab und gelangte noch eine Treppe weiter hinunter nach dem Keller. Dort brannte eine trübe Lampe. Ein Mann stand an der Tür Wache.
»Wer befindet sich darin?« herrschte Sternau ihn an. – »Arbellez und ...« – »Wo ist der Schlüssel?« unterbrach ihn der Deutsche. – »Eigentlich oben bei der Señorita.« – »Eigentlich? Jetzt aber ist er hier, soll das heißen?« – »Ja.« – »Gib ihn heraus!«
Der Mann machte ein erstauntes Gesicht, blickte Sternau forschend an und fragte:
»Wer seid Ihr? Was ist das für ein Lärm da oben?« – »Ich bin einer, dem du zu gehorchen hast, und der Lärm da oben geht dich gar nichts an. Heraus mit dem Schlüssel!« – »Oho! So schnell geht das nicht. Euren Namen will ich wissen! Es hat mir noch niemand gesagt, daß ich Euch zu gehorchen habe. Ich kenne Euch nicht!« – »Du sollst mich sogleich kennenlernen!«
Bei diesem Wort holte Sternau aus und versetzte dem Mann einen Faustschlag, unter dem er zusammenbrach. Er untersuchte die Taschen des am Boden Liegenden und fand einen Schlüssel, der paßte. In Zeit von einer Minute war die Tür geöffnet. Sternau nahm die Lampe und leuchtete in den Raum.
Es bot sich ihm ein schrecklicher Anblick.
Auf den kalten, nassen Steinplatten lagen drei Personen, halb übereinander, denn es war kaum Platz für zwei Menschen vorhanden. Lang ausgestreckt nahm der Vaquero die Länge des Bodens ein. Auf seinem Oberleib ruhte die alte, treue Marie Hermoyes, und teils auf ihr und teil auf ihm ruhte Pedro Arbellez, umwunden von den Fetzen, die diese beiden aus ihren Kleidungsstücken gerissen hatten.
In einer Ecke lagen ein Lichtstummel und ein Stückchen trockenen Brotes.
»Ist Señor Arbellez hier?« fragte Sternau. – »Ja«, antwortete der Vaquero, sich des Verwundeten wegen leise und vorsichtig emporrichtend, um den Frager anzusehen. – »Wo ist er? Welcher ist es?«
Bei diesen Worten leuchtete Sternau zu der Gruppe nieder. Dabei fiel der Schein der Lampe auf sein Gesicht. Der Vaquero erkannte ihn.
»O Gott! Das ist Señor Sternau! Wir sind gerettet!« rief er aus. – »Ja, mein braver Antonio, Ihr seid gerettet. Wie steht es mit dem Señor?« – »Er lebt. Wir haben ihn verbunden. Er kann nur ganz leise sprechen. Habt Ihr gehört, was mit ihm geschehen ist?« – »Ja.« – »Fluch dieser Josefa Cortejo!« – »Die Schuldigen werden ihre Strafe erhalten. Also gehen kann Señor Arbellez?« – »Daran ist nicht zu denken!« – »Nun, so mag Euch noch für wenige Minuten das Bewußtsein genügen, daß Ihr frei seid. Ich lasse die Tür offen, damit Ihr frische Luft erhaltet; ich muß wieder nach oben, werde Euch aber in kurzer Zeit holen. Bleibt einstweilen bei dem Señor zurück.« – »O heilige Jungfrau, welch eine Gnade!« sagte jetzt auch Marie Hermoyes. »Seid Ihr es denn wirklich, mein lieber, guter Señor Sternau?« – »Ja, ich bin es«, antwortete er. – »Und wir sind frei, wirklich frei?« – »Die Befreier sind da. Hört Ihr die Schüsse?« – »Ja, ich höre sie«, sagte der Vaquero. »Wer ist es? Ist vielleicht der Präsident Juarez mit seinen Leuten bereits hier?« – »Nein. Büffelstirn hat seine Mixtekas zusammengerufen. Bis Juarez konnte, hätte es zu lange gedauert.«
Sternau leuchtete jetzt ganz nieder zu dem Haziendero. Dieser lag mit offenen Augen da und hielt den Blick auf Sternau geheftet. Er bot einen fast totenähnlichen Anblick dar, aber ein glückliches Lächeln lag über seinem leichenblassen Gesicht ausgebreitet.
»Mein guter Señor Arbellez, kennt Ihr mich noch?« fragte Sternau, indem ihm eine große Träne in das Auge trat.
Der Gefragte nickte leise mit dem Kopf.
»Hat Antonio Euch erzählt, daß wir alle gerettet sind, daß wir alle noch leben und Eure Tochter Emma auch?«
Ein zweites Nicken war die Antwort.
»Nun, so tragt keine Sorge um sie. Sie befindet sich bei Juarez in vollständiger Sicherheit; Ihr werdet sie recht bald wiedersehen. Ich werde nachher sogleich nach Euren Wunden sehen; vorher aber muß ich hinauf, um mich zu überzeugen, wie die Sachen stehen.«
Sternau setzte den Gefangenen das Licht hin und begab sich wieder nach oben. Einigen Mixtekas, auf die er zuerst traf, befahl er, sich zu den drei Personen hinabzubegeben, um sie gegen etwaige Gefahren in Schutz zu nehmen. Sie beeilten sich, seiner Weisung nachzukommen.
Der Flur des Hauses bot einen gräßlichen Anblick dar. Es standen zwei Mixtekas da, die Fackeln hielten. Beim Schein derselben erblickte man die toten Anhänger Cortejos, die in allen möglichen grausigen Stellungen hoch übereinanderlagen. Der Boden bildete eine einzige Blutlache. Auch auf den Treppen lagen sie, überrascht von den schonungslosen Waffen der Mixtekas. In den oberen Räumen hörte man noch einzelne Todesschreie erschallen. Draußen im Hof und vor dem Haus aber war der Kampf noch im lebhaftesten Gange. Schüsse krachten; Rufe der Wut oder der Aufmunterung ließen sich hören, darunter Flüche, ausgestoßen von den keine Gnade findenden Mexikanern, die sich dem überlegenen Feind gegenüber rettungslos verloren sahen.
Als Sternau aus der Tür trat, konnte er die Szene überblicken. Einige vorhandene Holzhaufen waren von den Mixtekas in Brand gesteckt worden, und beim Schein dieser hoch emporlodernden Feuer ließ sich alles deutlich erkennen.
In einer Ecke des Hofes hatten sich die letzten Mexikaner zusammengedrängt. Es waren nicht mehr als zwölf bis fünfzehn Mann, die sahen, daß weder auf Hilfe, noch auf Gnade zu rechnen war, und sich daher mit Aufbietung ihrer letzten Kräfte verteidigten. Man sah, daß sie trotz ihrer Tapferkeit nur noch Augenblicke zu leben hatten.
Büffelstirn stand mit dem Rücken am Palisadenzaun und sandte eine Kugel nach der anderen in diese jetzt dem Tode geweihte Schar hinein.
»Schenken wir ihnen das Leben!« rief Sternau ihm zu. »Es ist genug Blut geflossen. Wir wollen menschlich sein.« – »Ist Señor Arbellez wohlauf?« fragte der Häuptling kalt. – »Er liegt noch im Keller. Man wird ihn herauftragen.« – »Man hat ihn also geschlagen, daß er nicht gehen kann?« – »Leider!« – »So sprich nicht von Gnade! Arbellez ist mein Freund und Bruder; er soll gerächt werden!«
Büffelstirn drehte sich wieder ab, hob die Büchse und drückte sie gegen einen der Feinde ab. Sternau sah ein, daß hier eine Gegenrede keinen Erfolg haben werde.
Seine Aufmerksamkeit wurde übrigens durch eine Gruppe in seiner unmittelbaren Nähe in Anspruch genommen. Am Boden lag nämlich ein verwundeter Mexikaner, der sich mit Aufbietung aller seiner geschwächten Kraft gegen einen Mixteka verteidigte, der sich bemühte, ihm das Messer in das Herz zu stoßen.
»Gnade, Gnade!« bat der Mann. – »Keine Gnade! Du mußt sterben!« antwortete der andere grimmig, indem er den jetzt fast Wehrlosen mit der Linken fest packte, während er mit der Rechten die Waffe schwang. – »Ich bin ja kein Feind. Ich habe die Gefangenen gespeist Sie hätten ohne mich verhungern und verdursten müssen!«
Auch diesen von der Todesangst diktierten Zuruf achtete der Mixteka nicht. Er stand im Begriff, dem Mexikaner den unfehlbaren Todesstoß zu versetzen, da aber wurde sein hocherhobener Arm von Sternau ergriffen.
»Halt!« gebot dieser. »Wir müssen diesen Mann erst hören.«
Der Mixteka wandte sein von der Aufregung des Kampfes verzogenes Gesicht dem Störer zu und sagte:
»Was geht es dich an! Ich habe diesen Mann niedergeworfen und besiegt; sein Leben ist mein Eigentum!« – »Wenn er das wirklich getan hat, was er sagt, so verdient er Gnade.« – »Ich habe ihn überwunden, und er soll sterben!«
Da zog Sternau seinen Revolver, ließ die Hand des Mixteka los und sagte:
»Stich zu, wenn du es wagst, ihn gegen meinen Willen zu töten!«
Dabei richtete er den Lauf seiner Waffe gegen ihn. Der Indianer konnte sich dem Eindruck von Sternaus Persönlichkeit nicht entziehen.
»Du drohst mir, deinem Verbündeten?« fragte er. – »Ja. Tötest du ihn, so bist auch du eine Leiche.« – »Gut. Ich werde mit Büffelstirn sprechen!« – »Tue das; aber versuche nicht, gegen meinen Willen zu handeln!«
Der Mixteka ließ von dem Mexikaner ab und ging zu seinem Häuptling. Sternau beachtete das nicht, sondern wandte sich zu dem Mann, der noch immer blutend am Boden lag, aber wenigstens von der unmittelbaren Todesgefahr errettet war.
»Du sagst, du habest die Gefangenen gespeist?« fragte er. – »Ja, Señor«, antwortete der Gefragte. »Ich danke Euch, daß Ihr diesem Indianer Einhalt geboten; ich wäre verloren gewesen.« – »Welche Gefangenen meinst du?« – »Die drei, die unten im Keller liegen. Ich habe ihnen täglich durch ein Loch Brot, Wasser und Licht hinabgelassen.« – »Warum?« – »Einer meiner Kameraden, der mit Cortejo fortgehen mußte, bat mich darum. Ich hoffe, daß Ihr das berücksichtigt, Señor.«
Sternau ahnte, daß der genannte Kamerad jedenfalls der Mexikaner sei, dem das Gesicht des Haziendero immer erschien und der, im Wald am Rio Grande sterbend, noch mit seinen letzten Worten gesagt hatte, daß er den Gefangenen Wasser und Brot gegeben habe.
»Gut«, sagte er, »du sollst leben. Wie steht es mit deinen Wunden?«
Sternau untersuchte ihn schnell; das Ergebnis war kein schlimmes.
»Du bist nicht gefährlich verletzt, der Blutverlust hat dich geschwächt; ich werde dich verbinden!« beruhigte er den Mexikaner, dann verband er ihn, so schnell es in der Eile gehen wollte und vertraute ihn endlich der Obhut der beiden Mixtekas an, die mit den Fackeln im Hausflur standen. Er war überzeugt, daß man seinen Befehl, diesem Mann nichts zu tun, respektieren werde.
Während sich diese Szene abspielte, war auch der Kampf beendet. Die letzten im Hof befindlichen Mexikaner waren tot. Nur draußen im freien Feld hörte man hier oder da noch einen vereinzelten Schuß fallen. Bärenherz trat zu Sternau, der beobachtend am Eingang stand.
»Der Sieg ist unser«, meldete er in seiner einfachen, wortkargen Weise. – »Sind Feinde entkommen?« fragte Sternau. – »Nur einige.« – »Man mag sie immerhin entwischen lassen. Die Rache ist blutig genug ausgefallen.« – »Lebt Señor Arbellez?« – »Ja. Wir wollen hinab zu ihm.«
Auch Büffelstirn trat hinzu. Er erwähnte kein Wort darüber, daß Sternau einen der Feinde in Schutz genommen hatte. Die drei begaben sich nach dem Keller, wo sie die befreiten Gefangenen unter dem Schutz der Mixtekas fanden, die Sternau hinabgesandt hatte.
Büffelstirn kniete neben Arbellez nieder.
»Kennt Ihr mich, Señor?« fragte er.
Der Haziendero nickte.
»Wer hat Euch schlagen lassen? Die Tochter des Cortejo?«
Ein zweites Nicken diente als Antwort.
»Leidet Ihr große Schmerzen?«
Der Verwundete antwortete durch ein leises Stöhnen, das mehr verriet als viele Worte. Er mußte Fürchterliches ausgestanden haben.
»Es sind viele der braven Mixtekas im Kampf verletzt worden«, sagte Sternau, »aber Señor Arbellez soll der erste sein, dem ärztliche Hilfe zuteil wird. Tragen wir ihn hinauf in ein ruhiges Zimmer.« – »Er soll von mir gepflegt werden«, meinte Marie Hermoyes. »Ich werde nicht ruhen, bis seine Wunden wieder geheilt sind.«
Sternau eilte voraus, um ein passendes Zimmer auszusuchen, in das der Haziendero getragen wurde. Als Sternau ihn untersuchte, sah man, wie geradezu teuflisch er mißhandelt worden war. Er mußte fürchterliche Schmerzen ausgestanden haben.
Als er von Sternau kunstgerecht verbunden worden war, ließen diese Schmerzen nach. Man sah es ihm an, welche Erleichterung er fühlte. Er ergriff die Hand des Arztes, drückte sie leise und flüsterte:
»Dank, Señor!«
Mehr konnte er nicht sagen. Büffelstirn legte ihm die Hand auf den Kopf.
»Ich werde meinen Bruder Arbellez rächen«, beteuerte er. »Niemand soll mich daran hindern. Wo ist die, die ihn hat schlagen lassen?«
Am besten konnte der antworten, der soeben eingetreten war, nämlich Helmers. Er hatte die Anwesenden gesucht und bei seinem Eintritt die Frage gehört.
»Sie liegt gefesselt in Emmas Zimmer«, antwortete er. »Wir werden sofort Gericht über sie halten. Vorher aber muß ich den Vater begrüßen.«
Helmers bog sich über Arbellez und küßte ihn auf die bleichen Lippen.
»Das ist der Augenblick, nach dem ich mich lange Jahre gesehnt habe«, sagte er. »Jetzt ist mein Wunsch erfüllt, und nun kann die Rache beginnen.«
Arbellez hatte jetzt so viel Kraft, daß er die Arme langsam erheben konnte. Er legte sie Helmers um den Hals und erwiderte flüsternd:
»Gott segne dich, mein Sohn!«
Mehr zu tun oder mehr zu sagen, war er zu schwach, aber auf seinem Gesicht sprach sich deutlich das Glück aus, den Sohn wiedergefunden zu haben und nun bald auch die Tochter wiedersehen zu können. Dieser Ausdruck des Glückes mit dem Zuge des Leidens, unter dem er niederlag, war so rührend, so ergreifend, daß keiner der Anwesenden die Tränen zurückhalten konnte. Selbst Bärenherz sagte:
»Unser kranker Bruder soll wieder gesund werden und glücklich sein. Aber die, die ihn gepeinigt hat, soll unsere Rache fühlen!« – »Man hole sie!« meinte Büffelstirn. »An seinem Lager soll sie erfahren, welche Strafe sie erwartet.« – »Sie ist ein Weib!« mahnte Sternau.
Sein Ton war ein begütigender. Ihm graute im voraus bei dem Gedanken an die Strafe, die der Angeklagten bevorstand, wenn diese von Rache erfüllten Männer zusammentraten, um ihr Schicksal zu bestimmen.
Da aber legte Büffelstirn ihm die Hand auf den Arm und sagte:
»Sie ist kein Weib, sie ist ein Teufel. Mein Bruder hat es von mir verlangt, daß vorhin einer der Feinde sein Leben erhielt. Mehr aber verlange er nicht. Dieses Weib ist schlimmer als alle unsere Feinde. Es ist der böse Geist, der seinen Vater beherrscht. Josefa ist es, der wir alle Leiden zu verdanken haben. Sie werde gerichtet nach dem, wie sie gehandelt hat. Ich selbst werde sie holen.«
Damit ging Büffelstirn und brachte nach wenigen Minuten Josefa geführt.
3. Kapitel.
Josefa war an Händen und Füßen gefesselt und sah fürchterlich bleich aus.
Pedro Arbellez warf einen Blick auf sie und schloß die Augen, er mochte sie gar nicht mehr sehen. Auch Marie Hermoyes wandte sich zur Seite, nur Antonio, der Vaquero, sagte:
»Endlich haben wir dich, du Teufelin. Du wirst nie wieder meinen Herrn schlagen lassen und mich einkerkern können. Man wird dir dein Urteil sprechen. Ich möchte nicht an deiner Stelle sein!«
Josefa antwortete nicht, aber aus ihren runden Eulenaugen schoß ein giftiger, haßerfüllter Blick nach dem Sprecher.
»Wer wird sie verhören?« fragte Helmers. – »Verhören?« antwortete Büffelstirn, indem sich seine Brauen zusammenzogen. »Wozu soll sie verhört werden? Sie weiß, was sie verschuldet hat, und wir wissen es auch. Sie hat den Tod verdient.« – »Ja, den Tod!« sagte Bärenherz. – »Sie muß sterben, das versteht sich von selbst«, stimmte Helmers bei. – »Darüber sind wir also einig«, fuhr Büffelstirn fort. »Aber wo und wie soll sie sterben? Meine Brüder mögen beraten.« – »Ein einfacher Tod ist zu wenig«, erklärte Antonio, der Vaquero. – »Ihr Sterben soll ein zehnfaches sein«, antwortete Büffelstirn. »Ich weiß, welches Urteil wir über sie fällen müssen. Wir geben sie den Krokodilen zu fressen.« – »Das ist zu wenig«, fiel der Vaquero ein. »Was hätte sie da für Schmerzen auszustehen? Ein Druck und ein Schluck, dann ist sie weg. Das ist keine Strafe für alles das, was sie auf dem Gewissen hat.« – »Sie soll nicht schnell sterben, sondern die Krokodile sollen nach ihr springen müssen«, entgegnete Büffelstirn. »Wissen meine Brüder, was ich meine?« – Ja«, antwortete Helmers, »ich stimme bei.« – »Der Wille meines Bruders ist auch der meinige«, erklärte Bärenherz. – »Und was sagt der Fürst des Felsens dazu?« fragte der Mixteka.
Sternau schauderte, er dachte an die Szenen, die sich vor Jahren am Teich der Krokodile abgespielt hatten. Das war ein fürchterliches Urteil. Josefa hatte es verdient, dennoch antwortete er:
»Auch ich erkläre, daß sie den Tod verdient hat, aber ich werde meine Einwilligung zu einer solchen Grausamkeit nicht geben.« – »Mein Bruder tut unrecht, sie zu beschützen«, entgegnete Bärenherz. »Will er sie erschießen lassen? Eine Kugel wäre eine Belohnung für sie.« – »Es bleibt bei dem, was ich gesprochen habe«, erklärte Büffelstirn. – »Trotzdem ich meine Einwilligung versage?« fragte Sternau. – »Ja, trotzdem! Mein Bruder hat eine Stimme, wir aber überstimmen ihn, er wird sich in unseren Willen schicken müssen.« – »Nach den Gesetzen der Prärie und der roten Männer ist das richtig. Aber ich habe zu bemerken, daß ich ein größeres Recht als alle anderen auf dieses Mädchen habe.« – »Unser Recht ist ebenso groß!« erklärte Büffelstirn. – »Nein. Meine Brüder kennen die Geschichte der Familie Rodriganda. Es gibt da Geheimnisse, die aufzuklären sind, und Josefa Cortejo kann mir allein Auskunft geben. Es darf ihr nichts geschehen, bevor sie mir nicht alles gestanden hat. Das fordere ich ganz bestimmt.« – »Mein Bruder hat recht«, sagte auch Bärenherz. »Aber er braucht ja nicht zu säumen. Hier steht sie, er kann fragen, und dann mag sie sterben.«
Josefa hatte bisher kein Wort gesprochen. Sie hielt die Augen nicht niedergeschlagen, sondern trotzig in die Ecke gerichtet. Sie war sich in diesem Augenblick bewußt, daß ihr Leben für Sternau einen viel zu großen Wert habe, als daß er in ihren Tod willigen könne.
Sie sagte sich, so lange sie nicht gestehe, müsse er sie leben lassen; darum nahm sie sich vor, diesen Vorteil sich um keinen Preis entwinden zu lassen.
Sternau zeigte auf einen Stuhl.
»Setzt Euch, Señorita«, sagte er zu ihr. »Ich habe mit Euch zu sprechen!«
Josefa tat, als ob sie Sternaus Worte gar nicht gehört habe.
»Gut, Ihr werdet auch im Stehen reden können«, meinte er. »Ihr seid mit den Verhältnissen der Familie Rodriganda gut bekannt?«
Josefa antwortete nicht.
»Ich fragte, ob Ihr die Verhältnisse der Familie Rodriganda kennt!«
Sie schwieg auch jetzt noch. Da zog Sternau die Brauen finster zusammen und sagte:
»Ich sehe ein, daß man mit Euch anders verfahren muß. Ihr zwingt mich, Euch auf gewaltsame Weise zur Sprache zu verhelfen, die Euch abhanden gekommen zu sein scheint. Wollt Ihr reden?«
Josefa schwieg noch immer. Da rief Sternau zornig: »Antonio, führe sie hinab und gib ihr zwanzig Hiebe, aber ebenso fest wie diejenigen, die Señor Arbellez erhalten hat.«
Der Vaquero schmunzelte.
»Das soll sehr gewissenhaft besorgt werden, Señor«, antwortete er. »Soll ich sie wiederbringen?« – »Natürlich!« – »Schön! Vorwärts, Señorita! Ihr sollt nicht zu kurz kommen.«
Damit faßte der Vaquero Josefa am Arm, um sie zur Tür hinauszuführen. Als Josefa merkte, daß es ernst war, gab sie endlich ihren Trotz auf.
»Was soll ich von den Rodrigandas wissen«, sagte sie mürrisch. – »Ah! Jetzt ist die Sprache wieder da! Für dieses Mal will ich daher das von mir diktierte Rezept noch nicht in Anwendung bringen. Stellt aber meine Nachsicht nicht zum zweiten Male auf die Probe; es würde Euch nur schlecht bekommen! Also Ihr wißt nichts über die Verhältnisse der Rodrigandas?« – »Nur so viel, wie ich als Tochter eines Mannes weiß, der bei den Rodrigandas angestellt ist.« – »Nun, was ist das?« – »Was wollt Ihr erfahren?« – »Ich will kein langes Verhör anstellen, sondern mich kurz fassen. Ihr wißt, daß Alfonzo nicht der Sohn des Grafen Rodriganda ist.« – »Was soll er sonst sein?« – »Der Sohn eines anderen, Eures Onkels Cortejo.« – »Das ist lächerlich!«
Josefa schlug bei diesen Worten wirklich eine helle, höhnische Lache auf.
»Ihr werdet nicht lange lachen, Señorita. Ich sagte bereits, daß ich kein umfangreiches Verhör anstellen will. Ihr habt einfach zu wählen, zwischen dem Tode und einem offenen Geständnis.«
Sternau sah Josefa einen Augenblick erwartungsvoll an. Ihre Miene zeigte, daß ihre Zuversicht erschüttert war, aber dennoch fiel es ihr nicht ein, die Mahnung Sternaus zu beherzigen.
»Ich habe nichts zu bereuen und keine Bekenntnisse abzulegen.«
Nach diesen in trotzigem Ton gesprochenen Worten wandte sie sich ab, um anzudeuten, daß man nicht weiter in sie zu dringen brauche.
»Ganz, wie Ihr wollt, Señorita«, entgegnete Sternau. »Ihr mögt noch auf Rettung hoffen, aber die Erfüllung dieser Hoffnung ist eine Unmöglichkeit. Da Ihr selbst nichts tut, um das Euch drohende Schicksal von Euch abzuwenden, so dürft Ihr auch von mir nichts erwarten.«
Nun machte auch Büffelstirn eine Bewegung der Ungeduld.
»Wozu diese vielen Worte? Dieses Weib ist ja gar nicht wert, die Stimme eines Menschen zu hören.« – »Du hast recht«, antwortete Sternau. »Man schaffe sie fort! Ihr Anblick ist mir widerlich; er erregt in mir Grauen und Abscheu.« – »Wohin?« fragte der Vaquero. – »Schließt sie in den Keller ein, in dem Ihr selbst gesteckt habt. Zwei Männer mögen Wache halten. Sie haften mir mit ihrem Kopf dafür, daß die Gefangene nicht entkommt.« – »Das soll besorgt werden, Señor. Sie mag das Logis kennenlernen, das sie uns angewiesen hat. Soll sie auch hungern und dürsten?« – »Natürlich.« – »So kommt, meine schöne Señorita!«
Antonio legte die Hand an Josefa, um sie fortzuschaffen. Sie schüttelte jedoch mit einer schnellen Bewegung diese Hand von sich ab und sagte entrüstet:
»Wie, einsperren lassen wollt Ihr mich, Señor Sternau, mich, eine Donna? Mich, die Tochter eines Cortejo?« – »Nennt Euch um Gottes willen nicht Donna! Ihr seid ein Scheusal und die Tochter des größten Schurken, den ich kenne. Führe sie ab, Antonio!« – »Ich gehe nicht mit!«
Josefa stampfte mit dem Fuß, machte Miene, trotz ihrer gefesselten Hände sich zur Wehr zu setzen, und als Antonio dennoch die Hand ausstreckte, um sie anzufassen, spuckte sie ihm ins Gesicht und rief:
»Packe dich, Mensch, wie darfst du es wagen, mich anzurühren!«
Das war dem braven Vaquero denn doch zu viel. Er holte aus und gab Josefa eine Ohrfeige, die so kräftig war, daß die Getroffene zu Boden stürzte.
»Was? Anspucken willst du mich, Kanaille?« rief er wütend. »Das sollst du nicht zum zweiten Male wagen.«
Damit riß er sie empor und schaffte sie aus dem Zimmer. Die Ohrfeige hatte Josefa so eingeschüchtert, daß ihr alle Lust zum Widerstand vergangen war.
4. Kapitel.
»Du willigst nun in unser Urteil?« fragte Büffelstirn Sternau. – »Ja«, antwortete dieser nach einigem Zögern. – »Daß sie von den Krokodilen gefressen wird.« – »Ja. Sie ist eine Milderung dieses Urteils nicht wert.« – »So werden wir mit Anbruch des Tages nach dem Berg El Reparo reiten, um sie in den Teich der Krokodile zu werfen.« – »Das ist zu früh«, erklärte Sternau. »Es haben noch andere über sie zu sprechen und an ihrem Verhör teilzunehmen. Wir müssen warten, bis Mariano und Graf Ferdinando angekommen sind. Anders geht es nicht.« – »Das wird sehr lange dauern.«
Schließlich gewann aber doch Sternaus Ansicht und Wunsch die Oberhand, und das Urteil wurde verschoben.
»Ich sehe, Sie wollen Zeit gewinnen«, meinte Helmers mürrisch. »Was werden Sie von ihr erfahren? Nichts, gar nichts! Sie wissen ja bereits alles.« – »Sie irren. Noch ist uns einiges unbekannt und unerklärlich. Und es genügt keineswegs, daß Mariano hintritt und sagt, er sei der Sohn des Grafen Emanuel de Rodriganda. Es sind Dokumente und Zeugen nötig, dies zu beweisen. Diese Josefa ist jedenfalls in alles eingeweiht, und darum ist uns ihre Aussage von der allergrößten Wichtigkeit.« – »Ah, sie soll Zeugnis ablegen, das heißt, sie soll so lange leben, bis der Prozeß, der in dieser Angelegenheit in Aussicht steht, beendet ist?« – »Diese Frage kann noch nicht beantwortet werden. Ein Geständnis an anderer Stelle genügt, wenn es von unparteiischen Zeugen beeidet wird.« – »Nun, wir sind ja Zeugen.« – »Aber mehr oder weniger beteiligt. Der beste Zeuge wird Juarez sein. Wir müssen auf alle Fälle warten, bis er hier angekommen ist.« – »Ich wiederhole, daß es schade um die Zeit ist. Das Mädchen wird niemals ein Geständnis ablegen. Hier liegt Señor Arbellez, den ich meinen Vater nenne; wir wissen, was mit ihm geschehen ist. Ebenso wissen wir alle, daß wir unsere früheren Schicksale zum großen Teile dem Einfluß dieses Mädchens zu verdanken haben. Schreit das nicht nach Rache, und zwar nach augenblicklicher Rache? Wollen wir einen Akt der Gerechtigkeit aufschieben, den zu vollziehen unsere Pflicht ist?« – »Mein Bruder Donnerpfeil hat recht«, erwiderte Büffelstirn. – »Er hat recht«, stimmte auch Bärenherz bei.
Sternau ging. Die drei anderen, nämlich Büffelstirn, Bärenherz und Donnerpfeil folgten ihm, blieben aber draußen im Korridor wie auf vorherige Verabredung stehen.
»Was sagen die beiden Häuptlinge dazu?« fragte Donnerpfeil halblaut. »Ist es gut, daß wir Sternau seinen Willen gelassen haben?« – »Ugh!« antwortete der Apache. »Der Fürst des Felsens ist klug. Er wird wissen, was er will, wenn auch ich es nicht weiß.« – »Nach seinen Gedanken hat er recht«, erklärte auch Büffelstirn. – »Auch ich stelle das keineswegs in Abrede; aber ich dürste nach Vergeltung!« – »Mein Bruder Donnerpfeil braucht ja nicht darauf zu verzichten«, meinte Büffelstirn. – »Ich muß aber doch verzichten, wenigstens für jetzt.« – »Nein. Die Rache kann bereits beginnen.« – »Wieso?« – »Man bereite der Gefangenen Qualen, so, wie sie welche bereitet hat.«
Helmers wußte sogleich, daß der Häuptling der Mixtekas einen bestimmten Gedanken habe. Darum fragte er rasch:
»Welche Qualen meint unser Freund Büffelstirn?« – »Die Qualen des Todes. Dieses Weib soll viele Male sterben. Sie soll die Rachen der Krokodile oft gegen sich geöffnet sehen.« – »Ah, ich begreife! Josefa Cortejo soll nach dem Berg El Reparo geschafft werden und denken, daß die Exekution ausgeführt wird?« – »Ja. Sie soll alle Tage, bis Juarez kommt, nach dem Teich der Krokodile geschafft und über dem Wasser aufgehängt werden.«
Helmers Augen leuchteten vor Vergnügen bei dem Gedanken auf, welche Qualen dies dem boshaften Weib machen werde.
»Das ist gut; das ist schön!« entgegnete er. »Aber wird Sternau es dulden?« – »Nein«, sagte Bärenherz.
Der Apache kannte den Deutschen sehr genau.
»So müssen wir es heimlich tun.« – »Ja, wir werden Sternau nichts sagen«, stimmte Büffelstirn bei. »Wird mein Bruder Bärenherz mit uns reiten?« – »Nein«, antwortete der Gefragte. »Sternau ist mein Bruder. Ich tue das, was er wissen darf.« – »Er ist auch mein Bruder«, antwortete Büffelstirn. »Aber noch viel eher war Arbellez mein Freund. Er ist bis auf die Knochen zerfleischt worden, und ich habe dies zu rächen. Reitet Donnerpfeil mit?« – »Ja«, antwortete dieser. »Ich hoffe nicht, daß Bärenherz Sternau sagen wird, was wir vorhaben.« – »Bärenherz ist kein Verräter«, erwiderte der Apache einfach. Dann wandte er sich um und stieg die Treppe hinab.
Er war ein goldreiner Charakter. Seiner indianischen Anschauungsweise nach hatte er allerdings für augenblickliche Rache gestimmt; nachdem er sich aber der Ansicht Sternaus angeschlossen, widerstrebte es ihm, sich an etwas zu beteiligen, das diesem verschwiegen bleiben mußte.
Die beiden anderen blieben zurück.
»Wann reiten wird?« fragte Helmers. – »Bei Tagesgrauen«, antwortete Büffelstirn. – »Allein?« – »Nein. Ich nehme mehrere meiner Männer mit.«
Das war also abgemacht, ohne daß Sternau eine Ahnung von dem hatte, was man hinter seinem Rücken besprochen. Er war jetzt mit den verwundeten Mixtekas vollauf beschäftigt. Gefallen waren ihrer nur wenige, desto mehr aber verwundet. Die Stube, die die Mexikaner als Wachstube benutzt hatten, wurde zum Verbandzimmer und Lazarett eingerichtet. Die Nacht war fast vergangen, als der letzte der Verwundeten seinen Verband angelegt erhalten hatte.
Fünf zuverlässige Männer, die zugleich gute Reiter waren, hatten gleich nach errungenem Sieg den Auftrag erhalten, sich auf den Weg nach Coahuila zu machen, um Juarez von dem Geschehenen zu benachrichtigen. Sie waren auch sofort aufgebrochen und hatten einen Weg gewählt, der sie nicht in Gefahr brachte, Franzosen zu begegnen.
Es fragte sich nun, was mit den Leichen der Gefallenen anzufangen sei. Büffelstirn war sofort mit einer Antwort bei der Hand.
»Die Krokodile der Mixtekas haben lange kein Fleisch gefressen. Man lade die Toten auf Pferde und bringe sie nach dem Berg El Reparo.«
Sternau schüttelte den Kopf.
»Das wäre grausig und zugleich zu anstrengend«, sagte er. »Wir begraben sie.« – »Man müßte eine sehr große Grube haben, und es wäre ebenso anstrengend, sie zu bereiten.« – »Wir brauchen keine Grube zu graben. Ich kenne von früher her die Vertiefung eines Steinbruchs hier ganz in der Nähe. Wir werfen die Leichen hinein und werfen dann dort herumliegende Steine und Erde darauf.« – »Ich kenne den Steinbruch. Er eignet sich sehr gut zum Grab so vieler Leute. Aber warum sollen wir uns die Arbeit machen, die Leichen auch noch zu bedecken. Die Aasgeier werden kommen, um das Fleisch der Gefallenen in ihren Magen zu begraben.« – »Das widerstrebt mir. Ich selbst werde das Begräbnis beaufsichtigen. Will mir mein Bruder Büffelstirn so viele von seinen Männern geben, als ich brauche?« – »Ja, mein Bruder mag sie sich selbst auswählen.«
Der Häuptling der Mixtekas gab diese Antwort sehr gern. Um zu dem Steinbruch zu kommen, mußte Sternau ja die Hazienda verlassen, und so konnte er also nicht bemerken, was mit Josefa vorgenommen wurde.
Der Morgen begann sich eben zu lichten, als eine beträchtliche Schar der Mixtekas unter Sternaus Anführung die Hazienda verließ. Sie hatten die Toten auf Pferde geladen und führten alles Werkzeug bei sich, das zum Graben geeignet war.
Jetzt suchte Büffelstirn Helmers auf, der sich auch leicht finden ließ.
»Es ist Zeit, aufzubrechen«, sagte er. – »Ich bin bereit«, antwortete Helmers. »Aber deine Leute werden sehen, daß wir Josefa Cortejo mitnehmen!« – »Sie werden nicht davon sprechen. Komm!«
Sie stiegen zum Keller hinab. Dort standen zwei Mann Wache. Helmers trug den Schlüssel bei sich und öffnete die Tür. Josefa lag an der Erde und machte keine Anstalten, sich zu erheben.
»Die Tochter Cortejos mag aufstehen und mit uns kommen«, sagte der Häuptling der Mixtekas, indem er sie mit dem Fuß stieß. – »Was wollt Ihr mit mir tun?« fragte sie. – »Das wirst du sehen.«
Und als Josefa auch jetzt noch nicht aufstand, faßte der Indianer sie beim Arm, riß sie mit starker Hand empor und aus dem Loch heraus. Diese Behandlung verursachte ihr einen solchen Schmerz, daß sie laut aufschrie.
»Wenn Büffelstirn befiehlt, so hast du zu gehorchen! Merke dir das!« sagte er. Und sich zu den Wachen wendend, fuhr er fort: »Donnerpfeil wird wieder zuschließen; ihr aber bleibt hier, gerade so, als ob dieses Weib sich noch darin befände. Der Fürst des Felsens darf nicht wissen, daß wir sie heimlich mitgenommen haben. Auch die anderen alle haben zu schweigen. Sagt ihnen das!«
Josefa wurde nun in den Hof geführt und auf ein Pferd gebunden. Auch die beiden Männer stiegen auf und ritten, von zehn Mixtekas begleitet, nach Westen hin davon, in welcher Richtung der Berg El Reparo lag.
Als nach einigen Stunden Sternau zurückkehrte und Büffelstirn suchte, um ihn nach etwas zu fragten, fand er ihn nicht. Einer der Mixtekas berichtete ihm:
»Er ist ausgelitten.« – »Allein?« – »Nein. Donnerpfeil war mit ihm und einige Männer von uns.« – »Weshalb verließen sie die Hazienda?« – »Ich weiß es nicht.« – »Wohin sind sie?« – »Auch das weiß ich nicht.«
Das kam Sternau sonderbar vor. Er suchte Bärenherz auf und fand ihn, hinter dem Haus liegend, im Schlaf. Der Apache war ermüdet gewesen, hatte aber vorgezogen, seine Ruhe im Freien abzuhalten. Sternau weckte ihn.
»Hat mein Bruder den Häuptling der Mixtekas davonreiten sehen?« fragte er. – »Nein.« – »Weiß mein Bruder auch nicht, wohin er ist?« – »Ich weiß es.« – »Nun, wohin ritt er?« – »Ich darf es nicht sagen.« – »Ah! Warum?« – »Ich habe es versprochen.« – »So darf ich auch nicht wissen, was Büffelstirn und Donnerpfeil vorhaben?« – »Nein.«
Sternau blickte nachdenklich vor sich hin. Dann sagte er:
»Wenn Bärenherz versprochen hat, zu schweigen, so darf er allerdings nicht reden. Aber ich möchte wenigstens erfahren, ob ich mich über die Abwesenheit der beiden Freunde beruhigen kann.« – »Ich glaube nicht, daß ihnen etwas geschehen wird.« – »Tun sie etwas, was ich nicht billigen würde?« – »Darüber darf der Apache nichts sagen.« – »Ah! Sie sind vielleicht gar nach dem Berg El Reparo geritten?« – »Mein Mund darf nicht reden.«
Nach diesen Worten drehte der Apache sich auf die andere Seite, zum Zeichen, daß er mit dieser Angelegenheit nichts mehr zu tun haben wolle.
»Ich werde es doch erfahren!« sagte Sternau.
Von einer bestimmten Ahnung getrieben, kehrte er in das Haus zurück und stieg in den Keller hinab. Dort standen die beiden Wachen vor der Tür.
»Wo befindet sich die Gefangene?« fragte er. – »Hier in diesem Loch«, antwortete der eine. – »Schließt auf!« – »Wir können nicht, wir haben keinen Schlüssel.« – »Wer hat ihn?« – »Donnerpfeil.« – »War Büffelstirn oder Donnerpfeil vorhin bei euch?« – »Nein.« – »Habt ihr gehört, daß diese beiden fortgeritten sind?« – »Nein.« – »Ruft einmal die Gefangene. Klopft an die Tür.« – »Sie antwortet nicht.«
Sternau versuchte es selbst. Er klopfte und rief, erhielt aber keine Antwort.
»Sie ist wie der Käfer, der sich totstellt, wenn er angerührt wird«, meinte der eine der beiden Wächter.
Dennoch aber fühlte Sternau sich nicht beruhigt. Er fragte nochmals sehr eindringlich:
»Sie befindet sich also wirklich da drin?« – »Ja.« – »Wenn ihr euch täuschtet, könnte großes Unheil entstehen!«





























