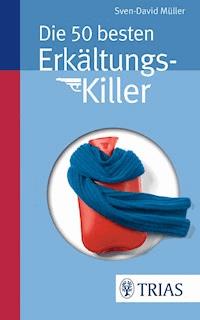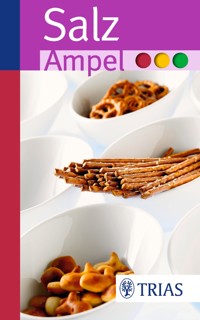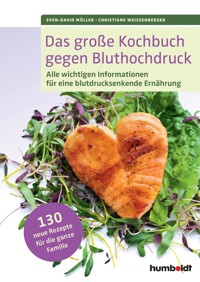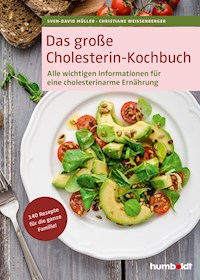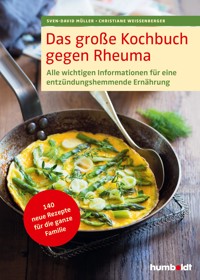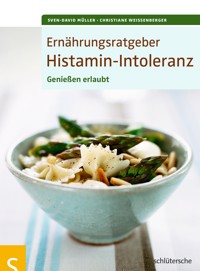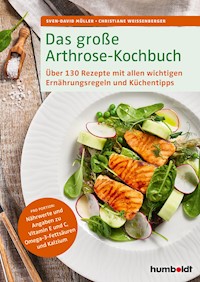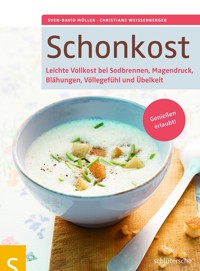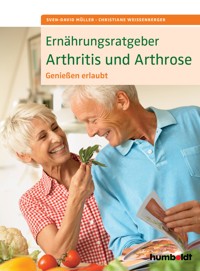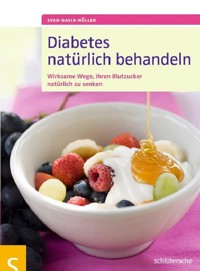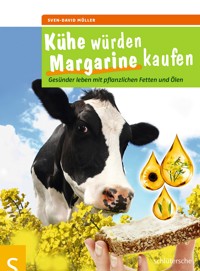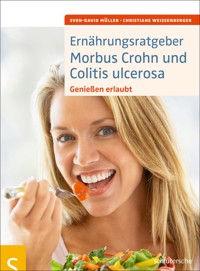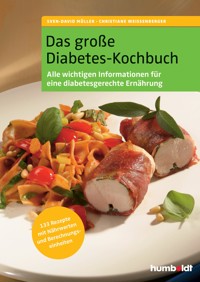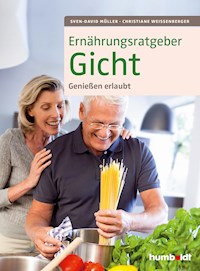
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Richtig essen und Gelenkschmerzen lindern Ein erhöhter Harnsäurespiegel ist der Grund für Gichtsymptome wie schmerzhafte Entzündungen in Füßen und Fingern. Bei Gicht hilft auf Dauer nur eine Ernährungsumstellung – aber es gibt auch eine gute Nachricht: Häufig wird damit schon eine Normalisierung der Harnsäurewerte erreicht. Dieser Ernährungsratgeber informiert ausführlich über die Krankheit und erläutert die Behandlungsmöglichkeiten. Die leckeren Rezepte von Sven-David Müller und Christiane Weißenberger zeigen, dass man auch bei Gicht auf Herzhaftes und Süßes nicht zu verzichten braucht. Wer dieser ausgewogenen Ernährung folgt, muss sich obendrein keine Sorgen um seine Figur machen. Im Gegenteil: Sie hilft dabei, überflüssige Pfunde loszuwerden und somit schmerzhafte Entzündungen spürbar zu lindern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 85
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
7 klare Regeln gegenerhöhte Harnsäurewerte im Blut
1. Normalisieren Sie Ihr Gewicht durch eine leicht kalorienreduzierte Kost und mehr Bewegung. Beim Abnehmen sollten Sie strenge Fastenkuren vermeiden, da durch die schnelle Gewichtsreduktion der Harnsäurespiegel erhöht wird.
2. Meiden Sie purinreiche Lebensmittel wie Innereien (Leber, Herz), Meeresfrüchte, Sardellen, Sprotten, Ölsardinen sowie die Haut von Fisch, Geflügel und Schwein. Die Mengen sollten 100 g (z. B. ein kleines Schnitzel) nicht überschreiten.
3. Ihr Speiseplan sollte vorwiegend aus Getreideprodukten sowie Milch und Milchprodukten bestehen. Als Eiweißlieferanten eignen sich auch Eier.
4. Gemüse und Obst sind ebenfalls wertvolle ballaststoffreiche Lebensmittel und können, bis auf einige Ausnahmen, reichlich (täglich mindestens 250 g) verzehrt werden. Gemieden werden sollten Hülsenfrüchte wie Erbsen, weiße Bohnen und Linsen sowie Spinat.
5. Die Ernährung sollte möglichst fettarm sein, da fettreiche Kost die Harnsäureausscheidung über die Niere vermindert und somit die Harnsäurewerte im Blut erhöht.
6. Zum Ausscheiden der Harnsäure ist viel Flüssigkeit notwendig. Deshalb sollten Sie täglich mindestens 2 Liter Flüssigkeit zuführen. Neben Mineralwasser eignen sich dafür auch verdünnte Obst- und Gemüsesäfte, Kräuter- und Früchtetees, in Maßen Kaffee und schwarzer Tee.
7. Alkohol sollten Sie nur mäßig konsumieren, denn nach Alkoholexzessen sind Gichtanfälle häufig und schmerzhaft, da der Alkohol die Harnsäureausscheidung hemmt und die Harnsäuresynthese in der Leber erhöht. Hohe Puringehalte hat beispielsweise das Bier, leider auch das alkoholfreie Bier.
VORWORT
HYPERURIKÄMIE UND GICHT – WICHTIG ZU WISSEN
Was ist Hyperurikämie und was ist Gicht?
Formen der Gicht
Der Gichtanfall
Harnsäureauskristallisation – welche Körperteile sind am häufigsten betroffen?
Die Medikamente
DIE ERNÄHRUNG UMSTELLEN – ABER WIE?
Richtig essen und trinken – was ist jetzt besonders wichtig?
Das richtige Gewicht
Nährstoffe in der purinarmen Ernährung
Richtig Trinken
Musterpläne
30 Ernährungstipps für das tägliche Leben
60 LECKERE REZEPTE BEI HYPERURIKÄMIE UND GICHT
Frühstücksträume
Purinarmes Luxusfrühstück
Kiwi-Orangen-Müsli
Birnen-Zimt-Müsli
Sonntagsfrühstück
Vollfruchtmüsli
Sonntagsbrötchen
Johannisbeerbrötchen
Käse-Trauben-Brot
Vollkornbrötchen „Südsee“
Herzhafte Mittagessen
Körnige Lauchcremesuppe
Französische Zwiebelsuppe
Gratinierte Tomatensuppe mit Basilikum
Schwäbische Käsespätzle
Möhrenpuffer mit Schafskäse
Knoblauchquark
Mediterranes Rührei
Eier in Senfsoße
Linsengemüse
Zucchini-Pilz-Ragout
Pellkartoffeln mit Meerrettichquark
Backkartoffeln „à la Méditerranée“
Überbackener Tomatenreis
Gefüllter Kohlrabi mit Parmesan-Kartoffelpüree
Gnocchi mit Austernpilzen und Mozzarella
Gemüselasagne
Bunte Gemüsepaella
Kabeljau mit Tomaten-Orangen-Soße
Lachs im Spinat
Schollenfilet mit Champignons
Fischfilet im Gemüsebett
Puten-Gemüse-Pfanne „Schanghai“
Zigeunergulasch
Hackbraten
Gemüsespaghetti
Leichte Abendessen
Chicoréesalat „Malteser Art“
Lauch-Apfel-Salat
Griechischer Salat
Möhren-Weißkohl-Frischkost
Bunter Hähnchensalat
Herbstsalat
Großer Rohkostteller
Marinierter Mozzarella mit Tomaten
Gazpacho
Fitnessburger
Eingelegte Joghurtkugeln „à la Kreta“
Pikante Apfel-Möhren-Paste
Kresse-Meerrettich-Aufstrich
Apfel-Sellerie-Aufstrich „à la méditerrané“
Avocado-Knoblauch-Aufstrich
Frühlingsbrot
Tomaten-Kresse-Brot
Süße Zwischenmahlzeiten und Desserts
Bananenquark
Rote Grütze mit Vanillecreme
Apfel-Birnen-Joghurt
Aprikosen-Brombeer-Traum
Obstspieße mit Joghurtdekor und Zimt
Heidelbeer-Halbgefrorenes
Apfeltorte
Käsekuchen
Exotischer Mango-Vanille-Drink
Möhren-Apfel-Shake
Pikanter Gemüsedrink
Heidelbeershake
VORWORT
Liebe Leserin, lieber Leser,
was hatten Alexander der Große, Michelangelo, der Sonnenkönig Ludwig XIV., Karl der Große, Peter Paul Rubens, Martin Luther, Casanova, Johann Wolfgang von Goethe, Charles Darwin, Winston Churchill, Gerd Fröbe und Franz Josef Strauß gemeinsam? Sie alle litten an Gicht.
Die Gicht gilt als Zivilisationskrankheit, die infolge einer erhöhten Belastung des Körpers mit Purinen auftritt. Purine befinden sich vor allem in tierischen Nahrungsmitteln. Im körpereigenen Stoffwechsel entsteht aus ihnen Harnsäure, ein hoher Harnsäurespiegel wiederum führt zum Gichtanfall.
Heute leiden mindestens 1,7 Millionen Menschen in Deutschland an Hyperurikämie und Gicht. Die Krankheit wird immer häufiger, da immer mehr Menschen an Übergewicht und dem sogenannten metabolischen Syndrom leiden. Ohne eine vernünftige Ernährungsweise, die wir in diesem Buch ausführlich beschreiben, kann eine medikamentöse Behandlung nicht ausreichend wirken. In vielen Fällen kann durch eine richtige harnsäurearme Ernährungsweise sogar die Einnahme von Medikamenten vermieden werden.
Dass eine Umstellung der Ernährung Spaß macht und die Speisen schmecken, beweist unser Ratgeber Kochbuch „Ernährungsratgeber Gicht – genießen erlaubt!“. Lecker essen und gleichzeitig die Gicht bekämpfen und die Harnsäure senken – unter diesem Motto steht unser Ratgeber.
Abwechslungsreiche, kreative Rezepte wurden mit hilfreichen und interessanten Informationen zum Thema Gicht kombiniert. Mehr als 60 Rezepte, die der ganzen Familie zusagen, bieten viele Anregungen und verführen zum Nachkochen.
Ihr
Sven-David Müller
Ihre
Christiane Weißenberger
Christiane WeißenbergerDiätassistentin/ Diabetes assistentin
Sven-David Müller, M. Sc.Diätassistent, Diabetesberater DDG und Gesundheitspublizist
»Lecker essen und gleichzeitig die Gicht bekämpfen und die Harnsäure senken – unter diesem Motto steht unser Ratgeber-Kochbuch.«
HYPERURIKÄMIE UND GICHT – WICHTIG ZU WISSEN
Hyperurikämie und Gicht werden auch als Wohlstandskrankheiten bezeichnet, da sie insbesondere durch ungesunde und reichliche Nahrungsaufnahme ausgelöst werden. Dieses Buch unterstützt Sie in Ihrer Umstellung auf eine harnsäurearme Ernährung und hilft Ihnen so, Ihr Gichtrisiko zu verringern.
Was ist Hyperurikämie und was ist Gicht?
Die richtige Ernährungsweise ist Grundlage jeder Behandlung von Hyperurikämie und Gicht.
In Deutschland leidet etwa zwei Prozent der Bevölkerung, oft unerkannt, an Gicht. Von erhöhten Harnsäurewerten (Hyperurikämie) sind 20 Prozent der westlichen Bevölkerung betroffen. Hyperurikämie und Gicht sind sogenannte Wohlstandskrankheiten, die insbesondere durch ungesunde und reichliche Nahrungsaufnahme ausgelöst werden. Die richtige Ernährungsweise ist Grundlage jeder Behandlung von Hyperurikämie und Gicht. Eine Ernährungsumstellung kann durch keine Medikamente ersetzt werden – die gute Nachricht lautet aber: Eine „Gicht-Diät“ hilft in vielen Fällen, auf Medikamente zu verzichten.
Vermutlich ist die Geschichte der Gicht so alt wie die Geschichte der Menschheit selbst. Der Begriff Gicht stammt aus der Volksmedizin des 12. Jahrhunderts, im Altangelsächsischen bezeichnete das Wort ghida den Körperschmerz. Über viele Jahrhunderte war die Gicht eine typische Krankheit der Reichen.
In kargen Kriegszeiten waren Gichterkrankungen selten, denn es gab kaum Fleisch und Alkohol. Dass Gichtanfälle überhaupt in Hungerzeiten auftreten, zeigt jedoch, dass die Gicht auch erblich bedingt sein kann. Ein angeborener Enzymdefekt ist dabei sehr selten, die häufigste erbliche Ursache ist eine Stoffwechselstörung. Als ernährungsbedingte Ursachen sind eine purinreiche Ernährung, hoher Alkoholkonsum, Überernährung und Übergewicht zu nennen.
Eine purinarme, ausgewogene Ernährung ist Grundlage der Behandlung.
Bei beiden Formen handelt es sich um eine Störung im Purinstoffwechsel. Purine sind Substanzen in der Nahrung. Da sie Bestandteile der Erbinformation jeder Zelle sind, kommen sie in fast allen tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln in unterschiedlichen Mengen vor. In der Regel enthalten tierische Nahrungsmittel mehr Purine als pflanzliche.
Bei beiden Formen handelt es sich um eine Störung im Purinstoffwechsel.
Beim Abbau der Purine aus der Nahrung entsteht Harnsäure. Jeder Mensch hat Harnsäure im Blut. Die im Körper anfallende Harnsäure stammt aus zwei Quellen: aus den Nahrungspurinen und den Purinen, die beim Abbau körpereigener Zellen anfallen.
Bei manchen Menschen kann Harnsäure nicht in ausreichender Menge ausgeschieden werden. Ein erhöhter Harnsäurespiegel kann dann zur Bildung von Harnsäurekristallen führen, die sich vor allem in Gelenken, Nieren und Harnwegen ablagern. Je höher der Harnsäurespiegel ist, umso wahrscheinlicher ist das Auftreten von Gichtanfällen.
Von einer erhöhten Harnsäurekonzentration im Blut bzw. Hyperurikämie spricht man ab einer bestimmten Konzentration von Harnsäure, bei der eine Ausfällung, d. h. die Kristallbildung, beginnt und sich die Harnsäure nicht mehr auflösen lässt. Dieser Grenzwert liegt etwa bei 0,4 mmol/l bzw. 6,5 mg/dl Blut. Als Gicht bezeichnet man die Folgen der Kristallablagerungen.
Formen der Gicht
Primäre Gicht
Mehrere Ursachen kommen für die Entwicklung der Primären Gicht infrage. Meist wird eine angeborene Neigung zu Gicht von äußeren Faktoren zusätzlich begünstigt. Kommen dann noch Risikofaktoren wie vermehrter Fleischkonsum oder der Verzehr anderer purinreicher Lebensmittel wie Hülsenfrüchte hinzu, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, dass Gicht entsteht.
Sekundäre Gicht
Die sekundäre Gicht entsteht aufgrund anderer Erkrankungen. Dies sind insbesondere:
• Krebserkrankungen des blutbildenden Systems, z. B. Lymphome
• Vermehrte Strahlenbelastung oder die Einnahme von Zellgiften wie bei einer Chemotherapie
• Nierenkrankheiten
• Erhöhter Milchsäurespiegel im Blut
• Alkoholmissbrauch
Die sekundäre Gicht entsteht aufgrund anderer Erkrankungen.
Weit weniger als fünf Prozent der Gichtfälle sind angeboren. In diesen wenigen Fällen ist die Gicht eine Stoffwechselerkrankung, die immer und dauerhaft medikamentös behandelt werden muss.
Der Gichtanfall
Hyperurikämie und Gicht entwickeln sich etwa 20 Jahre lang still. Der Krankheitsausbruch erfolgt beim Mann meist zwischen dem 45. bis 60. Lebensjahr in Form eines schmerzhaften Gichtanfalls. Die „östrogengeschütze“ Frau hingegen muss mit einem Ausbruch der Erkrankung in der Regel frühestens mit 65 Jahren rechnen. Bis zu den Wechseljahren ist sie besonders gut vor erhöhten Harnsäurewerten und erhöhten Blutfettwerten geschützt.
Die ersten Gichtanfälle treten in der Regel in Intervallen von einem halben bis zu einem Jahr auf. Es ist ebenfalls möglich, dass mehrere Jahre zwischen den einzelnen Gichtanfällen vergehen.
Was passiert beim Gichtanfall?
Vom akuten Gichtanfall sind häufig die Gelenke der großen Zehen betroffen. Diese Art des Gichtanfalls wird auch „Podagra“ genannt. Das Wort „Podagra“ kommt vom Steigbügel, denn mit einem akuten Gichtanfall im Großzehengrundgelenk kann man nicht in einen Steigbügel steigen, was früher durchaus wichtig war. Außer der großen Zehen sind häufig die Sprunggelenke und andere Gelenke betroffen.
Ab einem Harnsäuregehalt von 9 bis 10 mg pro 100 ml Serum ist in den meisten Fällen mit einem akuten Gichtanfall zu rechnen.
Zu einem akuten Gichtanfall kommt es oft nach schweren Mahlzeiten mit viel Alkohol, denn durch das purinreiche Essen steigt der Harnsäurewert im Blut besonders stark an. Die scharfkantigen Harnsäure-Kristalle, die sich meistens schon länger in einem Gelenk gesammelt haben, reizen es schließlich so stark, bis es sich entzündet.
Zu einem akuten Gichtanfall kommt es oft nach schweren Mahlzeiten mit viel Alkohol.
Zunächst schwillt das betroffene Gelenk an und schmerzt sehr stark. Es rötet sich entzündlich und wird so prall, dass die Haut glänzend gespannt ist. Durch den Druck, der von der Schwellung und der gespannten Haut ausgeht, wird das entzündete Zehengelenk noch mehr zusammengedrückt und der Schmerz steigert sich.
Auch das Allgemeinbefinden ist beim akuten Gichtanfall stark beeinträchtigt, man fühlt sich richtig krank. Fieber und beschleunigter Puls kommen oft hinzu und in vielen Fällen auch Kopfschmerzen. Ein akuter Gichtanfall dauert meistens etwa drei Tage lang an. Wenn man schon viele akute Gichtanfälle hatte und sich allmählich der chronischen Gicht nähert, hören die Schmerzen nach den Anfällen nicht mehr vollständig auf.
Hilfen während und nach einem Gichtanfall
Trinken Sie während und nach dem Gichtanfall viel!
Achten Sie auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr von mindestens 2,5 Litern in Form von Mineralwasser, verdünnten Obst- oder Gemüsesäften, Kräuter- und Früchtetees, Malzkaffee oder Light-Getränken. Vorsicht ist hingegen bei Fleischbrühe geboten, da diese extrem viele Purinkörper enthält. Gut geeignet sind vegetarische Brühen, die allerdings keine Soja- oder Hefeextrakte enthalten sollten.
Während des akuten Gichtanfalls ist neben der medikamentösen Therapie eine relativ streng purinarme Kost, die maximal 300 mg Harnsäure enthält, einzuhalten.