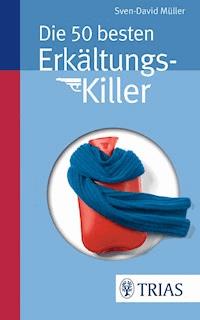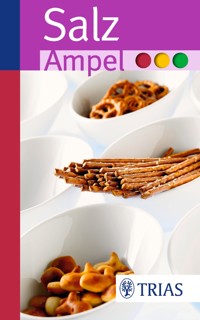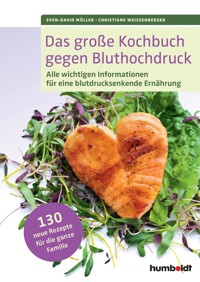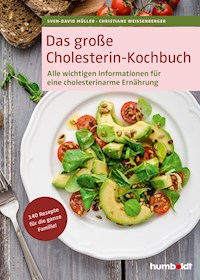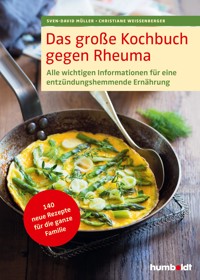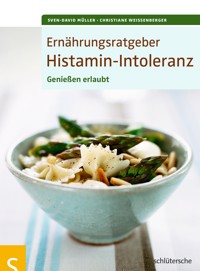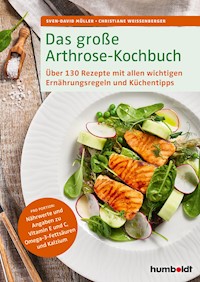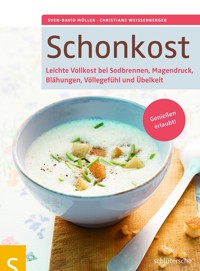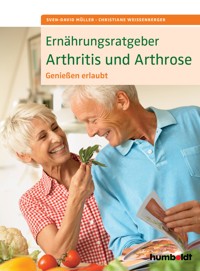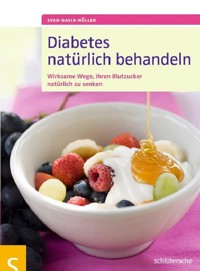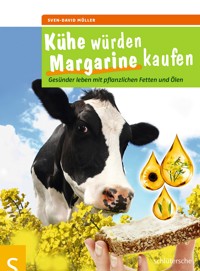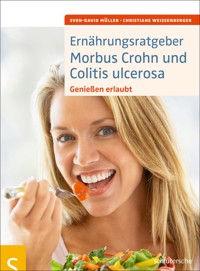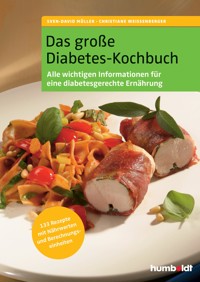Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schlütersche
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
ist für chronisch Nierenkranke ein unverzichtbarer Bestandteil der Behandlung. Es ist belegt, dass eine entsprechende Diät die Nierenfunktion bei nachlassender Aktivität verbessern kann und sich damit der Beginn der Dialysetherapie oft um Jahre hinauszögern lässt. Der Spagat zwischen nierenentlastendem und geschmackvollem Essen fällt vielen Patienten jedoch schwer. Dieses Buch zeigt anschaulich, wie die Umsetzung einer nierengesunden Ernährung in die Praxis gelingt. Sie erhalten einen Überblick über die verschiedenen Krankheitsbilder und die Behandlungsmöglichkeiten bei chronischen Nierenerkrankungen. Viele individuelle Empfehlungen begleiten Sie bei Ihrer Ernährungsumstellung. Und 50 Rezepte, die der ganzen Familie schmecken, beweisen, dass Ernährungstherapie und Genuss keineswegs im Widerspruch stehen müssen. - Alle wichtigen Ernährungsregeln bei Niereninsuffizienz und Dialyse - Mit Musterplänen und Spezialtabellen - 70 neue Rezepte – köstlich essen bei Niereninsuffizienz und Dialyse - Alle Rezepte mit Angabe von Kalorien, Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß sowie BEs, Natrium, Phosphat, Kalium und Purinen pro Portion
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Niereninsuffizienz – das ist jetzt wichtig
Die richtige Ernährung kann dazu beitragen, dass Sie trotz Niereninsuffizienz oder Dialyse ein weitgehend normales Leben führen.
Voraussetzung dafür ist, dass Sie die Ernährungsregeln kennen und strikt befolgen. Das ist nicht immer leicht, doch der Einsatz lohnt sich. In diesem Buch erfahren Sie zuverlässig, wie Ihnen die richtige Ernährung dabei hilft,
• Ihre Nieren zu entlasten,
• das Fortschreiten der Niereninsuffizienz zu verlangsamen,
• Mangel- und Unterernährung zu vermeiden,
• Vergiftungen oder Überwässerung zu verhindern und
•
VORWORT
GELEITWORT
UNSERE NIEREN – DAS MÜSSEN SIE WISSEN
Aufbau und Aufgaben der Nieren
Was bedeutet Niereninsuffizienz?
Was geschieht bei der Dialyse?
Die Nierentransplantation
DIE ERNÄHRUNG UMSTELLEN – WAS IST JETZT WICHTIG?
Das braucht unser Körper: Nährstoffe und Energie
Die richtige Ernährung bei Erkrankung der Nieren
Ernährung bei chronischer Niereninsuffizienz
Ernährung bei Dialyse
Ernährungsempfehlungen für die Dialyse
Musterpläne
Musterplan mit leichter Eiweißbeschränkung
Musterplan für Dialysepatienten
60 REZEPTE – KÖSTLICH ESSEN BEI NIERENINSUFFIZIENZ UND DIALYSE
Leckere Frühstücksideen
NBei Niereninsuffizienz
Camembert-Birnen-Toast
Quarkzopf
Beerenjoghurt
Heidelbeer-Thymian-Konfitüre
Erdbeer-Melonen-Konfitüre
Zitrus-Obstsalat mit Sahnequark
Sommerlicher Früchtesalat mit Buttermilch
DBei Dialysebehandlung
Heidelbeerquark
Heidelbeer-Vanille-Müsli
Fruchtige Brotmahlzeit
Apfelaufstrich
Lachsfrischkäse
Rhabarberaufstrich
Herzhafte Mittagessen
NBei Niereninsuffizienz
Spaghetti mit Paprikapesto
Farfalle all’arrabbiata
Zitronenrisotto mit Steinpilzen
Zucchini-Reis-Pfanne
Tomaten-Oliven-Tarte
Karottengratin mit Käsesauce
Auberginen mit Schnittlauch-Schinken-Dip
Pilzschmarren
Zucchini-Speck-Pfannkuchen
Austernpilze und Kopfsalat mit Joghurtdressing
Kartoffel-Kürbis-Pfannkuchen
Pellkartoffeln mit Pestoquark
DBei Dialysebehandlung
Gemischtes Gulasch mit Farfalle
Roulade mit Kartoffelbrei
Nudel-Hack-Pfanne
Nudel-Schinken-Auflauf
Kabeljau-Nudel-Pfanne
Hähnchenschenkel mit Curryreis
Asiareis mit Hähnchenbrust
Fischfilet mit Zucchini
Süße Zwischenmahlzeiten und Desserts
NBei Niereninsuffizienz
Pflaumen-Marzipan-Teilchen
Bananen-Honig-Toast
Minz-Schoko-Mousse mit Kiwisalat
Scones mit Frischkäse und Marmelade
Beerensalat mit Vanillesahne
Beerenspieß mit Vanilleeis und Sahne
Beeren-Honig-Eis
DBei Dialysebehandlung
Brombeer-Joghurt-Speise
Apfelquark
Blaubeermuffins
Erdbeer-Blätterteig-Gebäck
Leichte Abendessen
NBei Niereninsuffizienz
Tomatensuppe asiatischer Art
Emmentaler-Speck-Toast mit Tomaten
Petersiliensuppe mit Forellenfilets
Schnelle Salamipizza
Asiatischer Gurkensalat
Nudelsalat mit Rucola-Pesto
Paprika-Frischkäse-Mousse
Marinierte Zucchini
Baguette mit Guacamole
DBei Dialysebehandlung
Rindfleischsalat
Geflügelsalat
Obatzter
Salami-Tramezzini
Handkäs mit Musik
Marinierte Paprika mit Mozzarella
Mozzarella-Tomaten-Sandwich
Frühlingsaufstrich
ANHANG
Wichtige Adressen
Buchtipps
Register
VORWORT
Liebe Leserin, lieber Leser,
durch eine Vielzahl von Erkrankungen, jedoch insbesondere den Diabetes mellitus, kann die Funktion unserer Nieren empfindlich eingeschränkt werden. Der Arzt beschreibt diese Funktionseinschränkung als chronische Niereninsuffizienz. In vielen Fällen lässt die Funktion so weit nach, dass ein Nierenersatztherapieverfahren wie die Dialyse erforderlich wird.
Durch die richtige Ernährung ist es möglich, die Nierenfunktionseinschränkung auszugleichen und sogar eine Verschlimmerung des Zustandes zu verhindern. Und auch für Dialysepatienten ist eine Ernährungstherapie von besonderer Bedeutung, da die Nierenfunktion durch technische Apparaturen nicht vollständig nachgebildet werden kann.
Als Nierenpatient müssen Sie sich strikt an Ernährungsregeln halten. Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Nährstoff Eiweiß zu: Während in der Phase vor der Dialysepflichtigkeit die Eiweißzufuhr beschränkt werden muss, braucht der Dialysepatient mehr Eiweiß. Für jeden Nierenpatienten gelten weitere, ganz individuelle Ernährungsregeln, die Ihr behandelnder Nierenarzt mit Ihnen bespricht, und wir haben in unserem Buch genau darauf geachtet, dieser Notwendigkeit Rechnung zu tragen.
Wir sind froh, dass wir mit Experten wie Professor Helmut Mann und Professor Heinz-Günther Siebert, Professor Lothar Schramm, Dr. Josef Zimmermann, Dr. Kai-Olaf Netzer und Dr. Andrea Heyd-Schramm zusammenarbeiten und von ihnen lernen können. Besonders dankbar sind wir für die Zusammenarbeit mit Siegfried Stiller an der Universitätsklinik Aachen. Er ist Dialysepatient und konnte uns über die Jahre viele wertvolle Anregungen für die Praxis geben.
Während unserer Schulungen und Beratungen im KfH-Nierenzentrum Aachen und der Praxis für innere Medizin/Dialysezentrum Würzburg haben unsere Patienten erlebt, dass eine Diätkost für Dialysepatienten sehr wohlschmeckend und abwechslungsreich sein kann. Diese Erfahrung möchten wir nun in Form von leckeren Rezepten an Sie weitergeben. Wir wünschen Ihnen, dass Sie trotz Funktionseinschränkung Ihrer Nieren oder Dialysepflichtigkeit eine gute Lebensqualität erreichen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Nun wünschen wir Ihnen eine anregende Lektüre und viel Spaß beim Nachkochen und Variieren der Rezepte!
Ihr
Sven-David Müller
Ihre
Christiane Weißenberger
Christiane Weißenberger Staatlich anerkannte Diätassistentin/Diabetesassistentin
Sven-David Müller M. Sc., Staatlich anerkannter Diätassistent/Diabetesberater
GELEITWORT
Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie haben sich für dieses Ratgeber-Kochbuch entschieden, um mehr Sicherheit im Umgang mit Ihrer Erkrankung zu erhalten. Vielleicht sind Sie auch verunsichert, was Sie noch mit gutem Gewissen essen können, ohne Ihre Nieren zu sehr zu belasten. Mit diesem Buch können Sie sich einen Überblick über die verschiedenen Krankheitsbilder und die Behandlungsmöglichkeiten bei chronischen Nierenerkrankungen verschaffen. Weiterhin erhalten Sie viele abwechslungsreiche Rezeptideen zum Ausprobieren und Genießen.
In meiner Sprechstunde sehe ich regelmäßig Patienten, die an einer chronischen Nierenerkrankung leiden und die sich in einem schlechten bis teilweise sehr schlechten Ernährungszustand befinden. Durch die vielen verwirrenden oder mitunter auch widersprüchlichen Aussagen zur richtigen Ernährungsweise bei chronischer Niereninsuffizienz wissen viele dieser Patienten nicht mehr, was sie noch essen dürfen. Der Spagat zwischen nierenentlastendem und geschmackvollem Essen fällt Patienten oft schwer. Deshalb freut es mich sehr, hier ein Ratgeber-Kochbuch empfehlen zu können, das Betroffenen anschaulich zeigt, wie die Umsetzung in die Praxis gelingen kann.
Die diätetischen Maßnahmen bei Nierenerkrankungen sind vielfältig. Der Bedarf und die Toleranzgrenzen an Nähr- und Mineralstoffen (insbesondere Phosphat, Kalium und Natrium) sowie Flüssigkeit sind individuell. Die Ernährungsempfehlungen müssen einzelfallgerecht, je nach Befund und Ausscheidung, angepasst werden. Das Ziel dieses Ratgeber-Kochbuches ist es, Sie, den betroffenen Patienten, möglichst einfach, allgemein verständlich und umfassend zur Durchführung der richtigen Ernährung bei Niereninsuffizienz bzw. Dialysebehandlung anzuleiten. Darüber hinaus will das Buch aber auch die Freude am Essen wieder zurückbringen, denn mit den richtigen Tipps und Tricks gelingt das hier sehr überzeugend.
Der „Ernährungsratgeber Niereninsuffizienz und Dialyse“ ist übersichtlich und für den Betroffenen verständlich geschrieben. Er beschreibt Krankheitsbilder, die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten bei Nierenerkrankungen und vermittelt den aktuellen Stand der modernen Ernährungsmedizin. Wichtigen allgemeinen Informationen über die Funktionen der Niere folgen zahlreiche Rezepte, die bei chronischen Nierenerkrankungen bestens geeignet sind. Das Buch kann eine individuelle Ernährungsberatung durch Diätassistenten zwar nicht ersetzen, es stellt aber eine wichtige und gute Ergänzung dar. Den Autoren ist es gelungen, moderne Ernährungstherapie in die Praxis umzusetzen.
Ich wünsche diesem Ratgeber-Kochbuch daher eine weite Verbreitung, um Menschen mit chronischer Nierenerkrankung ein lebenswertes und genussvolles Leben zu ermöglichen.
Dr. med. Josef ZimmermannInternistNephrologe, Diabetologe, Hypertensiologe (DHL)Ernährungsmedizin DGEM
UNSERE NIEREN – DAS MÜSSEN SIE WISSEN
Die Nieren dienen unserem Körper vor allem als Filterorgan. Außerdem werden dort lebenswichtige Hormone produziert. Mit nur einer Niere können wir in aller Regel gut leben; fällt aber die Funktion beider Nieren aus, kann unser Körper diesen Funktionsverlust nicht ausgleichen und es besteht im schlimmsten Fall Lebensgefahr. Um die Auswirkungen einer Nierenfunktionsstörung besser verstehen zu können, sollten Sie über Aufbau und Aufgaben dieser wichtigen Organe Bescheid wissen.
Aufbau und Aufgaben der Nieren
Die Nieren sind bohnenförmig und durch ihre starke Durchblutung braunrot gefärbt.
Die beiden Nieren des Menschen sind paarig angelegte Organe; sie liegen beidseits der Wirbelsäule unter dem Zwerchfell im Retroperitoneum, das ist der Bereich, der hinter dem Bauchfell liegt. Sie sind ca. 10 bis 12 cm lang und 5 bis 6 cm breit. Die einzelne Niere besteht aus 6 bis 9 gleichartigen Einheiten, den so genannten Nierenlappen (Lobi renales), die man in Nierenmark (Medulla renalis) und Nierenrinde (Cortex renalis) gliedert.
Nieren bestehen aus einem arteriellen Gefäßbaum, an dessen filigranen Endästen ungefähr eine Million Nierenkörperchen hängen – ähnlich Äpfeln in einem Apfelbaum. Die Kapillarknäuel dieser Nierenkörperchen (auch Glomeruli genannt) filtern das Blut. Die Funktionsweise der Nieren ähnelt einer Kläranlage. Pro Tag pumpt das Herz ca. 2000 Liter Blut in diesen Gefäßbaum der Nieren und über die Nierenkörperchen werden hieraus ca. 150 Liter einer Klärflüssigkeit abgepresst. Diese nennt man Primärharn. In diesem Filtrat befinden sich die harnpflichtigen Substanzen. Wichtige Stoffe wie Vitamine und Eiweißpartikel werden dagegen im Filter der Nierenkörperchen zurückgehalten. Um einen hohen Flüssigkeitsverlust zu vermeiden, wird dieser Primärharn im den Nierenkörperchen nachgeschalteten Tubulusapparat zum Sekundärharn (= Urin) konzentriert. Der Tubulusapparat besteht aus einem Kanalsystem, in welchem dem Primärharn ein Großteil des Wassers und der gefilterten Elektrolyte entzogen und dem Kreislauf zurückgegeben werden. Die tägliche Urinmenge von ca. 1,5 Litern entspricht somit dem um den Faktor 100 konzentrierten Primärharn.
Querschnitt durch eine menschliche Niere
Pro Tag pumpt das Herz ca. 2000 Liter Blut in diesen Gefäßbaum der Nieren.
Aus den Kelchen im Nierenmark gelangt der Harn ins Nierenbecken und fließt dann über den Harnleiter in die Blase und schließlich von der Blase über die Harnröhre nach außen.
Wichtige Funktionen der Nieren
Die Nieren sind für uns Menschen lebenswichtige Organe, ihre Funktion kann durch keine Technik vollständig ersetzt werden. Ihre Aufgaben sind vielfältig:
Eine Niere wiegt beim Erwachsenen 120–200 g.
• Sie dienen dem Körper als Klärwerk für Abfallprodukte des Stoffwechsels, einschließlich von Medikamentenresten.
• Sie sorgen für die Aufrechterhaltung eines ausgeglichenen Wasserhaushalts.
• Sie kontrollieren das Säure-Basen-Gleichgewicht.
• Sie regulieren den Gehalt an den im Blut gelösten Elektrolyten Natrium und Kalium.
• Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Blutdruckregulation.
• Sie sind an der Bildung von aktivem Vitamin D3 beteiligt und somit in die Kontrolle des Mineralstoffwechsels des Knochens eingebunden.
• Durch die Produktion des Hormons Erythropoeitin regulieren die Nieren auch die Blutbildung im Knochenmark.
Was sind harnpflichtige Substanzen?
Im Stoffwechsel des menschlichen Körpers fallen ständig Produkte an, die nicht mehr weiter verwertet werden können. Neben der Leber sind die Nieren für viele Stoffwechselendprodukte das wichtigste Hauptausscheidungsorgan. Stoffe, die über die Niere mit dem Harn ausgeschieden werden, werden als harnpflichtige Substanzen bezeichnet. Kommt es zu Störungen bei der Ausscheidung von harnpflichtigen Substanzen, so steigt deren Konzentration im Körper in unterschiedlichem Ausmaß an. Harnpflichtige Substanzen sind:
• Harnstoff: Stoffwechselendprodukt der Eiweiße
• Kreatinin: Stoffwechselendprodukt der Muskulatur
• Harnsäure: Stoffwechselendprodukt der Purine (Purine sind Eiweißbestandteile, die im Körper zu Harnsäure umgewandelt und über die Nieren ausgeschieden werden. Ist die Harnsäurekonzentration im Blut zu hoch, kommt es zu Ablagerungen von Harnsäurekristallen in den Gelenken, die wiederum zu Zellverletzungen und damit zu Gicht führen.)
Purine sind stickstoffhaltige Zellbestandteile und kommen vermehrt in tierischen Lebensmitteln vor.
Was bedeutet Niereninsuffizienz?
Von Niereninsuffizienz spricht man, wenn die Nieren ihre Funktionen verlieren.
In diesem Fall kommt es zu einer Retention zahlreicher harnpflichtiger Substanzen im Blut. Die mangelhafte Ausscheidung saurer Stoffwechselendprodukte führt zu einer Übersäuerung des Körpers, metabolische Azidose genannt. Die Nieren können die Regulation des Elektrolyt-Haushaltes nicht mehr zuverlässig gewährleisten. Bei starkem Anstieg der Kaliumkonzentration im Blut (Hyperkaliämie) droht ein Herzstillstand. Der Nierenfunktionsverlust beeinträchtigt auch die adäquate Ausscheidung von Salz und getrunkener Flüssigkeiten. Hieraus entstehen Wasseransammlungen im Körper, die sich in leichteren Fällen durch Schwellungen der Beine bemerkbar machen, in schweren Fällen kommt es zu einem Lungenödem.
Im medizinischen Zusammenhang bedeutet Retention die Rückhaltung bestimmter Stoffe oder Flüssigkeiten.
Darüber hinaus sind typische Begleiterkrankungen bei chronischer Nierenschwäche die Entwicklung einer Blutarmut (renale Anämie), die durch die mangelhafte Bildung von Erythropoeitin verursacht wird und eine Knochenmineralisationsstörung (renale Osteopathie), ausgelöst durch die mangelhafte Ausscheidung von Phosphat und einen gestörten Vitamin-D-Stoffwechsel.
Formen und Ursachen von Niereninsuffizienz
Man unterscheidet ein akutes Nierenversagen von einem chronischen Nierenversagen.
Das akute Nierenversagen tritt rasch auf und ist meist Folge einer plötzlichen Mangeldurchblutung der Nieren, wie sie im Rahmen eines schweren Blutverlustes (z. B. nach Unfall oder schweren Operationen) und im Rahmen eines Kreislaufschocks (z. B. nach Herzinfarkt oder bei Blutvergiftung) auftreten kann. Eine akute Schädigung der Nierenkörperchen und des Tubulusapparates der Nieren kann auch durch bakterielle und virale Infektionen (z. B. Hantavirusinfektion) und Toxine verursacht werden (z. B. Bakteriengifte, Röntgenkontrastmittel und zu hoch dosierte Schmerzmedikamente).
Langjähriger Bluthochdruck und Diabetes sind die häufigsten Ursachen für eine chronische Schädigung der Nieren.
Das chronische Nierenversagen ist gekennzeichnet durch einen schleichenden langsamen kontinuierlichen Nierenfunktionsverlust.
In unserer Wohlstandsgesellschaft sind langjähriger Bluthochdruck (hypertensive Nephropathie) und Diabetes (diabetische Nephropathie) die häufigsten Ursachen für eine chronische Schädigung der Nierengefäße und der Nierenkörperchen. Chronisch verlaufen meistens auch autoimmunologisch bedingte Entzündungen der Nierenkörperchen (Glomerulonephritiden). Die regelmäßige Einnahme von Schmerzmedikamenten kann über eine Schädigung des im Nierenmark gelegenen Tubulusapparates ebenfalls zu einem chronischen Nierenversagen führen (Analgetikanephropathie). Zu nennen sind dann noch angeborene Nierenerkrankungen wie die schwammartige Zersetzung der Nieren durch flüssigkeitsgefüllte Bläschen (polyzystische Nierendegeneration).
Die Prognose des akuten Nierenversagens ist meist abhängig von der verursachenden Grunderkrankung. Das Sterblichkeitsrisiko von Patienten mit akutem Nierenversagen ist hoch. Bei erfolgreicher Behandlung kann sich die Nierenfunktion von einem akuten Nierenversagen aber vollständig erholen.
Im Gegensatz hierzu verschlechtert sich die Nierenfunktion bei chronischer Niereninsuffizienz kontinuierlich. Manche chronischen Nierenerkrankungen führen erst nach 20 bis 30 Jahren zu einer Dialysepflichtigkeit der betroffenen Patienten.
Diagnose der Niereninsuffizienz
Frühe Symptome von Nierenerkrankungen sind Verfärbungen und Schäumen des Urins durch Blut und Eiweißverlust. Beinahe jede Nierenerkrankung führt zu einem Anstieg des Blutdruckes. Durch Eiweißverlust im Blut kommt es zu Wassereinlagerungen im Gewebe mit Schwellungen der Augenlider und Unterschenkel (Ödeme). In fortgeschrittenen Stadien der Niereninsuffizienz entsteht durch die mangelhafte Produktion des die Blutbildung stimulierenden Hormons Erythropoeitin eine Blutarmut, die zu Blässe und allgemeiner körperlicher Schwäche führt.
Bei schwerer Niereninsuffizienz verschlechtert sich mit dem Anstieg der Konzentration der harnpflichtigen Stoffwechselendprodukte (Urämietoxine) im Blut das Allgemeinbefinden der betroffenen Patienten kontinuierlich. Der Appetit wird schlechter. Es besteht zunächst eine Abneigung gegen Fleisch- und Wurstwaren. Hinzu kommt dann Übelkeit mit Erbrechen. Der katabole Stoffwechsel führt zu einem körperlichen Verfall mit Muskelschwund.
Bei Diagnose, Therapie und Verlaufskontrolle der Niereninsuffizienz hilft ein genaues Protokoll der täglichen Flüssigkeitsaufnahme.