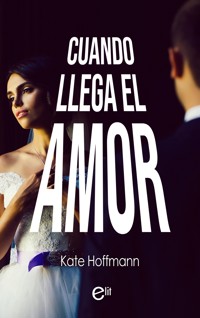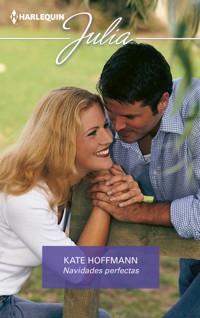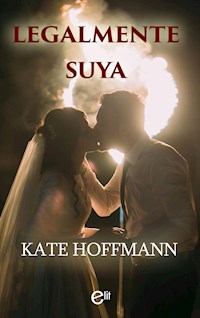1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CORA Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Quinns
- Sprache: Deutsch
Hautnah spürt Meggie das aufregende Spiel seiner Muskeln… Als ein Feuerwehrmann sie aus dem brennenden Haus trägt, erwachen in ihr ungeahnte Gefühle. Bis sie erkennt, wer ihr Retter ist: Dylan Quinn, ihr Traummann! Mit dem hat sie allerdings noch eine Rechnung offen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
IMPRESSUM
Es brennt! erscheint in der HarperCollins Germany GmbH
© by Peggy A. Hoffmann Originaltitel: „The Mighty Quinns: Dylan“ erschienen bei: Harlequin Enterprises Ltd., Toronto Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l.
© Deutsche Erstausgabe in der Reihe TIFFANYBand 994 - 994 by CORA Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg Übersetzung: Christian Trautmann
Umschlagsmotive: shutterstock_Marko Marcello, GettyImages_NycyaNestling_
Veröffentlicht im ePub Format in 07/2018 – die elektronische Ausgabe stimmt mit der Printversion überein.
E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783733757977
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. CORA-Romane dürfen nicht verliehen oder zum gewerbsmäßigen Umtausch verwendet werden. Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Weitere Roman-Reihen im CORA Verlag:BACCARA, BIANCA, JULIA, ROMANA, HISTORICAL, TIFFANY
Alles über Roman-Neuheiten, Spar-Aktionen, Lesetipps und Gutscheine erhalten Sie in unserem CORA-Shop www.cora.de
Werden Sie Fan vom CORA Verlag auf Facebook.
1. KAPITEL
Der Alarm ging um genau 15.17 Uhr los. Dylan Quinn sah vom Polieren der Chromteile von Löschwagen 22 auf. Er konnte schon nicht mehr zählen, wie oft der Alarm geschrillt hatte, während er den Wagen putzte. Die meisten Männer des Leitertrupps 14 und des Löschwagens 22 waren oben und ruhten sich nach dem langen Mittagessen aus, doch als sie herunterkamen, warf Dylan das Poliertuch weg und ging in den Nebenraum, in dem sich seine Stiefel, die Jacke und der Schutzhelm befanden.
Die Stimme des Einsatzkoordinators verkündete über Lautsprecher drei Mal den Ort des Brandes. Als Dylan die Adresse hörte, stutzte er. Verdammt, das war ja nur ein paar Blocks von der Feuerwache entfernt! Während die anderen ihre Ausrüstung anlegten, trat Dylan aus der breiten Garageneinfahrt und sah die Boylston Street hinunter.
Er konnte keinen Rauch erkennen. Hoffentlich würden sie keinen außer Kontrolle geratenen Brand vorfinden. Die Gebäude in den älteren Gegenden Bostons waren dicht an dicht gebaut, und obwohl Brandschutzmauern die Ausbreitung eines Feuers verhinderten, wurde die Brandbekämpfung durch die Enge erschwert.
Die Hupe des Feuerwehrwagens ertönte. Dylan drehte sich um und winkte Ken Carmichael, dem Fahrer. Als der Wagen aus der Feuerwache auf die Straße rollte, sprang Dylan auf das hintere Trittbrett und hielt sich am Haltegriff fest. Sein Herz begann ein wenig schneller zu schlagen, und seine Sinne waren geschärft, wie immer, wenn die Truppe zu einem Brand ausrückte.
Während sie sich einen Weg durch den Verkehr auf der Boylston Street bahnten, dachte er zurück an den Moment, als er sich entschlossen hatte, Feuerwehrmann zu werden. Als kleiner Junge hatte er entweder Straßenräuber oder Ritter der Tafelrunde werden wollen. Doch nach der Highschool waren diese beiden Jobs nicht zu haben gewesen. Aufs College wollte er nicht. Sein älterer Bruder, Conor, hatte gerade auf der Polizeiakademie angefangen, daher hatte Dylan sich für die Feuerwehrschule entschieden, und er hatte es nie bereut.
Im Gegensatz zu seiner unbekümmerten Jugend, als die Schule kaum eine Rolle spielte, hatte Dylan auf der Feuerwehrschule hart gearbeitet, um der Beste seiner Klasse zu werden. Das Boston Fire Department blickte auf eine lange, ehrenvolle Tradition zurück, gegründet vor über dreihundert Jahren als erste städtische Berufsfeuerwehr des Landes. Und jetzt war Dylan Quinn, der am wenigsten Wurzeln von allen hatte, ein Teil dieser Geschichte. Er hatte den Ruf eines umsichtigen, aber auch furchtlosen Feuerwehrmannes, dem alle vertrauten, die mit ihm arbeiteten.
Nur zwei Feuerwehrleute in seiner Abteilung hatten es schneller zum Lieutenant gebracht als er, und in einigen Jahren, wenn er die Abendschule absolviert hatte, würde er Captain sein. Doch ihm ging es nicht um den Ruhm, den Nervenkitzel oder gar um die hübschen Frauen, die Feuerwehrmänner zu umschwärmen schienen. Dylan war es stets nur darum gegangen, Leben zu retten. Wenn ihn das zu einem Helden machte, dann wusste er nicht, wieso. Für ihn gehörte es einfach zum Job.
Das Löschfahrzeug kam mitten im Verkehr langsam zum Stehen. Dylan schnappte sich seine Axt und sprang vom Wagen. Er überprüfte die Adresse und bemerkte eine schwache hellgraue Rauchwolke, die aus der offenen Tür eines Ladens aufstieg. Im nächsten Moment kam eine Frau mit rußbeschmutztem Gesicht herausgelaufen.
„Dem Himmel sei Dank, dass Sie da sind!“, schrie sie. „Beeilen Sie sich!“ Sie rannte wieder ins Haus.
Dylan lief hinter ihr her. „Lady! Bleiben Sie stehen!“
Das Letzte, was er gebrauchen konnte, war eine aufgeregte Frau, die sich in Gefahr brachte. Obwohl das Feuer auf den ersten Blick nicht gefährlich aussah, wusste er, dass man vorsichtig sein musste. Das Innere des Ladens war nicht viel verqualmter als der Pub seines Vaters in einer Samstagnacht. Doch Dylan wusste, dass jederzeit eine Stichflamme oder Explosion drohen konnte.
Er entdeckte die Frau hinter einem langen Tresen, wo sie wie wild ein kleines Feuer mit einem angesengten Küchenhandtuch zu löschen versuchte. Dylan packte ihren Arm. „Lady, Sie müssen hier raus. Lassen Sie uns die Arbeit machen, bevor Sie sich noch verletzen.“
„Nein!“, schrie sie und versuchte sich zu befreien. „Wir müssen das Feuer löschen, bevor es Schaden anrichtet!“
Dylan schaute über die Schulter und sah zwei seiner Leute hereinkommen. Einer trug einen Feuerlöscher. „Es sieht aus, als sei der Brandherd in dieser Maschine. Brecht sie auf und findet ihn“, befahl er und zerrte die Frau hinter sich her zur Tür.
„Aufbrechen?“ Die Frau stemmte die Absätze in den Boden.
Trotz der leichten Rußschicht auf ihrem Gesicht konnte Dylan erkennen, dass sie sehr schön war. Ihre Haare, die ihr in sanften Wellen auf die Schultern fielen, hatten die Farbe dunklen Mahagonis. Alles an ihrem Gesicht war perfekt – von den grünen Augen über die gerade Nase bis zu den sinnlichen Lippen. Er musste sich von der Betrachtung ihrer Lippen losreißen und daran erinnern, dass er hier eine Aufgabe zu erledigen hatte.
„Lady, wenn Sie nicht sofort hinausgehen, muss ich Sie hinaustragen“, warnte er sie und musterte sie von ihrem engen Pullover bis zum Lederminirock und den modischen Stiefeln. „Und angesichts der Länge Ihres Rocks wollen Sie bestimmt nicht, dass ich Sie über die Schulter werfe.“
Sie sah ihn empört an, und mit jedem ihrer raschen Atemzüge bewegten sich ihre Brüste auf äußerst verführerische Art.
„Dies ist mein Geschäft“, fuhr sie ihn an, „und ich werde nicht zulassen, dass Sie es mit Ihren Äxten zerlegen!“
Leise fluchend tat Dylan, was er schon unzählige Male zuvor bei Übungen und im Ernstfall getan hatte. Er bückte sich, umfasste ihre Beine und lud sich die Frau auf die Schulter. „Ich bin gleich wieder da!“, rief er seinen Leuten zu.
Sie strampelte und kreischte, aber Dylan nahm es kaum wahr. Stattdessen wurde seine Aufmerksamkeit von ihrem wohlgeformten Po neben seinem Ohr abgelenkt.
Sobald er mit ihr draußen war, stellte er sie behutsam neben einem der Feuerwehrwagen ab und rückte den hochgerutschten Rock zurecht. Sie schlug nach seiner Hand, als würde er sie absichtlich belästigen.
Allmählich verlor er die Geduld. „Sie bleiben jetzt hier“, befahl er ihr.
„Nein“, erwiderte sie.
Sie huschte an ihm vorbei zurück in den Coffeeshop, und Dylan rannte ihr nach. Er schlang einen Arm um ihre Taille und zog sie an sich. Ihr Po wurde auf eine Weise an seinen Schoß gedrückt, die ihn die Gefahr des Feuers beinah vergessen ließ.
Gemeinsam wurden sie Zeugen, wie Artie Winton seine Axt hinter die Maschine hakte und zu Boden riss. Dann zog er sie in die Mitte des Ladens, hob die Axt und ließ sie niedersausen. Augenblicke später bedeckte Jeff Reilly den zerbeultem rostfreiem Stahl mit einer Schaumschicht aus dem Feuerlöscher.
„Das ist der Brandherd“, rief Jeff. „Weiter scheint das Feuer sich nicht ausgebreitet zu haben.“
„Was war es?“, wollte Dylan wissen.
Reilly hockte sich hin, um die Maschine genauer untersuchen zu können. „Sieht aus wie eine von diesen Maschinen, mit denen man gefrorenen Joghurt zubereitet.“
„Nein“, meinte Winton, „das ist eine von diesen Hightech-Kaffeemaschinen.“
„Es ist ein Espresso Master 8000 Deluxe“, sagte die Frau. Eine Träne kullerte ihre Wange hinunter, und sie kaute auf ihrer Unterlippe.
Dylan fluchte innerlich. Zwar hatte er schon oft schlechte Nachrichten überbringen müssen, aber wenn Tränen flossen, wusste er nie, was er tun sollte. Worte des Mitgefühls klangen immer so hohl und gezwungen.
Er räusperte sich. „Ich will, dass ihr beide euch umseht“, befahl er. „Schaut nach, ob es Kurzschlüsse gibt oder Brandherde in den Wänden.“
Er zog seine Handschuhe aus, nahm die Frau bei der Hand und zog sie sanft zur Tür. Er sollte sich überlegen, was er sagen wollte, aber stattdessen war er fasziniert davon, wie zart sich ihre Finger anfühlten. „Sie können hier nichts mehr tun“, erklärte er ihr. „Wir werden alles überprüfen, und wenn es sicher ist, können Sie reingehen, sobald der Rauch abgezogen ist.“
Draußen führte er sie zum Heck des Löschwagens und drängte sie sanft, sich auf die Trittfläche zu setzen. Ein Sanitäter kam angelaufen, aber Dylan winkte ab. Er widerstand dem Impuls, die Frau in den Arm zu nehmen, denn eigentlich gab es keinen Grund zu weinen. Ihr einziger Verlust war eine Kaffeemaschine.
„Ist schon gut“, versuchte er sie zu trösten. „Ich weiß, Sie hatten Angst, aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Außerdem haben Sie kaum etwas verloren.“
Abrupt hob sie den Kopf und sah ihn wütend an. „Die Maschine hat fünfzehntausend Dollar gekostet! Das ist die beste Maschine, die es auf dem Markt gibt. Sie macht vier Espressi in fünfzehn Sekunden. Und Sie und Ihre axtschwingenden Barbaren haben sie in Stücke gehackt!“
Verblüfft über die Heftigkeit ihres Ausbruchs wich Dylan zurück. Sie sollte ihm lieber dankbar sein! „Hören Sie, Lady, ich …“
„Mein Name ist nicht Lady!“, schrie sie.
„Nun, was auch immer Ihr Name sein mag, Sie sollten froh sein.“ Es gelang ihm nicht, seine Gereiztheit zu verbergen. „Heute war ein guter Tag. Niemand ist ums Leben gekommen.“ Versöhnlicher fügte er hinzu: „Weder Sie noch jemand anders ist bei dem Brand verletzt worden. Sie haben weder wertvolle Erbstücke verloren noch Ihr Lieblingstier. Alles, was Sie verloren haben, ist eine Kaffeemaschine, noch dazu eine defekte.“
Sie sah ihn durch dichte, feuchte Wimpern an. Eine weitere Träne lief ihre Wange herunter, und Dylan widerstand der Versuchung, sie mit dem Daumen aufzufangen.
„Es ist nicht bloß eine Kaffeemaschine“, erinnerte sie ihn.
„Ich weiß. Es ist ein Espresso Master Deluxe 5000 oder so. Ein großer Kasten aus rostfreiem Stahl mit ein paar Druckanzeigen und jeder Menge Röhren. Lady, ich muss schon sagen …“
„Mein Name ist nicht Lady“, wiederholte sie. Sie strich sich die Haare aus dem Gesicht und wischte sich Ruß von der Nasenspitze. „Ich heiße Meggie Flanagan.“
Bis zu diesem Moment hatte Dylan sie nicht erkannt. Dabei hatte sie tatsächlich noch Ähnlichkeiten mit dem Mädchen, das er vor so langer Zeit gekannt hatte. „Meggie Flanagan? Mary Margaret Flanagan? Tommy Flanagans kleine Schwester?“
Sie bedachte ihn mit einem abfälligen Blick. „Kann sein.“
Dylan lachte, nahm seinen Helm ab und fuhr sich durch die Haare. „Die kleine Meggie Flanagan! Wie geht es deinem Bruder? Ich habe ihn Ewigkeiten nicht gesehen.“
Zuerst musterte sie ihn misstrauisch, dann fiel ihr Blick auf das Namensschild an seiner Jacke. Ihre Miene erstarrte, und selbst unter der Rußschicht konnte er erkennen, dass sie heftig errötete. „Quinn“, murmelte sie. „Oje.“ Sie stützte die Ellbogen auf die Knie und vergrub das Gesicht in den Händen. „Ich hätte mir denken können, dass du auftauchen und versuchen würdest, mein Leben noch einmal zu ruinieren.“
„Dein Leben ruinieren? Ich habe es gerettet!“
Sie sprang auf. „Das hast du nicht. Ich war sehr wohl in der Lage, das Feuer selbst zu löschen.“
Dylan verschränkte die Arme vor der Brust. „Wieso hast du dann die Feuerwehr gerufen?“
„Das habe ich nicht“, entgegnete sie. „Die Sicherheitsfirma hat es getan.“
Er nahm ihr das Küchenhandtuch ab und wedelte damit vor ihrem Gesicht. „Und damit wolltest du es löschen?“ Dylan schüttelte den Kopf. „Ich wette, du besitzt nicht einmal einen Feuerlöscher. Wenn du wüsstest, wie viele Brände mit einem simplen Feuerlöscher gelöscht werden können …“ Sie hob trotzig das Kinn, und er verstummte.
Meggie Flanagan. Fast war es ihm peinlich, welche Wirkung sie vorhin auf ihn gehabt hatte. Schließlich war sie die kleine Schwester eines seiner ältesten Freunde. Zwischen Männern gab es ungeschriebene Gesetze, und eines der wichtigsten war, dass man sich nicht an die Schwester eines Freundes heranmachte. Aber Meggie war nicht mehr das schlaksige Mädchen mit der Zahnspange und den dicken Brillengläsern. Und er hatte Tommy seit Jahren nicht gesehen. „Ich könnte dich wegen Sicherheitsmängeln vorladen.“
„Oh, nur zu“, meinte sie herausfordernd, machte auf dem Absatz kehrt und ging in ihren Coffeeshop zurück. „Angesichts unserer Vergangenheit traue ich dir das durchaus zu.“
Vergangenheit? Dylan sah ihr nach. „Meggie Flanagan“, dachte er. Mit diesem Namen verband er ein Mädchen, das sich im Hintergrund hielt und die Welt aus sicherer Distanz beobachtete. Die Frau vor ihm konnte man hingegen keineswegs schüchtern nennen. Und sie war auch nicht mehr mager und flach wie ein Brett, sondern besaß Rundungen an all den richtigen Stellen.
Er hatte nach der Schule Stunden bei Tommy Flanagan zugebracht und Musik gehört oder Videospiele gespielt. Und Meggie war stets da gewesen und hatte sie verstohlen durch ihre dicken Brillengläser beobachtet. Dylan hatte in seinem letzten Schuljahr praktisch bei den Flanagans gewohnt. Aber es waren nicht die Videospiele gewesen, die ihn immer wieder dorthin gezogen hatten. Tommys Mutter war eine fröhliche, freundliche Frau, bei der er sich immer auf eine Einladung zum Abendessen verlassen konnte, die er dankbar annahm.
Meggie saß ihm am Tisch stets gegenüber, und wann immer er aufschaute, sah sie ihn mit dem gleichen Blick an, mit dem sie ihn auch auf dem Gang in der Schule jedes Mal ansah. Sie war zwei Klassen unter ihm, und so hatten sie keine gemeinsamen Kurse. Dafür begegneten sie sich mindestens zwei Mal am Tag bei den Schließfächern oder im Speisesaal. Er hatte mitbekommen, wie sie gehänselt wurde. Tommy hatte ihr gegenüber besondere Beschützerinstinkte gehabt, und da Dylan sie als eine Art kleine Schwester betrachtete, hatte er das Gleiche empfunden.
Er beobachtete sie jetzt, wie sie vor ihrem Coffeeshop auf und ab ging und sich die Arme wegen des kalten Windes rieb. Das Bedürfnis, sie zu beschützen, war nach wie vor da, aber es war gemischt mit einer unleugbaren Anziehung und dem Verlangen, sie noch einmal zu berühren, nur um zu sehen, ob seine Reaktion noch dieselbe war.
Er zog seine Jacke aus und ging zu ihr. „Hier“, sagte er. „Du wirst dir noch eine Erkältung holen.“ Er wartete nicht auf ihre Erlaubnis, sondern legte ihr einfach die schwere, wasserdichte Jacke um die Schultern und ließ seine Hände einen Moment länger als nötig verweilen. Das Prickeln, das seinen Arm durchzog, ließ sich nicht leugnen.
Meggie blieb stehen. „Danke“, sagte sie widerwillig.
Dylan lehnte sich gegen die Backsteinfassade des Gebäudes und sah ihr beim Auf- und Abgehen zu. „Was hast du damit gemeint, als du sagtest, ich hätte dein Leben schon einmal ruiniert?“
Ihre Miene verfinsterte sich. „Nichts. Es spielt keine Rolle.“
Er lächelte, um sie aufzuheitern. „Ich erkenne dich kaum wieder, Meggie. Aber eigentlich kannten uns gar nicht richtig, oder?“
Ein seltsamer Ausdruck huschte über ihr Gesicht, und er war nicht sicher, ob er ihn richtig deutete. Hatte er sie mit seinen Worten verletzt? Gab es einen Grund, weshalb er sich an sie erinnern sollte?
Zu seiner Enttäuschung endete die Unterhaltung an diesem Punkt. Das Funkgerät im Löschwagen meldete einen weiteren Alarm, worauf die Feuerwehrleute innehielten und lauschten. Der Koordinator gab eine Adresse im Industriegebiet an, wo eine Fabrik brannte.
„Ich muss los“, sagte Dylan und drückte Meggies Hand. „Du kannst jetzt gefahrlos wieder hineingehen. Und es tut mir leid wegen der Espressomaschine.“
„Danke“, murmelte Meggie nur.
Er ging zum Wagen und war eigenartigerweise unfähig, sie aus den Augen zu lassen. Einen Moment lang sah sie aus wie das Mädchen, an das er sich erinnerte, wie sie da allein auf dem Gehsteig stand, unsicher die Hände knetend. „Grüß Tommy von mir, wenn du ihn das nächste Mal siehst!“, rief er ihr zu.
„Das werde ich“, rief sie zurück, den Blick fest auf ihn gerichtet.
Ken Carmichael hupte ungeduldig.
„Vielleicht sehen wir uns ja mal“, fügte Dylan hinzu.
„Deine Jacke!“, rief Meggie ihm nach und wollte sie ausziehen.
Er winkte ab. „Wir haben Ersatzjacken im Wagen.“
Er sprang in die Kabine, setzte sich hinter den Fahrer und machte die Tür zu. Mit eingeschalteter Sirene fuhren sie los. Artie und Jeff grinsten.
„He, Quinn, was ist mit deiner Jacke passiert?“, fragte Artie. „Hast du sie im Feuer verloren?“
Dylan zuckte die Schultern.
„Wir könnten auf dem Mond einen Brand löschen, und du würdest trotzdem eine Frau finden, die du verzaubern kannst“, meinte Jeff. Er beugte sich vor und rief dem Fahrer zu: „He, Kenny, wir müssen umkehren. Quinn hat schon wieder seine Jacke vergessen.“
Carmichael lachte und drückte die Hupe, um sich durch den Nachmittagsverkehr zu manövrieren. „Das ist eine schlechte Angewohnheit von ihm, ständig seine Jacken zu verlieren. Ich werde dem Chief sagen müssen, dass er sie ihm vom Gehalt abziehen soll.“
Dylan nahm die Ersatzjacke vom Haken und schlüpfte hinein. Diesmal war er sich gar nicht sicher, ob er die Jacke zurückhaben wollte. Meggie Flanagan war nicht wie die anderen Frauen, bei denen der Trick so leicht funktioniert hatte. Erstens schaute sie nicht bewundernd zu ihm auf. Soweit er es beurteilen konnte, hasste sie ihn sogar. Außerdem gehörte sie absolut nicht zu der Sorte Frauen, die er verführen und anschließend verlassen konnte. Schließlich war sie die kleine Schwester eines guten alten Freundes.
Er atmete tief durch. Nein, es würde lange dauern, bis er sich die Jacke von Meggie Flanagan zurückholen würde.
Eine dünne Rußschicht bedeckte alles im „Cuppa Joe‘s“. Die Eröffnung des Cafés war für den Tag nach Thanksgiving geplant, und Meggie fühlte sich erdrückt von der Arbeit, die noch vor ihr lag. Sie musste noch acht neue Angestellte einweisen und die letzten Details der Innenausstattung festlegen. Ein Anruf bei der Versicherungsgesellschaft ergab, dass sie sowohl die Reinigung als auch die Espressomaschine ersetzt bekommen würde. Nur hatte sie keine Zeit, auf die Reinigungstruppe zu warten, denn morgen sollten bereits die Tische und Stühle geliefert werden. Wenn die Eröffnung rechtzeitig stattfinden sollte, würden sie und ihre Geschäftspartnerin, Lana Richards, den Laden selbst wieder in Ordnung bringen müssen.
Der Qualm war nicht das Schlimmste am gestrigen Brand gewesen. Die Zerstörung ihrer Espressomaschine war ein vernichtender Schlag. „Drei Monate“, sagte sie und seufzte. „Drei Monate, bis sie eine neue Maschine liefern können. Ich habe ihnen sogar angeboten, für eine Eilbestellung extra zu bezahlen, aber sie sagen, sie schaffen es nicht. Jeder Coffeeshop will eine von diesen Maschinen.“
„Kannst du bitte von dieser Maschine aufhören?“ Lana richtete sich auf, warf einen schmutzigen Lappen in einen Eimer mit warmem Wasser und strich sich die blonden Haare aus dem Gesicht. „Wir kaufen einfach zwei Espresso Master 4000. Oder vier Espresso Master 2000. Irgendwas, damit wir nicht mehr über die Espressomaschine reden müssen.“
In Wahrheit musste Meggie sich zwingen, an die Maschine zu denken. Das hielt sie nämlich davon ab, sich Tagträumereien über den attraktiven Feuerwehrmann hinzugeben, der die Zerstörung der Maschine befohlen hatte. Wie oft in den letzten vierundzwanzig Stunden hatte sie sich bei Gedanken an Dylan Quinn ertappt? Und wie oft hatte das mit der lebhaften Erinnerung an eine Demütigung geendet?
„Dies ist unser Geschäft“, sagte Meggie leise. „Wir haben nicht die letzten fünf Jahre jeden Penny gespart, in Jobs gearbeitet, die wir hassten, und die Bank of Boston um ein Darlehen angebettelt, nur damit irgend so ein übereifriger Feuerwehrmann alles mit einem Axthieb in Trümmer legt.“
Andere Frauen mochten vielleicht fasziniert sein von Dylan Quinn. Schließlich begegnete einem nicht jeden Tag ein echter Held, groß und imposant in seiner Feuerwehrmontur. Er schien wie für diesen Job geschaffen. Unerschrocken und entschlossen, stark und … Meggie seufzte. Vermutlich gab es im Leben jeder Frau einen Dylan Quinn, einen Mann, der das Objekt einer endlosen Reihe von Was-wäre-wenn-Überlegungen war.
Was wäre gewesen, wenn sie auf der Highschool nicht so unscheinbar und er ein solcher Gott gewesen wäre? Und wenn sie ihre Zahnspange ein Jahr früher losgeworden wäre? Wenn sie imstande gewesen wäre, mit ihm zu sprechen, ohne unkontrolliert zu kichern? Zwar hatte sie sich seither verändert, aber die Erinnerung daran war immer noch peinlich.
In den vergangenen Jahren hatte sie hin und wieder an Dylan gedacht und sich gefragt, was aus ihrer ersten großen Liebe geworden war. In einsamen Nächten oder nach katastrophalen Dates hatte sie sich sogar ausgemalt, wie es sein würde, ihn wieder zu treffen. Schließlich war sie heute anders. Die Zahnspange und die dicken Brillengläser waren durch makellose Zähne und Kontaktlinsen ersetzt worden. Ihr Haar wurde nun vorteilhaft zur Geltung gebracht durch einen der besten Friseure Bostons. Am wichtigsten aber war, dass sie an genau den richtigen Stellen Rundungen bekommen hatte.
Dennoch gab es da ein paar Dinge, die sich nicht geändert hatten. Nach wie vor kam sie nicht besonders gut mit Männern zurecht. Obwohl sie beruflich viel erreicht hatte, ließ ihr Privatleben sehr zu wünschen übrig. Wahrscheinlich hatte es auch mit den Männern zu tun, mit denen sie ausging, aber Meggie schob ihr Pech vor allem darauf, dass sie zu viele Jahre als graue Maus verbracht hatte.
Dylan hingegen war einer der beliebtesten Jungen auf der Highschool gewesen. Mit seinem guten Aussehen und seinem umwerfenden Charme war er das Traum-Date aller Mädchen gewesen. Aber er war noch ein Junge gewesen, und daher hatte sie ihn als großen, schlaksigen Highschool-Casanova in Erinnerung gehabt, dessen Markenzeichen sein sexy Lächeln war. Diese Erinnerung war in dem Moment zerstört worden, als sie erneut in seine wunderschönen Augen geschaut hatte.
Alle Quinns hatten diese Augen, deren Farbe eine faszinierende Mischung aus Grün und Gold war. Diese Augen verursachten einer Frau weiche Knie und Pulsrasen. Und sie bewirkten, dass Meggie sofort wieder den Schmerz und die Demütigung jenes Abends empfand, an dem der Highschool-Ball stattfand.
„Das Feuer hat aber auch sein Gutes gehabt“, sagte Lana. „Immerhin hast du Dylan Quinn wiedergesehen.“
„Das hatte mir noch gefehlt“, entgegnete sie.
Meggie und Lana waren seit dem Studium an der University of Massachusetts Freundinnen, daher gab es wenig, was Lana nicht über die Männer – oder vielmehr den Mangel an Männern – in Meggies Leben wusste. Doch das Bild, das Meggie für ihre Freundin von Dylan entworfen hatte, war weder besonders schmeichelhaft noch sonderlich wahrheitsgetreu.
Die Türklingel läutete, und Meggie richtete sich hinter dem Tresen auf, in der Hoffnung, ihre neue Espresso Master 4000 Ultra würde vom Restaurantausstatter geliefert. Aber es war nicht Eddie, der übliche Fahrer, der zur Tür hereinkam, sondern Dylan Quinn.
Mit leisem Stöhnen duckte sie sich wieder hinter den Tresen und zupfte an Lanas Hosenbein. Dylan war der letzte Mensch, den sie sehen wollte! „Er ist es“, flüsterte sie.
Lana schüttelte ihr Bein, bis Meggie losließ. „Wer?“
„Dylan Quinn. Sag ihm, er soll verschwinden. Sag ihm, wir haben geschlossen. Sag ihm, dass es drüben in der Newbury Street noch einen Coffeeshop gibt.“
„Das ist Dylan Quinn?“, murmelte Lana benommen und starrte zur Tür. „Aber er sieht überhaupt nicht aus wie …“
Meggie schlug ihr mit der Faust auf den großen Zeh. „Wimmle ihn ab! Sofort!“
Ihre Partnerin trat hinter dem Tresen hervor. „Hallo. Sie sind bestimmt auf der Suche nach einer guten Tasse Kaffee. Tja, wie Sie sehen können, haben wir noch gar nicht geöffnet. Dieser Laden wird erst in drei Wochen geöffnet.“
„Ehrlich gesagt bin ich nicht wegen des Kaffees hier.“
Der warme, volle Klang seiner Stimme ging Meggie durch und durch. Unwillkürlich fragte sie sich, wie es wohl sein würde, dieser Stimme eine oder zwei Stunden lang zu lauschen. Würde sie davon so süchtig werden, dass sie nicht mehr ohne auskam?
„Aber für einen von Bostons Feuerwehrmännern kann ich sicher etwas zubereiten“, fuhr Lana fort. „Wir werden eines der wenigen Lokale sein, in denen es Jamaican Blue Mountain gibt. Möchten Sie eine Tasse probieren? Er ist wie der Nektar der Götter. Genau das richtige Getränk für Sie, würde ich sagen.“
Meggie stöhnte erneut und packte Lanas Bein, als sie zur Kaffeemaschine ging. „Serviere ihm nicht den jamaikanischen Kaffee“, zischte sie. „Er ist der teuerste im Laden. Wirf Dylan raus!“
Lana gab Kaffeebohnen aus einem Plastikbehälter im Kühlschrank in die Kaffeemühle. „Sie sind Dylan Quinn, nicht wahr?“
„Kenne ich Sie?“, fragte er.