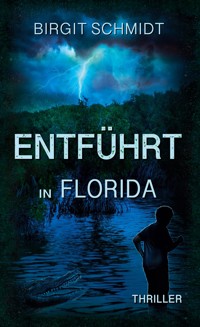Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es geschah hier und anderswo Eine Frau trifft nach vielen Jahren den Mann wieder, den sie einst sehr geliebt und der sie verlassen hat - Eine Kommissarin versucht alles, um einen Fall mehrerer ausgesetzter Babys zu lösen - Eine Frau verzaubert auf wundersame Weise das Zuhause anderer Menschen - Lassen Sie sich einfangen und überraschen von diesen und vielen weiteren spannenden, gefühlvollen, aber auch erheiternden Erzählungen der drei Autorinnen Birgit Schmidt, Jenny Canales und Sylvia Schwietering. Alle Kurzgeschichten handeln von Erlebnissen und Schicksalen verschiedener Frauen, die in der ganzen Welt beheimatet sind. Nicht nur für Frauen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Birgit Schmidt
Achtunddreißig
Bloody Sunday
Das Haus Nummer 55
Das vierte Baby
Der rote Ballon
Der Winter, in dem es Schokolade schneite
Es geschah in der Nacht
Gestohlen
Nichts als die Wahrheit
Parker ist ein guter Junge
Strange Fruit
Zwanzig Minuten
Jenny Canales
Ich werde Vierzig
Erinnerungen zwischen den Kulturen
Die Liebe, die nicht vergeht
Veronika fühlt sich allein
Sylvia Schwietering
Prolog
Die Frau im Wald
Anna und Sophie
Gute Vorbereitung
Paula
Waldspaziergang
Epilog
Autoren
Vorwort
Zwei Schwestern wollen sich nach vielen Jahren der Trennung an einer Grenze wieder treffen, ein Mädchen entdeckt durch Zufall, dass sie als Baby gestohlen wurde, eine Mutter will nicht wahrhaben, dass ihr Sohn ein Verbrecher ist und eine Hochstaplerin wird entlarvt. Eine Frau muss sich in einer völlig anderen Kultur zurechtfinden, und ein junges Mädchen ist gezwungen, sich ganz allein um ihr Baby zu kümmern. Was passiert einer Frau auf einem Waldspaziergang und wie bereitet man sich auf seine große Moderation vor?
Diese und viele weitere Geschichten in der Anthologie »Es geschah hier und anderswo« erzählen von Erlebnissen und Schicksalen verschiedener Frauen, die in der ganzen Welt beheimatet sind. Mal spannend und dramatisch, mal amüsant und erheiternd, bisweilen nachdenklich oder schmerzlich, manchmal auch politisch – die geneigten Leser und Leserinnen werden von den drei Autorinnen in ganz unterschiedliche Welten und Stimmungen entführt.
Lassen Sie sich überraschen!
Ein Buch nicht nur für Frauen…
Birgit Schmidt
Herausgeberin
Birgit Schmidt
Achtunddreißig
»Wenn du diesen Brief liest, dann hat sich mein letzter und sehnlichster Wunsch nicht erfüllt.
Meine liebe Tochter, ich schreibe dir heute diese Zeilen, damit meine Geschichte nicht vergessen wird. Als wir 1930 geboren wurden, stand unser schönes Land Hanguk1 noch unter der Herrschaft des japanischen Kaisers. Mutter gab mir den Namen Yena, Sternschnuppe, und meiner Schwester, die wenige Minuten nach mir das Licht der Sonne erblickte, den Namen Yerin, die Gutes bringt. Wir wuchsen behütet auf, bis der Zweite Weltkrieg begann. Die große Hoffnung, dass nach der Kapitulation Japans unser Land endlich frei sein würde, erfüllte sich nicht. Nachdem in der Vergangenheit erst Mongolen, dann Chinesen und schließlich Japaner über uns geherrscht hatten, teilten jetzt die Siegermächte unser Land in zwei Zonen auf. Die Sowjetunion besetzte den Norden, die USA den Süden, und der 38. Breitengrad markierte die Grenze. Nach dem Krieg führten unsere Eltern ein kleines Geschäft für Seide in Seoul und wir kamen so leidlich über die Runden. Rhee Syng-man kehrte aus seinem amerikanischen Exil zurück, übernahm bei uns im August 1948 von den USA die Regierungsgeschäfte und proklamierte die Republik Korea. Vier Wochen darauf verkündete Kim Il-Sung im Norden die demokratische Volksrepublik Korea. Rhee wollte unser Land vereinen, doch die USA unterstützten ihn nicht bei seinem Vorhaben und rüsteten unsere Armee nicht mit schweren Waffen aus. Die Hoffnung auf Ruhe und Frieden zerstörten die nordkoreanischen Truppen am 25. Juni 1950, als sie die Grenze nach Süden überschritten. Unsere Soldaten waren ihnen schutzlos ausgeliefert, und nur drei Tage später eroberte die Armee des Nordens Seoul und Umgebung. Wie viele andere mussten wir fliehen und unser Geschäft im Stich lassen.
Ich erinnere mich noch gut an jenen Morgen, an dem wir bei Tagesanbruch mit den Eltern durch das Fenster des Wohnzimmers, das nach hinten zum Garten hinaus führte, flüchteten, während die Soldaten an die Haustür hämmerten. Wir hasteten durch den Garten, in dem der Tau des Morgens das Gras in den ersten Sonnenstrahlen glitzern ließ. Von überall kamen die feindlichen Soldaten, die doch eigentlich unsere Brüder waren. Wir rannten über die angrenzenden Grundstücke, rutschten eine Böschung hinunter und liefen Richtung Reisfelder. Wir sahen uns nicht um, sondern eilten immer weiter, so schnell wir konnten. Vater voraus, Mutter dahinter, dann meine Schwester und ich. Schon als kleines Kind konnte ich schneller laufen als sie, so blieb Yerin langsam immer weiter hinter mir zurück. Als ich mich irgendwann traute, mich nach ihr umzusehen, packten sie gerade zwei Soldaten. Ich schrie: »Mutter, sie haben Yerin!« Mutter warf nur einen kurzen Blick zurück und rief: »Komm weiter, schnell!« Vater, der schon hundert Meter vor uns lief, winkte: »Hier rüber.« Mein Herz machte einen Sprung und ich zögerte, doch Mutter rief: »Sieh nicht zurück, sonst fassen sie uns auch.« Wir rannten um einen mit niedrigen Büschen bewachsenen Hügel und hinab zum Fluss, dessen ruhige Wasseroberfläche friedlich in der Sonne schimmerte. Am Flussufer gab es unzählige Höhlen, die sich weit in die Hügel hineinzogen und in denen wir als Kinder immer Verstecken gespielt hatten. Jetzt fanden wir in einer dieser Grotten Zuflucht. In jenem Moment ahnte ich noch nicht, dass ich meine Schwester nie wiedersehen sollte.
Die folgenden Tage und Wochen blieben wir immer in Bewegung. Vater bestimmte, wann wir den Unterschlupf verließen und wohin wir gingen. »Wenn wir unsere Verstecke täglich wechseln, finden sie uns nicht so leicht.« Er sollte Recht behalten. Meinen Einwand, wir müssten umkehren und nach Yerin suchen, überging er. »Wir können ihr nur helfen, wenn wir selbst in Sicherheit sind. Fassen sie uns, sind wir alle verloren.« Mutter sagte kein Wort dazu, und dabei blieb es, wir sprachen nie wieder darüber. Drei Jahre dauerte unsere Flucht, drei Jahre, in denen Mutter immer mehr verstummte. Es war die schrecklichste Zeit meines Lebens. Am 27. Juli 1953 vereinbarten der Norden und der Süden einen Waffenstillstand. Wie zum Hohn angesichts fast einer Million gefallener Soldaten und drei Millionen getöteter Zivilisten stellte er den Zustand vor dem Krieg wieder her. Er ist auch am heutigen Tage, an dem ich diese Zeilen schreibe, noch gültig, einen Friedensvertrag haben wir immer noch nicht.
Viele Jahre vergingen, bis ich durch einen Zufall erfuhr, dass meine Schwester im Norden noch lebte. Unsere Eltern waren bereits zu ihren Ahnen gegangen. Es dauerte lange, bis die Regierungen beider Länder endlich Treffen zwischen Familienangehörigen vereinbarten. Ich meldete mich sofort und bekam eine Nummer für die Lotterie zugewiesen. 132000 Landsleute nahmen über die Jahre seither daran teil. Wird die eigene Nummer gezogen, hat man genau diese eine Chance, seinen Lieben zu begegnen, niemand darf ein zweites Mal seine Verwandten treffen. Unzählige Male hatte ich Pech bei der Verlosung, doch in diesem Jahr, da ich 88 Jahre alt geworden bin, wurde meine Nummer endlich gezogen. Die 38. Die Zahl, die der Grenzlinie zwischen unseren Staaten entspricht. Ich sah es als gutes Omen an. Ich sollte mich täuschen.
Wir fuhren mit mehreren Bussen zur Amtsstube der südkoreanischen Einwanderungsbehörde, an der Grenze in Goseong. Streng dreinschauende Beamte überprüften unsere Dokumente sorgfältig, dann ging es weiter in die entmilitarisierte Zone an der Grenze. In der nordkoreanischen Region Kumgang sollte in einer Ferienanlage im Diamantengebirge das Treffen stattfinden. Drei Tage hat man uns dafür Zeit gegeben.
Wir, die wir alle mehr als siebzig Jahre, nicht wenige mehr als neunzig Jahre alt sind, kamen erschöpft an, doch wie alle war ich voller Vorfreude. Mein Herz klopfte, ich konnte es kaum erwarten, meine Schwester wiederzusehen. Nacheinander riefen sie alle Namen auf und brachten uns zusammen. Alle, nur mich nicht. Ein Offizieller der nordkoreanischen Gruppe kam auf mich zu und teilte mir mit, dass meine Schwester auf dem Weg zum Hotel verstorben sei. Kein Wort des Bedauerns, keine Anteilnahme, nur eine nüchterne Feststellung. Während dieser drei Tage, an denen die anderen sich über das Wiedersehen freuen, versuche ich, meine Gedanken zu ordnen und habe mich entschlossen, diesen Brief zu schreiben.
Ich weiß, mir bleibt nicht mehr viel Zeit und daher möchte ich meine Geschichte nicht der Vergessenheit preisgeben. Ich werde es nicht mehr erleben, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass eines Tages unser schönes Land wieder eins sein wird und Verwandte und Freunde sich ganz normal besuchen können. Ich wünsche mir, dass du, meine liebe Tochter, oder deine Kinder irgendwann in einem vereinten Korea leben werden.«
Sook strich zärtlich über die zwei Seiten, die mit einem feinen schwarzen Filzschreiber in gestochener koreanischer Schrift eng beschrieben waren. Sie bemerkte nicht, dass ihr Mann hinter ihren Stuhl getreten war. Er legte seine Hände auf ihre Schultern.
»Du weinst? Was hast du da für einen Brief?«
Sie faltete das dünne Papier vorsichtig zusammen und legte es behutsam in ein mit filigranen Pinselstrichen bemaltes Holzkästchen. »Er ist von meiner Großmutter Yena. Er lag in dieser Schatulle, die wir nach Mutters Tod in ihrem Kleiderschrank gefunden haben.«
»Und? Was steht drin?«
»Es ist die Geschichte von ihr und ihrer Zwillingsschwester.«
»Sie hatte eine Zwillingsschwester? Das wusste ich gar nicht.«
»Ich auch nicht. Mutter hat es mir nie erzählt. Die Schwestern wollten sich im Jahr 2018 an der damaligen Grenze treffen, doch ihre Schwester Yerin ist auf dem Weg dorthin verstorben.«
»Das ist tragisch, dass sie sich nicht mehr gesehen haben. Wenn ich mir vorstelle, wie die Grenze viele Familien jahrzehntelang getrennt hat.«
»Ja, ein trauriges Kapitel. Was haben wir heute für ein Glück, dass unser Land endlich wiedervereinigt ist.«
Bloody Sunday
Letzte Nacht träumte ich wieder von unserem Haus. Es lag friedlich in der Mittagssonne und zwei süßlich duftende Magnolienbäume beschatteten die leicht windschiefe Veranda mit dem blassblauen Dach. Pa hatte es mit den eigenen Händen erbaut, kurz bevor mein älterer Bruder Jim geboren wurde. Vaters Freunde hatten ihm dabei geholfen, das Dach und die Veranda mit dem Vordach zu zimmern. So war es damals bei uns in Selma. Freunde und Nachbarn halfen einander, beim Hausbau, bei der Ernte und auch sonst. Wir hielten zusammen, feierten gemeinsam, trauerten vereint.
In meinem Traum war ich wieder das kleine siebenjährige Mädchen, das sang und mit einer Zuckerstange in der Hand die staubige Curtis Street hinunter tanzte bis in unserem Vorgarten, den Ma hegte und pflegte. Ma arbeitete als Lehrerin an der hiesigen Elementary School und alle Kinder hatten sie ins Herz geschlossen. Sie liebte es, am Abend nach verrichteter Arbeit im Schaukelstuhl auf der Veranda zu sitzen und mit den Nachbarn noch ein Schwätzchen zu halten, während wir Kinder auf der Straße Verstecken oder mit Murmeln spielten, bis die Sonne unterging.
Jene Tage der Ruhe und Idylle nahmen im Mai 1963 ein jähes Ende. Ich weiß noch genau, wie Pa an einem sonnigen Sonntagvormittag zu der Trauerfeier von Sam Boynton ging. Sam und seine Frau Amelia hatten schon seit ein paar Jahren in Dallas County dafür gekämpft, dass wir Schwarze uns als Wähler registrieren lassen konnten. Leider war Sam nach einem Herzanfall früh von uns gegangen, aber viele der Aktivisten, mit denen er seit Jahren zusammengearbeitet hatte, wollten auf seiner Totenfeier die Gelegenheit ergreifen, um vor einem größeren Publikum über ihre Ziele sprechen. An dem Morgen umstellte Sheriff Clark mit seinen Männern die Kirche, um die Feier und die Reden zu verhindern, doch Pa und seine Freunde ließen sich nicht einschüchtern.
Seitdem herrschte Krieg zwischen dem Sheriff und uns. In den folgenden Wochen und Monaten mussten wir entgegen unserer Gewohnheit abends die Haustüren verriegeln, denn Mitglieder des Ku-Klux-Klans zogen mit Fackeln durch die Straßen von Selma und schlugen jeden Schwarzen tot, den sie zu fassen bekamen.
Es brodelte nicht nur in unserer kleinen Stadt Selma, die auch der Verwaltungssitz von Dallas County in Alabama war, sondern im gesamten Süden. Fünf Monate später, im Oktober, marschierten Ma und Pa mit ihren Freunden zu einer Masseneinschreibung. Mehr als 350 Schwarze hatten sich auf den Weg gemacht. An diesem 7. Oktober brannte die Sonne glühend heiß vom wolkenlosen Himmel. Der Registrierungsausschuss, in dem natürlich nur Weiße saßen, verschleppte die Einschreibung viele Stunden. Meine Eltern mussten vom frühen Morgen bis zum späten Nachmittag in der prallen Sonne ausharren. Mittags brachte ihnen mein Bruder Jim Wasser und etwas Maisbrei zur Stärkung. Dafür wurden er und einige andere, die auch die Wartenden versorgen wollten, von Sheriff Clark und seiner Truppe mit Elektroschockern traktiert. Am Abend schleppten meine Eltern Jim mit allerletzter Kraft heim. Registrieren lassen konnten sie sich an dem Tag nicht, das hatten gerade mal 25 Personen geschafft. Zu Hause verarzteten wir meinen Bruder, beteten gemeinsam und schworen uns, niemals aufzugeben, egal, was man uns noch antun würde. Unser Schwur wurde auf eine harte Probe gestellt.
Im Sommer 1964 nahmen Ma und Pa einen neuen Anlauf, um sich für die nächste Wahl registrieren zu lassen. Sie brachen bereits bei Sonnenaufgang auf und ließen mich mit meinen beiden älteren Brüdern zuhause zurück. Wir vertrödelten den Tag mit einem mulmigen Gefühl im Magen und wunderten uns, dass die Eltern bis zum Abend noch immer nicht zurückgekehrt waren. Dann, es war schon dunkel geworden, klopften meine Freundin Lucy und ihre Mutter an die Haustür und berichteten mit aschfahlen Gesichtern, was am Tage passiert war. Als unsere Eltern und fast fünfzig andere Personen das Verwaltungsgebäude in Selma betreten hatten, nahm Sheriff Jim Clark sie kurzerhand fest, denn sie waren schwarz. So einfach war das damals. Farbige durften nicht wählen. Das heißt, nachdem Präsident Lyndon B. Johnson den Civil Rights Act 1964 unterschrieben hatte, besaßen sie endlich das Recht dazu. Aber die Männer, die die Registrierungen vornahmen, dachten sich weiterhin allerlei Schikanen aus, um die schwarze Bevölkerung davon abzuhalten.
Lucy und ihre Eltern waren weiß und auf unserer Seite. Sie fanden es nicht richtig, dass diese Männer uns das Bürgerrecht des Wählens vorenthielten. Lucy und ihre Mutter brachten uns an diesem Abend selbstgebackenen Schokoladenkuchen und trösteten uns. Sie blieben beide zwei Nächte und zwei Tage bei uns, bis Clark und seine Männer Ma und Pa endlich freiließen. Von da an änderte sich zu Hause eine Menge.
In den folgenden Monaten marschierte Pa ständig zu irgendwelchen Versammlungen, die die Aktivisten im Geheimen abhielten. Drei oder mehr Personen durften sich nicht auf der Straße treffen, das hatte unser Gericht verfügt. Und der Sheriff und seine Schergen freuten sich diebisch, all die zu verhaften, die sich als dritte oder vierte Person irgendwem anschlossen. Natürlich aus purer Gemeinheit. Sie wollten verhindern, dass wir uns verabredeten, damals, als auf dem Land Telefone noch eine Seltenheit und das Internet Lichtjahre entfernt waren. Aber unsere Beine waren schnell und ausdauernd und unser Gedächtnis gut, und so liefen wir von Haus zu Haus und gaben die Informationen mündlich weiter. Dann bekamen meine Eltern und ihre Freunde Hilfe. Hilfe von Martin Luther King. Der arbeitete zu der Zeit als Pfarrer in Montgomery, der Landeshauptstadt von Alabama. Er war nicht nur unser Führer der Southern Christian Leadership Conference, sondern der gesamten Bürgerrechtsbewegung. Sams Witwe Amelia Boynton hatte ihn und seine Organisation gebeten, ein Hilfsteam zu uns nach Selma zu schicken, um die Einschreibungen voranzutreiben.
Am 26. Februar 1965 starb Vaters Schulfreund Jimmy Lee. Pa fuhr mit ein paar anderen nach Marion, einer kleinen Stadt in Alabama, in der Jimmy Lee Jackson als Diakon der baptistischen Kirche arbeitete. Auf ihrem friedlichen Protestmarsch wurde Jimmy, obwohl er als Mann Gottes keine Waffen trug, von den Alabama State Troopers geschlagen und von dem Trooper James Bonard Fowler angeschossen. Vater schleppte den Freund mit der Hilfe von zwei anderen ins Hospital, doch Jimmy Lee erlag nach acht Tagen seiner Schussverletzung.
Jimmys Tod entzündete die Lunte. Wenige Tage später, am Sonntag, den 7. März 1965, wollten etwa 600 Menschen auf dem Highway 80 von Selma nach Montgomery marschieren. Ich stand mit meinen Brüdern Jim und Ben am Straßenrand und beobachtete gespannt den Zug der Schweigenden. Meine Eltern liefen in der dritten Reihe. Alle hatten sich reihenweise untergehakt und trugen keine Waffen. Vor der Edmund-Pettus-Brücke stoppte Sheriff Clark mit seiner Truppe die Marschierenden. Wir mussten tatenlos zusehen, wie die Polizisten unsere Leute niederknüppelten und mit Tränengas jagten. Sie kamen von rechts, von links, von überall. Ich kreischte. Sie trieben die friedlich demonstrierenden Menschen wie eine Horde Vieh vor sich her. Meine Brüder schrien. Ich weiß noch, wie einer der Troopers uns zurief »Lauft!« Wir rannten um unser Leben. Ein Officer zu Pferd schlug meine Mutter von hinten mit einem Knüppel erst auf den Rücken und dann auf die Hinterseite des Halses. Sie stürzte zu Boden, versuchte, sich wieder hochzurappeln, doch dann kam ein anderer und schlug sie auf den Kopf, bis sie endgültig am Boden liegen blieb. Er prügelte weiter auf sie ein, obwohl sie längst das Bewusstsein verloren hatte. Ich konnte nicht zu ihr durchkommen, um ihr zu helfen, da die Troopers auch all die niederknüppelten, die den Verletzten beispringen wollten. Getrieben von den brutalen Polizeischlägern flüchteten wir nach Hause und warteten dort zitternd auf Nachrichten von unseren Eltern. Erst tief in der Nacht kam Pa heim. Er blutete aus zahlreichen Wunden, sein Gesicht schmutzig und verschmiert von Tränen und Straßenstaub. »Eure Ma ist tot«, presste er heraus, »doch ich schwöre euch bei Gott, sie ist nicht umsonst gestorben.« In dieser Nacht und am folgenden Tag sprach er kein weiteres Wort. Wir Kinder saßen in der Nacht am Küchentisch eng beieinander und hofften, dass keine Troopers oder Ku-Klux-Klan-Schläger uns aus dem Haus schleppten. Wir wussten nicht, wie viele unschuldige Menschen die Polizei und die aufgebrachte rassistische Meute an jenem Tag verletzten oder töteten, doch dieser schreckliche Tag blieb nicht nur unserer Familie als der blutige Sonntag ewig in Erinnerung. Unzählige Male wachte ich seitdem schweißgebadet des Nachts auf. Ich sehe Mutter auf der Straße liegen und ihr Blut färbt den Staub rot. Ich träume von den Schlägen, die meine Ma töteten.
Zwei Tage später, wir hatten Mutter noch nicht beerdigt, sagte Vater nur einen Satz: »Wir marschieren wieder.« Diesmal nahm er uns mit. Martin Luther King hatte alle Geistlichen des Landes aufgerufen, uns bei diesem zweiten Marsch zu unterstützen. Auch viele Weiße folgten seinem Ruf. Wir vier marschierten langsam mit den anderen zur Edmund-Pettus-Brücke. Dort wartete bereits Clarks Polizeitruppe mit angelegten Gewehren auf uns. King hielt einen Moment inne, kehrte dann um und alle folgten ihm schweigend und mit gesenkten Köpfen. Später schimpften Vater und viele seine Freunde, dass er aus Angst vor einer erneuten Eskalation einen Rückzieher gemacht hatte. Trotzdem gab es wieder einen Toten, doch der war diesmal weiß. James Reeb, ein Geistlicher, wurde von mehreren Rassisten mit Schlagstöcken angegriffen und geschlagen, als er nach dem Marsch mit Freunden Walker`s Cafe verließ. Zwei Tage später starb er an seinen Kopfverletzungen.
Reebs Tod ist der Wendepunkt, prophezeite Vater. Wie Recht er haben und was das für mich bedeuten würde, ahnte ich zu dem Zeitpunkt nicht im Entferntesten. Der Präsident kondolierte Reebs Witwe. Überall im Land hielten die Leute Mahnwachen ab. Man verhaftete vier Personen, ließ sie aber schnell wieder frei. Im April 1965 klagte man dann doch drei von ihnen des Mordes an. Die Zeugenaussagen belasteten sie schwer, doch die Jury bestand nur aus Weißen und es passierte das, was wir alle befürchteten. Sie wurden freigesprochen. Meine Wut über diese weiße Rechtsprechung wuchs mit jedem Tag und ich schwor mir, etwas dagegen zu tun.
Doch zuvor marschierten unsere Leute ein drittes Mal los und erreichten endlich Montgomery. Sie brauchten für die 86 Kilometer über den Highway 80 fünf Tage und vier Nächte. Und Vater behielt Recht. Diesmal wurden sie nicht geschlagen und gedemütigt, sondern von Soldaten der US-Army und der Nationalgarde geschützt. Dafür hatte der Präsident gesorgt. Noch viele Jahre später erzählte Pa mit leuchtenden Augen von dem großen Konzert am Abend, in dem Stars wie Harry Belafonte, Sammy Davies jr., Nina Simone und Tony Bennett auftraten und für unsere Freiheit sangen.
Ein Geräusch riss mich aus den Bildern der Vergangenheit. Linda, meine Sekretärin, stand in der Tür und räusperte sich. »Mrs. Hamilton.«
»Was gibt es, Linda?«
»Haben Sie noch was für mich? Wenn nicht, würde ich gern nach Hause gehen. Mein Mann hat heute Geburtstag.«
»Nein, alles gut. Machen Sie Feierabend, Linda. Und grüßen Sie Ihren Mann von mir.«
»Danke, Mrs. Hamilton. Und alles Gute für morgen.«
Sie stöckelte den Gang hinunter. Ich klappte die dicke Akte auf meinem Schreibtisch zu. Morgen früh um zehn würde ich das Abschlussplädoyer der Staatsanwaltschaft halten. Auf der Anklagebank saßen drei Ku-Klux-Klan-Mitglieder, alle über 90 Jahre alt. Doch Mord verjährt nicht. Auch nicht der an Schwarzen. Sie sollten ihre gerechte Strafe erhalten. Das war ich nicht nur meinen Eltern schuldig, sondern allen, die ihr Leben für die Gleichberechtigung gegeben hatten. Auf dem Weg nach Hause würde ich gleich noch ein paar Magnolien bei Macy`s Flowers and More kaufen und sie auf das Grab meiner Mutter legen. Sie hatte Magnolien über alles geliebt.
Das Haus Nummer 55
Am Abend meines fünfzehnten Geburtstags kehrte Mutter nicht mehr heim.
Der Zeiger der antiken Wanduhr rückte auf Mitternacht vor. Ich lugte zwischen den Gardinen auf die regennasse Straße, die die Straßenlaterne vor unserem Haus nur spärlich beleuchtete. Mutter arbeitete oft bis spät in dem winzigen Antiquitätengeschäft, das sie seit Vaters Deportation nach Bergen-Belsen ohne ihn führte. Doch so lange war sie noch nie ausgeblieben. Mit jeder Stunde, die verging, nagte die Angst stärker in mir.
Mein zehnjähriger Bruder Levi schlief in seinem Bett. Er wachte nicht auf, als jemand leise an die Wohnungstür klopfte. Ich öffnete die Tür einen Spalt. Die alte Frau Goldberg von gegenüber, die in ihrem graubraunen Regenmantel fast versank, blickte sich hastig um.
»Ich hoffe, es hat mich keiner verfolgt«, flüsterte sie und huschte in den Flur.
Ich schloss lautlos die Tür und sie fasste mich an den Schultern. »Sie haben eure Mutter verhaftet. Ihr müsst hier weg«, sagte sie heiser.
»Woher wissen Sie das?« Ich wollte nicht glauben, dass meine Befürchtungen wahr sein sollten.
»Mit den eigenen Augen hab ich gesehen, wie die Gestapo sie aus ihrem Laden gezerrt hat.« Tränen liefen über ihr faltiges Gesicht. »Schnell, packt ein paar Sachen. Lauft zum Haus Nummer 55 in der Leipziger Straße. Dort wird euch Herr Mannstein verstecken.«
Nach Vaters Verhaftung hatte Mutter mit uns viele Male diesen Notfall durchgespielt. Wie in Trance griff ich einen Koffer, packte Anziehsachen für Levi und mich, zwei Bücher und wenige persönliche Erinnerungsstücke hinein. Mutters Geburtstagsgeschenk, die silberne Kette mit dem ovalen Medaillon, das ein Foto der Eltern enthielt, legte ich mir mit zitternden Händen um. Dann weckte ich meinen Bruder.
»Levi, wach auf. Wir müssen fort. Sie haben Mutter verhaftet.«
Er sah mich mit großen Augen an und bekam kein Wort heraus. Ich half ihm beim Anziehen, knöpfte seine warme Jacke zu und setzte ihm die wollene Schirmmütze auf. Frau Goldberg schob ihn zur Tür.
»Beeil dich, Rachel«, sagte sie, »lösch das Licht. Niemand darf euch sehen.« Sie zog den Kopf ein und spähte durch den Haustürspalt auf die Straße. »Jetzt. Die Luft ist rein«, flüsterte sie. »Viel Glück. Ich habe mit Mannstein besprochen, dass ihr kommt.«
Wir mieden die Lichtkreise der Laternen und drückten uns in die dunklen Löcher der Hauseingänge. Ich trug den Koffer in der Rechten und hielt Levis Hand fest in der Linken. Nach einer knappen halben Stunde bogen wir in die Leipziger Straße ein und suchten das Haus mit der Nummer 55. Wir erblickten ein mehrstöckiges, mit reichlich Stuck verziertes Gebäude, in dessen Fenstern keine einzige Lampe brannte. Ich fasste den eisernen Türklopfer und zögerte. Mein Herz pochte, schließlich ließ ich ihn vorsichtig an die Tür fallen. Innen rührte sich niemand. Ich klopfte lauter. Jetzt hörten wir ein Schlurfen hinter der Tür. Es kam näher, dann öffnete sich die schwere Holztür langsam einige Zentimeter.
»Ja?« Der weißhaarige Mann im Morgenmantel über dem gestreiften Schlafanzug blinzelte.
Ich legte Levi den Arm um die Schultern und drückte ihn an mich. »Herr Mannstein?«