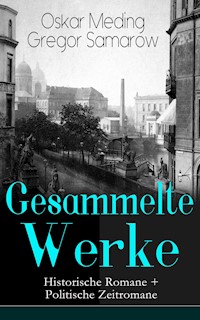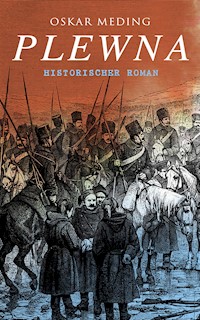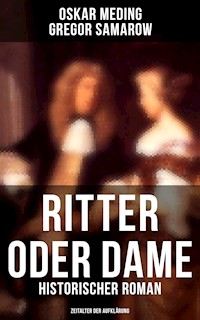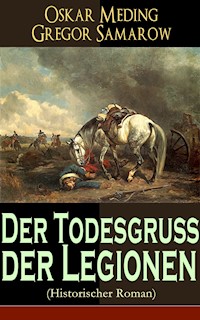1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Oskar Medings Werk 'Europäische Minen und Gegenminen' bietet einen detaillierten Einblick in die Geschichte und Techniken des Minenkriegs in Europa. Das Buch ist in einem klaren und präzisen Stil verfasst, der sowohl Fachexperten als auch Laien anspricht. Meding beleuchtet die Entwicklung von Minen als Kriegswaffen und analysiert die Strategien und Taktiken, die im Laufe der Geschichte verwendet wurden. Dabei zeigt er auch die Auswirkungen des Minenkriegs auf die Schlachten und Kriege in Europa. Das Buch ist eine wichtige Studie für Militärhistoriker und alle, die sich für Kriegsführung interessieren. Oskar Meding, ein renommierter Experte auf dem Gebiet der Militärgeschichte, hat sein umfangreiches Fachwissen in dieses Werk einfließen lassen. Als ehemaliger Offizier der Armee bringt er eine einzigartige Perspektive in das Buch ein, die es zu einem wertvollen Beitrag zur Militärliteratur macht. 'Europäische Minen und Gegenminen' ist ein Must-Read für alle, die mehr über diese faszinierende Facette der Kriegsführung erfahren wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Europäische Minen und Gegenminen
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel.
Es war Mitte März 1867.
Ein leichtes Halbdunkel herrschte in dem Wohnzimmer des kaiserlichen Prinzen von Frankreich im alten Paläste der Tuilerien. Die schweren grünen Vorhänge waren bis fast zur Mitte der Fenster zusammengezogen und die durch graue Wolken verhüllte Morgensonne sendete nur wenig Licht in das Innere des Zimmers, welches ein Helles, prasselndes Kaminfeuer mit behaglicher Warme erfüllte.
Auf dem großen Tisch in der Mitte lagen aufgeschlagene Bücher und Landkarten, auf einem Seitentisch standen kleine, statuettenartige Figuren von Papiermaché, die verschiedenen Truppenteile der französischen Armee darstellend, man sah daneben einen Zeichentisch und eine kleine Staffelei mit Gerätschaften zum Malen, einen kleinen elektrischen Apparat und rings umher eine Menge jener tausend Kleinigkeiten, welche teils zum Spiel, teils zum Unterricht des zarten Knaben dienten, den man den kaiserlichen Prinzen von Frankreich nannte, und auf welchen die Augen von ganz Europa teils mit teilnehmender Sorge, teils mit gespanntem Interesse, teils mit erbittertem Hasse ruhten.
Eine Chaiselongue stand in der Nähe des Kamins neben einem Tisch, bedeckt mit Bilderwerken, und auf derselben lag der junge, elfjährige Prinz, in einen weiten, weichen Schlafrock von schwarzer Seide gehüllt. Das blasse, magere Gesicht, von jener durchsichtigen, weißen Klarheit, welche langes körperliches Leiden hervorbringt, ruhte leicht Zurückgelehnt auf einem weißen, spitzenumsäumten Kissen, die großen, dunklen Augen blickten mit fieberhaftem Glanz aus dem perlmutterschimmernden Weiß hervor, und um den jugendlich frischen Mund mit der stolz aufgeworfenen Lippe zuckte es in erregtem Nervenspiel.
Die eine seiner feinen, schlanken und weißen Hände ruhte auf einem, auf seinen Knien aufgeschlagenen farbenreichen Bilderwerk, die Kostüme Frankreichs zu den verschiedenen historischen Epochen darstellend – das aufgeschlagene Blatt zeigte Ludwig XVI. im Krönungsornat und verschiedene Herren und Damen in glänzenden Hoftrachten jener Zeit.
Die andere Hand des Prinzen hielt der vor der Chaiselongue stehende Leibarzt des Kaisers, Doktor Conneau, in der seinen – aufmerksam auf den Sekundenzeiger seiner Uhr blickend und den Pulsschlag zählend.
Die ernsten und intelligenten Züge des alten Freundes und Arztes Napoleons III. waren nicht ganz frei von nachdenklicher Besorgnis, und länger, als sonst nötig, hielt er schon die Hand des kranken Knaben in der seinen, immer und immer wieder den Pulsschlag verfolgend und von Zeit zu Zeit in fast unmerklicher Bewegung den Kopf schüttelnd.
Auf der anderen Seite stand der Gouverneur des Prinzen, General Frossard, eine ernste, militärische Erscheinung, fest und soldatisch in seiner Haltung, Freundlichkeit, gemischt mit energischer Willenskraft, bildete den Ausdruck seiner Züge. Der forschende Blick seines Auges ruhte auf dem Arzte, der jetzt langsam die Hand des Prinzen herabsinken ließ und lange prüfend in dessen Gesicht blickte.
»Sobald das Wetter schöner wird,« sagte endlich Doktor Conneau, »muß der Prinz nach Saint Cloud; der fortwährende Aufenthalt in reiner und sonniger Luft ist jetzt erste Bedingung der weiteren Genesung.«
Die Augen des jungen Prinzen erweiterten sich, ein glückliches Lächeln umspielte seine Lippen.
»Ich danke Ihnen herzlich für diese Verordnung,« rief er mit seiner, trotz des jugendlichen Alters sonoren und wohllautenden, durch die Leiden der Krankheit etwas gedämpften Stimme, »oh, es treibt mich mit aller Gewalt hinaus aus diesen Mauern, hinaus in die weite, freie Luft zu den Blumen und Bäumen, die ich hier nur aus den Fenstern sehen kann! – Glauben Sie mir,« fuhr er nach einer kurzen Pause, während welcher sein Blick träumerisch auf dem kolorierten Kupferblatt vor ihm ruhte, – »glauben Sie mir, – hier in diesen Mauern werde ich niemals gesund, sie bringen mir Unglück, sie drücken und beängstigen mich, – o – ich bitte, lassen Sie mich gleich, – gleich heute hinausgehen!«
»Das Wetter ist noch zu rauh, mein Prinz,« sagte Doktor Conneau freundlich, indem er mit der Hand leicht und sanft über das glänzende, dunkelblonde Haar des kaiserlichen Kindes strich. – »Sie müssen noch einige Zeit warten, die Übersiedelung könnte Ihnen schaden!«
Ein Zug von Unmut und Verdruß legte sich um die Lippen des Prinzen, seine reine Stirn faltete sich über den Augenbrauen und seine Augen verhüllten sich in leichtem Tränenschimmer.
»Die Übersiedelung kann mir nicht so viel schaden,« rief er heftig, indem er die Fingerspitzen gegeneinander preßte, »als der Aufenthalt hier in diesen Tuilerien, die mich erdrücken. Ich will fort!«
»Prinz,« sagte der General Frossard mit kurzem und strengem Ton, »um das Wort: ich will – brauchen zu lernen, muß man zunächst zu gehorchen verstehen, zu gehorchen den Eltern und Lehrern – und vor allem der Notwendigkeit. Regen Sie sich nicht auf und warten Sie ruhig den Augenblick ab, wo der Doktor Ihre Übersiedelung anordnen wird.«
Der Prinz senkte die Augen, ein langer Seufzer drang aus seinen Lippen, und wie unwillkürlich deutete er mit der Hand auf das Kostümbild, das auf seinen Knien lag.
»Ich sage Ihnen aber,« sprach er nach einigen Augenblicken, indem der gereizte und eigenwillige Ausdruck von seinem Gesicht verschwand und eine tiefe Traurigkeit sich über seine Züge legte, – »ich sage Ihnen aber, daß ich hier nicht gesund werden kann! – Denken Sie, lieber Doktor,« fuhr er fort, – »ich lag hier vorher und besah diese Bilder der alten Trachten und erinnerte mich dabei alles dessen, was ich gelernt habe aus der Geschichte Frankreichs – und bei jedem neuen Bilde sah ich neues Blut und Unglück, welches dieser Louvre und diese Tuilerien, die jetzt mit ihm vereint sind, über ihre Bewohner gebracht haben, immer neue Ströme von Blut, immer neues Entsetzen, – ich wurde recht traurig, und hier bei diesem Bilde des armen Königs Ludwig schlief ich ein.«
Die Augen des Prinzen richteten sich weit und glänzend mit fieberhaftem Schimmer nach oben.
»Da träumte ich weiter,« fuhr er fort, indem seine Stimme fast zum Flüsterton herabsank, – »und ich sah den armen, kleinen Dauphin, wie er bleich und traurig die Hand gegen mich erhob – und dann sah ich den schönen König von Rom, er stieg langsam hinab in eine einsame Gruft und grüßte mich mit der Hand und blickte mich an so tief und wehmütig, daß es mir hier« – er legte die Hand auf sein Herz – »weh tat – und dann sah ich aus allen Mauern dieses Schlosses die hellen Flammen hervorbrechen, und draußen der Hof wurde ein Meer von Blut, und in dies Meer sanken die Trümmer des brennenden Schlosses hinein. – Und ich wollte fliehen, voll Angst und Entsetzen, – aber die Wellen des Blutmeeres rollten mir nach und wollten mich verschlingen, – da wachte ich auf – aber ich sehe noch das entsetzliche Bild vor mir! O lieber Doktor, lassen Sie mich fort von hier, aus diesen fürchterlichen Tuilerien, ich kann hier nicht schlafen, – aus Furcht, wieder so schrecklich zu träumen!«
Und bei Prinz faltete bittend die Hände und richtete seinen Blick mit flehendem Ausdruck auf den Arzt.
Doktor Conneau blickte ernst und sorgenvoll in die aufgeregten Züge des Knaben.
»Mein Prinz,« sagte der General Frossard mit ruhigem, festem Ton, »Sie müssen sich nicht aufregen und keinen Träumereien hingeben, – die Geschichte jedes Landes hat vieles Traurige und viele blutige und entsetzliche Momente, – denken Sie lieber an alles Große und Herrliche, das die Vergangenheit und die Gegenwart dieses schönen Frankreichs in so reichem Maße bieten!«
»Es wäre besser,« sagte Doktor Conneau zum General gewendet, »wenn der Prinz jetzt für einige Zeit jede Beschäftigung mit geschichtlichen Gegenständen aufgäbe, – Ruhe der Nerven ist für ihn notwendig.«
Der General nahm langsam das Buch von den Knien des kaiserlichen Prinzen.
»Lassen wir jetzt diese Bilder,« sprach er mit freundlichem Ernst, – »wir wollen uns einen Augenblick mit der Geometrie beschäftigen und einige kleine Aufgaben lösen.«
Und er nahm aus einer Mappe eine Tafel mit geometrischen Figuren aus der Lehre von den Dreiecken und legte sie vor den Prinzen.
Dieser blickte erheitert zu seinem Gouverneur empor und rief:
»O ja! das ist schön, – es macht mir so viel Freude, wenn ich eine Aufgabe lösen kann, – ich will mir recht viele Mühe geben!«
»Und ich verspreche Ihnen, lieber Prinz,« sagte Doktor Conneau lächelnd, »daß Sie, sobald als es irgend nur möglich ist, nach Saint Cloud gehen sollen, – ich werde sogleich mit dem Kaiser sprechen und ihn bitten, die nötigen Befehle zu geben!«
»Ihr Sohn aber geht mit mir,« rief der Prinz, – »nicht wahr? – Ich wäre nicht glücklich dort, wenn ich meinen lieben Kameraden nicht bei mir hätte.«
»Wenn der Kaiser es erlaubt, soll er Sie gewiß begleiten,« antwortete Doktor Conneau, – »und wenn Sie beide dort recht artig und fleißig sein wollen,« – fügte er freundlich lächelnd hinzu.
»Das verspreche ich!« rief der Prinz – »und,« fügte er mit einem halb ehrerbietigen, halb schelmischen Blick auf seinen Gouverneur hinzu, – »dafür sorgt der General!«
»Auf Wiedersehen!« sagte der Doktor, indem er mit einem Blick liebevoller Zärtlichkeit dem Sohne seines kaiserlichen Freundes die Hand reichte und nochmals leicht sein Haupt streichelte.
Dann verabschiedete er sich mit herzlichem Händedruck von dem General und verließ das Zimmer des Prinzen.
Mit trübem Blick und in tiefes Nachdenken versunken durchschritt er langsam die Galerie, welche zu dem Kabinett Napoleons führte.
Im Vorzimmer des Kaisers fand er den diensttuenden Adjutanten, General Favé, einen kleinen, beweglichen Mann mit leicht ergrauendem kurzen Haar und lebhaften Augen – und den Marquis de Moustier, welcher nach dem Rücktritt von Drouyn de Lhuys infolge der deutschen Katastrophe das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten übernommen hatte.
Der Marquis war soeben angekommen, hatte ein Portefeuille auf den Tisch gestellt und unterhielt sich mit dem General. Beide Herren trugen den schwarzen Überrock – nach der für den Morgenempfang am französischen Hofe herrschenden Sitte.
Herr von Moustier, einer jener altfranzösischen Edelleute, welche sich mit dem Kaiser ralliiert hatten, war damals ein Mann hoch in den Fünfzigern. Seine mittelgroße, früher so schlanke Gestalt hatte durch ein leichtes Embonpoint etwas von ihrer Eleganz eingebüßt, das vornehme, blasse Gesicht, umrahmt von kurzem schwarzen Haar, mit einem kleinen, schwarzen Schnurrbart auf der Oberlippe, trug die Spuren tiefer Kränklichkeit, zeigte aber dabei doch ein jugendlich leichtes Mienenspiel.
Der Doktor Conneau begrüßte den Marquis mit respektvoller Artigkeit und reichte dem General Favé freundlich die Hand.
»Herr Minister,« sagte er mit leichter Verbeugung, »ich bitte Sie, mir den Vorrang lassen zu wollen, ich werde Sie nicht lange zurückhalten, – ich möchte aber Seine Majestät nicht lange auf Nachrichten über das Befinden des kaiserlichen Prinzen warten lassen.«
Der Marquis von Moustier drückte durch eine verbindliche Neigung des Hauptes sein Einverständnis aus und fragte: »Und wie geht es dem Prinzen? – Sein Befinden,« fuhr er fort, »ist nicht nur eine medizinische, sondern auch eine sehr politische Frage, und ich muß mich daher doppelt dafür interessieren.«
»Der Prinz ist auf dem besten Wege zur vollständigsten Genesung, die Schmerzen in der Hüfte vermindern sich, und in kurzem wird er, wie ich hoffe, vollständig gesund sein,« erwiderte der Arzt mit zuversichtlicher Stimme, indes eine nicht ganz verschwindende Wolke auf seiner Stirn nicht durchaus mit dem Inhalt und Ton seiner Worte harmonierte.
»Das freut mich unendlich,« sagte der Minister, »Sie wissen, daß manche europäischen Kabinette und auch manche Parteien im Lande die Krankheit des Erben der Krone mit einer nicht sehr wohlwollenden Aufmerksamkeit verfolgen.«
»Es ist eine Folge des Scharlachfiebers,« sagte der Arzt ruhig, »welches das ganze Nervensystem des Kindes lebhaft erschüttert hat, wie das ja oft bei dieser Krankheit vorkommt. Es sind weiter keine ernsten Symptome vorhanden – und die Feinde des Kaisers und Frankreichs haben keinen Grund zu boshaften Hoffnungen.«
Die Tür des kaiserlichen Kabinetts öffnete sich – Napoleon III. erschien selbst in derselben und warf einen Blick in das Vorzimmer.
Mit leichter Neigung des Kopfes und freundlichem Lächeln erwiderte er die tiefen Verbeugungen des Ministers und des Leibarztes.
Der Kaiser war seit der Katastrophe des vergangenen Jahres sichtlich älter und leidender geworden. Der Winter hatte seine Gesundheit auf die Probe gestellt und ihn mit rheumatischen Leiden heimgesucht, deren schmerzhafte Affektionen sein überaus empfindliches und leicht erregbares Nervensystem angegriffen hatten. Die Spuren dieser nicht gefährlichen, aber schmerzhaften und peinlichen Leiden zeigten sich auf seinem Gesicht und in seiner Haltung, – und wie er dastand, leicht gebückt, den Kopf etwas zur Seite geneigt, da hatte das sanfte und verbindliche Lächeln, mit welchem er die Herren begrüßte, etwas Melancholisches, Schwermütiges, das bei einem Manne auf dieser Höhe der Herrschaft und Macht traurig berühren muhte.
Doktor Conneau näherte sich dem Kaiser und sprach:
»Ich komme vom kaiserlichen Prinzen, der Herr Marquis von Moustier will ein wenig Geduld haben,« fügte er mit einer Verbeugung gegen den Minister der auswärtigen Angelegenheiten hinzu.
Der Kaiser nickte dem Marquis lächelnd zu und sagte:
»Auf sogleich, mein lieber Minister!« –
Dann wandte er sich in sein Kabinett zurück.
Doktor Conneau folgte ihm.
Als die Tür sich hinter ihnen geschlossen, verließ der lächelnde Ausdruck vollständig das Gesicht des Kaisers. Er setzte sich in einen tiefen Lehnstuhl, welcher neben seinem Schreibtisch stand, und stützte beide Arme auf die Seitenlehnen.
Der von Schleiern umhüllte Blick seines Auges trat wie ein Stern aus den Wolken einer Sommernacht leuchtend hervor und richtete sich auf den langjährigen Freund, welcher ruhig vor ihm stehen blieb.
Aber dieser Blick war traurig, angstvoll bekümmert. Dieses wunderbar belebte Auge, welches da plötzlich in dem sonst so undurchdringlichen, ewig gleichen Antlitz des Imperators erschien, und aus den Zügen des Kaisers die fühlende, in reichem Leben bewegte Seele des Menschen hervorblicken ließ, dieses Auge strahlte einen Strom weichen, elektrischen Lichts aus, die großen, weiten Pupillen schienen in wechselndem Farbenspiel zu schimmern und zu zittern und richteten sich mit dem Ausdruck banger Frage auf das ruhige Gesicht des Arztes, der mit inniger Teilnahme zu dem vor ihm sitzenden Kaiser herabsah.
»Wie geht es meinem Sohne, Conneau?« fragte Napoleon.
»Sire,« erwiderte der Leibarzt mit ernster Stimme, »ich habe die beste und begründete Hoffnung auf die baldige und vollständige Genesung, aber ich kann es Eurer Majestät nicht verhehlen, der Prinz ist noch sehr ernstlich krank!«
Das Auge des Kaisers trat noch leuchtender und brennender hervor und schien in der Seele des Arztes lesen zu wollen.
»Ist Gefahr für sein Leben da?« fragte er mit fast tonloser Stimme.
»Ich würde kindisch und lächerlich handeln und wäre nicht der Freund Eurer Majestät,« sagte Doktor Conneau, »wenn ich Ihnen in diesem Augenblick auch nur ein Atom meiner Gedanken vorenthielte. – Nach der schweren Krankheit, die der Prinz durchgemacht hat,« fuhr er mit ernster und fester Stimme fort, »ist eine Art von Anämie, eine Verdünnung der Blutsubstanz eingetreten, verbunden mit einer sensitiven Reizbarkeit der Nerven, welche wie eine zu starke Flamme die ohnehin schwache und sich nicht genügend wieder ersetzende Lebenskraft verzehrt. Alles kommt darauf an, ob die geheimnisvolle Arbeit der Natur aus dem unerschöpflichen Quell ihres Reichtums die rasch sich verzehrenden Kräfte wieder ergänzen und die regelmäßige Ökonomie des Organismus wiederherstellen wird. Mein Arzneischatz besitzt dafür kein Mittel, auch wäre es hochgefährlich, mit scharfen und differenten Präparaten in die stille Entwicklung dieser zarten Natur einzugreifen. Entwickelt diese Natur die Kraft, um die Krisis, welche wesentlich eine Stagnation ist, zu überwinden, so kann der Prinz in kurzer Zeit vielleicht zu voller Jugendkraft erblühen und eine feste und kräftige Gesundheit erlangen, aber,« fuhr er fort, und sein klares, offenes Auge senkte sich vor dem brennenden Strahl des kaiserlichen Blickes, »wenn die Natur die Hilfe versagt, so kann ebenso schnell die an beiden Enden entzündete Kerze sich verzehren.«
»Und was muß geschehen, um der Natur ihre Arbeit zu erleichtern?« fragte der Kaiser, indem er die Hände faltete und sich weit zu dem Arzte hin vorbeugte.
»Absolute Ruhe, Fernhaltung jeder Aufregung und frische Luft,« erwiderte der Arzt, »der Prinz muß nach Saint Cloud, sobald das Wetter wärmer und beständiger wird, und ich wollte Eure Majestät bitten, die nötigen Befehle dazu zu geben.«
»Fahren Sie sogleich hinaus, lieber Conneau,« rief Napoleon, »und ordnen Sie alles an, wie es am besten ist, tun Sie alles, was nötig ist, und« – er streckte die Hände wie flehend dem Freunde entgegen – »erhalten Sie mir meinen Sohn, erhalten Sie den kaiserlichen Prinzen!«
Voll tiefen Mitgefühls und mit dem Ausdruck inniger, liebevoller Teilnahme blickte Doktor Conneau auf den Kaiser. Er trat einen Schritt näher zu ihm hin und sprach mit weicher, leicht zitternder Stimme:
»Was meine Kunst vermag, Sire, wird geschehen, und,« fügte er hinzu, »wo meine Kunst nicht ausreicht, wird mein Gebet den großen Arzt dort oben um seine Hilfe anflehen!«
Der Kaiser senkte den Blick und sah einige Augenblicke starr vor sich hin.
»Dringt das Gebet des Menschen zu jenem geheimnisvollen Wesen empor, das die Schicksale der Menschen und Völker lenkt?« fragte er in fast flüsterndem Ton. – »O mein lieber Freund,« rief er dann, indem er sich lebhaft emporrichtete und den Kopf langsam gegen die Lehne seines Fauteuils zurücksinken ließ, »wie schwer ruht die Hand des Schicksals auf mir! – Dieses Kind,« sagte er mit weicher Stimme, »ich liebe es – es ist so rein, so gut – wie ich einst war – vor langen, langen Jahren« – fügte er träumerisch hinzu, »es ist der Sonnenstrahl meines Lebens – aber es ist mehr – es ist die Zukunft meiner Dynastie, dieser Dynastie, die mein Oheim mit so viel Blut und Schlachtendonner gegründet, die ich mit so viel Geduld, so viel mühsamer Arbeit, so viel unermüdlicher Zähigkeit wieder errichtet habe! Wenn das Verhängnis mir dieses Kind nimmt, wird das Herz des Vaters brechen, das stolze Gebäude des Kaisers zusammensinken! – »Oh,« fuhr er fort, wie zu sich selber sprechend, »jeder Vater kann am Bette seines kranken Kindes sitzen, seine Atemzüge bewachen – ich aber muß all diese Sorge, all diesen Kummer in mich verschließen, mit lächelndem Angesicht muß ich meinen Sohn besuchen, verleugnen muß ich die Sorge, die mein Herz bedrückt, denn niemand, niemand, Conneau, darf es ahnen, daß der Wurm am Herzen meines Kaisertums frißt, o Conneau, Conneau,« rief er mit unendlich schmerzlichem Ausdruck, seinen Blick auf den Arzt richtend, »es ist recht schwer, Kaiser zu sein!«
»Alles Große ist schwer, Sire,« sagte Doktor Conneau, »jedenfalls war es schwerer, Kaiser zu werden, als es zu sein.«
»Wer weiß?« sagte Napoleon träumerisch.
»Aber warum wollen Eure Majestät so trüben Gedanken folgen?« sprach Doktor Conneau, »Sie waren so stolz und kühn in den Tagen des Unglücks, des Kampfes, haben Sie das Vertrauen auf Ihren Stern verloren, der so glänzend zum Zenith heraufgestiegen ist?«
Napoleon senkte einen langen Blick in die Augen seines Freundes.
»Oft will es mir scheinen,« sprach er düster, »als ob dieser Stern seine Mittagshöhe überschritten habe und sich niedersenken wolle zum Abend – zur Nacht, wenn dieses junge Leben erlischt, das den neuen Morgen nach meines Tages Ende herausführen soll. – Die Geschichte meines Hauses lehrt mich,« fuhr er mit dumpfem Tone fort, »daß das Schicksal Wege hat, welche von Austerlitz nach St. Helena führen!«
»Sire, welch finsterer Geist umschwebt Sie!« rief Doktor Conneau, »ist denn nicht jener Märtyrerfelsen von St. Helena der Grundstein des so glänzend wieder erstandenen Kaiserthrones geworden? – Sire, wenn die Welt hören könnte, welche Gedanken den mächtigen Herrscher des großen Frankreichs erfüllen –«
»Sie wird es nicht,« rief der Kaiser sich stolz aufrichtend, indem seine Züge den gewohnten ruhigen Ausdruck wieder annahmen, »diese Gedanken bleiben hier in der Brust des Freundes! – Conneau,« sagte er sanft, und ein unendlich anmutiges, fast kindlich freundliches Lächeln erhellte seine vorher so düsteren Züge, »ich habe doch einen Vorzug vor meinem Oheim; er lernte seine wahren Freunde erst in den späten Tagen des Unglücks kennen – ich habe sie vorher erprobt und weiß auf dem Thron, wer in der Verbannung an meiner Seite war.«
Und er reichte dem Leibarzt die Hand.
Dieser blickte mit feuchtem Auge zum Kaiser hin und sprach:
»Ich bitte Gott, daß das Glück Eurer Majestät ebenso treu bleibe, wie das Herz Ihrer Freunde.«
»Und nun gehen Sie, Conneau,« sagte Napoleon nach einer augenblicklichen Pause, »eilen Sie, die nötigen Vorkehrungen zu treffen, um das Leben des Prinzen zu retten, ich will arbeiten, um seinen künftigen Thron zu befestigen. – Noch eins,« rief er dem der Tür zuschreitenden Arzte zu, indem er einen Schritt zu ihm hintrat, niemand darf wissen, daß dem Prinzen irgendeine Gefahr droht, schon deshalb muß er fort, um aller Beobachtung zu entgehen. Niemand, Conneau! auch die Kaiserin nicht, sie würde ihren Kummer, ihre Sorge nicht verbergen können, auch mein Vetter Napoleon nicht,« fügte er hinzu, indem sein scharfer Blick sich tief in das Auge des Arztes tauchte.
»Seien Sie unbesorgt, Sire,« sagte dieser, »ich weiß die Geheimnisse des Kaisers zu bewahren!«
Und den nochmaligen herzlichen Händedruck des Kaisers erwidernd, schritt er der Tür zu und verließ das Kabinett.
Napoleon blieb allein.
Er ging einige Male langsam im Zimmer auf und nieder.
»Will das Schicksal sich wirklich gegen mich wenden?« sprach er nachdenklich, »sollte es wirklich so viel schwerer sein, sich auf der Höhe zu erhalten, als dieselbe zu erklimmen? – Und ist es die Hand des Schicksals,« fuhr er fort, »die sich gegen mich erhebt, habe ich nicht schwere Fehler gemacht? – Mexiko! – durfte ich mich in diese Unternehmung einlassen, ohne Englands sicher zu sein? – Die deutsche Katastrophe? – habe ich sie nicht herankommen lassen, da es noch Zeit war, sie zu beschwören? – Italien? war es richtig, vom Frieden von Zürich abzugehen und den Einheitsstaat erstehen zu lassen, der sich gegen mich erhebt und Rom verlangt, das ich ihm nicht geben kann, ohne die Kirche zu meinem Todfeind zu machen, ohne für immer den Einfluß Frankreichs auf der Halbinsel aufzugeben! – Und sind jene Carbonari zufrieden? – Bin ich sicher, daß nicht ein zweiter Orsini gegen mich die Hand erhebt? – Ja,« sprach er, sinnend vor sich hinblickend, »es waren große Fehler, die ich begangen habe, und ihre bösen Folgen stehen gegen mich auf! – Doch,« rief er nach einem augenblicklichen Nachdenken, indem ein Schimmer von Heiterkeit und Zuversicht über sein Gesicht flog, »es ist gut, daß diese peinliche Lage eine Folge meiner Fehler ist; menschliche Fehler kann menschlicher Wille und menschliche Klugheit verbessern und wieder gutmachen, aber des ewigen Fatums Hand ist unabänderlich und unerbittlich. – Wenn mein Sohn mir entrissen würde,« sprach er dann wieder düster, indem der Schimmer einer Träne die Wimpern seines Auges befeuchtete, »das wäre allerdings die Hand des Schicksals, aber für jetzt droht diese Hand nur, darum will ich so gut als möglich meine Fehler zu verbessern suchen, um das Schicksal zu versöhnen. – Dieser deutschen Frage gegenüber muß etwas geschehen, um der Welt und Frankreich insbesondere zu zeigen, daß meine Macht unvermindert dasteht, und daß so mächtige Veränderungen in den Verhältnissen Europas sich nicht vollziehen dürfen, ohne daß auch Frankreich in entsprechender Weise sich verstärkt, um das Gleichgewicht gegen die neue Macht zu erhalten.«
Er setzte sich in seinen Fauteuil und zündete an der daneben auf dem Tisch stehenden brennenden Kerze eine jener großen, aus den feinsten Blättern gewundenen Regaliazigarren an, welche für ihn eigens in der Havanna hergestellt wurden.
Während sein Blick sinnend den leichten, blauen Ringelwolken folgte, welche das Zimmer mit ihrem strengen, aromatischen Duft erfüllten, sprach er leise vor sich hin:
»Man rät mir zu großen Kombinationen und Koalitionen, um dies Werk von 1866 wieder zu zerstören. – Ist es das Interesse Frankreichs, das Interesse meiner Dynastie, ein so gefahrvolles Spiel zu unternehmen und in die nach den großen Gesetzen des nationalen Völkerlebens sich vollziehenden Ereignisse einzugreifen? – Wem würde ich nützen, wer würde es mir danken? – Nein,« sagte er lauter, »lassen wir jene Ereignisse ihren Entwicklungsgang gehen, die Stellung und das Prestige Frankreichs wird auch neben dem geeinten Deutschland in der Welt bestehen können, wenn ich nur auch in meine Wagschale die nötigen Gewichte zu legen verstehe. – Dieses Luxemburg ist das erste, das französische Belgien, ein neutralisierter Rheinstaat,« flüsterte er, »bei den weiteren Schritten zur Vereinigung Deutschlands werde ich vorsichtiger sein und mir meine Kompensationen vorher sichern! – Aber wird man in Berlin diese Erwerbung Luxemburgs zugestehen? – Man wird nicht so töricht sein, um dieser Frage willen mit mir zu brechen!« rief er aufstehend, »man hat wahrlich dort genug erreicht, um mir etwas wenigstens zu gewähren, dazu jetzt, wo meine Armee in ihrer verstärkten Organisation erheblich vorgeschritten ist.«
Er ergriff einen Brief, der auf dem Tische neben ihm lag, und blickte einige Augenblicke aufmerksam auf die eleganten, festen Schriftzüge, welche das stark glänzende Papier trug.
»Die Königin Sophie ist der geistreichste Politiker unserer Tage,« sagte er dann, »wie sie die feinsten Nüancen eines Gedankens versteht und erfaßt mit aller Feinheit der Frau und aller Klarheit des Mannes! – Sie glaubt nicht, daß die Frage so glatt sich löse, und befürchtet einen Konflikt –«
Er sann einen Augenblick nach und bewegte dann leicht eine kleine, neben ihm stehende Glocke.
»Ich lasse den Marquis de Moustier bitten,« befahl er dem eintretenden Kammerdiener.
Der Minister trat ein. Napoleon erhob sich und begrüßte ihn mit leichtem Kopfneigen. Dann deutete er auf einen ihm gegenüberstehenden Sessel und ließ sich wieder bequem in seinen Fauteuil sinken, während der Marquis sein Portefeuille öffnete und mehrere Papiere aus demselben hervorzog.
»Sie sehen heiter aus, mein lieber Minister,« sagte der Kaiser lächelnd, indem er die Spitze seines langen Schnurrbartes leicht durch die Finger gleiten ließ, »bringen Sie mir gute Nachrichten?«
»Sire,« sagte der Marquis, indem er den Blick über ein Papier gleiten ließ, das er aus seinem Portefeuille genommen, »die Negoziation im Haag geht vortrefflich – Baudin berichtet, daß die Regierung dort entschlossen sei, um jeden Preis die Trennung Limburgs und Luxemburgs von Deutschland zu erreichen und sich von der steten Drohung zu befreien, welche die bewaffnete Hand Preußens in der Festung Luxemburg für sie bildet. Alle Unterhandlungen in Berlin, um, nach der Auflösung des deutschen Bundes, jenes Band mit Deutschland zu lösen, sind vergeblich gewesen, und der König ist vollkommen bereit, das Großherzogtum an Frankreich abzutreten. Es müsse dann aber – was ich schon Ende des vorigen Monats in Aussicht gestellt habe – die ganze Negoziation mit Preußen hier übernommen werden. – Der Gesandte fügt hinzu,« fuhr der Marquis fort, »daß die Bevölkerung im Großherzogtum der Annexion an Frankreich durchaus geneigt sei und mit Freuden den Augenblick begrüßen werde, wo es ihr vergönnt sein möchte, einen Teil der großen französischen Nation zu bilden.«
Ein zufriedenes Lächeln umspielte die Lippen des Kaisers. Indem er leicht die Spitze seines Schnurrbarts drehte, fragte er:
»Hat man über den Preis des Verkaufs gesprochen?«
»Nicht eingehend,« erwiderte der Minister, »es ist das besonderen Verhandlungen vorbehalten.«
»Die Frage ist auch gleichgültig,« sagte der Kaiser, »man darf darauf kein besonderes Gewicht legen. Jedenfalls wird man in Holland wissen, daß der wesentlichste und wichtigste Teil des Preises in der Zukunft liegt. – Das flämische Sprachgebiet –«
»Man ist vollkommen von der gegenwärtigen und zukünftigen Bedeutung der Frage unterrichtet,« sprach der Marquis schnell, indem er in den Bericht blickte, den er in der Hand hielt, »und der Gesandte ist erstaunt, ein so eingehendes Verständnis gefunden zu haben.«
Mit leichtem Lächeln neigte der Kaiser das Haupt.
»Die allgemeine Volksabstimmung hat man als Bedingung gestellt,« fuhr der Minister fort.
»Das versteht sich von selbst,« sagte der Kaiser, indem er einen langen Zug aus seiner Zigarre tat und eine große, blaue Rauchwolke vor sich in die Luft blies, – »Doch nun, mein lieber Marquis,« fuhr er fort, und ein forschender Blick fuhr blitzschnell zu seinem Minister herüber, »wie glauben Sie, daß man die Sache in Berlin aufnehmen wird? – fürchten Sie, daß wir dort Schwierigkeiten haben werden?«
Der Marquis de Moustier zuckte leicht die Achseln und antwortete, indem er einen anderen Bericht aus seiner Mappe hervorzog:
»Benedetti hat natürlich über den Gegenstand selbst nicht mit dem Grafen Bismarck gesprochen, indes berichtet er, baß der preußische Ministerpräsident in jeder Weise den Wunsch betont, mit Frankreich auf dem besten und freundschaftlichsten Fuße zu stehen, und er zweifelt nicht, daß die preußische Regierung mit Freuden die Gelegenheit ergreifen werde, um den Wunsch der Erhaltung guter Beziehungen durch diese für sie in der Tat nicht bedeutungsvolle Konnivenz zu manifestieren.«
»Ich hoffe, daß Benedetti sich nicht täuscht.« sagte der Kaiser mit einem leichten Seufzer. – »Mein lieber Minister,« fuhr er nach einigen Sekunden fort, indem er sich leicht zu dem Marquis hinüberneigte, »Sie wissen, wie sehr man sich von Wien aus bemüht, uns nach jener Seite hinüberzuziehen, durch die Bildung eines Südbundes unter Österreichs Führung dem Werke Preußens ein unübersteigliches Bollwerk entgegenzusetzen –«
Der Marquis neigte leicht das Haupt.
»Aber ich muß Ihnen sagen,« fuhr der Kaiser fort, »ich will diesen Weg nicht gehen, die wahre Macht in Europa liegt in den Händen von Preußen und Rußland – und dieser Allianz will ich mich anschließen, denn in ihr liegt das Leben und die Zukunft. – Ich hatte schon früher einen ähnlichen Gedanken, ich dachte an die Wiederaufrichtung jener mächtigen schiedsrichterlichen Gewalt in Europa, welche Metternich unter dem Namen der heiligen Allianz geschaffen hatte, sie würde noch mächtiger, noch gewaltiger geworden sein, wenn Frankreich in ihr die Stelle Österreichs eingenommen hätte. Friedrich Wilhelm IV. verstand mich, aber sein reicher Geist verdunkelte sich – und er starb, jener große Gedanke blieb unausgeführt, vielleicht läßt er sich heute wieder anbahnen. – Wenn man mir die Konzession von Luxemburg macht und mir bewilligt, was Frankreich noch bedarf, um seine Zukunft sicher und groß zu gestalten, dann, mein lieber Marquis, sollen meine Ideen eine festere Gestalt gewinnen.«
Der Marquis verneigte sich.
»Ich kenne,« sägte er, »diesen Gedanken Eurer Majestät und habe ja damals auch daran gearbeitet, seine Ausführung vorzubereiten, leider,« fuhr er fort, indem er den Blick senkte, »war es mir nicht vergönnt, meine Tätigkeit in jener Richtung fortzusetzen –«
Der Kaiser reichte ihm die Hand hinüber, welche der Minister ehrerbietig ergriff.
»Sie waren damals das Opfer Ihres Diensteifers,« sagte Napoleon verbindlich, »eines Diensteifers, für den ich Ihnen stets dankbar bin und bleiben werde.«
»Und wenn,« rief der Marquis, »diese Konzession verweigert weiden sollte, das heißt, wenn man zunächst Schwierigkeiten machen sollte, so wird ein festes und energisches Auftreten genügen, um die Zustimmung zu erreichen; England wird uns keine Schwierigkeiten machen, und in Berlin wird man vor wirklich ernstem Auftreten zurückweichen. Die Aufregung des Krieges und das Hochgefühl des Sieges sind dort verraucht, die Schwierigkeiten der inneren Verhältnisse des Nordbundes machen sich mächtig fühlbar, und schwerlich wird man um dieses Gegenstandes willen einen ernsten Konflikt mit kriegerischer Eventualität sich zuspitzen lassen. – Ich kenne,« fuhr er mit leichtem Lächeln fort, »Berlin, und weiß, wie schwer man sich dort entschließt.«
Der Kaiser blickte ihn einen Augenblick nachdenklich an.
»Sie haben das alte Berlin gekannt,« sagte er dann, »ich fürchte, man ist dort jetzt schneller von Entschluß, und sieht auch sehr klar die letzten Konsequenzen eines ersten Schrittes. – Indes,« rief er und richtete den Kopf empor, »es muß gehandelt werden, instruieren Sie also Baudin, daß er so bald als möglich den Luxemburger Vertrag zum Abschluß bringt – und daß er vor allem bis zur definitiven Abmachung die äußerste Diskretion bewahrt, wir müssen mit einem fait accompli hervortreten.«
Der Marquis verneigte sich und stand auf, indem er seine Papiere in die Mappe verschloß.
Der Kaiser erhob sich und trat einen Schritt zu seinem Minister.
»Halten Sie aber zugleich den Faden der Negoziation mit Österreich fest,« sagte er, »wir müssen den Weg offen halten, um, wenn auf der einen Seite unseren Plänen Schwierigkeiten entgegentreten, das andere Gewicht in die Wagschale werfen zu können!«
»Seien Eure Majestät unbesorgt,« erwiderte der Marquis, »der Herzog von Gramont wird seine Konversationen mit Herrn von Beust fortsetzen – sie verstehen beide so vortrefflich zu sprechen,« fügte er mit kaum merkbarem Lächeln hinzu, »und wir werden seinerzeit daraus machen, was wir wollen, die Basis für ein politisches Gebäude, oder das lehrreiche Material für unsere Archive.«
»Auf Wiedersehen, lieber Marquis,« rief Napoleon, indem er freundlich lächelnd mit der Hand grüßte, und sich tief verneigend verließ der Minister das Kabinett.
»Ich muß eine spezielle Instruktion an Benedetti aufsetzen lassen,« sagte der Kaiser, »damit er die ganze Bedeutung der Frage versteht und dafür das Terrain vorbereitet.«
Und er wendete sich langsam nach der Seite des Zimmers wo eine dunkle Portiere den Ausgang verdeckte, welcher zu seinem geheimen Sekretär Pietri hinabführte.
Das Gemach blieb leer.
Nach einigen Minuten öffneten sich die Flügel der Eingangstür und der Kammerdiener des Kaisers rief:
»Ihre Majestät die Kaiserin!«
Die Kaiserin Eugenie trat rasch in das Kabinett, hinter ihr schloß sich geräuschlos die Türe.
Die schlanke, geschmeidig elastische Gestalt der Kaiserin ließ in ihrer jugendlich anmutigen Haltung die einundvierzig Lebensjahre nicht vermuten, welche über ihr Haupt hingezogen waren.
Trugen die Züge ihres Gesichts, von dem wunderbar schönen, in dunklem Goldblond schimmernden Haare umrahmt, auch nicht mehr den Ausdruck der früheren Jugend, so hatte doch auch das Alter noch keines seiner unerbittlichen Zeichen auf dieses nach der Antike geschnittene Antlitz gezeichnet, dessen reine und edle Schönheitslinien über dem Einfluß der Zeit zu stehen schienen.
Mit unnachahmlicher Grazie trug die Kaiserin den schönen Kopf auf dem langen, schlanken Hals; ihre großen Augen von schwer bestimmbarer Farbe, nicht strahlend von scharfem Geisteslicht, aber in schimmerndem Schmelz eine lebhafte Empfänglichkeit reflektierend, erleuchteten belebend die an den Marmor erinnernden Züge.
Die Kaiserin trug ein dunkles Seidenkleid, dessen reiche, schwere Falten, der Mode der Zeit gemäß, in weiter Ausdehnung über jene schwellenden tulles d´illusion hinabflossen, welche man in den untern Kreisen der Gesellschaft durch die häßlichen und geschmacklosen Krinolines nachahmte, eine Brosche, von einem großen Smaragd, mit Perlen umrahmt, bildete ihren einzigen Schmuck.
Sie blieb erstaunt stehen, als sie das Zimmer leer sah, der Blick ihres großen Auges suchte den Kaiser.
Indem dieser Blick die dunkle Portiere streifte, welche zu dem Kabinett Pietris führte, erschien ein Ausdruck des Verständnisses auf ihren Zügen, und zu dem Tisch in der Mitte hinschreitend, setzte sie sich langsam in den Fauteuil, welchen der Kaiser vor Kurzem verlassen hatte.
Ihr Blick lief über den Tisch hin, wie um etwas zu suchen, womit sie sich die Zeit vertreiben könne, während sie ihren Gemahl erwartete.
Da fiel ihr Auge auf den Brief, welchen der Kaiser dorthin aus der Hand gelegt hatte, und ihre Blicke hafteten auf den Schriftzügen mit einem leichten Ausdruck von unmutigem Verdruß.
Sie streckte die schöne Hand aus und indem sie das Blatt mit den Spitzen ihrer zarten, rosigen Finger ergriff, begann sie zu lesen.
»Welche Freundschaftsversicherungen!« rief sie mit kaum merklich zitternder Stimme.
Plötzlich aber öffnete sich ihr Auge weiter, und ihre Züge nahmen den Ausdruck höchster Spannung an. Mit fliegendem Blick las sie den Brief zu Ende, warf ihn dann auf den Tisch zurück und erhob sich, um mit raschen Schlitten einige Male im Zimmer auf und nieder zu gehen.
»Das also ist im Werk!« rief sie dann, indem sie wieder stehen blieb, und die weißen Finger fest auf die Lehne des Fauteuils drückte, »ich habe es gefürchtet, daß der Geist des Kaisers sich nicht frei machen kann von dem Gedanken, mit diesem Deutschland, dieser Schöpfung des preußischen Ehrgeizes, Frieden zu machen und den Gedanken an Revanche, an Rache aufzugeben. – Mit dieser armseligen Kompensation, diesem nichtsbedeutenden Großherzogtum Luxemburg soll Frankreich sich abkaufen lassen, um ruhig zuzusehen, wie Deutschland heranwächst, wie Italien sich immer mehr stärkt zum Verderben und zum Untergang der Kirche?«
Sie tat wieder einige Schritte durch das Zimmer.
»Wenn dies Arangement ausgeführt wird,« rief sie lebhaft, »so ist die Zukunft dahingegeben, das darf nicht sein, wir müssen warten und uns stärken, um dann mit der ganzen Macht Frankreichs auftreten zu können und mehr zu erreichen, als dies Luxemburg.«
Sie machte eine wegwerfende Bewegung mit der Hand.
»Aber wie verhindern,« sagte sie leise, das Haupt neigend, »was schon abgemacht zu sein scheint!« –
Ein Geräusch wurde hörbar, Napoleon erschien unter der Portiere.
Die Kaiserin wendete anmutig den Kopf und lächelte ihrem Gemahl entgegen.
Rasch trat der Kaiser zu ihr hin, ein freundlicher Schimmer belebte sein Gesicht.
Sie reichte ihm die Hand; mit einer fast jugendlichen Bewegung voll anmutiger Eleganz drückte er die Lippen darauf.
»Sie haben lange gewartet?« fragte er.
»Einen Augenblick,« erwiderte die Kaiserin, »ich kam, um mit Ihnen zu Louis zu gehen, der arme Kleine muß bald nach Saint Cloud, hat mir Conneau gesagt.«
»Ja,« sagte der Kaiser, »er bedarf der frischen Luft und der Ruhe, um vollständig zu genesen. Beides hat er hier nicht, um so weniger, als die Besuche der Ausstellung schon bald beginnen, und uns sehr in Anspruch nehmen werden, die Souveräne werden fast alle kommen –«
»Also der europäische Horizont zeigt keine Wolken,« fragte die Kaiserin lächelnd.
»So wenig als die schöne Stirn meiner an jedem Morgen neuverjüngten Gemahlin,« erwiderte der Kaiser, dann bewegte er die Glocke.
»Die Frau Admiralin Bruat!« befahl er dem Kammerdiener.
»Sie wartet bereits im Vorzimmer,« sagte die Kaiserin.
»Also gehen wir zu unserem Louis,« sprach Napoleon und reichte seiner Gemahlin den Arm.
Die Flügeltüren öffneten sich, mit freundlichem Lächeln begrüßte der Kaiser die ihm entgegentretende Gouvernante der Kinder von Frankreich, die Wittwe des Admirals Bruat.
Sie schritt voran; lächelnd mit einander plaudernd, begab sich das kaiserliche Paar nach den Gemächern des Prinzen.
Zweites Kapitel.
Vor dem großen Palais am Boulevard des Italiens, dessen weite Parterreräume von dem Grand Café eingenommen werden, und in dessen Beletage der weltbekannte Jockeyklub seine glänzenden Salons etabliert hat, hielt um die Mittagsstunde eines sonnigen Märztages in rascher Anfahrt ein kleines blaues Coupé von jener äußersten, einfachen Eleganz in dem Bau des Wagens und in dem Geschirr, welche man vorzugsweise in Paris, und in Paris wieder in höchster Vollkommenheit bei den Mitgliedern jenes berühmten Klubs findet, der den Sport auf die Höhe der anmutigsten Vollendung gebracht hat. Eine einfache, dunkle Chiffre, überragt von einer Grafenkrone, befand sich auf dem Schlage, und dem leichten Zügeldruck des in tadelloser dunkelblauer Livree unbeweglich auf dem Bock sitzenden Kutschers gehorchend, hielt das edle, hochelegante Pferd mit ruhiger Sicherheit vor dem großen Eingangstore den schnellen Trab ab und stand bewegungslos da, nur den schönen Kopf leicht erhebend und aus den weit geöffneten Nüstern den heißen Atem in die frische Märzluft ausstoßend.
Aus dem Coupé stieg ein großer, schlanker Mann, mit der höchsten Eleganz in dunkle Farben gekleidet. Große tiefdunkle Augen blickten ruhig, aber mit traurig sinnendem Ausdruck, aus dem edlen, scharfgeschnittenen Gesicht, dessen gleichförmige, matte Blässe nur durch einen kleinen, schwarzen Schnurrbart auf der Oberlippe unterbrochen wurde. Seine kurzen, schwarzen Haare bedeckte, in die Stirne gedrückt, einer jener niedrigen, graziösen Hüte aus den Magazinen von Pinaud und Amour, seine Hand, in elegantem, dunkelgrauem Handschuh, drückte leicht ein weißes Batisttuch gegen die Lippen, um sich gegen die rauhe Märzluft zu schützen.
Er warf einen prüfenden Blick auf das Pferd und befahl dem Kutscher, nach Hause zu fahren. Dann nahm er aus einem Körbchen, welches eine kleine Bouquetiere ihm präsentierte, einen kleinen Strauß duftender Veilchen, legte dafür ein Frankenstück in den Korb und stieg leichten, elastischen Schrittes die breite, mit dichten, weichen Teppichen belegte Treppe hinauf. Oben angelangt, wendete er sich zu dem mit mächtigen, geschnitzten Büffets und reichen silbernen Aufsätzen ausgestatteten Frühstückszimmer; die auf dem Korridor wartenden Lakaien des Klubs in ihren eleganten Livreen öffneten die Türe und ein junger Mann von etwa einundzwanzig Jahren, mit hochblondem, offenem und frischem Gesicht von norddeutschem Typus, welcher allein in dem großen Gemach an einem kleinen, zierlich gedeckten Tische saß, rief dem Eintretenden mit einem lächelnden Blick seiner großen, lichtblauen Augen entgegen:
»Guten Morgen, Graf Rivero – Gott sei Dank, daß Sie kommen, um diese langweilige Einsamkeit zu beleben, in welcher ich mich hier wie ein Einsiedler befinde. Ich weiß nicht, wo alle Welt heute noch steckt, ich bin früh geritten und habe einen ungeheuren Appetit, ich habe mir da ein sehr gutes, kleines Dejeuner komponiert, wollen Sie meinem Geschmack vertrauen und ein Kuvert nehmen?«
»Mit Vergnügen, Herr von Grabenow,« erwiderte der Graf, indem er seinen Hut einem Lakaien reichte.
Der Haushofmeister des Klubs war herangetreten und winkte bei der Antwort des Grafen den zum Dienst bereit stehenden Dienern, welche mit jener Geschwindigkeit und Unhörbarkeit, die der Bedienung in den guten Häusern eigentümlich ist, dem jungen Herrn von Grabenow gegenüber ein Kuvert auf den Tisch legten. »Nehmen Sie inzwischen ein Glas von diesem Sherry,« sagte der junge Mann, indem er dem Grafen, welcher sich ihm gegenübergesetzt hatte, aus dem vor ihm stehenden Karaffon von geschliffenem Kristall ein kleines Glas mit dem goldgelben Weine füllte, »er ist gut, und ich glaube, fast der einzige in Paris.«
Der Graf nahm mit leichter Verneigung das Glas, trank einige Tropfen und sagte dann mit seiner leisen und doch volltönenden und melodischen Stimme:
»Man sieht Sie so wenig in letzter Zeit, mein lieber Herr von Grabenow – bei Ihrem Alter,« fügte er mit einem halb schalkhaften, halb melancholischen Lächeln hinzu, »ist es überflüssig, zu fragen, welche Geschäfte Sie in Anspruch nehmen.«
Ein flüchtiges Rot überflog die Stirne des jungen Mannes und mit einiger Hast erwiderte er: »Ich war nicht ganz wohl, leicht erkältet und mein Arzt hatte mir verordnet, mich sehr zu schonen.«
Der Graf nahm eine goldbraune Seezunge, welche man ihm servierte, und sprach, indem er den Saft einer Zitrone darauf träufelte, mit scherzhaftem Ton:
»Deshalb begegnete ich Ihnen auch wohl neulich im Bois de Boulogne in der Nähe der Kaskaden in einem verschlossenen Coupé mit einer – ohne Zweifel älteren Dame, welche Sie in Ihrer Krankheit pflegt – leider,« fuhr er lächelnd fort – »war das Gesicht Ihrer Duenna in so dichte Schleier gehüllt, daß ich nichts davon sehen konnte.«
Herr von Grabenow warf aus seinen großen, fast noch kindlich reinen, blauen Augen einen schnellen, erschrockenen Blick auf den Grafen.
»Sie haben mich gesehen?« fragte er schnell.
»Ich ritt dicht an Ihrem Wagen vorüber,« erwiederte der Graf, »aber Sie waren so sehr in die Unterhaltung mit Ihrer – Krankenwärterin vertieft, daß es mir unmöglich war, Sie zu grüßen.«
Und er schenkte sich aus einer größeren Kristallkaraffe ein Glas jenes leichten, duftigen St. Emilion ein, dieser so selten rein zu findenden Perle aller edlen Rebengewächse von Bordeaux.
»Herr Graf,« sagte der junge Mann nach einem augenblicklichen Nachdenken, indem er mit treuherzigem Ausdruck hinüberblickte, – »ich bitte Sie herzlich, niemand sonst etwas von Ihren Beobachtungen mitzuteilen, ich möchte nicht, daß diese Sache Gegenstand der Bemerkungen – und der Nachforschungen der andern würde – Sie wissen, welche Ansichten und Grundsätze sie alle haben, und in diesem Falle passen dieselben nicht.« Der Graf blickte mit ernstem, teilnahmsvollen Ausdruck zu dem jungen Manne hinüber und ließ einen Augenblick seinen tiefen, dunkeln Blick in dessen klaren, blauen Augen ruhen.
»Meine Diskretion versteht sich von selbst,« sagte er dann mit leichter Neigung des Hauptes, »nur möchte ich Ihnen raten,« fuhr er mit freundlichem, wohlwollenden Lächeln fort, »künftig die Vorhänge Ihres Coupés zu schließen, denn nicht bei allen Ihren Bekannten könnten Sie der Diskretion so sicher sein, als bei mir.«
Herr von Grabenow blickte ihn mit dankbarem Ausdruck an.
»Und dann,« fuhr der Graf Rivero nach leichtem Zögern fort, »verzeihen Sie dem viel älteren Manne eine Bemerkung, welche nur in meiner aufrichtigen Teilnahme für Sie ihren Grund hat. Es gibt der künstlichen Schlingen so viel in Paris – und diejenigen sind oft die gefährlichsten, welche sich mit den bescheidenen Blüten unschuldiger Gefühle umwinden.«
Der junge Mann sah ihn groß mit ein wenig betroffenem Ausdruck an.
»Lassen Sie meine Bemerkung eine ganz allgemeine sein,« sagte der Graf, indem er die Hülle einer kleinen cotelette en papillote löste, welche der Lakai ihm darbot, »und erinnern Sie sich derselben bei entsprechender Gelegenheit.«
Herr von Grabenow sah ihn freundlich an, seine Erwiederung wurde abgeschnitten durch den Eintritt eines alten Herrn von ungefähr siebenzig Jahren im Reitanzug, welcher mit noch ziemlich fester und elastischer Haltung eintrat.
Herr von Grabenow und der Graf Rivero erhoben sich leicht zu seiner Begrüßung mit jener Courtoisie, welche eine gut erzogene Jugend stets dem höheren Alter entgegenbringt.
»Sieh' da, meine Herren,« rief der Eingetretene, indem er Hut und Reitpeitsche abgab und mit der Hand grüßte, »Sie sind beneidenswert – so frühstückt man nur in der glücklichen Zeit, da Magen und Herzen jung sind, später erfordert die gebrechliche Maschine eine andere Diät.«
Und er nahm von einem silbernen Teller, welchen der Haushofmeister ihm präsentierte, ein Glas Madeira und eine Schnitte jenes weichen, zarten Gebäckes, welches unter dem Namen Madeleines de Commercy unter den vielen vortrefflichen Dingen, welche die Provinzen Frankreichs ihrer Hauptstadt liefern, einen nicht geringen Rang einnimmt.
»Der Herr Baron von Vatry will uns verhöhnen,« sagte der Graf Rivero, »indem er von den Leiden des Alters spricht; ich habe Sie gestern einen Fuchs reiten sehen, Herr Baron, dessen Temperament mir Schwierigkeiten gemacht hätte, und den Sie mit bewundernswerter Leichtigkeit und Sicherheit führten. – Sie spotten der Herrschaft der alles bezwingenden Zeit!«
Der alte Herr lächelte geschmeichelt und sagte: »Leider ist diese Herrschaft unabänderlich und unterwirft uns endlich doch, wir mögen uns noch so lange dagegen sträuben.«
Während er seine Madeleine in den Madeira tauchte, öffnete sich schnell die Türe und in rascher Bewegung trat ein ganz junger, äußerst elegant, aber ein wenig stark nach Mode gekleideter Mann ein, dessen blasses, etwas ermüdetes und abgespanntes Gesicht unverkennbar den Typus vornehmer englischer Rasse trug.
»Woher so eilig, Herzog von Hamilton?« fragte Herr von Vatry, »zu dieser für Sie so frühen Stunde?«
»Ich bin gestern abend lange im Café Anglais gewesen,« rief der junge Herzog, indem er sich vor Herrn von Vatry verbeugte und die andern Herren mit der Hand grüßte, »wir haben ein herrliches Souper gehabt, äußerst amüsant, –
A minuit sonnant commence la fête, Maint coupé s'arrète, On en voit sortir Des jolies messieurs, des dames charmantes, Qui viennent pimpantes Pour se divertir, –«
trällerte er, mit möglichst falscher Stimme das Lied der Metella aus Offenbachs »Vie parisienne« zitirend, »es war göttlich!«
»Daher cette mine blafarde,« rief Herr von Grabenow lachend, »das ist die Folge, wie Metella weiter singt.« –
»Jetzt aber,« sagte der Herzog, »will ich mit Poëze und einigen andern Pistolen schießen, wir haben gewettet, wer das Coeur-Aß fünfmal hintereinander trifft, da muß ich mir eine feste Hand machen in dieser frühen Morgenstunde durch ein vernünftiges Frühstück. – Kognak und Wasser,« rief er dem maître d'hotel zu – »und lassen Sie mir einige deaveld cotelets machen, ich habe dem Koch neulich das Rezept gegeben – aber viel Curry, immer noch mehr Curry; diese französischen Köche verstehen den englischen Gaumen nicht.«
Der Lakai präsentierte eine geschliffene Flasche Kognak und eine Karaffe Wasser, der Herzog füllte sein Glas zu gleichen Teilen mit beiden Flüssigkeiten und leerte es auf einen Zug.
»Ah,« rief er, »das ermuntert die Lebensgeister!«
»Apropos, Graf Rivero,« rief der Herzog, nachdem er das Glas geleert, »wer ist denn dieser neu aufgegangene Stern aus Ihrem Vaterlande, der seit einiger Zeit jeden Abend im tour du lac erscheint und alle Augen blendet durch ihre Schönheit und die Eleganz ihrer Equipagen? – Marchesa Pallanzoni hat man sie mir genannt – wissen Sie etwas von dieser strahlenden Schönheitskönigin?«
»Ich kenne die Dame ein wenig,« antwortete der Graf in ruhigem, gleichgültigem Ton, »da ich Relationen mit ihrer Familie habe, welche ein altes Geschlecht Italiens ist. – Ihren Gemahl kenne ich nicht, es soll ein sehr alter, kränklicher Mann sein, von dessen Pflege sich die junge, schöne Frau wohl ein wenig hier in Paris erholen will. Ich war einigemale in ihrem Salon und habe sie sehr geistvoll und angenehm gefunden.«
»Das nenne ich Chance!« rief der Herzog, – »dann können Sie mich also bei diesem wunderbaren Phänomen, das alle Herzen bezaubert, einführen?«
»Mit dem größten Vergnügen,« erwiderte der Graf mit leichter Neigung des Kopfes – »die Marchesa empfängt, wenn sie zu Hause ist, jeden Abend.«
Inzwischen hatte man dem Herrn von Grabenow und dem Grafen Rivero in jenen kleinen, zierlichen Tassen von Sèvresporzellan den Kaffee serviert, dessen aromatischer Duft sich im Zimmer verbreitete.
»Ich bin Sklave der Übeln deutschen Gewohnheit des Rauchens,« sagte Herr von Grabenow, indem er sich erhob, »und werde mich ein wenig in die beschauliche Stille des Rauchzimmers zurückziehen.«
»Fahren Sie mit mir zum Schießen, meine Herren!« rief der Herzog von Hamilton, »man sieht Sie ja nirgends mehr, Herr von Grabenow« – er sprach diesen deutschen Namen nach englischer Weise aus – »Sie werden zum Einsiedler!«
»Lassen Sie mich meine Zigarre konsultieren,« sagte der junge Mann, »ob ich es wagen kann, mit so guten Schützen wie Sie zu konkurrieren.« – Und mit artiger Verbeugung gegen den alten Baron Vatry wendete er sich zur Tür.
»Sie rauchen ebenfalls, Herr Graf?« fragte er den Grafen Rivero, welcher aufgestanden war und sich anschickte, ihn zu begleiten.
»Ich will im Lesezimmer ein wenig die Journale durchblättern,« erwiederte der Graf.
Beide hatten den Speisesalon verlassen.
»Ich will Ihnen aufrichtig gestehen,« sagte der junge Herr von Grabenow, als sie draußen waren, »ich habe meine Rauchpassion nur zum Vorwand genommen, um fortzugehen, ich möchte nicht unter jene Gesellschaft geraten, von der man so leicht nicht wieder losgelassen wird.«
Ein Lakai überreichte dem Grafen auf einer silbernen Platte einen Brief.
»Der Kammerdiener des Herrn Grafen hat soeben dies Billett hierher gebracht.«
Der Graf warf einen schnellen Blick auf das Kuvert, auf welchem man in blauem Druck las: Maison de S. M. I'Impératrice, Service du premier Chambellan.
»Haben Sie einige Minuten übrig, Herr von Grabenow?« fragte er.
»Gewiß, mit Vergnügen,« erwiderte dieser.
»Ich habe meinen Wagen fortgeschickt, wollen Sie mich vor meiner Wohnung in der Chaussee d' Antin absetzen? – es ist wenige Schritte von hier.«
»Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung, Herr Graf.«
Beide Herren stiegen die breiten Treppen hinab, auf einen Wink des Portiers fuhr das elegante, kleine Coupé des Herrn von Grabenow vor und beide Herren stiegen ein.
Nach wenigen Augenblicken verabschiedete sich Graf Rivero von dem jungen Manne vor seinem Hause in der Chaussee d'Antin.
Herr von Grabenow rief seinem Kutscher die Nummer eines Hauses in der Rue Notre Dame de Lorette zu und in raschem Trabe eilte der leichte Wagen durch das Treiben der Equipagen auf den Boulevards und hielt nach kurzer Zeit vor einem großen Hause in der genannten Straße. Der junge Mann verließ das Coupé, befahl dem Kutscher zu warten und stieg die nicht zu breite, aber reine und saubere Treppe hinauf.
Der Vorflur der ersten Etage war durch eine große Wand von undurchsichtigem, weißen Glase verschlossen und hatte zwei Eingänge, an deren jedem ein Glockenzug mit gläsernem Knopfe sich befand.
Unter dem einen dieser Glockenzüge sah man ein Schild von Porzellan, auf welchem in einfacher, schwarzer Schrift geschrieben war: Mr. Romano. Der andere Glockenzug hatte keinen Namen.
Der junge Mann zog lebhaft den letzteren.
Eine ältere Dienerin, halb Kammerfrau, halb Haushälterin, öffnete. Herr von Grabenow trat in das kleine Vorzimmer.
»Fräulein Julia zu Hause?« fragte er – und ohne die Antwort der sich freundlich verneigenden Dienerin abzuwarten, wendete er sich rasch zu einer links vom Eingange befindlichen Flügeltür, öffnete dieselbe und trat in einen hellen, mittelgroßen Salon mit allem jenen reizenden und anmutigen Komfort ausgestattet, welchen der französische Geschmack in dem Innern der Wohnungen herzustellen weiß.
In einem tiefen, mit lichtblauer Seide überzogenen Fauteuil, welchen eine Gruppe großer Blattpflanzen, untermischt mit Rosen und Heliotrop, umgab und fast versteckte, lag anmutig zurückgelehnt ein junges Mädchen in einfacher grauer Haustoilette.
Ihre klassisch schön geschnittenen Züge, überhaucht vom duftigen Schmelz der ersten Jugend, hatten jenen wunderbar reizenden bräunlichen Teint der Italienerinnen aus den südlichen Teilen der Halbinsel, das glänzende, kohlschwarze Haar lag glatt gescheitelt und in reichen Flechten geordnet um das Haupt, ohne eine Spur jener extravaganten Coiffüren, welche um jene Zeit die französischen Damen auf ihren Köpfen zur Schau zu tragen begannen. Ihre großen, mandelförmig geschnittenen Augen blickten träumerisch nach oben, die schönen Hände ruhten gefaltet auf einem Buch in ihrem Schoß, in dessen Lektüre ihre eigenen Gedanken sie unterbrochen zu haben schienen. – Und wehmütig und schmerzlich mußten diese Gedanken sein, denn ein leises Zucken bewegte die frischen, roten Lippen, und in den langen, weit übergebogenen Augenwimpern blinkte der zitternde Schimmer einer Träne.
Bei dem Eintritt des jungen Mannes glänzte ein lichter Strahl in ihrem Blick, den sie rasch der Türe zuwendete, und ein liebliches Lächeln umspielte ihren Mund, ohne indes ganz die schmerzlichen Linien verwischen zu können, welche denselben vorher umzogen hatten. Herr von Grabenow eilte auf sie zu.
»Ich kann nicht lange fern von meiner Julia bleiben,« rief er, sie mit entzücktem Auge betrachtend, indem er einen Arm auf den Fauteuil über ihrem Kopf stützte und mit den Lippen ihre Stirn berührte, »ich habe mich losgerissen von meinen Freunden, um hierher zu eilen.«
Und er zog einen Sessel heran, setzte sich vor sie und blickte ihr innig und liebevoll in die Augen, indem er ihre Hände an sein Herz drückte.
Sie folgte allen seinen Bewegungen mit einem träumenden, schwärmerischen Blick und sagte leise: »Wie wohl ist mir, wenn du da bist; wenn ich in deine klaren, reinen Augen blicke, so meine ich, jenen herrlichen, blauen Himmel meines Vaterlandes zu sehen, welcher mir nur als unmündiges Kind gelächelt hat, und den ich doch liebe und voll Sehnsucht im Herzen trage.«
»Und doch bist du traurig?« rief er, ihre Hand küssend, »sieh', wie schön diese herüberhängende Rose zu deinem dunkeln Haare paßt, sie scheint darum zu bitten, daß sie dich schmücken dürfe.«
Und er streckte die Hand nach einer bis zur Lehne des Fauteuils herabhängenden Moosrose aus, welche sich anmutig an die dunklen Flechten ihres Haares lehnte.
»Laß die Blume,« rief sie fast ängstlich, »warum ihr kurzes Blütenleben zerstören, für mich paßt kein Blütenschmuck,« fügte sie leise hinzu, indem sie die Hand wie abwehrend erhob.
Aber schon hatte er sich erhoben und die schöne, halb erblühte Rose ergriffen, um sie zu brechen. Plötzlich zuckte er mit leisem, unwillkürlichen Schmerzenslaut zusammen, die Rose fiel in den Schoß des jungen Mädchens.
»Non son rosa senza spine!« rief sie lächelnd, aber mit trauriger Stimme, indem sie die Blume erhob und sinnend betrachtete.
»Doch, meine Geliebte,« sagte er, »hier ist eine Rose ohne Dorn!« Er steckte die Blume leicht in die glänzend, schwarze Flechte ihres Haares und sah sie mit glückstrahlendem Blick an.
Sie seufzte tief.
»O,« rief sie mit schmerzlichem Ton, »wie scharf und schneidend ist der Dorn – in diesem Herzen, das für dich blüht, nur richtet er sich nicht nach Außen, wie bei der blühenden Rose, sondern mit bitterem Schmerz dringt er mir tief in die eigene Brust!«
»Und wie heißt der schlimme Stachel, der dich quält, selbst in meiner Gegenwart?« fragte er mit dem Tone leisen, liebevollen Vorwurfs.
Sie richtete sich empor – sah ihm mit ihrem tiefen, dunklen Blick lange in die offenen, lichten Augen und sprach langsam und ernst:
»Die Blüte meines Lebens, das ist die Gegenwart, der Gedanke an die Vergangenheit und der Gedanke an die Zukunft – das, was andere glückliche Menschen Erinnerung und Hoffnung nennen, das sind die scharfen, schneidenden Dornen! Wie bald wird die Blüte verwelkt sein, und meinem Herzen werden nur die Dornen bleiben! – Du hast eine Vergangenheit,« sprach sie, ihn innig anschauend, »du hast die Erinnerung an eine glückliche Kindheit, du hast die Hoffnung – die Zukunft – was habe ich?« flüsterte sie mit unsäglich schmerzlichem Ton und eine Träne verhüllte den Blick ihres in bläulichem Schwarz schimmernden Auges.
Der junge Mann schwieg, ein wenig betroffen, er schien nicht sogleich eine Antwort zu finden auf die aus dem bewegten Herzen des jungen Mädchens hervordringende Frage.
Sanft bog er ihr Haupt zu sich herüber und küßte den silbernen Tropfen von ihren Wimpern.
»Du hast mir noch so wenig von deiner Vergangenheit, deiner Kindheit erzählt!« sprach er leise.
»Oh, daß ich sie vergessen könnte,« rief sie, »und nur der Gegenwart leben! – Vielleicht könnte ich es« – fuhr sie düster und traurig fort, »wenn diese Gegenwart eine Zukunft hätte, aber so –! – Was soll ich dir von meiner Vergangenheit erzählen?« sagte sie nach einer Pause, während welcher sie den Blick traurig in den Schoß senkte. »Sie ist einfach, ein Bild Grau in Grau! – Ich weiß,« fuhr sie fort, »daß Italien mein Vaterland ist, ich weiß es nicht nur, weil man es mir gesagt hat, weil in der sanften, gesangreichen Sprache Dantes und Petrarcas die ersten Laute von meinen Lippen klangen, nein, ich weiß es,« rief sie mit strahlendem Blick, »weil ich in meinem Herzen trage jenen reinen, blauen Himmel, jenes schimmernde Meer mit dem flüsternden Rauschen feiner sanften Wellen, mit dem brausenden Donner seiner zürnenden Brandung – weil ich sie mit dem Auge der Seele vor mir sehe, jene dunklen, schattigen Haine, jene Marmorpaläste, jene schimmernden Statuen, weil ich vor Sehnsucht vergehe, die Lippen auf den heiligen Boden meines Vaterlandes zu drücken, zu sterben, um in dieser Erde zu ruhen.«
Sie schwieg und blickte abermals träumerisch vor sich hin. Er küßte schweigend ihre Hand.
»Und mit dieser Sehnsucht im Herzen,« fuhr sie fort, »die Seele erfüllt von diesen Bildern, die immer deutlicher, immer mächtiger in mir heraufstiegen, je mehr ich älter wurde und mich entwickelte – mußte ich hier in diesem lärmenden, staubigen, unruhigen Paris leben, allein mit der Trauer meines Herzens«
»Aber deine Eltern, deine Mutter?« fragte der junge Mann.
Sie sah ihn tief in die Augen und senkte dann schmerzlich den Blick.
»O,« rief sie, »mein Freund – das ist das Allerschmerzlichste! – Mein Herz sehnte sich danach, meine Mutter lieben zu können, es drängte ihr entgegen mit allen seinen Schlägen – aber es fand weder Liebe noch Verständnis. Meine Mutter hatte keine Zeit für ihr Kind in dem unruhigen, unstäten Leben, das wir führten, bald in Überfluß und regelloser Verschwendung, bald in dürftiger Not –«
Sie senkte errötend das Haupt.
»Mein Vater,« fuhr sie dann fort, »sorgte für mich mit treuer Teilnahme, er hielt mir Lehrer und ließ mich ausbilden, so gut er es vermochte, immer hatte er, auch in den bedrängtesten Zeiten, die Mittel übrig, die notwendigen Kosten meiner Erziehung zu bestreiten und dies war der einzige Punkt, in welchem er, sonst so weich, so nachgiebig, meiner Mutter mit unbeugsamem Ernst entgegentrat. Ich liebte ihn dafür, mein Herz suchte sich an ihn zu schließen, aber – so treu und unablässig er für mich sorgte, ebenso unnahbar blieb er der Zärtlichkeit meines Herzens. Es lag wie eine ängstliche Scheu in seinem Blick, wenn er mich ansah, und oft wendete er sich zitternd und tränenden Auges ab, wenn ich an ihn herantrat und ihm mit einem Worte der Liebe und Dankbarkeit die Hand küßte. – So blieb ich einsam,« sagte sie traurig – »und lebte in mir selbst und mit mir allein ein stilles Leben, dessen Angelpunkt die ewige unbezwingliche und unerfüllte Sehnsucht nach dem fernen Lande meiner Geburt blieb, die Sehnsucht nach der Lösung eines Rätsels, das mein einsames und einförmiges Leben umgab!«
»Arme Julia!« sagte er innig.
»Als ich herangewachsen war.« fuhr sie mit niedergeschlagenen Augen fort, »änderte sich das Benehmen meiner Mutter gegen mich; sie beobachtete mich, sie achtete auf meine Toilette, auf mein Benehmen, sie ließ sich von mir vorsingen und lobte meine Stimme, sie ordnete meine Haare und sprach über die Farben, welche mir am besten ständen, aber es war keine Teilnahme, die mir wohltat, sie war kalt und ohne Liebe und sie erschreckte und ängstigte mich. – Bald nahm sie mich mit, wenn sie ausging, sie führte mich ins Bois de Boulogne, wenn dort ganz Paris sich versammelte, in die Theater, so oft sie die Ausgabe machen konnte, sie rief mich in ihr Zimmer, wenn dort fremde Herren waren, sonst hatte sie mich hinausgeschickt, wenn Besuche zu ihr kamen, sie ließ mich vorsingen, man sagte mir, daß ich Talent und gute Stimme habe, daß ich schön sei, aber in einer Weise, die mich ängstigte, verletzte, entsetzte! So kam es,« fuhr sie leiser fort, indem ein halb scheuer, halb liebevoller Blick zu ihm hinüberstreifte, »daß du mich an jenem Abend in der avant scène-Loge des Variété-Theaters fandest, du weißt, wie leicht es dir gemacht wurde, dich mir zu nähern –«
»Und bereust du das?« fragte er liebevoll, indem er sanft seinen Arm um ihre Schultern legte.
Sie bog sich zu ihm hin, ließ den Kopf an seine Brust sinken und weinte leise.
»Ich liebte dich,« flüsterte sie, »aber glaubst du, daß meine Mutter unsere Liebe begünstigte, glaubst du nicht, daß sie mich ebenso dir entgegengeführt, mich in deine Arme gedrängt haben würde, wenn ich dich nicht geliebt hätte, wenn mein einsames Herz nicht dem deinen entgegengeschlagen hätte? – O!« rief sie und Schluchzen erstickte ihre Stimme, – »für sie genügte es, daß du der reiche Kavalier warst, der ihre Tochter kaufen konnte!«