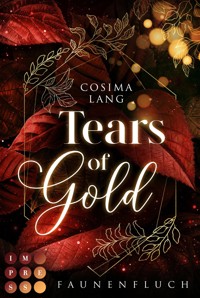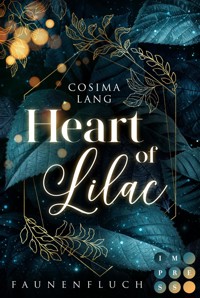9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Eine Liebe gemeißelt in Rache und Verrat** Ophelias Blutlinie steht unter einem bedrohlichen Schicksal: Jede Frau ist dazu verdammt, an ihrem einundzwanzigsten Geburtstag zu Stein zu erstarren. Um diesem Unheil zu entgehen, macht Ophelia sich auf in die sagenumwobene Welt Gaia, um dort nach dem Erschaffer des Fluchs zu suchen, dem Faun Andros. Als sie dem dunklen Herrscher schließlich in seinem Palast gegenübersteht, spürt sie sofort eine unwiderstehliche Anziehungskraft, die ihr regelrecht den Atem raubt. Und dann ist da noch der gutaussehende, aber geheimnisvolle Kyros, der seine Hilfe anbietet und sie warnt, Andros niemals ihre wahre Identität zu nennen. Nach und nach gerät Ophelia in ein Netz aus Liebeswirren, Geheimnissen und Intrigen und muss alles, was sie bisher für sicher gehalten hat, infrage stellen … Lass dich in die magische Welt der Faune entführen! Eine Liebesgeschichte zwischen Schicksal, Feindschaft und dunklen Familiengeheimnissen. //Diese E-Box enthält beide Romane der magischen Faunenfluch-Dilogie von Cosima Lang: Band 1: Heart of Lilac Band 2: Tears of Gold//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
www.impressbooks.de Die Macht der Gefühle
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses E-Book ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch lizensiert und wurde zum Schutz der Urheberrechte mit einem digitalen Wasserzeichen versehen. Das Wasserzeichen beinhaltet die verschlüsselte und nicht direkt sichtbare Angabe Ihrer Bestellnummer, welche im Falle einer illegalen Weitergabe und Vervielfältigung zurückverfolgt werden kann. Urheberrechtsverstöße schaden den Autor*innen und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Impress Ein Imprint der CARLSEN Verlag GmbH, Völckersstraße 14-20, 22765 Hamburg © der Originalausgabe by CARLSEN Verlag GmbH, Hamburg 2024 Text © Cosima Lang, 2023, 2024 Coverbild: rawpixel.com / ©stockgood / Freepik.com / ©pikisuperstar / shutterstock.com / ©Phatthanit Covergestaltung der Einzelbände: Emily Bähr ISBN 978-3-646-61062-8www.impressbooks.de
© privat
Cosima Lang hat schon immer gerne in fremden Welten und abenteuerlichen Geschichten gelebt. In der Schule hatte sie lieber die Nase in einem guten Buch, als auf die Tafel zu schauen. Mit achtzehn fand sie endlich den Mut, auch ihre eigenen Geschichten niederzuschreiben. Ihre Liebe zu Fantasy drückt Cosima Lang auch in Form von Make-up-Looks aus, die sie oft passend zu Büchern gestaltet. Aktuell studiert sie Antike Kulturen und Germanistik und lebt mit ihrem Hund zusammen.
Wohin soll es gehen?
Vita
Band 1: Heart of Lilac
Band 2: Tears of Gold
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Cosima Lang
Faunenfluch 1: Heart of Lilac
Eine Liebe gemeißelt in Rache und Verrat
Ophelias Blutlinie steht unter einem bedrohlichen Schicksal: Jede Frau ist dazu verdammt, an ihrem einundzwanzigsten Geburtstag zu Stein zu erstarren. Um diesem Unheil zu entgehen, macht Ophelia sich auf in die sagenumwobene Welt Gaia, um dort nach dem Erschaffer des Fluchs zu suchen, dem Faun Andros. Als sie dem dunklen Herrscher schließlich in seinem Palast gegenübersteht, spürt sie sofort eine unwiderstehliche Anziehungskraft, die ihr regelrecht den Atem raubt. Und dann ist da noch der gutaussehende, aber geheimnisvolle Kyros, der seine Hilfe anbietet und sie warnt, Andros niemals ihre wahre Identität zu nennen. Nach und nach gerät Ophelia in ein Netz aus Liebeswirren, Geheimnissen und Intrigen und muss alles, was sie bisher für sicher gehalten hat, infrage stellen …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
1
Die meisten Menschen denken nicht oft über ihren Tod nach. Er ist ein seltsames Konzept in weiter Ferne, das kaum einen Einfluss auf das tägliche Leben hat. Man lebt, liebt und lernt jeden Tag, ohne auch nur einen Gedanken an das Ende zu verschwenden.
Ein paar wenige unglückliche Seelen auf dieser Welt sind jedoch dazu verdammt, immer und immer wieder an dieses Schicksal zu denken. Manchmal bringt ihnen der Schlaf Erlösung. Doch die Realität hängt über ihnen wie eine dunkle Regenwolke und verfolgt sie auf Schritt und Tritt.
***
Das alte, schmiedeeiserne Tor knarzte leise, als ich es aufschob. Erschrocken zuckte ich zusammen und warf schnell einen Blick über meine Schulter, ob mich irgendjemand entdeckt hatte.
Aber das Feld um mich herum lag verlassen da. Die Sonne war noch nicht vollständig aufgegangen, im Zwielicht des Morgens verschluckte der dichte Nebel das noch steif gefrorene Gras beinahe komplett. In der Ferne konnte ich die Lichter einiger Autos sehen, die bereits auf der Straße unterwegs waren.
Um mich herum lag die Welt kalt und tot da. Die Natur war in ihrem Winterschlaf gefangen. Obwohl es bereits März war, ließ der Frühling noch auf sich warten. Ich rieb meine kalten Finger aneinander und verfluchte mich innerlich, dass ich meine Handschuhe zu Hause vergessen hatte.
Ein wenig sehnte ich mich nach meinem warmen Zimmer, in dem sicher bereits ein Feuer brannte und ein heißes Frühstück auf mich wartete. Aber das hier war wahrscheinlich meine letzte Chance, diesen Ort zu besuchen, wenn mich mein Mut heute nicht im Stich ließ.
Aufgeregt trat ich durch das altertümliche Tor in eine vollkommen fremde Welt. Vorbei war es hier mit dem grauen Winter, stattdessen strahlte über mir die Sommersonne so hell, dass es mir schon bald zu warm in meinem Parka wurde.
Ich ließ das Kleidungsstück achtlos zu Boden fallen und trat tiefer in den Garten hinein. Eine sanfte Brise ließ die Blätter in den Büschen rauschen und trug den Duft von Blumen mit sich. Schmetterlinge, Bienen und andere Insekten tanzten in einem wilden Spektakel aus Flügeln durch die Luft. Das Gras unter meinen Stiefeln war leuchtend grün und sah so weich aus, dass es dazu einlud, sich darauf auszuruhen.
Dieser Ort war paradiesisch schön, doch änderte das nichts an der grauenhaften Erinnerung, die er in mir hervorrief.
Auf den ersten Blick schienen die Pflanzen hier frei und wild zu wachsen, doch der Eindruck täuschte. Es hatte mich Jahre gekostet, bis ich den richtigen Weg gefunden hatte, doch jetzt liefen meine Beine ihn wie von allein ab. Ich kam an einer Reihe von Statuen vorbei, von Frauen, die mein Schicksal teilten. Ich kannte all ihre Namen auswendig – von der jüngsten bis zur ältesten.
Ich kannte den Tag ihrer Geburt und den ihres Todes – immer genau einundzwanzig Jahre später.
Einundzwanzig Jahre hatte das Schicksal für sie vorgesehen, bevor der Fluch auch sie ergriffen und hierhergebracht hatte.
Einundzwanzig Jahre, in denen sie lieben und leben konnten, ehe sie für immer zu Stein erstarrten.
Einundzwanzig Jahre, von denen mir nur noch eines zum Leben blieb.
An diesem Tag nahm ich mir nicht die Zeit, ihre Gesichter zu betrachten, die im Moment ihres Todes erstarrt waren. Ich konnte mich nicht dem Schmerz, Schock oder der Angst stellen, dem panischen Ausdruck, der für immer in Stein gemeißelt war. Stattdessen wanderte ich mit gesenktem Kopf den kaum erkennbaren Weg entlang, bis ich in der Mitte des Gartens ankam.
Auf der kleinen, mit Wildblumen überwachsenen Lichtung stand ein steinerner Pavillon, dem als einziges die Vergänglichkeit anzusehen war. Moos wuchs über die kunstvoll geschwungenen Säulen hinauf bis aufs Dach. Im Inneren befand sich die einzige Statue, deren Namen ich nicht kannte.
Es war klar, dass es sich um eine Frau handelte, auch wenn ihr Gesicht für immer durch die Witterung verloren gegangen war. Jahrelang hatte ich in den Chroniken meiner Familie gesucht, doch keinen Hinweis auf die Unbekannte gefunden.
Ich lehnte mich an eine der Säulen und ließ mich zu Boden sinken, bis ich auf dem von der Sonne gewärmten Moos saß. Ich hasste diesen Ort aus tiefster Seele, aber konnte nichts gegen das Gefühl des Friedens unternehmen, das mich jedes Mal ergriff, wenn ich hierherkam.
Und gerade an diesem Tag brauchte ich diesen Frieden. Hier war ich so unendlich weit weg von dem lauten, nervenaufreibenden Chaos, welches mein Leben umgab. Keine Termine, die ich einhalten, keine Veranstaltungen, die ich besuchen musste, keinerlei Verpflichtungen. Keine falschen Freunde, die immer noch glaubten, ich würde ihre mitleidigen Blicke nicht sehen.
Keine politischen Veranstaltungen, auf denen ich eigentlich nichts zu suchen hatte. Aber als die Tochter von Auris war ich nun einmal ein Symbol für den Kampf gegen unsere Feinde. Ich musste der Welt gezeigt werden, damit wir niemals vergaßen, warum wir die Faune so hassten:
Weil sie unsere Welten gespalten hatten.
Weil sie unsere Ressourcen gestohlen hatten.
Weil sie unsere unschuldigen Kinder verfluchten.
Ein frustriertes Schnauben entfuhr mir. Soweit ich informiert war, handelte es sich bei meiner Familie um die einzige, die verflucht war. Niemand anders musste seine Töchter zu ihrem einundzwanzigsten Geburtstag zu Grabe tragen. Ob es irgendwo da draußen noch eine unglückliche Seele wie mich gab? Dann würde ich mich an meinem Sterbetag nicht so alleine fühlen.
Ich wurde aus meinen düsteren Gedanken gerissen, als ich hinter mir Schritte hörte. Ich machte mir nicht einmal die Mühe, den Kopf zu drehen. Es gab nur einen Menschen außer mir, der hierherkam. »Guten Morgen, Robert.«
»Was machst du hier, Ophelia?« Ich hörte den Unmut in seiner Stimme, blickte jedoch weiter stur auf die unbekannte Statue.
»Ich genieße die Sonne. Über den Winter bin ich doch etwas blass geworden.«
Mein Bruder schnaubte auf dieselbe Weise, wie unser Vater es tat. »Du solltest nicht hier sein, Fi. Vor allem nicht heute.«
Jetzt wandte ich ihm doch den Kopf zu. »Wieso nicht? Ist es unpassend, sich an seinem Geburtstag sein zukünftiges Grabmal anzuschauen?«
Robert kniff die grünen Augen zusammen, die meinen so ähnlich waren. »Heute ist dein Geburtstag. Den solltest du feiern.«
Einen Moment lang wollte ich dem Drang nachgeben, ihm eine patzige Antwort an den Kopf zu werfen und ihn so hoffentlich zu vertreiben, doch das wäre nicht fair gewesen. Robert litt ebenfalls unter dem Fluch. Es uns beiden nur noch schwerer zu machen, brachte überhaupt nichts.
Also kam ich etwas ungelenkig auf die Beine. »Du hast recht. Komm, lass uns nach Hause gehen. Ich muss mich für die Party fertig machen«, sagte ich, obwohl ich auf meine Geburtstagsfeier überhaupt keine Lust hatte. Aber das interessierte niemanden.
Als ich an ihm vorbeiging, hielt er mich zurück. »Aber wenn ich dich schon alleine erwische, will ich dir etwas geben.« Er zog ein Päckchen aus seiner Jackeninnentasche.
»Uh, was kann das wohl sein?« Spielerisch schüttelte ich das Geschenk, bevor ich an der kleinen Schleife zog und den Deckel anhob. Im Inneren verbarg sich nicht wie erwartet Schmuck, sondern ein paar wunderschön gearbeitete Handschuhe.
»In der Hoffnung, dass du die nicht immer vergisst.« Voller geschwisterlicher Liebe wuschelte Robert mir durchs Haar und zerstörte dabei meinen sorgsam gebundenen Zopf.
»Die sind wirklich wunderschön.« Behutsam fuhr ich über den weichen, dunkelgrünen Stoff. »Ich werde sie ganz sicher nicht verlieren.«
»Wir werden sehen.« Er legte den Arm um meine Schultern, um mich liebevoll, aber nachdrücklich in Richtung des Tores zu lenken. »Genug jetzt von diesen traurigen Gedanken. Wir wollen heute feiern.«
Robert zuliebe zwang ich ein Lächeln auf meine Lippen, doch es fühlte sich falsch und gekünstelt an. Den letzten Geburtstag im Leben zu feiern, schien mir nicht wie ein freudiges Ereignis. Aber von mir wurde nun einmal erwartet, dass ich eine fröhliche Miene aufsetzte und tapfer immer weiter lächelte, auch wenn es in mir drin ganz anders aussah. Die meisten Nächte erwachte ich schreiend aus Albträumen, um mich dann wieder in den Schlaf zu weinen. An manchen Tagen konnte ich meine Tränen auch tagsüber nicht unterdrücken, dann biss ich die Zähne so fest zusammen, dass mir der Kiefer schmerzte.
Ich war nicht tapfer, ich war verzweifelt. Aber Verzweiflung konnte ein guter Antrieb sein.
Nachdem wir den verwunschenen Garten verlassen und wieder in unsere Welt, in den eisigen Winter, getreten waren, zog ich den Reißverschluss meiner Jacke, so schnell ich konnte, zu. Schon jetzt vermisste ich das Gefühl der Sonne auf meiner Haut.
Nicht weit vom Tor entfernt stand Juniper, mein Schimmel, neben Roberts Pferd. Die gemeinsamen Ausflüge waren seit meiner Kindheit einige Momente der Freiheit gewesen. Auch diente mir die Zeit mit Juniper als Fluchtmöglichkeit.
Ich ignorierte die helfende Hand, die mein Bruder mir reichte, und schwang mich mit eigener Kraft auf Junipers Rücken. Von hier oben konnte ich über die Mauer blicken, die den fluchbeladenen Garten umgab. Doch von hier aus war nichts von dem Sonnenschein und den Statuen zu sehen. Stattdessen war da nur ein brachliegendes Feld.
Dieser Ort war einer der wenigen auf dieser Welt, an dem die Faunenmagie noch zu spüren war. Sie war so ganz anders als unsere, weniger roh und aggressiv, mehr ein Sommerregen als ein Herbststurm. Hätte ich die Geschichte dieses Gartens nicht gekannt, hätte ich ihn als wunderschön empfunden.
Mit den Beinen trieb ich Juniper zum Galopp an, meinen Blick streng auf den Horizont gerichtet, um dem Drang, mich noch einmal umzudrehen, zu widerstehen. Ich suhlte mich in meinem eigenen Unglück, das war mir bewusst, aber so sehr ich mich auch bemühte, konnte ich dagegen nichts unternehmen.
Der kalte Wind pfiff in meinen Ohren, während die Felder und Wiesen an uns vorbeizogen. Es dauerte nicht lange, bis in der Ferne das alte Anwesen auftauchte, das meine Familie ihren Stammsitz nannte. Hier hatte unser Reichtum seinen Anfang genommen, genauso wie mein Fluch.
Hier hatte alles begonnen. Doch anstatt diesen Ort niederzubrennen und die Asche in alle vier Winde zu verstreuen, war meine Familie geblieben – in dieser Mischung aus Palast und Gefängnis.
Die hohen Mauern um das gesamte Anwesen herum waren zum Schutz errichtet worden, nicht nur vor den Faunen, sondern auch vor den Menschen, die meiner Familie nicht gut gesinnt waren. Ein Tor führte einzig und allein hinein aufs Hofgelände. Es sah zwar alt aus, doch es war ein Wunderwerk der modernen Technik, voller Überwachungssysteme und versteckter Waffen.
In einer kleinen Mauernische neben dem Tor standen, wie an jedem Tag, zwei Sicherheitsmänner, die uns zur Begrüßung kurz zunickten, ehe sie sich wieder mit ausdrucksloser Miene den Bildschirmen zuwandten, die jeden Zentimeter um die Mauer herum zeigten.
Im Hof vor dem Haupteingang stieg ich von Juniper ab. Obwohl die Gala zu meinem Geburtstag erst in ein paar Stunden begann, herrschte hier bereits wildes Treiben. Hausangestellte und Aushilfen huschten von links nach rechts, hinein ins Haus und wieder heraus. Keiner von ihnen bemerkte uns.
Ich nahm Junipers Zügel in die Hand, um meine Stute zu den Stallungen hinter dem Anwesen zu führen. Robert schloss sich mir an und brach zum ersten Mal, seitdem wir vom Garten aufgebrochen waren, das Schweigen: »Ich wünsche mir, dass du heute einen schönen Abend erlebst.«
Ich biss mir so fest auf die Zunge, dass ich Blut schmeckte, nur um die Worte zurückzuhalten:
Weil es mein letzter Geburtstag ist?
Weil wir der Welt zeigen müssen, wie stark wir sind?
Beruhigend klopfte ich Robert auf den Arm. »Es wird sicher perfekt werden, so wie jedes Jahr.« Denn eins musste man meiner Familie lassen, wir konnten wahrhaft gute Partys feiern.
Zwei Stallhilfen eilten uns entgegen, um sich um die Pferde zu kümmern. An jedem anderen Tag hätte ich mich persönlich um Juniper gekümmert, doch heute galt meine volle Aufmerksamkeit etwas anderem. Dieser Abend war etwas Besonderes, mein letzter Geburtstag, mein Abschied.
Ich konnte Roberts Blick auf mir spüren. Die Sorge um mich, die in Wellen von ihm abstrahlte – schon mein ganzes Leben lang. Er wartete darauf, dass ich zusammenbrach, dass mich meine Kraft verließ und er mich auffangen musste. Aber noch war dieser Tag nicht gekommen.
»Ich werde mich zurechtmachen. Wir sehen uns nachher.« Bevor Robert noch etwas erwidern konnte, drückte ich ihm einen Kuss auf die Wange, um dann, so schnell ich konnte, zu verschwinden.
Mit gesenktem Kopf eilte ich die langen Gänge des Herrenhauses entlang. Auch wenn ich es mir selbst nicht gerne eingestand, zerrte dieser Tag an meinen Nerven. In den letzten Jahren war Verdrängung mein Heilmittel der Wahl gewesen, bloß nicht daran denken, dass mein Leben ein zu kurzes Ablaufdatum hatte. Aber seit einigen Monaten war dies einfach nicht mehr möglich.
Und so konnte ich nicht anders, als mich mit der Wirklichkeit meiner Situation auseinanderzusetzen und zum ersten Mal in meinem Leben alleine nach einer Lösung zu suchen. Bisher hatte meine Familie diese Aufgabe übernommen, nicht nur bei mir, sondern bei allen Töchtern der Familie Auris. Über die letzten zwei Jahrhunderte wurde jede Quelle des Wissens ausgeschöpft, jeder Zauberer und Magier dieser Welt darauf angesetzt, und selbst die modernste Technik zu Rate gezogen. Doch nichts hatte den Fluch brechen können.
Ich wusste nicht, wann genau sich meine Einstellung geändert hatte. Ab wann ich nicht mehr bereit war, einfach nur abzuwarten, bis sich eine Lösung von selbst zeigte. Meine Zeit war begrenzt, und wenn ich mehr davon haben wollte, dann musste ich handeln, dann musste ich mich selbst der Gefahr aussetzen.
Ich wurde jäh aus meinen Gedanken gerissen, als ich eine Gestalt im Flur vor meinem Zimmer bemerkte. Fast unhörbar seufzte ich, unterdrückte ein Augenverdrehen und schenkte Izabel stattdessen ein halbwegs freundliches Lächeln, das sie mit einem knappen Nicken erwiderte.
Mein Vater nannte sie eine persönliche Assistentin, die mir mein Leben erleichtern sollte. Ich betrachtete sie eher als kontrollierender Wachschutz, der mir auf Schritt und Tritt folgte. Izabel war nicht die erste Person, die diese Rolle erfüllte, es gab schon einige vor ihr. Doch auch nach mehreren Monaten war ich immer noch nicht mit ihr warm geworden.
Sie folgte mir nicht bis in mein Zimmer, sondern blieb in der Tür stehen. »Das Kleid wurde bereits hochgebracht und liegt bereit. Ich war so frei, ein leichtes Mittagessen zu bestellen. Sollte noch irgendetwas sein, dann rufen Sie einfach nach mir.«
»Danke, Izabel.« Als sie die Tür mit einem leisen Klicken hinter sich schloss, atmete ich erleichtert durch. Mir blieben nur noch ein paar Stunden Ruhe und Frieden, ehe mich die Menge erwartete. Mein Weg führte mich zuerst durch mein Schlafzimmer in das geräumige angeschlossene Badezimmer.
Die enorme Eckbadewanne war schon immer meine große Liebe gewesen. Während sie volllief, zündete ich die umstehenden Kerzen an und ging dann zurück in mein Zimmer.
Ich war kein paranoider Mensch, aber seitdem ich mit meinen Vorbereitungen begonnen hatte, wurde ich das Gefühl einfach nicht los, beobachtet zu werden. Sicher waren es nur meine Schuldgefühle, aber ich musste trotzdem noch einmal überprüfen, dass wirklich alles für heute Nacht bereit war.
Aus der hintersten Ecke meines übergroßen Kleiderschrankes holte ich den gepackten Rucksack hervor, zusammen mit der passenden Kleidung. Es war kompliziert gewesen, an einige der Sachen zu kommen, aber mit etwas Bestechung am Ende doch möglich.
Nachdem ich das Innere des Rucksacks noch einmal überprüft hatte – Wechselkleidung, einen Haufen Geldscheine, Schmuck, den ich im Notfall noch zu Geld machen konnte, und ein paar falsche Ausweise –, packte ich alles wieder sicher weg und widmete mich meinem Bad.
Für die Stunde, die ich in dem heißen Wasser verbrachte, vertrieb ich jeden weiteren Gedanken aus meinem Kopf. Es machte wenig Sinn, mich weiter mit den Wenns und Abers zu quälen. Nachdem meine Haut vom Bad ganz aufgeweicht war, machte ich mich für den Abend fertig.
Pünktlich um 17.55 Uhr verließ ich in einem bodenlangen, dunkelroten Abendkleid das Zimmer. Das Klackern meiner hohen Schuhe wurde von dem dicken Teppich auf dem Boden gedämpft, und das warme Licht der Lampen ließ die Edelsteine um meinen Hals glitzern.
Wie bei jeder Gala wartete Robert am Ende der großen Treppe im Foyer auf mich. »Noch einmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Ophelia.«
»Auf geht’s!«
Seite an Seite traten wir in den grandiosen Ballsaal, der einen großen Teil des Erdgeschosses einnahm. Unser Eintreten wurde vom tosenden Applaus der Menge begleitet. Alle Aufmerksamkeit lag auf uns. Über die Jahre hatten wir eine Routine entwickelt, wie Robert und ich an solchen Events vorgingen.
Nachdem die Gäste mich begrüßt und mir zum Geburtstag gratuliert hatten, übernahm mein Bruder das Gespräch, während ich dane-benstand, lächelte und nickte. Ich war kein Fan von diesem hohlen Smalltalk, begleitet von falschem Lächeln und gespielter Freundschaft.
Ich kannte die Namen der meisten hier Anwesenden auswendig und wusste, womit genau sie ihr Geld verdienten; konnte die Unternehmer von den Politikern unterscheiden, die Würdenträger richtig ansprechen und den Geschäftspartnern meiner Familie Komplimente machen. Aber ich kannte niemanden in diesem Raum wirklich.
Alles, was hier interessierte, war nur die Tatsache, wer ich war und was ich repräsentierte: den Auris-Fluch und unsere gemeinsame Geschichte mit den Faunen. Ich war ein Symbol für diese Geschichte gewesen, für einen Krieg, der schon Jahrhunderte her war, aber immer noch unsere Gegenwart bestimmte.
Um meine Hände zu beschäftigen und meinen Kopf zu beruhigen, nahm ich mir ein Glas Champagner vom Tablett einer vorbeieilenden Kellnerin.
Eine gefühlte Stunde später hatten wir es endlich durch die Menge hindurch bis zu meinem Vater geschafft, der zusammen mit einigen seiner engsten Freunde und Partner in einer Ecke Hof hielt. Als er mich erblickte, erhellte ein breites Lächeln sein Gesicht, sodass sich die vielen Falten noch deutlicher abzeichneten. Papa war nicht mehr der Jüngste, aber er war immer noch ein beeindruckender Mann.
»Alles Gute zum Geburtstag, mein Liebling.« Er zog mich in eine feste Umarmung, und für einen Moment war ich umgeben von seiner Wärme und dem mir so vertrauten Geruch seines Aftershaves. Zuhause, Kindheit, Sicherheit.
»Danke, Papa. Und danke für diese tolle Party.«
»Du hast nur das Beste verdient.« Er küsste mich auf die Stirn und machte dann Platz, damit die restlichen umstehenden Personen mir gratulieren konnten.
Als Letztes trat eine umwerfend schöne Frau an mich heran und zog mich in eine etwas ungeschickte Umarmung. »Alles Gute, Ophelia.«
»Danke, Franziska.« Ich klopfte der langjährigen Freundin meines Bruders auf die Schulter, bevor ich schnell etwas Abstand zwischen uns brachte.
Franziska war … nett. Besser konnte ich es nicht beschreiben. Zwischen Robert und mir lagen beinahe fünfzehn Jahre, weshalb wir uns zwar nahestanden, aber nicht viel am Leben des anderen teilhatten. So kannte ich seine Freundin nur flüchtig von derartigen Veranstaltungen oder den wenigen Besuchen in den vergangenen Jahren.
Zum Glück bestand Franziska nicht darauf, auf gute Freundin zu machen, sondern lächelte noch einmal, ehe sie ihre ganze Aufmerksamkeit Robert widmete. Sie war nicht die Einzige, die mich nicht weiter beachtete, nachdem man mir gratuliert hatte. Eigentlich war meine Aufgabe für diesen Abend erledigt, ich hatte mein Gesicht gezeigt, gelächelt und mich von vollkommen Fremden feiern lassen. Bis mein Vater seine übliche Rede hielt, gab es nichts weiter für mich zu tun.
Also nippte ich an meinem Champagner, beobachtete die Leute und hielt mich im Hintergrund. Ab und an erwiderte ich das Lächeln eines Gastes, aber ich hatte niemandem der hier Anwesenden irgendetwas zu sagen, und unter den vielen Menschen gab es nicht eine Seele, die ich als meinen Freund bezeichnet hätte.
Die Minuten zogen vorbei. Ich musste mich zusammenreißen, nicht ungeduldig mit dem Fuß auf dem Boden zu tippen. Ließ mein Vater sich an diesem Abend besonders viel Zeit vor seiner Rede oder kam es mir einfach nur so vor? Ich war kurz davor, mich auf die Suche nach ihm zu machen, als er endlich auf das kleine Podium trat.
Innerhalb weniger Augenblicke senkte sich Schweigen über den Saal, als alle ihre Aufmerksamkeit meinem Vater schenkten. Dieser räusperte sich, wie vor jeder Rede, bevor seine Stimme die Stille zerriss.
»Einen guten Abend. Und danke an euch alle, dass ihr heute hier seid, um meine wundervolle Tochter zu feiern.« Er schenkte mir ein warmes Lächeln, und für einen Moment folgten alle seinem Beispiel und wandten sich mir zu. Dann sprach mein Vater weiter und alle Blicke richteten sich erneut auf ihn.
»Vor genau zwanzig Jahren war einer der schönsten Tage meines Lebens. Anastasia und ich hatten nicht mit einem zweiten Kind gerechnet, aber dann kamst auf einmal du, liebe Ophelia, und unsere kleine Familie wurde größer. Es war so eine Freude, dich aufwachsen zu sehen, zu sehen, wie du dich zu einer wundervollen, einzigartigen jungen Frau entwickelst.
Deine Mutter und ich haben immer nur das Beste für dich gewollt, und wäre sie jetzt hier, wäre sie so stolz auf dich!«
Bei der Erwähnung meiner Mutter schossen mir Tränen in die Augen. Ihr Tod war schon so lange her gewesen, dass ich mich kaum noch an sie erinnern konnte. Geblieben waren mir nur Erinnerungsfetzen ihrer warmen, weichen Stimme und ihrer liebevollen Umarmung.
»Du bist das Licht meines Lebens, und ich würde alles für dich geben«, fuhr mein Vater fort. Ich versteifte mich, denn ich wusste genau, worauf hinaus seine Rede nun führen würde.
»Es ist nicht fair, dass dieser Fluch auf dir lastet. Dass selbst nach Jahrhunderten noch der Hass der Faune auf uns lastet und ein unschuldiges Leben fordert.«
Seinen Worten folgten zustimmendes Gemurmel und nickende Köpfe. Diese Abscheu gegen die Faune verband die meisten Menschen in diesem Saal.
»Ich werde die Hoffnung nicht aufgeben, Ophelia. Wir werden weiter nach einem Weg suchen, diesen Fluch zu brechen. Denn du verdienst ein langes, aufregendes Leben, mein Schatz. Ich liebe dich!«
Ich trat zu meinem Vater auf die Bühne und schloss ihn in eine feste Umarmung. »Ich liebe dich auch, Papa.« Ich brachte nur ein gebrochenes Flüstern hervor. »Danke für alles.«
Lange konnte ich jedoch nicht in seinen Armen verweilen, denn einige der Gäste verlangten nach seiner Aufmerksamkeit.
Nicht, dass es mich störte. Für mich war der Abend vorbei. Ich war gesehen, gefeiert und bemitleidet worden. Von jetzt an würde niemand weiter auf mich achten.
Trotzdem blieb ich noch einige Minuten, lächelte abermals und betrieb sinnlosen, leeren Smalltalk, bis ich mir sicher sein konnte, dass mein Vater und mein Bruder beschäftigt waren.
Obwohl ich den Drang verspürte, aus dem Saal zu fliehen, schlenderte ich so entspannt wie möglich in Richtung einer der etwas versteckten Türen, damit ich ungesehen verschwinden konnte. Im Türrahmen blieb ich noch einmal stehen und warf einen Blick zurück in den Saal.
Papa und Robert standen nicht weit voneinander entfernt, jeder von ihnen in ein Gespräch vertieft. Die beiden waren die einzige Familie, die ich hatte, mein Anker in diesem Leben. Dass unser letzter gemeinsamer Moment dieser hier war, brach mir beinahe das Herz.
Plötzlich übermannte mich der Drang, zu ihnen zu rennen, sie in den Arm zu nehmen und meinen ganzen Plan zu vergessen. Doch bevor ich einen Schritt machen konnte, rief ich mich innerlich zur Ordnung.
Heute war der einzige Abend, den ich für meine Flucht nutzen konnte. Ich würde diesen Faun finden, der mich verflucht hatte, koste es, was es wolle.
2
Zu sagen, ich hätte Zweifel an meinem Plan, war noch untertrieben, aber ich konnte nicht länger einfach nur hier herumsitzen und in diesem goldenen Käfig auf meinen Tod warten.
Ich schnürte die einfachen Sneakers und schulterte meinen Rucksack. Dann schloss ich hastig die Tür hinter mir und eilte den dunklen Flur entlang – nicht, dass mir doch noch ein Grund einfiele, meinen Plan aufzugeben und hierzubleiben.
Das alte Herrenhaus barg das eine oder andere Geheimnis. Einschließlich der versteckten, längst vergessenen Gänge, die früher von den Bediensteten benutzt wurden, um ungesehen in die Räume zu gelangen. Als Kind hatte ich eine der Geheimtüren gefunden und war stundenlang zwischen den Wänden des Hauses verschwunden. Als ich am Abend endlich wieder aufgetaucht war – am anderen Ende der Villa –, hatten meine Eltern bereits die Polizei informiert. Damals war ich klug genug gewesen, meine neue Entdeckung für mich zu behalten. Hätten meine Eltern von den Geheimgängen erfahren, hätten sie sie sicher zumauern lassen.
Jetzt trat ich, mit einer dicken Taschenlampe bewaffnet, durch die versteckte Tür in der Vertäfelung gegenüber meinem Zimmer in den schwarzen, muffig riechenden Gang. In den letzten Wochen war ich die Tunnel so lange abgegangen, dass ich den Weg noch im Schlaf gefunden hätte.
Mit einem finalen, dumpfen Bumm schloss sich die dicke Tür hinter mir, und für einen Moment war ich umgeben von absoluter Finsternis – ich hatte mich nicht getraut, die Taschenlampe im Flur anzuschalten, um nicht bemerkt zu werden.
Ich hatte schon immer Angst vor der Dunkelheit. Möglicherweise, weil ich mir so mein Ende vorstellte – für immer gefangen in der Finsternis, ohne mich bewegen zu können, ohne Erlösung. Meine Hände zitterten nun so stark, dass mir die Taschenlampe beinahe herunterfiel, als ich sie hastig anschaltete.
Das weiße Licht tanzte aufgeregt über die alten Steinwände, während ich den Tunnel weiter entlangeilte. Hier unten gab es weder Empfang noch irgendeinen Anhaltspunkt, wie viel Zeit verging. Mal ganz abgesehen davon, hatte ich mein Handy ohnehin in meinem Zimmer zurückgelassen. Auf diese Weise wollte ich das Risiko vermeiden, dass meine Familie mich orten ließ.
Der Tunnel führte langsam abwärts. Bald befand ich mich unter dem Haus und zog weiter in Richtung Osten. Hier unten gab es nichts als uraltes Gestein, Staub, Spinnweben und allerhand Krabbeltier. Dennoch wurde ich das Gefühl nicht los, beobachtet zu werden. Mehrmals blieb ich stehen, da ich glaubte, Schritte zu hören. Doch da war nichts.
Weiter und immer weiter schritt ich durch die Dunkelheit, bis ich gänzlich das Zeitgefühl verlor. Das Licht der Taschenlampe setzte der Finsternis um mich herum so wenig entgegen, dass ich den Ausgang aus den Tunneln schon aus weiter Ferne sehen konnte. Meine Schritte beschleunigten sich zunehmend, bis ich am Ende nur noch rannte.
Der Ausgang des Geheimgangs lag verborgen unter einem Metallgitter an einer wenig belebten Straße. Es kostete mich einiges an Kraft, bis ich das alte, verrostete Gitter endlich zur Seite geschoben hatte, aber dann trat ich hinaus in die kalte, klare Nachtluft.
Das laute Scheppern, als ich das Metallgeflecht wieder fallen ließ, war das einzige Geräusch weit und breit. Um mich herum gab es nichts weiter als brach liegende Felder und die einsame Straße. In der Ferne lag das Herrenhaus – erkennbar an den hell erleuchteten Fenstern.
Mit einem tiefen Seufzen schulterte ich meinen Rucksack und wandte mich zum Gehen um, als mich eine Stimme in der Dunkelheit erstarren ließ.
»Gehen wir irgendwohin, Prinzessin?«
Das grelle Licht einer Taschenlampe blendete meine Augen, sodass ich nur Schemen ausmachen konnte. Dann erkannte ich langsam eine schlanke Gestalt, die näherkam.
»Izabel?« Sie trug ein ähnliches Outfit wie ich, nur sahen die schwarze Hose und der Pulli nicht aus wie ein Kostüm. Ihr dunkelrotes Haar war zu einem hohen Zopf gebunden, der ihre scharfen Wangenknochen betonte. Sie hob ihre schmalen Augenbrauen fragend und wartete noch immer auf meine Antwort.
»Was machst du hier?«, reagierte ich mit einer Gegenfrage. Das Herz pochte mir viel zu hart in der Brust und trieb das Adrenalin durch meine Adern.
»Du hast dein kleines Fluchtpaket nicht so gut versteckt, wie du vielleicht gedacht hast.« Izabel stand vollkommen locker und entspannt da, so als führten wir nur ein Gespräch im Flur vor meinem Zimmer.
»Du hast mein Zimmer durchsucht?« Ungeahnte Wut packte mich. Wie konnte sie es wagen? Ich wusste, dass meine Familie dazu neigte, übergriffig zu sein, wenn es um meine Sicherheit ging, aber das überschritt absolut jede Grenze.
Nur leider hatte ich gerade keine Zeit, mich darüber aufzuregen. Wenn Izabel von meinem Plan wusste, konnte sie es auch weitererzählt haben. Hektisch zuckte mein Blick durch die Nacht, in der festen Erwartung, dass gleich mein Bruder und eine kleine Armee an Sicherheitsmännern auftauchen würden. »Weiß mein Bruder davon?«
»Beruhig dich, ich habe niemandem davon erzählt.«
Leider halfen ihre Worte nicht gegen meine Anspannung, ganz im Gegenteil, nun kam noch Misstrauen hinzu. »Was willst du?« In diesem Moment konnte Izabel alles von mir verlangen.
Ein paar Herzschläge lang schaute sie mich einfach nur ausdruckslos an, bevor sie sprach. »Ich will eine Antwort. Wie genau sieht dein Plan aus? Willst du dein letztes Jahr einfach nur in Freiheit verbringen oder bist du auf dem Weg nach …?« Ihre Stimme verklang, als traute sie sich nicht einmal, den Namen auszusprechen.
»Ich bin auf dem Weg nach Gaia.« Zum ersten Mal, seitdem ich diesen Plan gefasst hatte, sprach ich ihn laut aus. Beinahe erwartete ich, dass in der Ferne Donner die Nacht durchriss. Doch um uns herum blieb es still.
Wieder starrte Izabel mich einige Zeit nur an, ehe sie nickte. »Ich verstehe dein Bedürfnis, diesen Weg zu gehen. Hoffnung und Verzweiflung können einen auf seltsame Ideen bringen, aber …«
»Ich bin nicht verzweifelt«, unterbrach ich sie und machte einen Schritt auf sie zu, bis wir uns Auge in Auge gegenüberstanden. »Darüber bin ich hinweg, seitdem meine Mutter sich an meinem zwölften Geburtstag die Augen ausgeweint hat. Und ich habe keine Hoffnung, denn dieser Plan ist absoluter Wahnsinn. Aber ich bin nicht bereit, einfach auf meinen Tod zu warten. Ich bin wütend, Izabel, auf die Faune, auf die Welt und auch auf meine Familie.« Und diese Wut würde mich voranbringen.
»Verstehe. Du hast jedes Recht, wütend zu sein. Deshalb habe ich auch niemandem etwas gesagt. Aber ich begleite dich.«
»Was?« Ich zuckte zurück, bis wieder etwas Abstand zwischen uns lag. »Wieso? Nein!«
Izabel stemmte die Hände in die Hüfte. »Du hast zwei Optionen, Prinzessin: Entweder nimmst du mich mit oder ich alarmiere jeden einzelnen im Haus. Dann kommst du keinen Kilometer weit.«
»Du erpresst mich allen Ernstes?« Mir entfuhr ein ungläubiges Lachen. Eines musste ich ihr lassen, Mut hatte sie.
»Ja, das tue ich.« Unbeeindruckt zuckte sie mit den Schultern. »Also?«
»Beantworte mir vorher auch eine Frage. Wieso willst du mich begleiten?«
»Weil ich ebenfalls wütend bin und es hier nichts gibt, was dagegen hilft. Außerdem wird deine Familie meinen Kopf fordern, da ich dich habe entkommen lassen.«
Verdammt nochmal! Eigentlich war es vollkommen egal, wieso Izabel mich begleiten wollte. Ich würde sie nicht mehr loswerden, so viel war mir klar. Außerdem hatte ich keinerlei Erfahrung darin, jemanden bewusstlos zu schlagen, und sie war mehr als einen halben Kopf größer als ich. Also gab ich mich schließlich geschlagen.
»Dann komm«, zischte ich zwischen zusammengebissenen Zähnen, bevor ich, ohne weiter auf sie zu achten, losstapfte.
Rasch schulterte sie ihre schwarze Tasche und folgte mir wortlos.
Die Landstraße, auf der wir uns gerade befanden, mündete irgendwann in eine größere Straße und diese führte in ein nicht weit entferntes Wohngebiet. Aber bis dahin wollte ich gar nicht laufen. Etwa auf halber Strecke kreuzte eine alte Bahnstrecke die Straße, die früher zu den Minen meiner Familie geführt hatte und zu dem Portal nach Gaia.
Diese Nähe zu einem der größten Portale der Welt hatte meiner Familie damals zu ihrem Reichtum verholfen – und später zu unserem Fluch.
Aber jetzt war ich ziemlich dankbar dafür, dass das Portal nur ungefähr 50 Kilometer entfernt lag. Mehr hätte ich zu Fuß nie so schnell geschafft, ohne dass meine Familie angefangen hätte nach mir zu suchen. Deswegen war der Zeitpunkt meiner Flucht auch so wichtig gewesen. Ich wusste, bis morgen Nachmittag würde niemand nach mir suchen, und wenn sie mein Verschwinden schließlich bemerkten, wäre ich schon längst in Gaia angekommen.
Schweigend stapften Izabel und ich Seite an Seite durch die Nacht. Selbst ohne die Taschenlampen konnten wir in der Dunkelheit noch erkennen, wohin wir gingen. Dank meiner vielen Ausritte mit Juniper, die mich genau an dieser Straße entlanggeführt hatten, war ich in der Lage einzuschätzen, wie viel Weg noch vor uns lag.
Während der Wanderung hielt ich meinen Kopf gesenkt und richtete meine ganze Konzentration auf die Straße vor mir, damit ich nicht über einen der winzigen Steine stolperte, die auf dem Asphalt lagen. Ich musste mich mit aller Macht davon abhalten nachzudenken, um meinen Plan nicht zu hinterfragen und am Ende doch umzukehren.
Aus dem Augenwinkel schielte ich zu Izabel, die ihren Blick starr Richtung Horizont gerichtet hatte. »Hast du für meinen Bruder spioniert?«, fragte ich rundheraus.
Sie zuckte nicht einmal mit der Wimper. »Ja, das gehörte mitunter zu meinen Aufgaben. Aber ganz ehrlich, es gab nicht sonderlich viel über dich zu berichten. Nicht böse gemeint.«
Zur Antwort nickte ich lediglich. Auch wenn ich immer vermutet hatte, dass mein Bruder einen strengen Blick auf mich werfen ließ, versetzte diese Bestätigung mir doch einen besonders schmerzhaften Stich. Aber das war nicht alles, sie befeuerte auch meine Wut und trieb mich so schneller voran.
Bis wir zu den alten Bahngleisen kamen, sprach keine mehr von uns ein Wort. Mir war das nur recht, es gab sowieso nichts mehr zu sagen. Erst als die Gleise in Sicht waren, verlangsamte ich meine Schritte wieder.
Obwohl sie bereits seit Ewigkeiten nicht mehr in Benutzung waren, lagen die Gleise noch im astreinen Zustand da. Erst vor einigen Jahren hatte mein Vater sie wieder instand setzen lassen, fast so als rechnete er damit, dass man sie irgendwann wieder brauchte. Jetzt war ihre einzige Aufgabe, mir als Orientierungspunkt zu dienen.
Meine Hände zitterten, als ich den ersten Fuß auf die Schienen setzte. Irgendetwas sagte mir, dass dies der Moment war, ab dem es kein Zurück mehr gab. Was auch immer am anderen Ende dieser Gleisstrecke auf mich wartete, nun musste ich mich ihm entgegenstellen.
Kilometer um Kilometer arbeiteten wir uns vorwärts, nur die Geräusche der Nacht zwischen uns.
»Ich möchte deinen Plan ja wirklich nicht kritisieren«, sagte Izabel plötzlich und erschreckte mich dabei fast zu Tode. Das konzentrierte Laufen hatte mich in eine Art Trance versetzt, wodurch ich alles um mich herum ausgeblendet hatte.
Izabel bemerkte davon allerdings nichts, als sie unberührt fortfuhr: »Aber das Portal nach Gaia ist verschlossen. Man kommt nicht hindurch.«
Portal war ein hübsches Wort für diesen Riss, der unsere beiden Welten – die zwar zur selben Zeit, aber nicht im selben Raum existierten – verband. Er zog sich einmal komplett wie ein Band um die Erde und ermöglichte uns, zwischen Gaia und unserer Welt zu wechseln.
Izabel hatte allerdings recht. Schon seit fast 200 Jahren war dieser Riss durch Magie und Gestein verschlossen. Die Welten waren dadurch voneinander getrennt. Es gab keine Möglichkeit, hindurchzukommen. Zumindest wurde das behauptet.
»Es gibt einen Weg hindurch«, antwortete ich meiner Begleiterin kryptisch. Ich war noch nicht bereit, alle meine Karten offenzulegen. Auch wenn ich nicht glaubte, dass Izabel mich verraten würde, gab es in mir doch einen winzigen Teil, der zur Vorsicht rief.
Sie schnaubte neben mir, aber drängte mich nicht weiter mit Fragen. Stattdessen setzten wir unseren Weg nun wieder in störrischem Schweigen fort.
Die Nacht wurde langsam heller, der nächste Tag kündigte sich an. Und mit der Morgendämmerung kam meine Unruhe. Denn mit jeder Minute, die verstrich, mit jedem Menschen, der erwachte, nahm das Risiko, dass mein Verschwinden bemerkt wurde, zu. Ich musste mich zurückhalten, um nicht loszulaufen und noch mehr Abstand zwischen mich und das Herrenhaus zu bringen. Es würde nichts bringen, außer an meinen sowieso schon schwindenden Kräften zu zerren.
Die ganze Nacht waren wir gelaufen, und die kurzen Verschnaufpausen zum Trinken hatten nicht viel geholfen. Meine Füße schmerzten nicht einmal mehr, stattdessen spürte ich sie kaum noch. Aber eine längere Pause einzulegen, stand außer Frage.
Das Schweigen zwischen Izabel und mir hatte angehalten, auch wenn es mir so vorkam, dass sie ab und an zu einer Frage ansetzte, aber dann doch stumm blieb. An ihrer Stelle wäre ich mehr als nur neugierig gewesen, den Plan zu erfahren. Auch ich war neugierig über ihre wahren Beweggründe. Doch keine von uns traute sich zu fragen.
Die monotone Stimmung der Wanderung änderte sich erst, als wir an einem Schild vorbeikamen. Inzwischen war die Sonne bereits vollständig aufgegangen, doch spendete sie wegen der Wolken wenig Licht und Wärme. Zuerst hatte ich das alte Holzschild gar nicht bemerkt, das halb versteckt zwischen einigen kahlen Büschen stand.
»Auris-Portal«, las Izabel mit kratziger Stimme vor. »Wir haben es also fast geschafft.«
»Nicht so ganz«, erwiderte ich, ehe ich weiterging. Unser Weg führte uns nicht zu dem großen weltbekannten Portal, sondern ein Stück westlicher.
Aber weit kamen wir nicht, denn eine drei Meter hohe Mauer aus altem Stein versperrte uns den Weg. Eine Wand ohne Tor oder Tür, welche die Grausamkeiten des Krieges vor den Menschen verbergen sollte. Bei ihrem Anblick stellten sich die kleinen Härchen auf meinem Körper auf. Oder lag es an den Spuren uralter und wütender Magie, die immer noch in der Luft lagen?
»Scheiße«, entfuhr es Izabel neben mir. Sie streckte die Hand aus, als wollte sie die Mauer berühren, doch ließ sie unverrichteter Dinge wieder sinken. »Warst du schon einmal hier?«
Stumm schüttelte ich den Kopf. Auch wenn meine perfide Neugierde mich immer wieder in den Todesgarten getrieben hatte, bis hierher, an den Rand des alten Schlachtfeldes, hatte ich mich doch nie getraut. Hier lauerten nur Tod und Verderben.
»Du willst doch wohl nicht, dass wir da hinüberklettern, oder?«
Zum ersten Mal sah ich so etwas wie echte Angst in Izabels Augen. Vermischt mit Zweifel mir gegenüber. Ich konnte ihre Gefühle nur zu gut verstehen. Jeder Mensch auf dieser Welt wusste und fürchtete, was hier geschehen war.
Ein Krieg, so unmenschlich und grausam, dass es nicht einmal mehr Worte dafür gab. Die Faune hatten uns angegriffen. Mit ihren geballten Streitkräften und alles vernichtender Magie wollten sie unsere Welt einnehmen, und wir Menschen hatten uns verteidigt. Diese Schlacht hatte hunderttausende Leben auf beiden Seiten gekostet. Doch auch nach Jahren war kein Gewinner in Sicht gewesen. Am Ende hatten die Faune sich zurückgezogen und die Portale geschlossen. Seitdem war dieser Ort tot. Es gab nichts weiter als blanke Erde, bedeckt mit Asche und den Knochen der Gefallenen.
»Komm. Lass uns weitergehen.« Ich hielt es an diesem Ort nicht länger aus. Mit brüsken Schritten eilte ich an der Mauer entlang, immer weiter Richtung Westen.
»Verrätst du mir wenigstens jetzt, wie dein Plan aussieht?« Izabel musste ein Stück joggen, um mich wieder einzuholen.
»Der Riss verläuft nicht gleichmäßig durch unsere Welten. Er verläuft überirdisch und unter der Erde, im Wasser genauso wie auf dem Land. Manchmal ist er so breit, dass ganze LKWs durchpassen, das sind die ›Portale‹«, ich malte Anführungszeichen in die Luft. »Sind nichts weiter als besonders breite Teile des Risses, die für Menschen und Faune bequem zu erreichen sind. Oder es früher einmal waren.«
»Hm.« Izabel grübelte über meine Worte nach. »Wieso weiß ich das nicht? Ich dachte immer, die Portale wurden durch Magie geschaffen.«
Ich zuckte nur mit den Schultern. »Vielleicht ist das Wissen einfach über die Jahre verloren gegangen. Immerhin sind die Portale inzwischen nichts weiter als Denkmäler an die Grausamkeiten der Vergangenheit. Aber in den Chroniken meiner Familie steht so manches Interessantes.«
Izabel schnaubte. »Klar, dass deine Familie so was wie eine Chronik hat, Prinzessin.«
Ich überging ihren Kommentar. »Auch wenn die großen Portale verschlossen sind, der Riss selbst ist es nicht. Es gibt immer noch Millionen von Öffnungen, manche davon sogar groß genug für einen Menschen.«
»Und woher weißt du davon?«, fragte meine Begleiterin, doch gab sich sofort selbst die Antwort. »Vermutlich aus dem Internet.«
»Wirklich eine Quelle des unendlichen Wissens.« Es war damals ein Moment der Schwäche und Neugierde gewesen, die mich in diesen Kaninchenbau geführt hatte und am Ende auch ins Darknet, wo dieses geheime und durchaus gefährliche Wissen geteilt wurde.
»Es gibt Berichte von dem einen oder anderen über den Fund eines derartigen Portals. Es hat mich verdammt viel Zeit und Nerven gekostet, aber am Ende habe ich Koordinaten zu einem Ort nicht weit vom Auris-Portal bekommen.« Es hatte mir einen richtigen Schock verpasst, dass es einen offenen Weg nach Gaia gab, nur einen Steinwurf von meinem Zuhause entfernt.
»Also spazieren wir hier durchs Nichts, weil irgendein Typ im Internet behauptet, es gebe dieses Portal?«
Izabels Skepsis spiegelte meine nur zu gut wider, aber davon ließ ich mich nicht beirren. »Ganz genau.« Ich beschleunigte meine Schritte und konzentrierte mich nun ganz auf unsere Umgebung. Mein Kontakt hatte mir zwar die genauen Koordinaten geschickt, aber ohne Handy war es doch ziemlich schwer, sich zu orientieren.
Ich sollte Ausschau halten nach zwei großen, aneinandergelehnten Felsen. Direkt daneben sollte es einen umgekippten, uralten Baum geben, dessen Wurzeln frei in der Luft hingen. Zwischen ebendiesen Wurzeln sollte der Riss breit genug sein, damit ein Mensch hindurchgehen konnte.
Ich fragte mich, ob sich der Riss schon immer an dieser Stelle befand, oder ob er mit den Wurzeln zusammen aus der Erde gezogen worden war. Bei der Vorstellung, dass an dieser Stelle schon Jahrtausende lang Würmer und Käfer unbeobachtet und fröhlich zwischen den Welten hin- und herkrabbelten, musste ich schmunzeln.
Aber das Lächeln verging mir recht schnell wieder, als ich zuerst die Felsen und dann den besagten alten Baum entdeckte. Da war es also, das Portal nach Gaia. Es sah genauso aus wie auf dem Foto, das ich im Darknet gesehen hatte. Ich blieb wie angewurzelt stehen, sodass Izabel in mich hineinrannte.
»Hoppla! Wir sind also da«, stellte sie mit ausdrucksloser Stimme fest.
Ich nickte, bevor ich meine Füße zwang, sich wieder in Bewegung zu setzen. Bis hierher war ich gekommen, jetzt musste ich nur noch diese letzten paar Schritte machen.
»Warte.« Izabel hielt mich am Arm zurück. Mit großen, braunen Augen blickte sie mich an. »Bist du dir absolut sicher, dass du das machen willst? Wir können immer noch umdrehen!«
Da war er. Mein Ausweg. Ich war mir sicher, würde ich jetzt zusammen mit Izabel wieder nach Hause gehen, verlören wir niemals wieder ein Wort über diesen kleinen Ausflug. Mein Leben würde weitergehen, meine Zeit ablaufen und schon viel zu bald wäre ich gefangen in einer Ewigkeit aus Stein.
Ich erwiderte ihren Blick, so fest ich konnte. »Ich muss das machen.« Auch wenn die Angst mir die Knie weich werden ließ und die Schuldgefühle wie Steine auf meiner Brust lagen, die Wut brannte in meinem Inneren. »Aber du musst nicht mitkommen.«
Izabel schluckte schwer. »Nein, ich habe meine Entscheidung getroffen. Wenn du da durchgehst, dann komme ich mit dir.«
Ich wollte ihr danken, wusste aber, dass es keine Rolle spielte. Wieso auch immer sie mich begleitete, es hatte nichts mit mir zu tun. Also drehte ich mich auf dem Absatz um und steuerte – ehe mich doch noch der Mut verließ – schnurstracks den umgestürzten Baum an.
Auch von Nahem bemerkte ich nichts Außergewöhnliches an den mit Dreck und Erde behafteten Wurzeln. Sie sahen aus wie ganz normale Baumwurzeln. Etwas zögerlich streckte ich die Hand aus, um zwischen ihnen hindurchzufahren.
»Kannst du deiner Quelle eigentlich eine schlechte Rezension hinterlassen, sollte das hier zu nichts führen?«, scherzte Izabel, aber ich hörte die Anspannung in ihrer Stimme.
Gerade als ich den Mund öffnete, um etwas zu erwidern, kribbelten meine Finger, bevor sie vor meinen Augen einfach verschwanden. Sie waren immer noch da, ich konnte sie noch spüren und bewegen, aber nicht mehr sehen. Blitzschnell, so als hätte ich mich verbrannt, zog ich die Hand zurück.
Da war es also, das Portal nach Gaia. Jetzt, wo ich wusste, dass es wirklich existierte, nahm ich auch ein Knistern in der Luft wahr. Es war fast so, als hielte der Riss sich im Verborgenen, und je näher wir kamen und je mehr wir uns auf ihn fokussierten, umso deutlicher zeigte er sich uns.
Izabel schloss ihre Finger so fest um meinen Unterarm, dass es schon schmerzte. »Eine Frage noch. Woher weißt du, dass uns das nicht umbringt?«
»Wir sind nicht die ersten, die hindurchgehen. Andere haben davon berichtet.« Doch im Gegensatz zu den anderen wollte ich für eine Zeit dortbleiben, und nicht auf der Stelle wieder in unsere Welt zurückkehren.
»Scheiße, ey!« Izabel rieb sich übers Gesicht, bevor sie weitersprach. »Soll ich zuerst gehen?«
Ich schüttelte den Kopf. Das hier war mein Plan, also würde ich vorangehen. Ich nahm all meinen Mut zusammen, machte einen beherzten Schritt nach vorne und fiel in die Dunkelheit.
3
Um mich herum erstreckte sich das Nichts. Es gab kein Oben, kein Unten, keinen Himmel und keine Erde, obwohl ich immer noch den Boden unter meinen Füßen und die Luft auf meiner Haut spürte. Ich fiel und fiel in die Finsternis und bewegte mich doch nicht von der Stelle. Die Zeit schien sich bis ins Unendliche zu ziehen, ohne Anfang, ohne Ende. Nur das Nichts.
Nichts.
Nichts.
Dann war es vorbei. Das Ganze hatte nicht einmal einen vollständigen Atemzug gedauert.
Ich hatte einen Schritt gemacht und fand mich in einer fremden Welt wieder. Vor Schreck stolperte ich noch etwas weiter nach vorne, bis meine Beine unter mir nachgaben und ich auf dem weichen Gras zusammensackte.
Hinter mir hörte ich Izabel erschrocken keuchen, bevor sie neben mir zu Boden sank. Wir beide atmeten schwer, als wären wir gerade einen Marathon gelaufen, mein Herz raste und jeder Muskel in meinem Körper zitterte.
»Heilige Scheiße«, stöhnte meine Begleiterin leise. »So was haben die Menschen früher regelmäßig gemacht!?«
Ich versuchte, meine Atmung unter Kontrolle zu bekommen, ehe ich ihr antwortete. »Soweit ich das den Archiven entnehmen konnte, war der Übergang früher vollkommen reibungslos. Ich denke, dieses seltsame Gefühl hat etwas mit der Portal-Sperre zu tun. Wir haben sie wohl durchbrochen.«
Izabel schüttelte sich. »Ich hatte das Gefühl, in tausend Stücke gerissen zu werden. Stell dir mal vor, du bleibst in dem Riss stecken!«
Daran wollte ich gar nicht erst denken. Ich blickte mich stattdessen lieber um. Das war also Gaia!
Ich hatte mir diese Welt über die Jahre so oft ausgemalt – meine Fantasie beflügelt von den Pflanzen im Todesgarten und den wenigen Zeichnungen und Beschreibungen in alten Büchern. Aber keiner meiner noch so wilden und bunten Träume glich diesem Ort auch nur annähernd.
Wir befanden uns auf einer Wiese, die sich bis zum Horizont erstreckte. Wildblumen in allen Farben und Formen wuchsen um uns herum, ihr süßer Duft schwängerte die Luft. Der Himmel über uns erstrahlte in einem warmen Frühlingsblau, und die Sonne wurde nur ab und an von einer kleinen, flauschigen Wolke verdeckt. Ein sanfter Wind bewegte das Blütenmeer hin und her.
Immer noch auf den Knien drehte ich mich herum, um das Portal auf dieser Seite zu untersuchen. Doch hier gab es keinerlei Anhaltspunkte für einen Riss.
Meine Kehle war trocken und das Schlucken fiel mir schwer. Ich spürte, wenn ich zurückkehren wollte, dann musste es jetzt sein. Sobald wir aufbrächen und uns von hier entfernten, wäre der Rückweg verloren. Doch wie hätten wir zurückkehren können? Ein Riss war nicht zu sehen.
»Warum ist es hier Frühling?« Izabels Frage zerriss meine aufkommende Panik.
»Unsere Welten sind jahreszeitlich nicht ganz synchron. Während es bei uns Winter ist, ist es auf der anderen Seite des Risses Frühling.« Gaia war keine Kopie von unserer Erde. Neben den verschiedenen Spezies an Lebewesen und Pflanzen gab es auch noch einige andere Unterschiede. So verliefen nicht nur die Jahreszeiten anders, sondern auch die Tage waren unterschiedlich lang.
Ich ließ meinen Rucksack auf den Boden sinken und stöhnte erleichtert auf, als von meinen Schultern endlich die Last abfiel. Aus den Tiefen meines Gepäcks holte ich eine kleine Taschenuhr hervor, die mich genauso faszinierte wie verstörte.
Das Silber fühlte sich kalt in meiner Hand an. Langsam öffnete ich sie und blickte auf die Anzeige. Darin wurde nicht wie gewöhnlich die Uhrzeit angezeigt, sondern dank einer alten Magie ein laufender Countdown bis zum Ende meiner Tage. Auch nach fast 100 Jahren funktionierte sie noch fabelhaft.
Ich hatte das alte Ding zusammen mit einem Tagebuch einer meiner Vorfahrinnen in einer Kiste gefunden. Sie hatte dasselbe Schicksal wie mich ereilt, und es hatte nicht lange gedauert, ihre Statue im Garten zu finden. Louise war ihr Name gewesen, und sie hatte die Taschenuhr selbst in Auftrag gegeben. Sie wollte stets wissen, wie viel Lebenszeit ihr noch blieb, um nicht einen Tag davon zu verschwenden.
Ich bewunderte sie für ihre Einstellung, aber für mich fühlte sich diese dauerhafte Erinnerung an die ablaufende Zeit morbid an. Ich wollte handeln, statt abzuwarten. Erst als ich meinen Plan geschmiedet hatte, war mir die Uhr wieder eingefallen. Ich wusste bereits, dass die Zeit in Gaia und auf der Erde nicht ganz synchron verlief, also hatte ich beschlossen, das alte Ding mitzunehmen.
Es hatte mich einiges an Fingerspitzengefühl und Nerven gekostet, sie richtig einzustellen. Jetzt zeigte sie noch 364 Tage an. Es war gerade einmal ein halber Tag seit meinem Geburtstag vergangen und doch fühlte es sich an wie ein vollkommen anderes Leben.
»Wo entlang soll es jetzt gehen?« Bei Izabels Frage klappte ich die Uhr wieder zu und ließ sie in den Tiefen meiner Tasche verschwinden.
Sie hatte sich vom Boden erhoben, um ihren Blick über den Horizont gleiten zu lassen. Die Wiese schien sich bis ins Unendliche zu erstrecken, nur Gras, Blumen und flache Sträucher.
Ich rappelte mich ebenfalls auf und versuchte, meine Gedanken zu sammeln. Aufregung, Panik und Hoffnung wirbelten durch meinen Körper und ließen mich für einen Moment schwanken. Es war ein surreales Gefühl, überhaupt bis hierhergekommen zu sein, aber nun durfte ich mich nicht von meinen Emotionen ablenken lassen.
»Die alten Aufzeichnungen sprachen von einem riesigen Wald. Dort finden wir den Faun, der mich verflucht hat.« Die sanfte Brise trug meine Worte davon, in die Weiten von Gaia.
»Ein Wald also?«, grübelte Izabel leise vor sich hin, wobei sie sich langsam um sich selbst drehte. »Einen besseren Anhaltspunkt hast du nicht?«
»Sorry, ich habe meine Karte von Gaia zu Hause liegen lassen«, schoss ich zurück. Ich tat es ihr nach und suchte die Umgebung nach irgendetwas ab, was uns weiterhelfen konnte.
»Da!« Izabel deutete auf einen Punkt am Horizont. »Ein Hügel. Sicher haben wir von dort aus eine bessere Sicht.«
Ich nickte, und so begann unsere Wanderung über die Blumenwiese. Die wärmenden Strahlen der Frühlingssonne verwandelten sich schon bald in eine Hitze, die mir den Schweiß den Körper herunterlaufen ließ. Den Pulli stopfte ich in meinen Rucksack und gleich darauf auch das Shirt. Nur noch mit dünnem Top bekleidet stapfte ich Izabel hinterher, der die Hitze kaum etwas auszumachen schien.
Ich war beim besten Willen nicht so gut in Form wie gedacht. Der Hügel lag doch deutlich weiter entfernt, als ich erwartet hatte, und mein ohnehin schon erschöpfter Körper protestierte mit jedem Schritt mehr.
Die Umgebung veränderte sich während unserer Wanderung kaum. Zu sehen waren nur die schier endlosen Weiten aus Wildblumen, die so unnatürlich idyllisch und schön dalagen, dass es mich langsam störte. Dieser Ort strahlte zu viel Frieden aus. Irgendwie machte mich das aggressiv. Es wirkte weniger wie ein bewohnter Ort, sondern mehr wie ein erträumtes Paradies.
Mitten in der Bewegung blieb ich stehen, um mich noch einmal genauer umzusehen. Ein grässliches Gefühl nistete sich in meinem Magen ein. Die Flora stand hier zwar in voller Blüte, aber es gab weder Vögel am klaren Himmel noch irgendwelches Kleingetier auf der Wiese. Nicht einmal Insekten, die um die Blüten herum schwirrten.
»Hast du schon irgendein Tier gesehen?«, rief ich Izabel hinterher, die mein Stehenbleiben gar nicht bemerkt hatte und schon ein gutes Stück voraus war. Sie schien einen ähnlichen Gedanken zu haben, denn sie suchte mit den Augen erst den Himmel und dann den Boden ab. Ich beeilte mich, aufzuholen.
»Das ist kein gutes Zeichen, oder?«, fragte sie, als ich bei ihr angekommen war.
Ich zuckte mit den Schultern. »Vielleicht verstecken sie sich auch einfach nur vor uns. Aber seltsam ist es schon.« Nachdenklich kaute ich auf meiner Unterlippe herum, während ich die Wiese um uns weiterhin nach einem Lebewesen absuchte.
»Wie viel von Gaia wurde bei dem Krieg eigentlich zerstört?« Izabel flüsterte so leise, dass ich sie kaum verstand.
»Das weiß ich nicht. Aber die Welt sieht hier noch intakt aus. Ich bin sicher, wir werden bald einem Lebewesen über den Weg laufen.« Einen anderen Gedanken wollte ich an dieser Stelle nicht zulassen. Die Vorstellung, dass diese Welt vollkommen unbewohnt und meine Reise vergebens war, ließ mich schwer schlucken.
Dieser ganze Plan beruhte auf fragwürdigen Informationen aus uralten Büchern und Schriften, angetrieben von meinem starken Verlangen zu leben. Aber im Endeffekt hatte mich meine Wut einfach nur blindlings loslaufen lassen. Und nun waren wir in einer fremden Welt – ohne einen Weg zurück – und uns nicht einmal sicher, ob es hier noch Faune gab.
Obwohl mein Körper protestierte, stakste ich weiter in Richtung des Hügels. Ich durfte jetzt keinen Zweifel zulassen.
Die Sonne war bereits über den Zenit gewandert, als wir endlich am Fuße des Hügels ankamen. Es kostete mich meine letzte Kraft, die kleine Erhöhung zu erklimmen, und als ich endlich oben angekommen war, brannte meine Lunge und das Seitenstechen machte mir das Atmen schwer.
»Wow«, hauchte Izabel neben mir, die sich deutlich schneller von der Kletterpartie erholt hatte. Ihren Blick hatte sie in die Ferne gerichtet, wobei sie ihre Augen mit der Hand vor der Sonne schützte.
Als ich endlich wieder halbwegs vernünftig atmen konnte, folgte ich ihrem Blick. Vor uns erstreckte sich ein großer Wald. Die Bäume wirkten selbst aus unserer Entfernung riesig.
»Den Wald haben wir schon mal gefunden.« Izabel löste ihre dunkelroten Haare aus dem Zopf, bevor sie ihn erneut band. »Wir könnten hier eine Pause machen, vielleicht sogar übernachten, und morgen weitergehen.«
Mein Körper jubelte laut »JA!«, aber ich ignorierte ihn und antwortete stattdessen: »Lass uns weitergehen. Ich denke, zwischen den Bäumen sind wir sicherer, als hier auf dem Hügel.«
Sie nickte ernst und suchte immer noch skeptisch die Umgebung mit den Augen ab. Ein Meer aus Wildblumen. Das war alles, was wir sahen. Und so schön der Anblick auch war, verursachte er mir doch eine Gänsehaut.
Ziemlich unelegant stolperte ich den Hügel wieder herunter. Auch wenn mein Körper immer noch protestierte, fiel mir die Wanderung nun etwas leichter. Vielleicht weil ich endlich ein klar erkennbares Ziel vor Augen hatte.
Viel schneller als erwartet kamen wir am Rand des Waldes an. Ich bemerkte erst, mit welcher Kraft die Sonne auf uns herunterstrahlte, als ich in den erfrischend kühlen Schatten der Bäume trat. Diese waren so hochgewachsen, dass ich den Kopf in den Nacken legen musste, um die Baumkronen zu sehen.
Das Sonnenlicht brach sich zwischen den Blättern, die im Wind tanzten, und ließ sie in den verschiedensten Grüntönen leuchten. Dichtes, weiches Moos bedeckte einen Großteil des Waldbodens, nur an wenigen Stellen wuchs ein Busch oder sogar ein kleiner Baum.
Zwischen den massiven Stämmen war so viel Platz, dass wir bequem hindurchspazieren konnten – allerdings immer den Blick gen Boden gerichtet, um nicht über eine der Wurzeln zu stolpern, die sich wie ein Netzwerk kreuz und quer zwischen die Bäume schlängelten.
»Wie soll es nun weitergehen?« Izabel machte sich daran, eben eine solche Wurzel zu erklimmen, die sich bis etwa zwei Meter über dem Boden erhob. »Ich sehe nichts weiter als Bäume.«
Ich sackte auf dem Boden zusammen und ließ seufzend den Rucksack von meinen Schultern gleiten. Auf einmal war ich so müde, dass meine Augen mir beinahe zufielen. Mit den Fingern fuhr ich über die trockene Rinde der Wurzel, bis meine Hände auf dem weichen Moos liegen blieben. Obwohl wir uns im kühlen Schatten der Bäume befanden, war beides warm.
Ich wollte schlafen, einfach nur schlafen. Am liebsten direkt für mehrere Tage. Doch meine Begleiterin ließ mir leider keine Ruhe.
Mit einem dumpfen Aufprall sprang Izabel von der Wurzel, um sich vor mir aufzubauen. »Wir müssen weiter.«
Ich rieb mir meine trockenen Augen. »Ich weiß. Aber ich glaube nicht, dass meine Beine mich noch tragen können.«
Trotz meines Protestes zog sie mich ruckartig hoch. »Wir müssen einen sicheren Platz für die Nacht finden, dann können wir uns ausruhen. Wer kann schon sagen, welche Monster hier auf uns lauern.«
»Wer soll uns denn angreifen? Die Bäume? Außer uns sehe ich hier keine Lebewesen«, gab ich zu bedenken.
Wie um meine Worte Lüge zu strafen, flog in diesem Moment etwas über unsere Köpfe hinweg, und ein riesiger Schatten bezog nicht weit entfernt von uns auf einem Ast Stellung. Dieses Wesen erinnerte mich an einen Vogel, es war mit Federn bedeckt, hatte jedoch vier Flügel und beunruhigend lange Krallen, die sich in die Rinde gruben.
»Einen sicheren Schlafplatz finden klingt gut.« Plötzlich entdeckte ich noch ungeahnte Kräfte in mir.
Ich konnte die Augen des Vogels wie Laser in meinem Rücken spüren, als wir tiefer in den Wald wanderten. Irgendwann war der Waldrand nur noch ein kleiner Streifen goldenes Licht. Obwohl es unter den Bäumen dunkler und kühler war, fühlte sich der Wald lebendiger an als die Wiese.
Je weiter wir gingen, desto mehr Lebenszeichen bemerkte ich. Unsichtbare Vögel, die hoch oben in den Wipfeln zwitscherten, Kleintier, das durchs Unterholz flitzte, und das eine oder andere Mal meinte ich sogar, ein größeres Tier in der Ferne auszumachen. Doch zum Glück näherte sich uns keines dieser Wesen. Im Gegensatz zur Geisterwiese wirkte dieser Wald belebter.
Kopfschüttelnd konzentrierte ich mich wieder auf den Weg vor mir. Vielleicht lag es an der Erschöpfung, die sich inzwischen in meinen Knochen eingebettet zu haben schien, aber zu meiner eigenen Überraschung fühlte ich rein gar nichts. Diese Welt, so wunderschön, fremd und einzigartig sie auch war, löste nichts in mir aus. Die Aussicht, bald dem Erschaffer meines Fluches gegenüberzustehen, ebenfalls nicht. Mein Innerstes war genauso taub wie meine Beine.
Also zählte ich meine Schritte, damit mein Verstand wenigstens etwas zu tun hatte. 10, 20, 30, 150, 300, 500. Immer einen Fuß vor den anderen, immer einen Baum nach dem anderen hinter uns lassend, dabei meinen Blick streng gen Boden gerichtet. Erst als ich in der Ferne ein leises Plätschern hörte, hob ich den Kopf wieder.
Nachdem wir einen weiteren massiven Baum umrundet hatten, standen wir vor einem kleinen Fluss, der sich idyllisch zwischen den Wurzeln hindurchschlängelte. Zum ersten Mal seit Stunden fiel Sonnenlicht auf meine Haut, doch es war bei Weitem nicht mehr so wärmend. Es musste bereits auf den Abend zugehen. Dennoch genoss ich es.
Hellrosa Blumen überwucherten das Flussufer, aber die Erde selbst wirkte trocken. Ein kleines Stück den Bach entlang wuchs eine Wurzel so weit über den Boden, dass sie eine kleine Höhle bildete. Einen besseren Platz würden wir für die Nacht sicher nicht finden.