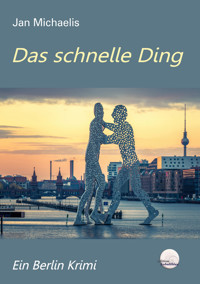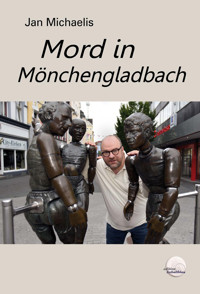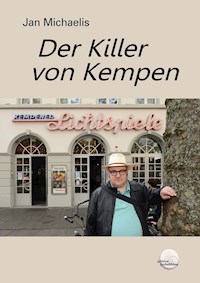Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wie ermitteln, wenn man mit gebrochenem Bein im Rollstuhl sitzt? Was tun, wenn man dann auch noch in Geldnöten steckt? Als der künstlerische Fotograf Herbert Weber aus dem Fenster gestoßen wird, bricht er sich das Bein. Seine Frau Anne übernimmt das Ruder und besorgt ihm einen Ermittlungsauftrag. Wochenlang sitzt Herbert Weber am Fenster zu den Jagenberg-Werken in Düsseldorf-Bilk, beobachtet und fotografiert den Eingang. Er arbeite für seinen Vater, einen Anwalt. Dieser setzt seine Schwiegertochter zunehmend unter Druck. Anne muss mehr Informationen liefern. Deshalb ermittelt sie undercover als Sekretärin im Werk. Bis sie buchstäblich in Flammen steht. Der historisch belegte Brand von April 1960 steht im Mittelpunkt dieser Novelle, die eine starke Frau zeigt. Jan Michaelis erzählt vom Milieu von Kartellen und Monopolen. Er zeigt Düsseldorf als Industriestandort im Wirtschaftswunder. Gründlich recherchiert und mit Ironie führt Jan Michaelis in die 60er Jahre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 91
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jan Michaelis
Fenster zumWerk
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2025
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Angaben nach GPSR:
www.engelsdorfer-verlag.de
Engelsdorfer Verlag Inh. Tino Hemmann
Schongauerstraße 25
04329 Leipzig
E-Mail: [email protected]
Copyright (2025) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Lektorat: Marianne Evrard
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Fenster zum Werk
Herbert Weber und seine Frau Anne kannten es als die Adresse in Düsseldorf für Konzerte, Karnevalsbälle und Kongresse. Und auch Siegfried Weber kannte das Apollo-Theater, obwohl der Rechtsanwalt dort nicht ein- und ausging, er bevorzugte seinen Platz am Radio.
Das Apollo hat eine wechselhafte Geschichte.
Ab 1937 wurde das Haus an der Adersstraße, Ecke Königsallee als Kino, aber auch für Konzerte, Operetten und Revuen genutzt.
Dann zerstörte eine Brandbombe im Kriegsjahr 1942 das Theater. So war das Haus unbewohnbar geworden. Schließlich hatte der Architekt Ernst Huhn es wieder aufgebaut.
Im Jahr 1950 wurde es mit einer Operette wiedereröffnet. Dann blühte es im Glanze des Glückes des Wirtschaftswunders fast ein Jahrzehnt.
Mitwirkender an dieser Prachtentfaltung war der Illusionist Kalanag.
Auf dem Dach des fünfstöckigen Hauses prangte in großen Lettern „Apollo“, daneben flatterten Fahnen im Wind, der von der Königsallee her nach Süden wehte.
Die Hausecke war gerundet. In den fünfziger Jahren fanden sich im Straßenpflaster vor dem Theater noch eingelassene Straßenbahnschienen.
Gerade fuhr eine Bahn daran vorbei.
Am 12. März 1959 wurde der Theaterbau sowohl für den Kino- wie für den Varietébetrieb geschlossen. Das Apollo-Theater stand leer und verfiel.
Ende des Jahres fuhr Anne Weber mit der Straßenbahn daran vorbei, sah den Verfall und erinnerte sich an die Blütezeit.
Über dem Eingang, der vier Meter hoch war, begann ein Schriftzug, der der Rundung um die Ecke folgte: „Kalanag mit Gloria“. Dazu war Kalanags Kopf als Portrait abgebildet. Der Kopf zeigte einen lächelnden Mann, der mit einer dickrandigen Brille harmlos wirkte. Wie immer heimste Kalanag alle Lorbeeren ein, obgleich er mit seiner Ehefrau zusammenarbeitete, die auch seine Bühnenpartnerin war, jedoch im besten Fall namentlich erwähnt wurde. Kalanag schmückte sich mit Gloria.
Kalanag hieß eigentlich Helmut Schreiber, hatte beim Film gearbeitet und Geld angespart, welches er jetzt nach dem Ende der Nazi-Zeit in seine Karriere als Zauberer investierte und für seine Aufführungen Tänzer, Helfer und Musiker einstellte. Üppige Bühnenbilder und Zauberkunststücke, die in Geschichten eingebaut waren, bei denen Tanz illustrierend wirkte und visuelle Abwechslung bot, machten aus der Zaubershow eine Revue, die begeisterte.
Der dickleibige Kalanag hatte seinen Körperbau als Markenzeichen genutzt und sich auf das Bühnenfach des „lustigen Onkels“ verlegt, da er nicht einem Apoll, sondern eher einem Bacchus glich. Ausgerechnet im Theater des Apollon.
Aber im Rheinland mag das angehen. Denn Gott Bacchus oder Dionysos zu Ehren feierten die Bacchanten ihre Trinkgelage und parodierten die römischen Triumphzüge. So gesehen waren sie es, die den Karneval an den Rhein brachten.
Kalanag präsentierte Kunststücke, die auch für ein Trinkgelage passend gewesen wären: „Das Wasser aus Indien“ war eine Kanne, deren Inhalt nie versiegte, und an „Kalanags Bar“ wurde jedes gewünschte Getränk angeboten – ob kalt, ob heiß – wie bei einem Tischleindeckdich.
Beide Zauberkunststücke waren vorher von anderen Zauberern aufgeführt worden und Kalanag hatte sie von ihnen geliehen.
Mit der Begründung, ihn hätte das Volkslied „Auf einem Baum ein Kuckuck saß“ inspiriert, prägte er den Zauberspruch: „Sim Sala Bim“.
Ein anderer Zauberer aus Dänemark hatte dieselbe Begründung und nutzte denselben Zauberspruch. Beide stritten darum. Ein Dritter schaute nach und fand: Der Däne war Erster im Gebrauch des Zauberspruchs. Aber ein anderer Dritter gab zu bedenken, die Geschichte sei zwar schön, aber es gäbe eine Zauberzeitschrift, die „Simsalabim“ als Titel führte, und das tat, bevor der Däne diesen Titel benutzte.
Auch der Name „Kalanag“ wurde entliehen: In einer Geschichte von Rudyard Kipling aus dem „Dschungelbuch“ heißt ein Kriegselefant „Kalanag“. Aber ist das die Quelle? „Kala Nag“ jedenfalls ist ein Berg im Himalaja und den gab es bereits lange vor Kipling.
Helmut Schreiber hätte Doppelgänger von Heinz Erhard sein können. Wie Erhard hatte er einen Haarkranz um eine Teilglatze, trug die gleiche Brille, war beleibt und schon etwas älter. Er rauchte Zigarre, wie es in der Wirtschaftswunderzeit üblich war.
Kalanags Zaubershows im Apollo-Theater waren fast immer ausverkauft. Kalanag ging es also sehr gut.
Doch dann trafen ihn ein Herzinfarkt und ein Gehirnschlag. Helmut Schreiber war auch darin der Doppelgänger von Heinz Erhard, dessen Schlaganfälle dieser zwar überlebte, die ihn aber verstummen ließen. Schreiber jedoch verstarb.
In Düsseldorf-Unterbilk gegenüber dem St. Martinus-Krankenhaus saß ein älterer Mann auf einer Parkbank und fütterte Tauben. Herbert Weber trat zu ihm heran und fragte: „Darf ich mich zu Ihnen gesellen?“
Herbert erkannte den Mann nicht, denn er hätte nie erwartet, dass Altbundespräsident Theodor Heuss hier auf der Sitzgelegenheit innehielt und sich auf seinen Stock stützte. Bis zum Ende des Gesprächs wird er es nicht wissen.
Der Angesprochene griff zum Gruß an seinen Hut, nickte dann und deutete auf den Platz neben sich. Herbert setzte sich und sagte: „Was bedrückt Sie?“
„Auch ein Mann in einem seriösen Beruf … erlebt seine Stunden …“
Herbert hörte aufmerksam zu.
„Was ich Ihnen erzähle, wird sehr persönlich sein …“, sagte Theodor Heuss. „… vor Ihnen steht … der Literat, der zahlreiche Essays über Malerei, Grafik, Plastik … geschrieben hat.“
Heuss hielt inne.
„Sie wollen mir das Bein amputieren.“
Der alte Mann deutete auf das linke Bein.
„Es nutzt alles nichts. Ich habe mir hier im St. Martinus-Krankenhaus eine zweite Meinung eingeholt. Es muss sein.“ Und nach einer Pause.
„Lassen Sie uns über Wichtigeres sprechen, über etwas, was zählt, was relevant ist: über Kunst.“
„Da reden Sie mit dem Richtigen darüber“, sagte Herbert Weber. „Ich will davon leben, Kunst zu machen, aber es scheint, dass es eben nur für wenige wichtiger ist als die Gesundheit.“
„Gesundheit? Ich lasse mir das Rauchen nicht verbieten und auch mein Viertele trinke ich. Ohne Rotwein geht es bei mir nicht“, sagte Heuss und wirkte väterlich und so normal wie jedermann. Genau das hatte ihm den Spitznamen „Papa“ eingehandelt.
„Ich habe mir meinen Ruhestand anders vorgestellt. Meine Elly ist schon gegangen. Jetzt sitze ich allein in einem viel zu großen Haus in Stuttgart. Ich habe es für sie bauen lassen auf dem Killesberg, damit sie dort mit mir spazieren gehen konnte, meine Elly. Sie hatte es mit dem Herzen, also dachte ich, ebenerdig und dann in den Weinbergen spazieren gehen, das wäre es doch. Jetzt kann ich bald selbst nicht mehr spazieren gehen. Nein, kommt nicht in Frage, dann sterbe ich eben, das Bein bleibt dran!“
Herbert hatte noch immer nicht begriffen, wen er vor sich hatte, er hatte auch keinen Grund anzunehmen, dass der Bundespräsident a. D. sich so vertraulich mit einem Wildfremden unterhalten würde, mitten in Düsseldorf. Aber Heuss war ein nahbarer Präsident gewesen, auch wenn er seit Jahren gegen dieses „Papa-Gerede“ ankämpfte, das er nicht ausstehen konnte.
Theodor Heuss war zehn Jahre in diesem höchsten Amt im Staat tätig gewesen. Sein Nachfolger wurde am 1. Juli 1959 gewählt: Heinrich Lübke.
Herbert sagte: „Wollen wir ein Bier zusammen trinken?“
Dann nahm er zwei Flaschen aus seinem Mantel und reichte eine Heuss, der sagte: „Auf einem Bein kann man nicht stehen.“
Da verschluckte sich Herbert.
Der ältere Herr wirkte hier fehl am Platz. Er war zu ordentlich gekleidet. Ein alter Mann, aber rüstig. Und jetzt stand er hier mitten in Düsseldorf-Derendorf im Eingangsbereich dieser Gaststätte mit dem seltsamen Namen „Menora“. Der schwere, dicke Vorhang war hinter ihm zugefallen. Er sah sich um. Der Zigarettenrauch hing undurchdringlich im Raum, der mit dunklem Holz ausgekleidet war. Der alte Mann brauchte nur wenige Schritte zur Theke, wo bereits ein Gast saß, den er ansprach. „Meine Güte! Ihr Mantel ist ja zerrissen …“, sagte Siegfried Weber.
„Das ist nicht mein Mantel. Verhalten Sie sich so, als ob wir uns nicht kennen würden und nicht verabredet sind!“, sagte der Gast, ohne sich zu Siegfried umzudrehen, der jetzt neben ihm Platz nahm, als wenn er ihn nicht kennen würde.
„Warum haben Sie mich ausgerechnet hierher bestellt?“, fragte Weber.
„Hier vermutet uns keiner. Hier sind wir sicher vor fremden Blicken“, sagte der Gast und hielt sich dabei an seinem Kaffee fest, neben dem ein leeres Cognacglas glänzte.
„Aber …“, wagte Siegfried, doch der Gast fiel ihm ins Wort.
„Kein Aber! Als Deutschland im Mai 1945 besetzt wurde, fanden die Alliierten knapp sieben Millionen Personen, die sie als Displaced Persons einstuften, Menschen die aus ihrer Heimat vertrieben, verschleppt oder geflohen waren und dorthin zurück sollten, das war der Wunsch der Alliierten. Und diese Displaced Persons treffen sich hier in dieser Gaststätte. Ein guter Ort für uns, weil uns hier keiner vermutet! Wir sind ja keine Displaced Persons. Wir haben mit diesen Menschen nichts zu tun.“
„Aber, warum diese Geheimhaltung?“
„Ich habe meine Gründe.“
Der Gast machte ein Handzeichen und der Kellner stellte ihm einen neuen Cognac hin.
Auch Siegfried Weber bestellte, allerdings nur einen Kaffee, den der Kellner frisch aufbrühte. Der Kellner nutzte dazu eine Kanne und einen Porzellanfilter von Melitta, in den er eine Filtertüte aus Papier steckte. Die Bohnen schüttete der Kellner in eine Mühle aus Holz, mit deren Drehhebel er sie zu Pulver zermahlte. Aus einer Schublade entnahm er das fertige Kaffeepulver und streute es in den Filter. Dann goss er kochendes Wasser hinzu, erst nur wenig, dann die restliche Menge. Das wunderbare Aroma des frisch gebrühten Kaffees vermischte sich mit dem Zigarettenrauch. Siegfried bedankte sich. Dann wagte er einen neuen Vorstoß.
„Also, was soll die ganze Geheimnistuerei?“
„Sie sollen für mich die Jagenberg-Werke überwachen. Ich bin Ihr Auftraggeber, ich bestimme die Regeln. Das muss Ihnen genügen!“
Der Gast schwenkte das Cognacglas, roch daran, kippte den Cognac in seinen Kaffee und sagte kein weiteres Wort. Dann erhob er sich von seinem Platz und ging einige Schritte zur Wand rechts von ihm, wo ein Spielautomat hing. Es war ein Super-Joker mit je einem Geldeinwurfschlitz für D-Mark-Münzen und Pfennige links und rechts. Der Gast warf einige Groschen ein und der Automat flackerte und drehte mehrere Walzen in der Mitte, bis diese stehen blieben und in einem Sichtfeld anzeigten, ob er gewonnen oder verloren hatte. Das wiederholte sich, bis das Gerät mit gurgelnden Pieptönen signalisierte, dass es nach weiteren Groschen verlangte.
Siegfried trank seinen Kaffee. Er fühlte sich hier nicht wohl. Er war in diesem Milieu nicht zu Hause. Er hatte als Rechtsanwalt zwar schon für Displaced Persons gearbeitet, aber er wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, die Gaststätte „Menora“ aufzusuchen, wo sich vor allem jüdische Menschen seit Ende des Krieges trafen. Jetzt, Ende 1959, war das Restaurant noch immer ein Treffpunkt, aber nach 15 Jahren hatte sich das Publikum verändert, sodass hier nun vor allem Spieler und Kleinkriminelle zusammenkamen.
Warum also sollte er ausgerechnet hierher kommen? Was verheimlichte ihm sein Auftraggeber? Und warum verschwieg er ihm überhaupt etwas?