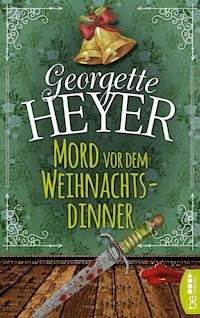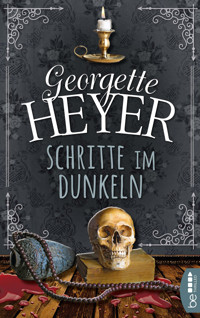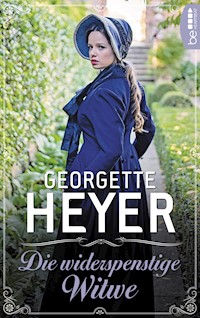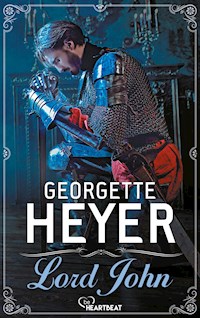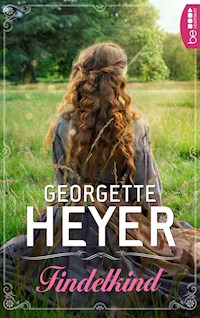
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Liebe, Gerüchte und Skandale - Die unvergesslichen Regency Liebesromane von Georgette
- Sprache: Deutsch
Der Herzog von Sale ist seit seiner Geburt Vollwaise und wird von seiner aufmerksamen Verwandtschaft sehr behütet aufgezogen. Aber inzwischen hat der gutmütige junge Lord es satt, von allen bevormundet und verhätschelt zu werden - er sehnt sich nach einem Abenteuer! Als sein Cousin ihn um Hilfe im Zusammenhang mit einer Erpressung bittet, sieht der Herzog eine Chance, endlich aus seinem goldenen Käfig auszubrechen. Er verkleidet sich als einfacher Reisender und macht sich auf den Weg, um das schöne Findelkind Belinda aus den Klauen eines abgefeimten Gauners zu entreißen. Aber am Ende der gefährlichen Reise wartet auf den Herzog das größte aller Abenteuer - die Liebe.
"Findelkind" (im Original: "The Foundling") ist eine wundervoll leichtfüßige Regency-Geschichte der unvergleichlichen Georgette Heyer.
Jetzt als eBook bei beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
"Eine modern-altmodische Scheherezade, die vergnüglich kurzweilige Lesenächte beschert." - Österreichischer Rundfunk
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 710
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Über dieses Buch
Der Herzog von Sale ist seit seiner Geburt Vollwaise und wird von seiner aufmerksamen Verwandtschaft sehr behütet aufgezogen. Aber inzwischen hat der gutmütige junge Lord es satt, von allen bevormundet und verhätschelt zu werden – er sehnt sich nach einem Abenteuer! Als sein Cousin ihn um Hilfe im Zusammenhang mit einer Erpressung bittet, sieht der Herzog eine Chance, endlich aus seinem goldenen Käfig auszubrechen. Er verkleidet sich als einfacher Reisender und macht sich auf den Weg, um das schöne Findelkind Belinda aus den Klauen eines abgefeimten Gauners zu entreißen. Aber am Ende der gefährlichen Reise wartet auf den Herzog das größte aller Abenteuer – die Liebe.
Über die Autorin
Georgette Heyer, geboren am 16. August 1902, schrieb mit siebzehn Jahren ihren ersten Roman, der zwei Jahre später veröffentlicht wurde. Seit dieser Zeit hat sie eine lange Reihe charmant unterhaltender Bücher verfasst, die weit über die Grenzen Englands hinaus Widerhall fanden. Sie starb am 5. Juli 1974 in London.
Georgette Heyer
Findelkind
Aus dem Englischen von Hanna Lux
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Copyright © Georgette Heyer, 1948
Die Originalausgabe THE FOUNDLING erschien 1955 bei William Heinemann.
Copyright der deutschen Erstausgabe:
© Paul Zsolnay Verlag GmbH, Hamburg/Wien, 1972.
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven © Richard Jenkins Photography
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7517-0304-8
www.lesejury.de
Kapitel 1
Als der junge Mann, der – sein Gewehr über der Schulter und gefolgt von einem betagten Spaniel – durch den Park schlenderte, in Sichtweite des Hauses kam, erkannte er, dass es bereits viel später sein musste, als er vermutet hatte, denn die Sonne war schon hinter dem großen Steingebäude verschwunden, und herbstliche Nebelschwaden stiegen vom Boden auf. Zwischen den Bäumen hatte man den Nebel kaum wahrgenommen, doch als der Gentleman nun aus ihrem Schutz auf eine Allee hinaustrat, die über sanft gewellten Rasen zur Südfront des Hauses führte, bemerkte er, wie dunstverhangen der Ausblick war, und gleichzeitig kam ihm zu Bewusstsein, dass er in seiner leichten Nankingjacke fröstelte. Er beschleunigte seinen Schritt ein wenig, aber statt den ursprünglich eingeschlagenen Weg beizubehalten, auf dem er sich der Vorderseite des Hauses mit der hübschen Kolonnade korinthischer Säulen und der über dem Mittelteil aufragenden Kuppel genähert hätte, bog er von der Allee ab und eilte, einen eleganten, mit verschiedenen klassischen Statuen geschmückten Blumengarten durchquerend, auf einen Nebeneingang im Ostflügel zu.
Das Haus, das nun die Stelle eines früheren, vor einem halben Jahrhundert abgebrannten Gebäudes einnahm, war ein verhältnismäßig moderner, in klassischem Stil in Stein und Stuckziegeln ausgeführter Bau, dem eine vierhundertfünfzig Fuß lange Vorderfront ein imposantes Aussehen verlieh, und da es außerdem über besonders angenehme Proportionen und eine gefällige Lage verfügte, wurde es in jedem Reiseführer als ein (natürlich nur an den Tagen, an denen sein hochwohlgeborener Eigentümer es der Schaulust der Öffentlichkeit preisgab) in jeder Hinsicht sehenswertes Objekt empfohlen. Der wissbegierige Besucher erfuhr überdies, dass ihn im Park und in den Lustgärten eine verschwenderische Fülle von Kunstwerken erwartete, wobei diese Art der Verschönerung jedoch weder aufdringlich wirkte noch im Widerspruch zu den Prinzipien moderner Gartengestaltung stand. Der dichte Park, der durch Wasserspiele zusätzlich an Reiz gewann, erstreckte sich über eine Fläche von ungefähr sieben Quadratmeilen, durch die sich eine drei Meilen lange Allee hinzog. Die weiten Gärten verrieten in ihrer gepflegten Mannigfaltigkeit die Hand eines wahren Meisters auf diesem Gebiet, dessen Gehilfen auch nicht dem kleinsten Unkrautpflänzchen erlaubten, den Kopf ans Licht zu stecken, geschweige denn einer Hecke oder Rabatte die Unart eines wilden Triebes. Streng symmetrisch angeordnete Beete zeugten von einem erlesenen Geschmack, und sogar die Wildnis jenseits des italienischen Gartens und der anschließenden Gruppe von Büschen erweckte den Eindruck, als wucherte dort wohl freie, aber doch sorgsam kontrollierte Natur.
»Sale Park«, konnte man im Reiseführer lesen, »der Hauptsitz Seiner Gnaden, des Herzogs von Sale, ist ein geräumiges Gebäude von bestechender Anmut. Seitenflügel und Mittelteil sind durch Kolonnaden verbunden, während ein großes Portal das reichverzierte Giebelfeld stützt.« Hieran knüpfte sich die Bitte, der Besucher möge eine kurze Zeit lang verweilen, um die Wasserspiele, den üppigen Wuchs edler Bäume und den bezaubernden Blick, den man von der Süd- und zugleich Vorderfront aus genoss, zu bewundern, bevor er sich der Betrachtung des stattlichen Herrenhauses selbst zuwandte und die ganze Pracht korinthischer Säulen, der Giebel und Kuppeln in sich aufnahm, deren architektonische Feinheiten wohl ein eingehendes Studium verdienten.
Danach folgte ein warmes Lob für den griechischen Tempel, den der fünfte Herzog mit einem enormen Kostenaufwand hatte errichten lassen, aber der junge Gentleman in Manchesterhosen und einem Nankingjagdrock ging an dem so Gepriesenen vorbei, ohne ihm einen Blick zu gönnen – ja, es hatte in der Tat den Anschein, als seien ihm Schönheit und Grandeur seiner Umgebung völlig gleichgültig, trat er doch ziemlich achtlos auf exakt gestutzte Graseinfassungen und gestattete zu allem Überfluss auch seinem Spaniel, nach Herzenslust durch die Blumenbeete zu streifen.
Sowohl in seinem Äußeren als auch in seiner Kleidung, an der nicht nur die auffallende Schlichtheit sondern auch ein Patronengurt bemerkenswert war (ein Attribut, auf das jeder Gentleman mit Rücksicht auf die Eleganz seiner Erscheinung schaudernd verzichtet hätte), konnte er sich mit diesem großartigen Hintergrund in keiner Hinsicht messen. Er war kaum mittelgroß, und seine schlanke Gestalt wirkte fast schmächtig. Hellbraunes, naturgelocktes Haar umrahmte zwar sympathische, aber durchaus alltägliche Züge. In dem feingeschnittenen, allerdings etwas blassen Gesicht überraschte vielleicht nur das leuchtende Grau der ausdrucksvollen Augen, aber dem Blick fehlte es an zwingender Kraft, um jene Faszination auszuüben, die echte Aufmerksamkeit erregt. Seine Haltung war im Grunde makellos, bis auf die Tatsache, dass sie das unbestimmte Flair vermissen ließ, das für gewöhnlich eine bedeutende Persönlichkeit umgibt – mit anderen Worten, es wäre leichter gewesen, ihn in einer Menge zu übersehen, als ihn von den Übrigen zu unterscheiden. Aus seinem Betragen sprachen eindeutig die Kultiviertheit einer vornehmen Erziehung und sogar eine gewisse Würde, aber ob es nun an dem Umstand lag, dass er erst vierundzwanzig Jahre alt war, oder an einem angeborenen Mangel an Selbstvertrauen, machte er alles in allem, ohne eigentlich schüchtern zu sein, einen so stillen Eindruck, dass man es fast schon als Zeichen äußerster Zurückhaltung hätte auffassen können. Daraus mag sich wohl auch erklären, warum gelegentlich auf ihn hingewiesene Besucher es geradezu unglaublich fanden, in einem derart bescheidenen Wesen dem Eigentümer von so viel Reichtum und Pracht gegenüberzustehen, und doch war er seit vierundzwanzig Jahren nicht nur der rechtmäßige Besitzer von Sale House, sondern auch von einer Stadtresidenz in der Curzon Street in London und acht weiteren Landsitzen, angefangen von einem in Somerset bis zu einem zugigen Schloss im schottischen Hochland, denn nicht umsonst war er der erlauchte Adolphus Gillespie Vernon Ware, Herzog von Sale und Marquis von Ormesby, Earl von Sale, Baron Ware von Thame, Baron Ware von Stoven und Baron Ware von Rufford, und alle diese hochtrabenden Titel trug er seit dem Augenblick seiner Geburt. Er war ein nach dem Tod des Vaters geborenes Kind, der einzige lebende Nachkomme des sechsten Herzogs und seiner sanften, unglücklichen Frau, die schließlich, nachdem sie ihrem Gemahl zuerst zwei totgeborene und dann drei Kinder geschenkt hatte, die noch im Säuglingsalter starben, bei der Niederkunft eines Knaben im siebenten Monat ihrer Schwangerschaft verschieden war. Das Baby war so schwach und winzig, dass man ihm allgemein prophezeite, es würde noch vor Ablauf eines Jahres neben seinen Geschwistern in der Familiengruft ruhen. Aber das Glück bei der Wahl einer guten Amme und die aufopfernde Pflege der ersten Kinderfrau trugen gemeinsam mit den unermüdlichen Bemühungen der Ärzte, dem strengen Regiment seines Onkels und Vormunds, Lord Lionel Ware, und der zärtlichen Fürsorge seiner Tante dazu bei, den siebenten Herzog mit Erfolg durch jede bedrohliche Krise zu schleusen, und so hatte er trotz einer beschwerlichen Kindheit – er neigte nämlich wegen seiner zarten Konstitution nur allzu leicht zu Erkältungen und darüber hinaus zu einer verhängnisvollen Anfälligkeit für alle ansteckenden Krankheiten – nicht nur überlebt, sondern war auch zu einem durch und durch gesunden jungen Mann herangewachsen, der zwar nicht gerade einem Herkules glich oder die urwüchsige Zähigkeit seiner Onkel und Cousins besaß, aber doch robust genug war, um seinen Ärzten herzlich wenig Grund zur Besorgnis zu geben. Der Doyen dieses mehrköpfigen Konsortiums hatte ohnehin des Öfteren versichert, er hielte den kleinen Herzog für wesentlich widerstandskräftiger, als man es ihm zutraute – das habe er immerhin durch die Hartnäckigkeit, mit der er sich bis jetzt ans Leben klammerte, hinlänglich bewiesen. Diese Meinung wurde jedoch von den besorgten Verwandten, Erziehern und Bediensteten, in deren Obhut sich der Herzog befand, keineswegs geteilt. Es lag nun schon einige Jahre zurück, seit er das letzte Mal ein wenig gekränkelt hatte, aber seine Umgebung litt trotzdem noch immer unter der Überzeugung, man müsse ihn so behutsam behandeln wie ein rohes Ei.
Aus diesem Grund stellte der junge Herzog, als er den Ostflügel seines Hauses erreichte, auch ohne eine Spur von Überraschung fest, dass man offensichtlich auf sein Erscheinen gewartet hatte. Bevor er noch den Fuß auf die erste Stufe der Steintreppe setzen konnte, die zum Eingang emporführte, wurde das Tor bereits weit aufgerissen und gab den Blick auf ein im dahinterliegenden Flur versammeltes Empfangskomitee frei – allen voran der Butler, eine höchst respekteinflößende Figur, dessen Miene der Eingeweihte unschwer entnehmen konnte, dass es, wenn Seine Gnaden schon unbedingt eine für seinen Rang gänzlich unwürdige Seitentür und den anschließenden schmalen Korridor benutzen wollte, nicht seine Sache sei, an einem so exzentrischen Benehmen Kritik zu üben. Er geleitete seinen Herrn unter vielen Verbeugungen hinein, und als er sah, dass dieser außer seinem Gewehr noch eine schwere Jagdtasche trug, bedeutete er einem Lakaien durch einen stummen Wink, ihm diese unschickliche Bürde abzunehmen. Der Herzog entledigte sich seiner Last mit einem wehmütigen kleinen Lächeln und murmelte zaghaft etwas von der Absicht, sich im Gewehrraum dem Putzen seiner Waffen widmen zu wollen.
Sein Jägermeister nahm dem Lakaien die Büchse, eine wunderschöne Manton, aus der Hand und sagte vorwurfsvoll: »Ich werde mich selbst darum kümmern, Euer Gnaden. Wenn ich gewusst hätte, dass Euer Gnaden heute Lust verspürten, auf die Jagd zu gehen, hätte ich für einen Lader gesorgt und –«
»Aber ich wollte keinen«, warf der Herzog ein.
Mr. Padbury schüttelte nur nachsichtig den Kopf.
»Und ich glaube«, fügte der Herzog hinzu, »ich könnte hin und wieder – wirklich nur hin und wieder, Padbury! – meine Gewehre selbst reinigen.«
Sogar der Lakai wirkte schockiert über diese Bemerkung, aber da er nur eine untergeordnete Stellung einnahm, konnte er lediglich mit dem zweiten Lakaien, der ihn zum Seiteneingang begleitet hatte, einen vielsagenden Blick wechseln, während das Trio Butler, Verwalter und Jägermeister den Herzog zutiefst gekränkt anstarrte. Schließlich rief ein Mann in mittlerem Alter, an dessen eleganter Livree man den Kammerdiener erkannte: »Die Gewehre selbst reinigen – aber, Euer Gnaden! Das geht doch nicht! Noch dazu, wo Euer Gnaden bis auf die Haut durchnässt sind, was mich, mit Verlaub, ob dieser dünnen Jacke nicht wundert!«
»Aber nein!«, sagte der Herzog. Dann schaute er auf den schmutzigen Spaniel hinunter und ergänzte: »Aber Nell muss trockengerieben werden.«
Man versicherte ihm, das würde unverzüglich geschehen. Der Jägermeister begann zu beteuern, er werde keine Zeit verlieren, den nassen Gewehrkolben eigenhändig einer Spezialbehandlung zu unterziehen, wobei ihn der Verwalter mit einem diskreten Hüsteln unterbrach, um seinem Herrn mitzuteilen, dass Mylord sich bereits nach seinem Verbleib erkundigt habe.
Der Herzog hatte den Ausführungen seines Kammerdieners und seines Jägermeisters ziemlich geistesabwesend gelauscht, aber nun spitzte er die Ohren. Anscheinend verzichtete er auf einen Abstecher in den Gewehrraum, denn er fragte ein wenig ängstlich, ob er schon zu spät zum Dinner kam, und der Butler, der zwar offiziell ein Untergebener des Verwalters, doch im Grunde die wesentlich größere Autorität war, antwortete darauf in etwas rügendem Ton, Seine Lordschaft sei vor ungefähr einer halben Stunde hinaufgegangen, um sich für das Essen umzukleiden.
Der Herzog machte ein bestürztes Gesicht und meinte, dann müsse er sich beeilen, worauf der gestrenge Majordomus mit mildem Wohlwollen versicherte, man werde mit dem Dinner auf ihn warten, und majestätisch durch den Korridor vorausstolzierte, um die Tür zur Haupthalle zu öffnen, eine Bemühung, für die er nichts weiter als eine neuerliche Enttäuschung erntete, weil Seine Gnaden es vorzog, die Seitentreppe am Ende des Ganges zu seinen Gemächern emporzueilen.
Sein Schlafzimmer war ein riesiger Raum, den man vom Vestibül im oberen Stockwerk aus erreichte, doch gerade auf den letzten paar Metern, die ihn noch von seiner Tür trennten, lief er seinem Onkel in die Arme – einem stattlichen Mann Anfang der Fünfzig mit aristokratisch geschnittenen Zügen und scharfen Habichtsaugen unter buschigen Brauen.
Lord Lionel Ware, der sich gern damit brüstete, ein Vertreter der alten Schule zu sein, hatte seine gewohnte ländlich-sittliche Tracht – bequeme Hirschlederhosen und Stulpenstiefel – gegen ein Paar Kniehosen von der Art getauscht, wie man sie einst in seiner Jugend für de rigueur hielt. Das zweite Zugeständnis an die Etikette waren eine emaillierte Schnupftabaksdose und ein Spitzentaschentuch, unübersehbar in einer Hand getragen. Beim Anblick seines Neffen zuckten seine Brauen in die Höhe, und er rief (das heißt, eigentlich klang es mehr wie ein joviales Bellen): »Ha! Endlich wieder aufgetaucht, Gilly?«
Der Herzog nickte lächelnd. »Verzeihen Sie, Sir. Komme ich zu spät? Geben Sie mir noch zwanzig Minuten, bitte!«
»Unsinn!«, sagte Lord Lionel gereizt. »Das Dinner wird serviert, wenn du fertig bist, und damit basta. Aber du bist ein schöner Narr, dich um diese Jahreszeit noch so spät draußen herumzutreiben. Höchstwahrscheinlich hast du dir dabei wieder mal eine Erkältung geholt!«
»Ach, woher denn!«, antwortete der Herzog im gleichen freundlich zerstreuten Tonfall, den er schon seinem Kammerdiener gegenüber gebraucht hatte.
Lord Lionel strich mit der Hand über den Ärmel der Nankingjacke und schien nicht unzufrieden. »Na gut!«, meinte er. »Ich will zwar nicht dauernd die Gluckhenne für dich spielen, mein Junge, aber ich wäre froh, wenn du möglichst bald aus diesen Kleidern fahren würdest. Wetten, dass du in diesem lächerlichen Schuhwerk nasse Füße bekommen hast? Hättest lieber Gamaschen anziehen sollen. Nettlebed! Hat Seine Gnaden keine anständigen Sachen für die Jagd?«
»Seine Gnaden lehnt es ab, Gamaschen zu tragen, Mylord«, sagte der Kammerdiener missbilligend. »Und Seine Gnaden hat mir auch weder befohlen, seine Kleider bereitzulegen, noch überhaupt seine Absicht, auf die Jagd zu gehen, geäußert«, fügte er hinzu. Es war weniger ein Versuch, sich selbst reinzuwaschen, als eine bekümmerte Rüge an der Unvorsichtigkeit seines Herrn.
»Ich habe nichts dagegen, wenn du dich nicht von vorn und hinten bedienen lassen willst«, erklärte Lord Lionel streng, »aber deine Gewohnheit, einfach stillschweigend zu verschwinden, finde ich idiotisch, Gilly. Man könnte fast glauben, du hast Angst, jemand würde dir einen Spaziergang verbieten.«
Ein amüsiertes Glitzern stahl sich in die Augen des Herzogs. »Vielleicht habe ich einen Hang zur Geheimniskrämerei«, bemerkte er bescheiden.
»Lass den Quatsch!«, sagte Seine Lordschaft. »Wann wirst du endlich begreifen, dass du erwachsen bist und tun und lassen kannst, was du willst? Und jetzt marsch, und vergiss gefälligst nicht, andere Strümpfe anzuziehen. Hoffentlich hast du wenigstens die aus Flanell genommen und nicht –«
»Sogar die lammwollenen«, unterbrach ihn der Herzog noch bescheidener.
»Na schön, und jetzt sei so gut und beeil dich! Oder willst du vielleicht Londoner Sitten in Sale einführen?«
Der Herzog verneinte entschieden, einen solchen Wunsch zu hegen, und verschwand in sein Schlafzimmer, wo Nettlebed bereits die Abendtoilette bereitgelegt hatte. Der Raum war trotz seiner riesigen Ausmaße gut durchwärmt, denn im Kamin brannte schon seit einigen Stunden ein Feuer, und ebenso lange verhinderten die sorgsam geschlossenen Fenster das Eindringen von jedem tückischen Hauch frischer Luft. Dunkelrote Damastvorhänge sperrten das verblassende Tageslicht aus, und der gleiche Stoff war über den Baldachin des großen Himmelbetts drapiert. Auf dem Toilettentisch und dem Kaminsims standen mehrarmige Kerzenleuchter. In der Waschschüssel wartete, zugedeckt mit einem frischen Handtuch, ein Silberkrug mit heißem Wasser. Das ganze Zimmer war in rotem Damast und Mahagoni gehalten, die Wände schmückten Tapeten mit dem chinesischen Muster, wie es vor einigen Jahren der Prinzregent in Mode gebracht hatte, als er seinen Sommerpalast in Brighton fast ausschließlich damit ausstatten ließ. Die gesamte Einrichtung wirkte eine Spur zu großzügig und überladen für den unscheinbaren jungen Mann, der hier wohnte, doch alles in allem war es keineswegs ein ungemütlicher Raum, denn tagsüber flutete durch die nach Süden gehenden Fenster gewöhnlich heller Sonnenschein herein, und man genoss eine prachtvolle Aussicht auf die Allee zwischen den symmetrischen Beeten und dem weiten Rasen, auf die vom Reiseführer so warm empfohlenen Wasserspiele und das sich in der Ferne verlierende Gewoge majestätischer Baumkronen. Der Herzog schlief hier, seit sein Onkel erklärt hatte, er sei nun zu alt für ein Regiment von Weiberröcken, und den verschreckten Zehnjährigen kurzerhand aus dem heimeligen Kinderzimmer mit der Begründung hierher verpflanzte, dieses Zimmer hätten vor ihm schon sein Vater und Großvater benutzt, und es stünde einzig und allein dem Herrn des Hauses zu, darin zu residieren. Als Seine Gnaden danach noch von verschiedenen Mitgliedern der Dienerschaft erfuhr, dass einst der fünfte Herzog in dem wuchtigen Bett seinen letzten Atemzug tat, konnte er nur dankbar dafür sein, als Lord Lionel es auf Grund der zarten Gesundheit seines Neffen für ratsam hielt, im anschließenden Ankleideraum ein Rollbett für eine verlässliche Aufsichtsperson aufstellen zu lassen. Der brave Nettlebed, der in den Augen mancher Leute als Kammerdiener für einen so jungen Mann vielleicht ein wenig zu alt war, begann nun geschäftig herumzuhantieren und bedachte seinen Herrn mit einer liebevollen Strafpredigt, während er ihm den Patronengurt löste und den Rock und die Weste aus grauem Tuch auszog. Wie fast alle Bediensteten, die für das Wohl des Herzogs sorgten, war er früher bei dessen Vater angestellt gewesen, woraus er ohne viele Umstände das Vorrecht ableitete, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, sobald kein weniger bedeutendes Mitglied des Haushalts in Hörweite war. In Gegenwart des übrigen Personals unterstrich er die Würde des Herzogs auf eine Weise, die diesen viel mehr in Verlegenheit brachte als die gutmütige Tyrannei unter vier Augen.
Jetzt sagte Nettlebed, während er den Patronengurt beiseitelegte: »Ich wundere mich, dass Mylord kein Wort darüber verloren hat, dass Euer Gnaden sich mit diesem hässlichen, vulgären Gürtel gefallen, der eher einem Wilddieb anstünde als einem Gentleman, noch dazu einem, der, wie man so sagt, zum Fürsten geboren ist. Aber was hilft’s! Man könnte es Euer Gnaden bis zum Jüngsten Tag predigen, es würde doch nichts nützen! Und warum wollten Sie keinen Lader mitnehmen, bitte sehr, von Padbury gar nicht zu reden? Der Ärmste war ganz außer sich, dass Sie ohne ihn auf und davon sind, wo Sie doch bestimmt auch einen Treiber benötigt hätten.«
»Ich bin ganz gut ohne einen ausgekommen«, sagte der Herzog und setzte sich, damit Nettlebed ihm die Stiefel ausziehen konnte. »Und was meinen Patronengurt betrifft, kannst du ihn meinetwegen ruhig vulgär finden, aber immerhin erspart er mir eine Menge Platz in den Taschen, und man kann damit ebenso schnell laden wie auf jede andere Art.«
»Ja, aber wenn Sie einen Lader mitgenommen hätten, wie es für Euer Gnaden schicklich gewesen wäre, hätten Sie das grässliche Ding überhaupt nicht gebraucht«, erwiderte Nettlebed streng. »Seine Lordschaft war durchaus nicht erfreut darüber, das ist mir nicht entgangen.«
»Ich bin sicher, er hat sich deswegen nicht geärgert«, antwortete der Herzog, während er zum Waschtisch hinüberging und das Handtuch vom Krug nahm. »Auf jeden Fall befürwortet er es sehr, dass ein Mann sich in jeder Situation selbst zu helfen weiß.«
»Das mag schon sein, Euer Gnaden«, sagte Nettlebed, indem er den Versuch des Herzogs vereitelte, den Krug aufzuheben. Er goss das Wasser in die Schüssel und entzog seinem Herrn das Handtuch. »Aber wenn sich Seine Lordschaft auf die Jagd begibt, tut er das nie ohne seinen Lader und kaum ohne ein paar Treiber, denn schließlich weiß er genau, was er seiner hohen Stellung schuldig ist.«
»Schön, und wenn ich das nicht weiß, lege ich trotzdem keinen Wert darauf, dass man es mir ständig unter die Nase reibt«, seufzte der junge Mann. »Manchmal denke ich, wie angenehm es sein müsste, als einer meiner Pächter geboren zu sein.«
»Aber Euer Gnaden!«, rief Nettlebed bestürzt.
Der Herzog nahm das Handtuch, um sich das nasse Gesicht abzutrocknen. »Natürlich möchte ich nicht zu denen gehören, die gezwungen sind, in Strohhütten zu hausen«, sagte er nachdenklich.
»Strohhütten!«
»In Rufford.«
»Ich habe keine Ahnung, wovon Euer Gnaden sprechen!«
»Man beklagt sich dauernd über die Zustände, die dort herrschen. Ich finde, man sollte sie alle niederreißen, ja eigentlich bin ich sogar überzeugt davon, seit ich sie selbst gesehen habe.«
»Sie haben sie gesehen, Euer Gnaden?«, fragte Nettlebed schockiert. »Um Gottes willen, wann denn?«
»Als wir in Yorkshire waren, bin ich hingeritten«, antwortete der Herzog ruhig.
»Na bitte!«, sagte Nettlebed ungehalten. »Schon wieder eine von den Eskapaden, die Euer Gnaden lassen sollten! Schließlich ist es Mr. Scrivens Aufgabe, sich um solche Dinge zu kümmern, und er ist bestimmt ein fleißiger und tüchtiger Mensch. Außerdem hat er seine Angestellten, die für ihn das Land abgrasen!«
»Nur kümmert er sich eben nicht darum«, sagte der Herzog, indem er vor seinem Toilettentisch Platz nahm.
Nettlebed reichte ihm das Halstuch. »Dann können Euer Gnaden überzeugt davon sein, dass das nicht notwendig ist.«
»Du erinnerst mich ungemein an meinen Onkel, mein Guter«, bemerkte der Herzog.
Nettlebed betrachtete ihn kopfschüttelnd. »Dabei hat Ihnen Seine Lordschaft ganz gewiss gesagt, dass es weit und breit keinen besseren Verwalter gibt als Mr. Scriven.«
»Oh, natürlich! Es gibt für ihn nichts Wichtigeres als die Wahrung meiner Interessen.«
»Nun, was könnten Euer Gnaden da noch mehr verlangen?«
»Ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn er sich einmal bemühen würde, meine Wünsche zu erfüllen.«
Die leichte Gereiztheit, die in der sonst so ruhigen Stimme seines Herrn schwang, veranlasste Nettlebed, in barschem Ton, der allerdings kaum seine innige Zuneigung verbarg, zu sagen: »Jetzt weiß ich, was mit Euer Gnaden los ist! Sie sind bloß müde, weil Sie diese schwere Jagdtasche und das Gewehr herumgeschleppt haben, deshalb sind Sie auf einmal so trübsinnig! Wenn es manchmal so aussieht, als würde sich Mr. Scriven nicht immer nach Ihren Wünschen richten, dann nur, weil Sie einfach noch zu jung sind, um beurteilen zu können, wie man mit den Pächtern umgehen muss oder was das Beste für das Gut ist.«
»Wie recht du hast«, erwiderte der Herzog gleichgültig.
Nettlebed half ihm in den Rock. »Ihr Vater, Euer Gnaden, hatte jedenfalls unbegrenztes Vertrauen zu Mr. Scriven.«
»Selbstverständlich.«
Da Nettlebed spürte, dass sein Herr noch immer nicht restlos überzeugt war, begann er, die zahlreichen Tugenden des Oberverwalters aufzuzählen, doch nach wenigen Minuten unterbrach der Herzog seinen Redefluss und sagte: »Schon gut, schon gut! Haben wir heute Abend Gesellschaft?«
»Nein, Euer Gnaden, Sie werden ganz allein sein.«
»Das klingt zu verlockend, als dass es wahr sein könnte.«
»Nein, nein, Euer Gnaden, glauben Sie mir! Sie werden unten niemand antreffen außer Mylord und Mylady, Mr. Romsey und Miss Scamblesby«, beteuerte ihm Nettlebed.
Der Herzog lächelte, verzichtete aber auf einen Kommentar. Er ließ sich geduldig seinen Rock über den Schultern glattstreichen, ergriff das ihm gereichte frische Taschentuch und begab sich zur Tür. Nettlebed öffnete sie und nickte einem draußen in der Halle müßig herumstehenden Lakaien zu, der daraufhin augenblicklich verschwand, offenbar um die Neuigkeit zu verbreiten, dass man in Bälde mit dem Erscheinen Seiner Gnaden rechnen durfte. Er war der Haushofmeister und bekleidete ein Amt, das mittlerweile im Aussterben begriffen war, doch da man in Sale Park hartnäckig an einem Pomp festhielt, der bereits dem vergangenen Jahrhundert angehörte, blieb seine Stellung unangetastet. Solange der Herzog noch unmündig gewesen war, hatte der Haushofmeister nur in sehr beschränktem Rahmen Gelegenheit gefunden, seine Talente zu entfalten, aber jetzt schöpfte er Hoffnung, das große Haus bald wieder voller vornehmer Gäste zu sehen, die alle ihre eigenen strapaziösen Bediensteten mitbrachten, von ihren jeweiligen Schrullen und Launen gar nicht zu reden, die einen Mann von niedrigerem Niveau unter Umständen wohl zum Selbstmord treiben konnten, für Mr. Turvey dagegen eine Quelle reinsten Ergötzens darstellten.
Der Herzog schritt die Treppe hinunter und ging über die Marmorfliesen der riesigen Halle zur Doppeltür, die auf die Galerie führte. Hier pflegte sich die Familie vor dem Dinner zu versammeln, seit der Großvater des Herzogs das Haus nach dem Brand wieder aufgebaut hatte, doch da die Galerie über hundert Fuß lang war, hatte der Herzog sich manchmal des Gefühls nicht erwehren können, dass sich, natürlich außer an den Besuchstagen, ein kleinerer Raum vielleicht besser für diesen Zweck eignen würde, aber als er behutsam einen solchen Vorschlag äußerte, stieß er damit bei seinem Onkel auf so heftige Missbilligung, dass er mit seiner gewohnten Fügsamkeit jede Hoffnung auf eine Änderung der bestehenden Gepflogenheiten begrub.
Zwei livrierte Lakaien, die bisher anscheinend versucht hatten, Wachsfiguren zu verkörpern, erwachten plötzlich zum Leben und rissen die Flügeltür auf, durch die der Herzog auf die Galerie hinausspazierte. Neben den beiden baumlangen Burschen in ihrer blasierten Herrlichkeit wirkte er wie ein armseliger Zwerg.
Da der September sich schon seinem Ende zuneigte und die Abende einen kleinen Vorgeschmack auf winterliche Kälte brachten, prasselte im Kamin am Ende der Galerie ein munteres Holzfeuer. Lord Lionel Ware stand vor der Glut, und wenn er auch seine Uhr in diesem Moment nicht in der Hand hielt, machte er doch den Eindruck, als hätte er sie vor ein paar Sekunden in die Tasche gesteckt. Neben ihm bemühte sich Reverend Oswald Romsey in zwar sehr lobenswerter, aber nicht ganz erfolgreicher Weise, eine Miene aufzusetzen, auf der nicht allzu deutlich seine Empörung über die unwillkommene Verzögerung zu lesen stand. Der frühere Hauslehrer des Herzogs hatte nun die Aufgabe übernommen, für das Seelenheil seines Schützlings zu sorgen, und nutzte die Pausen zwischen der keineswegs anstrengenden Erfüllung seiner Pflichten dazu, eine gelehrte Abhandlung über die Hebräerbriefe zu verfassen. Auf einem strohfarbenen Brokatsofa, durch die imposante Figur ihres Gatten völlig von der Wärme des Feuers abgeschirmt, saß die Tante des Herzogs, eine Dame von üppigen Formen, der die gegenwärtige Mode – hohe Taille, enge Röcke – nicht unbedingt schmeichelte, und auf einem Stuhl in schicklichem Abstand von diesem intimen Kreis thronte bolzengerade Miss Scamblesby, eine alte Jungfer unbestimmbaren Jahrgangs, von der eigentlich niemand genau wusste, wie sie mit der Familie verwandt war, obwohl Lady Lionel sie immer »meine Cousine« nannte. Jedenfalls wohnte sie in Sale Park, solange der Herzog denken konnte, und versah hier die Pflichten einer Art gehobener Kammerfrau. Dank Lady Lionels außerordentlicher Gutherzigkeit musste sie sich beileibe nicht überanstrengen oder bekam gar die Schattenseiten des Dienstbotendaseins zu spüren. Das Einzige, was sie wohl oder übel ertragen musste, war die schrecklich langweilige Konversation Ihrer Ladyschaft und gelegentlich ein barsches Wort von Lord Lionel, aber da er seine Grobheiten gleichmäßig auf sämtliche Mitglieder des Haushalts verteilte, bestärkte sie das nur in dem Gefühl, tatsächlich zur Familie zu gehören.
Der Herzog dagegen, der, wie sein Onkel ihm des Öfteren versicherte, ein viel zu empfindliches Gemüt besaß, konnte sich nicht von dem Gedanken befreien, dass an Miss Scamblesby im Stillen so mancher Kummer nagte, und verabsäumte es nie, ihr ein ehrendes Maß an Aufmerksamkeit zu schenken oder ein im Grunde nicht bestehendes Verwandtschaftsverhältnis dadurch anzuerkennen, dass er sie mit Cousine Amelia ansprach. Als sein Onkel ihn weniger aus Lust am Nörgeln als vielmehr wegen seines Hangs zur Pedanterie darauf hinwies, dass die Verbindung dieser angeblichen Cousine dritten Grades von Lady Lionel mit der Familie Ware doch nur als äußerst lose zu bezeichnen war, lächelte er bloß und wich der drohenden Debatte mit einer Geschicklichkeit aus, wie man sie sich nur durch jahrelange Übung aneignen kann.
Während er nun die Galerie hinunterging, begrüßte er sie freundlich und erkundigte sich nach den Kopfschmerzen, über die sie am Vormittag geklagt hatte. Sie dankte ihm errötend und sagte, sie fühle sich schon viel besser, doch der kurze Dialog genügte, Lord Lionel zu der vernichtenden Bemerkung anzuregen, er könne bei Gott nicht verstehen, wieso manchen Leuten der Kopf weh tun sollte, wo er selbst in seinem ganzen Leben noch nie von einem solchen läppischen Übel heimgesucht worden war. Mr. Romsey steuerte beflissen seinen Teil bei und meinte, sehr zum Missvergnügen der Übrigen: »Ah, wer kann dafür wohl mehr Verständnis haben als Seine Gnaden? Mich wundert das nicht! Wir mit unserer robusten Gesundheit dürfen da nicht mitreden, denn schließlich hat er in seinem jungen Leben schon mehr durchgemacht als wir alle miteinander!«
»So ein Blödsinn!«, sagte Lord Lionel, der es nicht leiden konnte, wenn jemand anderes dieses Thema anschnitt.
Mr. Romseys gutgemeinte Taktlosigkeit weckte Lady Lionel aus ihrer gewohnten Lethargie, und sie begann überraschend lebhaft all die schwerwiegenderen Anfälle von Kopfschmerzen aufzuzählen, unter denen ihr Neffe als kränkliches Kind gelitten hatte. Der Herzog hörte sich die Tirade geduldig an, aber Lord Lionel wurde sichtlich gereizt und warf von Zeit zu Zeit ein verächtliches »Pah!«, ein, bis er sich endlich nicht mehr beherrschen konnte und den Redeschwall seiner Gemahlin ziemlich unwirsch mit den Worten unterbrach: »Ja, ja, Sie haben ganz recht, Madam, aber das ist jetzt alles vergessen, und wir wollen Gilly doch nicht dauernd daran erinnern! Warst du heute auf Vogeljagd, mein Junge? Und? Erfolg gehabt?«
»Wie man’s nimmt – sechs Rebhühner und ein paar Ringeltauben, Sir«, antwortete der Herzog.
»Na, großartig!«, sagte sein Onkel anerkennend. »Wenn die Ringeltaube auch nicht das ist, was ich im Prinzip unter Wild verstehe, habe ich doch schon etliche Male beobachtet, dass es ausgesprochen knifflig ist, sie zu erwischen. Was für ein Kaliber hast du verwendet?«
»Sieben«, sagte der Herzog.
Lord Lionel schüttelte den Kopf und pries die Vorteile von Nummer vier oder fünf. Sein Neffe lauschte höflich und erwiderte dann, er räume ihm mit seinem schwereren Kaliber gern einen Zufallstreffer auf weite Distanz ein, aber mit einem guten Hinterlader und Nummer sieben dürfe man mit einem viel verlässlicheren Schuss rechnen. Da der Herzog ein ausgezeichneter Schütze war, begnügte sich Lord Lionel mit einer flüchtigen Bemerkung über neumodische Torheiten und fragte, ob er eine seiner Purdeys genommen hätte.
»Nein, eine Manton«, sagte Gilly. »Ich wollte Joseph Mantons neues Patentgewehr ausprobieren.«
»Also, was mich betrifft, ich kaufe meine Gewehre jetzt schon seit dreißig Jahren nur bei Walker und Maltby«, erklärte Seine Lordschaft. »Aber euch Jungen ist das Althergebrachte ja nie gut genug! Wahrscheinlich willst du mir nun weismachen, dass an dieser neuen Flinte ein ganz besonderer Trick dran ist!«
»Ich glaube, die Ladung ist kompakter, und man macht sich auch nicht so schmutzig dabei.«
»Hoffentlich hast du dir keine nassen Füße geholt, Gilly«, sagte Lady Lionel. »Du weißt ja, wenn du dich erkältet hast, bekommst du spätestens morgen wieder grässliche Halsschmerzen, und gerade neulich fiel mir ein, dass ich mich absolut nicht mehr an den Namen dieses reizenden Arztes erinnern kann, der so auf eine Behandlung mit Elektrizität schwor. Du warst damals noch ein Kind, deshalb wirst du’s bestimmt auch nicht mehr wissen, aber es war eine ganz phantastische Sache, obwohl dein Onkel gar nichts davon hielt.«
»Weiß dieser verdammte Borrowdale eigentlich nicht, dass wir endlich alle da sind?«, fragte Lord Lionel mit beträchtlicher Lautstärke. »Es wird glatt noch sechs Uhr, bis wir uns zum Dinner setzen!«
»Ach ja, damals war Elektrizität gerade große Mode«, fuhr seine Frau seelenruhig fort. »Ich kenne bestimmt ein Dutzend Leute, die sich behandeln ließen.«
»Der Captain würde sagen, sie hatten alle einen Knacks«, sagte Miss Scamblesby, nicht ohne ihren Worten das einleitende Kichern vorauszuschicken, das Seiner Lordschaft stets von neuem auf die Nerven ging.
Lord Lionel war zwar sehr stolz auf seinen Sohn und hegte für ihn ein großes Maß an väterlicher Liebe, was aber nicht bedeutete, dass er sich die diversen Aussprüche seines Sprösslings ungestraft zitieren ließ. Deshalb erwiderte er auch prompt, er könne diesen ordinären Jargon auf den Tod nicht leiden, und brachte so die bedauernswerte Miss Scamblesby in heftige Verlegenheit, aus der sie nur der plötzliche Auftritt Borrowdales erlöste, der im selben Moment wie ein rettender Engel eintrat, um zu verkünden, das Dinner sei serviert. Der Herzog eilte zuvorkommend zu seiner Tante, um ihr beim Aufstehen vom Sofa behilflich zu sein, Miss Scamblesby schlang sich einen Paisley-Schal um die Schultern, nahm von Mr. Romsey ihren Fächer und ihr Retikül in Empfang, und die kleine Gesellschaft spazierte im Gänsemarsch in die Halle hinaus, von wo sie sich dann in den Speisesalon begab.
Hier nahm der Herzog in einem riesigen geschnitzten Eichenstuhl am oberen Ende der Tafel Platz, während Lord Lionel sich ihm gegenüber auf ein ähnliches Monstrum setzte. Lady Lionel residierte zur rechten Hand ihres Neffen, und Miss Scamblesby und Mr. Romsey ließen sich an der noch freien Längsseite des Tisches nieder, wo allerdings nur ein Lakai zu ihrer Bedienung bereitstand.
Da Lord Lionel ein leidenschaftlicher Verfechter einer – zumindest in seinen Augen – ordentlichen, einfachen Mahlzeit war, wurden in Sale Park nur zwei Gänge serviert, wenn die Familie allein speiste. Der erste Gang setzte sich der Reihenfolge nach aus Schildkrötensuppe, Fisch und einer Rehkeule zusammen, wozu noch eine Anzahl von Zwischengerichten wie Schweinerippchen mit Rober-Sauce, gespickte Rindsfilets, getrüffelter Kalbsbraten und ein geschmorter Schinken kamen, aber weil Seine Lordschaft ein bescheidener Esser und der Herzog bekannt für seinen schwachen Appetit war, blieb Miss Scamblesby die Einzige, die diese Herrlichkeiten richtig zu würdigen wusste, da sie noch dazu (wie Seine Lordschaft gern seinem Neffen gegenüber betonte) den berüchtigten Wolfshunger aller armen Verwandten besaß.
Beim ersten Gang herrschte, bis auf ein paar belanglose Äußerungen, zähes Schweigen. Der Herzog sah müde aus; seine Tante unterwarf sich nur höchst selten der Anstrengung, Konversation zu machen, und Lord Lionel schien in Gedanken versunken. Als die Schüsseln jedoch nach einer Weile in einer Prozession hinausgetragen wurden, schaute er plötzlich mit einem Ruck auf und sagte: »Du meine Güte, was seid ihr heute Abend bloß für eine langweilige Bande!« Eine Feststellung, die auf seine Tischgenossen allerdings eher entmutigend als anregend wirkte.
»He, Gilly!«, rief er, nachdem eine wohlberechnete Pause von niemandem genutzt verstrichen war. »Hast du eigentlich überhaupt nichts zur Unterhaltung beizutragen?«
Der Herzog streifte ihn mit einem erschreckten Blick, und Mr. Romsey meinte freundlich: »Wahrscheinlich sind Sie müde, Mylord.«
»Nein nein!«, beteuerte Gilly, fast entsetzt über diese indirekte Beschuldigung.
»Müde?«, fragte Lord Lionel sofort besänftigt. »Weiß der Teufel, warum ihr immer gleich vermuten müsst, dass er bei der geringsten Anstrengung sofort aus den Socken kippt! Begreift ihr denn nicht, wie lästig es für einen jungen Mann sein muss, wenn ständig ein solcher Unsinn von ihm behauptet wird! Du langweilst dich, Gilly, das ist alles! Ja, ja, brauchst es gar nicht abzustreiten – glaubst du vielleicht, ich kann es nicht verstehen? Hättest ein paar von deinen Freunden aus Oxford einladen sollen, damit sie dir Gesellschaft leisten, wenn du auf die Jagd gehst. Was wirst du immer nur allein hier herumhocken!«
»Danke, Sir, aber ich – ich fühle mich sehr wohl!«, stotterte Gilly. »Sie – ich meine, wir haben doch eine Menge Leute zur Fasanjagd eingeladen, soviel ich weiß.«
»Sicher, mein Junge, aber bis dahin ist’s noch eine ganze Weile«, sagte Seine Lordschaft mild. »Und vor November kannst du kaum mit einer großen Jagdgesellschaft rechnen.«
In diesem Augenblick wurde der zweite Gang serviert, und eine neue Vielzahl von Silberschüsseln prangte gleich darauf einladend auf dem Tisch. Ein paar Tauben und ein Hase bildeten das Hauptgericht, aber daneben gab es noch verschiedene Arten von Gemüse, diverse Cremes, Gelees und Kuchen, darunter auch, wie Miss Scamblesby mit scharfem Blick sogleich registrierte, einen Gâteau Mellifleur, eine Köstlichkeit, für die sie eine besondere Vorliebe hegte.
Lady Lionel bediente sich großzügig mit Artischockenböden in Sauce. »Ich habe nachgedacht«, sagte sie. »Wenn du Lust hast, Gilly, könnten wir nach dem Essen eine Partie Whist spielen. Mr. Romsey lässt sich bestimmt gern dazu überreden, und wenn nicht, kann noch immer Amelia einspringen. Sie spielt gar nicht so schlecht.«
Ihr Gatte stellte bei diesem Vorschlag ziemlich hastig sein Weinglas nieder und erklärte ihr mit unziemlicher Eile, dass Gilly sich nicht das Geringste aus Whist mache. »Ebenso wenig wie aus jedem anderen Kartenspiel«, ergänzte er rasch. »Außerdem ist mir gerade eingefallen, dass Chigwell heute Nachmittag die Post aus dem Empfangsbüro heraufgebracht hat. Es ist ein Brief von Onkel Henry für dich dabei, Gilly. Ich geb ihn dir nachher.«
Nachdem solcherart für die Unterhaltung des Herzogs gesorgt war, sank Lady Lionel erleichtert wieder in ihre schläfrige Interesselosigkeit zurück, wobei sie sich noch ganz kurz und flüchtig wunderte, was Lord Henry ihrem Neffen wohl schreiben könnte. Miss Scamblesby sagte, es schiene ihr schon eine Ewigkeit her, seit sie das Vergnügen gehabt hatten, Lord und Lady Henry Ware in Sale begrüßen zu dürfen, und Mr. Romsey erkundigte sich, ob Mr. Matthew inzwischen nicht schon Freshman in Oxford war.
»Nein, er kommt jetzt ins sechste Semester«, antwortete der Herzog.
»Aber doch nicht auf unserem College, Mylord?«, fragte Mr. Romsey mit einem vertraulichen Zwinkern.
Da er selbst in Balliol und der Herzog in Christ Church studiert hatte, musste sich das besitzanzeigende Fürwort zwangsläufig auf den Umstand beziehen, dass er seinen Schützling vor einiger Zeit nach Oxford begleitet hatte, um dort während ihres Aufenthaltes mit Argusaugen über dessen Gesundheit und Umgang zu wachen, ein Arrangement, das für einen sensiblen jungen Mann wie den Herzog der reinsten Höllenqual glich und ihm sogar als Erinnerung noch so unerträglich vorkam, dass er nur mit Mühe eine unhöfliche Antwort unterdrückte.
»Mein Neffe besucht das Magdalen College«, sagte Lord Lionel kurz angebunden. »Und was heißt überhaupt, mein Bruder und seine Frau waren ewig lang nicht mehr da? Schließlich haben sie im Sommer sechs Wochen bei uns verbracht, noch dazu mit dem ganzen Haufen Kinder, und was mich betrifft, werde ich das bestimmt nicht so bald vergessen! Mit ihrem verdammten Kricket haben sie mir den schönen vorderen Rasen komplett ruiniert, und wenn sie meine Söhne gewesen wären –«
»Aber sie baten mich vorher ausdrücklich um Erlaubnis, Sir«, unterbrach ihn Gilly sanft.
Lord Lionel öffnete den Mund zu einer heftigen Erwiderung, besann sich jedoch und klappte ihn wieder zu. Nach einer winzigen Pause sagte er: »Na, jedenfalls ist es dein Rasen, und meinetwegen kannst du drauf herumtrampeln lassen, wen du willst. Trotzdem geht es über meinen Begriff, wie du einen solchen Vandalismus befürworten konntest!«
Der Herzog schoss seinem Onkel unter gesenkten Wimpern einen boshaft glitzernden Blick zu. »Vielleicht deshalb, weil ich selbst dort immer gern Kricket gespielt hätte.«
»Ha, was nicht noch alles! Und heute würdest du dich schön dafür bedanken, mein Lieber, wenn ich dir und Gideon erlaubt hätte, eine der gepflegtesten Grasanlagen in der ganzen Grafschaft zu zerstören!«
Mittlerweile hatte Miss Scamblesby ihre Portion Gâteau Mellifleur bewältigt, und Lady Lionel erhob sich schwerfällig von ihrem Stuhl. Der Herzog bückte sich nach den diversen kleinen Gegenständen, die ihr dabei entglitten und zu Boden fielen, die Lakaien rissen diensteifrig die Tür auf, und die beiden Damen rauschten hinaus, um die Männer ihrem Wein zu überlassen.
Die Diener räumten die Tafel ab, stellten die Karaffen auf den nunmehr blanken Tisch und zogen sich diskret zurück. Lord Lionel rückte sich genüsslich zurecht, erfüllt von der Vorfreude auf den behaglichen ersten Schluck, während sein Neffe ganz im Gegensatz zu ihm fast im wahrsten Sinne des Wortes auf glühenden Kohlen saß. Der Kamin hinter seinem Rücken verstrahlte eine Hitze, die ihm den Schweiß auf die Stirn zu treiben begann, die dekorative Schnitzerei seines Stuhles hinderte ihn daran, die Lehne ihrem Zweck entsprechend zu benutzen, und außerdem mochte er keinen Portwein.
Lord Lionel eröffnete das Gespräch mit einer Plauderei über ein paar Verbesserungen, die ihm für eines der herzoglichen Güter empfehlenswert erschienen, wobei er sich natürlich auf die Anregungen des Oberverwalters stützte. »Du solltest einmal selbst mit Scriven reden, Gilly«, meinte er. »Darfst nicht vergessen, dass du in weniger als einem Jahr eine große Verantwortung übernimmst. Ich würde es daher sehr begrüßen, wenn du dich mit dem ganzen Geschäftskram entsprechend vertraut machst.«
»Ach, du lieber Himmel, ja!«, rief Mr. Romsey, der inzwischen geziert an seinem Wein genippt hatte. »Nun ist es wirklich bald so weit! Kaum zu fassen! Nächstes Jahr wird Seine Gnaden tatsächlich schon fünfundzwanzig! Dabei kommt es mir vor, als wäre mir erst gestern die Ehre widerfahren, die Erziehung unseres jungen Herrn leiten zu dürfen!«
»Ich zweifelte nie daran, eine weise Wahl getroffen zu haben«, sagte Seine Lordschaft gnädig. »Aber ich bin der Meinung, mein Neffe darf nicht damit rechnen, dass man ihn noch weiß Gott wie lang am Gängelband führt. Du hast zwar eine Menge liebenswerter Eigenschaften, Gilly, doch es fehlt dir eben leider an Charakterstärke.«
Der Herzog nahm diese – wie er wusste gerechtfertigte – Kritik widerspruchslos hin. Trotzdem überlief ihn unwillkürlich ein Schauder bei dem Gedanken an die peinlichen Szenen, die sich ohne Frage in Sale abgespielt hätten, wäre er mit dem gleichen Temperament gesegnet gewesen wie sein Onkel. Sein Cousin Gideon besaß es in gewissem Maß, was ihm natürlich die Sympathie seines Vaters eintrug, aber Gideon war schon als Junge stets ein streitsüchtiger Kraftprotz und ungefähr so zartbesaitet wie ein Fleischerhund gewesen. Ob Prügel oder Schelte – an ihm prallte alles ab. Der Herzog hingegen hätte nie sagen können, vor welcher der beiden Möglichkeiten ihm mehr graute. Zu seinem Glück behandelte ihn Lord Lionel seit jeher viel nachsichtiger als seinen eigenen Sohn, so dass er sich im Grunde nicht allzu sehr vor ihm fürchtete. Aber sein von Natur aus sanftes Wesen und sein Abscheu vor lauten, heftigen Auseinandersetzungen, wozu noch die wehmütige Erkenntnis kam, dass die Strenge seines Onkels, mit der dieser für seine Interessen und sein Wohlergehen sorgte, einer herzlichen Zuneigung entsprang, hatten zur Folge, dass er sich fügsam unterordnete, wo sein Cousin mit flammender Empörung reagiert hätte.
»Du bist das Familienoberhaupt, Gilly«, sagte Lord Lionel. »Und du musst jetzt endlich lernen, dich durchzusetzen. Ich habe alles Menschenmögliche getan, um dich für deine schwere Aufgabe vorzubereiten, aber du bist einfach viel zu schüchtern.«
Mr. Romsey schüttelte sinnend den Kopf. »Ach ja, heutzutage gibt es in der Tat nur wenige junge Männer, die sich glücklich preisen können, solche Vorteile genossen zu haben wie Seine Gnaden. Was mich betrifft, Sir, so bin ich ganz sicher, dass Ihr Neffe sich Ihrer aufopfernden Bemühungen würdig erweisen wird.«
Der Herzog dachte flüchtig an seine Kinderzeit, die er mit Rücksicht auf seine Gesundheit zum Großteil in seinem Haus in der Nähe von Bath verbracht hatte und die mehr oder minder einem Kuraufenthalt gleichgekommen war. Er dachte an die drei Kerkerjahre in Oxford; an zwei weitere Kerkerjahre auf dem Kontinent unter der Aufsicht eines ehemaligen Offiziers, der ihm Unterricht im Reiten und in anderen männlichen Sportarten gab. Und plötzlich fasste er den Entschluss, einmal selbst die Initiative zu ergreifen, auch wenn es sich dabei nur um eine Lappalie handelte. Er stieß seinen Stuhl zurück und sagte forsch: »Wollen wir jetzt nicht zu meiner Tante gehen?«
»Ich bitte dich, Gilly, du musst doch sehen, dass ich mein Glas noch nicht ausgetrunken habe«, antwortete Lord Lionel ärgerlich. »Dass du dir diese übertriebene Eile bloß nicht angewöhnst! Du solltest dich immer zuerst versichern, dass auch alle bereit sind, sich zu erheben, bevor du zum Aufbruch bläst.«
»Verzeihung, Sir«, murmelte der Herzog kleinlaut, und schon waren seine guten Vorsätze wieder vergessen.
Kapitel 2
Als sie die Sitzung schließlich aufhoben, um sich zu den Damen zu begeben, fanden sie die beiden vor dem Kamin im roten Salon, einem der hübschen Empfangszimmer im ersten Stock. Lady Lionel hatte Talgkerzen bringen lassen und ihren Stickrahmen, den nun aber Miss Scamblesby auf dem Schoß hielt und eifrig bunte Seidenfäden durch den Stoff zog. Ihre Ladyschaft knüpfte höchstens einmal einen Fransenbesatz, da sie aber ständig nach ihrer Stickerei verlangte, um dann die passenden Schattierungen des Seidengarns auszuwählen und das Muster zu kritisieren, konnte sie sich mühelos einreden, wahrhaft bienenfleißig zu sein, und überdies ohne die geringsten Gewissensbisse eine Unmenge Komplimente über ihre Geschicklichkeit einheimsen.
Mr. Romsey ging zu Miss Scamblesby hinüber, um festzustellen, wie weit das Werk inzwischen gediehen war, und während Lady Lionel ihm vielleicht zum zehnten Mal erklärte, sie arbeite an einer Altardecke für die Schlosskapelle, gab ihr Gatte Gilly den Brief von seinem jüngeren Onkel. Als der Herzog die Zeilen überflog, spiegelte seine Miene – zu Lord Lionels grenzenloser Qual, weil er ohnehin schon darauf brannte, die Nachricht selbst zu lesen – gelinde Überraschung wider. Die Mitteilung umfasste nicht mehr als ein einziges, allerdings auf beiden Seiten eng beschriebenes Blatt (unnütze Papierverschwendung ließ sich mit Lord Henrys ausgeprägtem Hang zur Sparsamkeit nicht vereinen), auf dem der Absender seinen Neffen davon in Kenntnis setzte, dass er im Begriff war, durch die Verlobung seiner ältesten Tochter mit dem Sprössling einer sehr angesehenen Familie eine äußerst wünschenswerte Verbindung zu vollziehen. Es war ihm noch gelungen, außer dieser Botschaft eine detaillierte Schilderung der näheren Umstände auf das Blatt zu zwängen und hinzuzufügen, er hoffe, die beabsichtigte Vermählung würde die Zustimmung Seiner Gnaden finden.
Der Herzog gab den Brief mechanisch an Lord Lionel weiter, und Seine Lordschaft bemerkte, während er den Inhalt gierig in sich aufnahm: »Ha! Dachte ich mir’s doch! Yelvertons Sohn, was? Keine schlechte Partie für ein Küken, das noch die Schulbank drückt!«»Aber wozu der Aufwand, mir deshalb zu schreiben?«, fragte Gilly. »Das verstehe ich nicht!«
Lord Lionel runzelte die Stirn und warf ihm über den Rand des Briefes einen entrüsteten Blick zu. »Bist du von allen guten Geistern verlassen? Das ist wohl eine Selbstverständlichkeit, will ich meinen! Eine durchaus angebrachte Geste. Du wirst ihm natürlich deine Glückwünsche übermitteln und sagen, dass du diese Verbindung außerordentlich billigst.«
»Aber er schert sich doch sicher keinen Deut darum, ob ich einverstanden bin oder nicht«, widersprach der Herzog eine Spur gereizt.
»Verschone mich gefälligst mit deinen seltsamen Scherzen!«, brauste Seine Lordschaft auf. »Hörst du eigentlich jemals zu, wenn ich mit dir rede? Weiß der Teufel, wie oft ich dir schon eingebläut habe, dass du das Familienoberhaupt bist und lernen musst, dich auch als solches zu fühlen! Und jetzt kommst du mir mit diesem haarsträubenden Unsinn, dass dein Onkel sich keinen Deut um dein Einverständnis schert! Wenn du schon so gar keine Ahnung hast, was du deiner Position schuldig bist, dann könntest du wenigstens begreifen, dass er eben mehr von Tradition hält als du! Sein Brief ist völlig korrekt – ganz wie es sich gehört. Ehrlich gestanden hätte ich nicht erwartet, dass er für das Mädchen eine so vorteilhafte Partie zustande bringen wird – auch wenn die Sache vielleicht nicht hundertprozentig meinem Geschmack entspricht.«
»Da bin ich ganz Ihrer Meinung«, stimmte Gilly zu, indem er das Blatt wieder an sich nahm. »Meine Cousine ist noch nicht siebzehn, und Alfred Thirsk muss doch schon mindestens vierzig sein.«
»Ach, das spielt überhaupt keine Rolle«, sagte Lord Lionel. »Nur habe ich mich für diese Yelverton-Brut nie recht erwärmen können. Haben alle einen so verdammt vulgären Einschlag, seit der Alte – Yelvertons Vater meine ich, aber du kannst dich wohl kaum an ihn erinnern – die Erbin von irgendeinem reichen Spießbürger geheiratet hat. Na, gottlob ist das ja nicht meine Angelegenheit!«
»Sehr richtig, Sir«, pflichtete ihm der Herzog ein wenig boshaft bei. »Da sie aber mich betrifft, sollte ich meinem Onkel vielleicht erklären, dass mir seine Absicht sogar sehr missfällt. Arme Charlotte! Sie kann doch unmöglich diesen Mann heiraten wollen!« Lord Lionel schnaubte vernehmlich und sagte dann mit mühsam beherrschter Stimme: »Ich hoffe sehr, du wirst dich nicht zu einer solchen Unverschämtheit versteigen! Wie kommst du unerfahrener Springinsfeld überhaupt dazu, dir darüber ein Urteil anzumaßen, he?«
»Aber Sie rieten mir doch erst vor ein paar Minuten, Sir, ich soll versuchen, mich endlich durchzusetzen«, erwiderte der Herzog sanft.
»Mein lieber Gilly, darf ich dir versichern, dass mir für deine Art von Logik entschieden der Humor fehlt«, sagte Lord Lionel streng. »Du musst dir unbedingt vor Augen halten, dass dieser absolut korrekte Brief deines Onkels nichts anderes ist als eine bloße Förmlichkeit, die dir keineswegs als Vorwand dienen soll, dich auf eine höchst unpassende Weise hervorzutun. Das wäre ja noch schöner, wenn sich ein Mann in Henrys Alter von so einem Grünschnabel belehren lassen müsste, wie er seine ganz persönlichen Dinge zu regeln hat! Du schreibst ihm, was ich dir befohlen habe, und zwar gefälligst leserlich und nicht in deinem üblichen unzumutbaren Gekritzel! Und noch was – lass mich den Brief zur Vorsicht lieber sehen, bevor du ihn versiegelst.«
»Ganz wie Sie wünschen, Sir.«
Als Lord Lionel merkte, dass während dieser Predigt das Lächeln in den Augen seines Neffen ganz erloschen war, fuhr er etwas milder fort: »Kein Grund, die Ohren hängen zu lassen, mein Junge, nur weil ich gezwungen bin, dir mal die Leviten zu lesen. Die Sache ist erledigt – abgemacht? Gib deiner Tante nun den Brief, und dann komm mit mir in die Bibliothek hinunter. Habe nämlich was mit dir zu besprechen.«
Bei dieser unheilschwangeren Aufforderung umwölkte sich Gillys Miene, aber er reichte Lady Lionel gehorsam den Brief und folgte seinem Onkel in die Bibliothek im Erdgeschoss. Als sie eintraten, schloss er sofort aus den bereits brennenden Kerzen und dem Feuer im Kamin, dass diese Unterredung nicht der Eingebung eines Augenblicks entsprungen sein konnte. Unbewusst straffte er die Schultern und nahm sich vor, auf alle Fälle Haltung zu bewahren. Wenn er nur den Mut gehabt hätte, sich eine der Zigarillos anzustecken, die ihm sein Cousin Gideon in sträflichem Leichtsinn geschenkt hatte. Aber da Lord Lionel ein fanatischer Gegner dieses »vulgären Lasters« war, das »überdies nur die Lungen verpeste«, verzichtete er lieber auf die moralische Stütze eines verwegen zwischen die Lippen geklemmten Glimmstängels. »Setz dich«, knurrte Lord Lionel, während er selbst zum Kamin hinüberging und davor seine Lieblingsstellung einnahm.
Dieser Befehl war zwar nicht ganz so entnervend wie frühere in Kommandoton erteilte Ermahnungen, gerade zu stehen und die Hände auf dem Rücken zu verschränken, aber die Aussicht, auf einem niederen Fauteuil sitzen zu müssen, während sein Onkel sich drohend über ihm auftürmte, war auch nicht gerade angenehm. Die bereits umwölkte Stirn des Herzogs legte sich daher in noch bekümmertere Falten, als er nun folgsam, aber sichtlich widerstrebend auf den für seine Martern auserkorenen Stuhl sank.
Für Lord Lionel bestand offenbar ein gewaltiger Unterschied, ob man Tabak rauchte (eine primitive Gewohnheit) oder der eleganten und durchaus standesgemäßen Sitte des Schnupfens huldigte, denn er genehmigte sich jedenfalls eine großzügig bemessene Prise und ließ den Deckel der Dose danach befriedigt zuschnappen. »Weißt du, Gilly«, begann er, »Henrys Brief kommt mir gerade recht.«
Der Herzog blinzelte zu ihm auf. »Wirklich, Sir?«
»Ja, mein Junge. In ein paar Monaten bist du volljährig, und es ist höchste Zeit, dass wir an deine Zukunft denken.«
Gilly spürte plötzlich einen Druck in der Magengrube, als hätte er einen Stein geschluckt. »Wenn Sie meinen, Sir?«
Aber Lord Lionel schien diesmal nicht geneigt, sofort in medias res zu gehen. Er klappte seine Schnupftabaksdose wieder auf und sagte: »Ich habe immer versucht, mein Bestes für dich zu tun. Mag sein, dass ich manchmal zu streng war -«
»Oh nein«, protestierte der Herzog schwach.
»Nun, es freut mich, das zu hören, denn ich habe dich schon von klein auf immer sehr gerngehabt. Ich kann wohl auch ohne Bedenken gestehen, dass du mir nie Grund zur Besorgnis gegeben hast – abgesehen von deiner zarten Gesundheit natürlich und einem gewissen Mangel an Energie.«
Da der Herzog merkte, dass sein Onkel eine Antwort von ihm erwartete, stotterte er hastig: »Da-danke, Sir!«
»Obwohl dir ein bisschen mehr Verstand bestimmt nicht schaden würde«, ergänzte Lord Lionel, sein Lob gleich wieder dämpfend. »Du magst ja eine Menge Fehler haben, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dein armer Vater wäre mit seinem Sohn nicht unzufrieden, könnte er dich heute sehen.« Hier nahm er noch eine Prise. Gilly suchte vergeblich nach Worten, und es entstand ein unbehagliches Schweigen. Schließlich fuhr Lord Lionel fort: »Dein Vater hat mich zu deinem Vormund bestellt, und ich bilde mir ein, dass ich in jeder erdenklichen Weise seinen Wünschen nachgekommen bin. Habe dich sogar Adolphus taufen lassen«, fügte er mit leisem Groll hinzu, »obwohl das einer von diesen neumodischen deutschen Namen ist, die ich einfach grässlich finde. Na, immerhin war das eine Belanglosigkeit, und du weißt ja, ich habe dich nie so genannt. Und ich habe Henry auch nie erlaubt, sich in deine Erziehung einzumischen, obwohl er einer von deinen Vermögensverwaltern ist. Nichts gegen deinen Onkel – meinetwegen soll er seinen eigenen Söhnen eintrichtern, was er will, aber dein Vater und ich waren uns immer einig, dass sein Niveau unseren Ansprüchen niemals genügen kann. Wirklich ein Jammer, dass man ihn damals auch zum Treuhänder gemacht hat, doch das lässt sich nun nicht mehr ändern, und ich hoffe doch zu wissen, wie ich mit meinem Bruder umgehen muss.«
In Anbetracht seiner Erinnerungen fand der Herzog diese Hoffnung durchaus berechtigt, fühlte sich aber nicht dazu berufen, seine Meinung kundzutun, sondern murmelte stattdessen etwas Unverständliches.
»Jedenfalls besteht kein Grund, dich noch wie ein Kind zu behandeln«, sagte Lord Lionel in einer Anwandlung von Ehrlichkeit. »Deshalb will ich dir auch nicht verheimlichen, dass ich herzlich wenig auf das Urteil deines Onkels gebe. Dumm ist er ja gerade nicht, das muss man ihm lassen, aber auf die Gefühle seiner Brüder hat er leider nie viel Rücksicht genommen. Besonders als er sich dieses alberne Frauenzimmer um keinen Preis aus dem Kopf schlagen wollte – aber das gehört nicht hierher, und wenn er schon unbedingt ein Mädchen aus einer scheinheiligen Methodistenfamilie heiraten musste, um mit ihr ein Rudel bösartiger Bälger in die Welt zu setzen, denen nichts Besseres einfällt, als unseren schönen Rasen zu ruinieren – fünfzig Jahre Pflege waren notwendig, um ein solches Juwel zu schaffen! –, soll es wirklich nicht meine Sache sein, an ihm Kritik zu üben. Aber wohlgemerkt« – er hob mahnend den Finger – »ich habe ihm von Anfang an gesagt, wohin das führen würde. Aber Henry hat ja nie auf die Ratschläge anderer gehört, selbst wenn er wusste, dass sie hundertmal klüger und erfahrener waren als er. Hoffentlich trittst du nicht in seine Fußstapfen, Gilly.«
Der Herzog versicherte ihm, das brauche er keinesfalls zu befürchten.
»Schön, dann habe ich dir wenigstens nicht umsonst ein paar vernünftige Ideen in den Schädel gehämmert«, nickte sein Onkel. »Aber das hat alles nichts damit zu tun, was ich dir eigentlich sagen will.« Er richtete seinen strengen Blick auf Gillys gesenkten Kopf und schwieg einen Moment. »Ich spreche von deiner Heirat, Gilly«, sagte er dann abrupt.
Der Herzog zuckte zusammen. »Meine Heirat, Sir?«
»Warum bist du so überrascht?«, fragte Lord Lionel. »Es wird dir doch nichts Neues sein, dass ich diesbezüglich bereits alles in die Wege geleitet habe? Ich finde es idiotisch, aus einer ganz normalen Sache ein großes Geheimnis zu machen, und da ich mich seit geraumer Zeit gleichermaßen mit dem Problem beschäftige, wie ich für dein zukünftiges Glück und Wohlergehen sorgen kann, als auch mit der äußerst wichtigen Frage, die Nachfolge zu sichern, habe ich mich sehr bemüht, dir eine Braut auszuwählen, die dir außer den notwendigen Vorzügen eines vornehmen Geblüts und einer beträchtlichen Mitgift auch die Aussicht bietet, mit ihr eine harmonische Ehe führen zu können. Du siehst also, mein Junge, ich habe all diese modernen Flausen berücksichtigt, die dir zweifellos im Kopf herumspuken. Glaub ja nicht, dass ich von vornherein nur die erste und, wie ich gern zugeben will, auch augenfälligste Möglichkeit in Betracht zog. Ich hatte verschiedene junge Damen in der engeren Wahl, aber meines Erachtens passen sie alle nicht zu dir. Deshalb trage ich mich nun schon etliche Jahre mit dem Gedanken, dass du, sobald du volljährig bist, Lady Harriet Presteigne zur Frau nimmst.«
Der Herzog sprang auf und rief erregt: »Ja – nein! Natürlich wusste ich davon. Aber die Nachfolge ist doch nicht in Gefahr, Sir. Mein Cousin Gideon und die fünf Söhne von Onkel Henry –«
»Bleib mir bloß mit Onkel Henrys Söhnen vom Leibe!«, befahl Lord Lionel erbost. »Wenn sie alle dem Ältesten nachgeraten, der, wie man mir berichtet hat, dauernd in irgendeiner blamablen Klemme sitzt – und ich habe übrigens kaum Hoffnung, dass das nicht der Fall sein wird, denn was soll schon dabei herauskommen, wenn einer eine Methodistin heiratet? – kann ich nur sagen, dass es mich zutiefst erstaunt, falls du auch nur einen Augenblick lang einen von denen als deinen Erben in Erwägung ziehst!«
»Aber Sir, ich würde es ja nicht sehen, wie er sich dabei anstellt«, wandte der Herzog vernünftig ein. »Und Matts Schwierigkeiten sind wirklich nicht der Rede wert! Außerdem bin ich davon überzeugt, dass Gideon sich viel besser für meine Position eignen würde als ich. Bestimmt –«
»Schluss jetzt mit dem Blödsinn!«, fuhr ihn Lord Lionel mit ungewohnter Schärfe an. »Versteh mich richtig, Gilly! Ich habe nicht einmal im Traum daran gedacht, meinen Sohn als Herzog zu sehen, und nichts könnte mich mehr betrüben, als dass es letzten Endes dazu kommen müsste! Übrigens spreche ich da sicher auch ganz in Gideons Sinn. Hat er dir vielleicht irgendeinen Grund gegeben –«
»Aber nein, nicht den geringsten!«, beteuerte Gilly hastig. »Ich habe nur gemeint – ich wollte nur sagen –, es kann doch nicht unbedingt notwendig sein, dass ich schon so bald heirate.«
»So bald?« Sein Onkel zog die Brauen hoch. »Mein lieber Junge, seit fünf Jahren ist das zwischen mir und Ampleforth eine ausgemachte Sache! Und die junge Dame weiß garantiert ebenso Bescheid, denn ihre Mutter ist eine sehr kluge Frau und hat die Kleine sicher bestens auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet.«
»Soll das heißen, Harriet ist darüber im Bilde?«, fragte der Herzog verblüfft.
»Selbstverständlich, warum auch nicht? Falls dir irgendwelche romantischen Hirngespinste vorschweben, empfehle ich dir, sie schleunigst zu verscheuchen. So etwas passt vielleicht in einen kitschigen Roman oder für die unteren Schichten der Gesellschaft, aber niemals für unseresgleichen! Darauf kannst du dich verlassen. Ja, ja, wahrscheinlich hältst du mich für gefühllos, aber schließlich habe ich oft genug erlebt, was aus einer sogenannten Liebesheirat geworden ist. Katastrophal! Glaub mir, du mit deinen vierundzwanzig Lenzen und dem Kopf voller Unsinn hast nicht halb so viel Ahnung, was für dich gut oder schlecht ist, wie ich! Es wird dir kaum entgangen sein, dass deine Tante und ich die Ampleforths bei jeder nur halbwegs passenden Gelegenheit nach Sale eingeladen haben, und dich brauchte man auch nicht erst lange zu bitten, ihre Besuche zu erwidern. Ich beobachte dich nun schon seit längerer Zeit, und ich wäre ehrlich gestanden sehr überrascht zu erfahren, dass dir Lady Harriet völlig gleichgültig ist.«
Der Herzog umklammerte haltsuchend eine Stuhllehne. Er wirkte noch blasser als sonst und machte ein ausgesprochen unglückliches Gesicht.
»Nein, natürlich nicht! Ich schätze sie sehr! Sie war immer schrecklich liebenswürdig, aber eine Heirat –!«
»Ach, zier dich nicht, Gilly!«, sagte Lord Lionel eine Spur ungeduldig. »Du willst mir doch nicht erzählen, du hättest nie daran gedacht! Du hast genau gewusst, dass es eine beschlossene Sache war.«
»Ja«, gestand der Herzog mit Grabesstimme. »Ja, ich hab’s gewusst. Nur hoffte ich – das heißt, ich dachte –«
»Na, was hast du gehofft und gedacht?«
»Ich weiß nicht.« Es klang hilflos. »Vielleicht, dass noch etwas geschehen würde – dass ein anderer um ihre Hand anhält – oder – oder – dass es wenigstens noch nicht so bald sein muss.«
Sein Onkel betrachtete ihn mit einem listigen Blick. »Hast du ein Tendre für eine andere Frau, Gilly?«
Der Herzog schüttelte stumm den Kopf.
»Hätte ich auch nicht angenommen, nachdem du dir nie viel aus Mädchen gemacht hast, aber du kannst es mir ruhig sagen, wenn ich mich irre.« Er wartete, bekam aber nur wieder ein Kopfschütteln als Antwort. »Ja, was zum Teufel ist es dann? Heraus mit der Sprache, wenn ich bitten darf!«
Der Herzog zog sein Taschentuch hervor und presste es an die Lippen. »Ich weiß es selbst nicht genau. Das heißt um Gottes willen nicht, dass ich etwas gegen Harriet habe – wir waren einander ja schon als Kinder sehr zugetan. Sie ist das freundlichste und reizendste Wesen, das ich kenne – ja wirklich, die Gutmütigkeit in Person und so bescheiden und außerdem noch besonders hübsch, aber – aber ich habe mir immer vorgestellt, wenn es einmal so weit ist, werde ich mir meine Frau selbst aussuchen, eine Frau, für die ich – in die ich verliebt bin!«
»Oho! Ein kleiner Schwärmer!«, sagte Lord Lionel amüsiert. »Und wo ist diese Schöne?«
»Ich bin ihr noch nicht begegnet. Ich –«