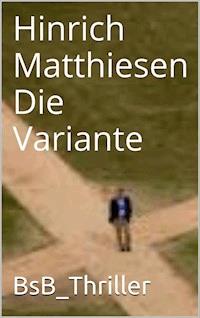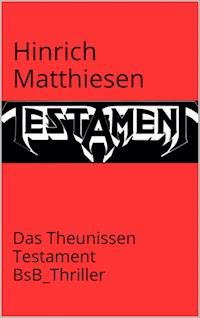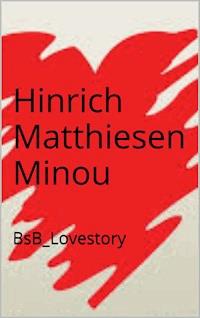Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Best Select Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Hinrich Matthiesen Werkausgabe Die Romane
- Sprache: Deutsch
Jeder ist so vieles, lebt aber von dem, was er ist, nur einen Bruchteil aus. Jannick will eigentlich nur ein paar Tage allein sein, ohne seine Frau und seine beiden halbwüchsigen Kinder. Doch die kleine Flucht aus dem Alltag wird zum Abenteuer, zum Albtraum. Der schnell gefundene Freund für abwechslungsreiche Tage verrät ihn. Jannick schlägt blindwütig zu - erschlägt ihn. Jannick Erdmanns wohlbehütete bürgerliche Existenz ist vernichtet. Aber hat er nicht immer schon von einem aufregenden, „alternativen“ Leben geträumt? Er fliegt nach Yucatán, um dort unter einem anderen Namen ein neues Leben zu beginnen. Hinrich Matthiesen hat einen spannenden, an abenteuerlichen Verwicklungen und dramatischen Konflikten reichen unterhaltsamen Roman geschrieben, der eindrucksvoll zeigt, wie Menschen mit den Sehnsüchten und Träumen anderer skrupellos spielen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hinrich Matthiesen
Jahrgang 1928, auf Sylt geboren, wuchs in Lübeck auf. Die Wehrmacht holte ihn von der Schulbank. Zurück aus der Kriegsgefangenschaft, studierte er und wurde Lehrer, viele Jahre davon an deutschen Auslandsschulen in Chile und Mexiko. Hier entdeckte er das Schreiben für sich.
1969 erschien sein erster Roman: MINOU. Dreißig Romane und einige Erzählungen folgten. Die Kritik bescheinigte seinem Werk die glückliche Mischung aus Engagement, Glaubwürdigkeit, Spannung und virtuosem Umgang mit der Sprache. Die Leser belohnten ihn mit hohen Auflagen.
Immer stehen im Mittelpunkt seiner Romane menschliche Schicksale, Menschen in außergewöhnlichen Situationen. Hinrich Matthiesen starb im Juli 2009 auf Sylt, wo er sich Mitte der 1970er Jahre als freier Schriftsteller niedergelassen hatte.
»Zum literarischen Markenzeichen wurde der Name Matthiesen nicht zuletzt durch die Kunst, in eine pralle Handlung Aussagen zu verweben, die außer dem aktuellen stets auch einen davon unabhängigen Bezug haben. Gedankliche Strenge, sprachliche Disziplin und ein offensichtlich unauslotbarer verbaler Fundus lassen Matthiesen zu einem Kompositeur in Prosa werden.«
Deutsche Tagespost
»Matthiesen ist zu beneiden um seine Fähigkeiten: Kompositionstalent, menschliche Einfühlung, scharfe Beobachtungsgabe – und vor allem um seinen Stil«
Deutsche Welle
»Matthiesen ist für seine genauen Recherchen bekannt. Seine Bücher weichen nicht einfach in exotische Abenteuer aus, sondern befassen sich immer wieder mit deutscher Vergangenheit und Gegenwart. Unterhaltsam sind sie allemal.«
FAZ-Magazin
Werkausgabe Romane Band 14
Herausgegeben von Svendine von Loessl
Der Roman
Jeder ist so vieles, lebt aber von dem, was er ist, nur einen Bruchteil aus.
Jannick will eigentlich nur ein paar Tage allein sein, ohne seine Frau und seine beiden halbwüchsigen Kinder. Doch die kleine Flucht aus dem Alltag wird zum Abenteuer, zum Albtraum. Der schnell gefundene Freund für abwechslungsreiche Tage verrät ihn. Jannick schlägt blindwütig zu – erschlägt ihn.
Jannick Erdmanns wohlbehütete bürgerliche Existenz ist vernichtet. Aber hat er nicht immer schon von einem aufregenden, „alternativen“ Leben geträumt? Er fliegt nach Yucatán, um dort unter einem anderen Namen ein neues Leben zu beginnen.
Hinrich Matthiesen hat einen spannenden, an abenteuerlichen Verwicklungen und dramatischen Konflikten reichen unterhaltsamen Roman geschrieben, der eindrucksvoll zeigt, wie Menschen mit den Sehnsüchten und Träumen anderer skrupellos spielen können.
Titelverzeichnis der Werkausgabe in 31 Bänden am Ende des Buches
Hinrich Matthiesen
Fluchtpunkt
Yucatán
Roman
:::
BsB_BestSelectBook_Digital Publishers
Werkausgabe Romane
Herausgegeben von Svendine von Loessl
Band 14
Teil 1
1.
Jannick Erdmann stand draußen am Heck. Ein paar Frosttage hatten die sonst so ansehnliche Kieler Förde in ein schmutziges grauweißes Gewässer verwandelt. Die treibenden Eisschollen sahen aus wie nachlässig drapierte Tupfen aus Eierschaum auf einem großen Teller Suppe.
Er sah hinunter ins Schraubenwasser und beobachtete, wie die Möwen in die quirlige Gischt hineinschossen, um sich die Brotbrocken herauszufischen, die die Schulkinder ihnen vom oberen Deck aus zuwarfen. Aber er verfolgte das Geschehen, das sich täglich wiederholte, nur mit halbem Interesse. Er dachte an die Deutschstunde, die erst vor gut zwanzig Minuten zu Ende gegangen war. Marlies Menke hatte wieder einmal so ungeniert dagesessen. Vorn, in der ersten Reihe. Sie trug, im Gegensatz zu den meisten ihrer Mitschülerinnen, keine Jeans, sondern Kleider und Röcke, und heute war ihr Rock noch höher gerutscht als sonst. Ist sie einfach nur naiv?, fragte er sich. Oder weiß sie genau, was sie da tut?
Trotz der Kälte und des Windes zog Jannick Erdmann die Handschuhe aus, bückte sich und holte sein Notizbuch aus der zu seinen Füßen stehenden Aktentasche, blätterte darin, sah sich Marlies Menkes Zensuren an. Geschichte: vier, zwei, drei, drei. Deutsch: zwei, zwei, drei. Sonstiges: nur der Vermerk über eine nicht abgelieferte Hausaufgabe und einmal ein Pluszeichen für ein freiwillig übernommenes Referat. Sie hat also, sagte er sich, keinen Grund, es mit unlauteren Mitteln zu versuchen. Wenn es ihr aber doch um die Zensuren geht und sie also noch bessere haben will, wieso denkt sie dann, dass solche Tricks verfangen könnten?
Er steckte das Notizbuch zurück in die Tasche, hauchte in die kalt gewordenen Hände, zog die Handschuhe wieder an. Sein Blick glitt hinüber zum Ufer, aber auch jetzt nahm er nur mit halber Aufmerksamkeit in sich auf, was dort zu sehen war; die Reventlow-Brücke, keine Brücke im eigentlichen Sinn, sondern nur einer der Anlegestege des westlichen Förde-Ufers; auf den Bohlen ein paar winterlich gekleidete Menschen, die auf das andere, das stadtwärts fahrende Schiff warteten; links von dem hölzernen Steg die Kais der großen Fähr-Linien, die ihre Schiffe nach Skandinavien schickten, nach Korsør, Oslo und Helsinki; rechter Hand das Landeshaus, Sitz der Behörden, auch des Schulamtes, auf dessen Korridoren er einige Male auf und ab gegangen war, ähnlich beklommen wie früher als Kind auf den langen dunklen Fluren seiner Schule.
Seine Gedanken kehrten zurück zu Marlies Menke, aber nun war er nicht mehr mit ihren Zensuren beschäftigt, sondern überlegte: Vielleicht könnte es auf einem Maskenball geschehen, auf dem man sich für ein paar Stunden hinter dem Kostüm und der schwarzen Larve verstecken kann. Ich würde alsranchergehen und einen Texashut mit breiter Krempe tragen, damit auch das, was die Larve nicht verdeckt, im Schatten bleibt. Und meine Stimme halte ich zurück. Oder ich verstelle sie. Es ist Sommer, ein Sommerfest, und ich gehʼ in der Nacht, weilʼs mir drinnen zu warm ist und zu laut, hinaus in den Garten. Und da sitzt sie dann schon, allein, auf einem Brunnenrand oder einer Bank. Auch sie voller Träume und Sehnsüchte oder einfach nur ein bisschen gelöst von dem Wein, den sie getrunken hat. Und sie sagt: »Hallo,rancher,suchst du nach deinen entlaufenen Tieren?« Und ich sagʼ, weil sie einen Umhang aus Sevillaner Spitzen trägt: »Hallo, Carmen!« Und dann: »Ja, die Tiere. Willst du mir nicht helfen?« Und wir suchen gemeinsam, entfernen uns immer mehr vom Haus. Der Garten ist groß wie ein Park, und wir geraten an seinen Rand. Die Musik kommt von ganz weit, tönt nur noch schwach zu uns herüber. Wir legen uns nebeneinander ins Gras, streifen uns gegenseitig die Larven vom Gesicht. Aber sie erkennt mich nicht, denn es ist dunkel. Sie löst den Gürtel des Texaners, und ich komme, an allen Staatsanwälten vorbei, zu meinem Glück. Und am nächsten Morgen – es ist ein Montag, und er beginnt mit Geschichte – frage ich sie ganz milde nach dem Wiener Kongress oder nach dem Deutschen Bund und billige ihr zu, mir alle Antwort schuldig zu bleiben, weil sie immer noch den Texaner im Kopf hat.
Der Stoß des Fährschiffs gegen den Kitzeberger Anlegesteg riss ihn aus seinen Träumen. Er betrat die Gangway, grüßte zerstreut ein paar Bekannte, ging vorsichtig über die vereisten Bohlen der Mole. Als er eine Minute später den Waldweg erreichte, stellte er sich auf seine Familie ein.
Der Tisch war gedeckt. Die Kinder saßen schon. Er war mittags immer der letzte, der nach Hause kam. Carola ging mit der Schüssel von Platz zu Platz und legte auf.
»Herr Mischke hat mir in Kunst dreizehn Punkte gegeben, eine Eins minus.« Ninas Hand glitt über die Tischdecke, schob einen graugrünen Gegenstand neben den Teller ihres Vaters. »Ist aus Speckstein gemacht«, ergänzte sie.
Jannick Erdmann nahm das kleine Gebilde in die Hand, betrachtete es. Es stellte einen Kopf mit zwei Gesichtern dar, einem, das nach links, und einem, das nach rechts sah.
»Ich habʼ lange daran gefeilt und geschliffen«, fuhr Nina fort. »Ich hatte Pech, kriegte den allerletzten Stein. Die anderen hatten viel schönere, auch größere, aus denen sich mehr machen ließ. Holger holte aus seinem ein ganzes Pferd heraus. Mit Reiter.«
»Das ist ein Januskopf«, sagte Erdmann.
»Ja, das meinte Herr Mischke auch. Was ist das eigentlich, ein Januskopf?«
»Ein römischer Gott. Der Gott des Torbogens. Später nannte man ihn auch den Gott des Anfangs.« Seine Hand umspannte die Figur, umschmeichelte den glatten Stein. »Fasst sich tatsächlich wie ganz fester Speck an. Wie Fleisch. Wie kühle Haut. Warum hast du ihm zwei Gesichter gegeben?«
»Na ja, nur so ein gewöhnlicher Kopf, das war mir zu simpel. Und da habʼ ich mir gedacht, machst ihm ein Doppelgesicht; dann ist er wenigstens ein bisschen geheimnisvoll.« Nun nahm auch die Mutter die Figur in die Hand, betrachtete sie lange. »Die Gesichter sind sehr verschieden«, sagte sie. »War das Absicht? Oder war es zu schwer, das Gleiche noch einmal zu schaffen?« Sie schob ihrem Mann den Stein wieder zu.
»Zuerst wollte ich sie genau gleich machen«, antwortete Nina, »aber dann fiel mir ein, dass man manchmal von einem Menschen sagt, er hat zwei Gesichter oder auch zwei Seelen, und damit meint man ja gerade den Unterschied, nämlich zwei ganz verschiedene Charakteranlagen. Und ich finde, das sind meistens die interessanten Typen, und darum habʼ ichʼs so gemacht. Ich gebe zu, das war natürlich etwas leichter, als sich beim zweiten Gesicht ganz genau an das erste zu halten.«
Jannick Erdmann schob seinen Teller zur Seite, nahm die Figur wieder auf und hielt sie mit beiden Händen, wobei die Finger wie streichelnd über die beiden Gesichter fuhren.
»Ja, es sind wirklich zwei verschiedene Menschen«, sagte er. »Der eine lächelt ein bisschen.« Er hob den Stein in die Höhe, zeigte ihn herum.
»Vater, ich schenke dir den Kopf«, sagte Nina. »Ich merkʼ schon, dir sagt er am meisten. Du kannst ihn als Briefbeschwerer benutzen. Außerdem heißt du so ähnlich, Jannick und Janus, das ist doch fast das Gleiche.«
Der Vater sah seine Tochter an. »Ist das nicht ein bisschen zu impulsiv? Irgendwann würdest du ihn vielleicht gern einem Freund schenken, und dann hast du ihn nicht mehr.«
»Ach was!«
»Vielen Dank, Nina!« Er griff mit der Linken über den Tisch, streichelte den Arm seiner Tochter. »Ich freue mich über die Figur. Sie soll auf meinem Schreibtisch stehen und mir, je nachdem, wie ich mich fühle, ihr ernstes oder ihr heiteres Gesicht zeigen.«
Er wandte sich seinem Sohn zu: »Und was hast du von der Zensurenfront zu melden?«
Ralph wischte sich den Mund mit der Serviette ab. Während die Tochter mehr dem Vater ähnelte, seine graugrünen Augen hatte und das blonde Haar und manchmal sogar sein Mienenspiel, war der Sohn der Mutter nachgeraten, hatte ihr südländisches Aussehen geerbt, ihren dunklen Teint und das fast schwarze Haar. Auch die haselnussbraunen Augen und die Art, wie er seinen Gesprächspartner bisweilen ansah, ein wenig keck, wenn nicht gar herausfordernd, hatte er von der Mutter. Diese zugleich lustigen und listigen Augen waren auf den Vater gerichtet, als der Vierzehnjährige nun antwortete: »Die Einsen holt man sich in den allerersten Klassen und in den allerletzten. In der Pubertät kriegt man Dreien, Vieren und Fünfen. Das ist immer so. Das sagen sogar unsere Lehrer.« Und um seine Behauptung zu untermauern, übertrieb er den Stimmbruch, legte es, als er weitersprach, förmlich an auf die heiseren und krächzenden Töne: »Ihr könnt froh sein, dass ich nicht ausschließlich Fünfen anbringe! Und dabei bin ich wirklich mittendrin.«
Jannick Erdmann zündete sich eine Zigarette an. »Also gehtʼs in zwei Jahren, wenn du halbwegs da hindurch bist, wieder aufwärts?«
»Aber sicher doch!«
»Dann bin ich ja beruhigt. Und wie sieht heute«, fragte er in die Runde, »das Nachmittagsprogramm aus?«
»Ich muss in die Stadt«, antwortete Carola, »zum Zahnarzt. Ich nehme die Kinder mit. Ralph setze ich in Welllingdorf ab; er will mit Norbert Englisch machen. Und Nina möchte sich ein Paar Schuhe kaufen. Wir sind alle drei gegen halb sechs zurück. Und du? Willst du dich erst mal ein bisschen hinlegen?«
»Ja, eine halbe Stunde. Danach habe ich ein paar Arbeiten zu korrigieren.«
Er zog gleich die Schuhe aus und legte sich auf die Couch, winkte seiner Frau zu, als sie das Zimmer verließ.
Neben der Couch stand ein flacher runder Tisch. Auf ihn hatte Jannick Erdmann die Specksteinfigur gestellt, seinem Kopf ganz nah. Er drehte die Figur, betrachtete den Mund des ernsten Gesichtes. Kein Lächeln und nicht so volle Lippen wie auf der anderen Seite. Das Wort ›gedrängt‹ fiel ihm ein. Ein gedrängter Mund. Ein Mund, der Härte verriet.
Das ist es, dachte er, was mir immer gefehlt hat: Härte.
Plötzlich gingen seine Gedanken weit zurück. Er sah sich als Kind. Auf dem Weg zur Schule. Schüchtern. Ängstlich. Mit der Verzweiflung des Sechsjährigen, der nicht zur Schule gehen will. Voller Angst vor dem Hausmeister, der, wie immer, in seinem grauen Kittel an der Tür stehen und Macht ausüben wird, indem er die ins Gebäude drängenden Massen abfängt, sie mit Herrscherblick und strengem Wort zur Räson bringt und in kleine geordnete Gruppen einteilt. Dieses Zittern vor dem Mann mit der Feldherrn-Attitüde, der die Schüler dirigiert, als stelle er Schlachtordnungen auf, der sich einzelne aus der lärmenden Schar herauspickt und sie an die Wand stellt.
Später dann, die erste Stunde hat begonnen, die Angst vor dem Lehrer, vor seinen Kontrollen, selbst wenn alles in Ordnung ist; vor seinen tadelnden Worten ebenso wie vor seinem Notizbuch, diesem schrecklichen Register mit Langzeitwirkung. Und obendrein die Angst vor den Mitschülern, vor ihrer Überlegenheit, die sich allein schon darin zeigt, dass sie keine Angst haben. Mittags, endlich, die Erlösung!
Doch am nächsten Morgen erneut die Beklommenheit und für einen Augenblick sogar der Argwohn gegenüber der Mutter, die es mit den anderen zu halten scheint und ihn, der wieder nicht in die Schule will, zum Gehen drängt, die ihn vorwärtsschiebt, weil er sich mit seinem ganzen kleinen verkrampften Körper auflehnt gegen den qualvollen Weg, sich auf den Fußboden wirft, sodass der Mutter nichts anderes übrigbleibt, als ihn mit dem sich schließenden Türblatt wie mit einem starken Besen ins Treppenhaus hinauszukehren.
Ein anderes Bild. Der Fünfzehnjährige. Immer noch ängstlich gegenüber den anderen, immer noch voller Misstrauen, sobald er es mit ihrer Überlegenheit zu tun hat. Aber da ist auch schon der Zorn über die eigene Schwäche und der heiße Wunsch, anders zu sein, so zu sein wie die Starken, die er fürchtet und hasst und bewundert. Ein kläglicher Versuch, es ihnen gleichzutun, jedoch an der falschen Person, an der Mutter. Ausgerechnet an ihr, bei der es am wenigsten Sinn hat, Überlegenheit zu proben. Das Ergebnis? Ein geschmackloser, hässlicher Sieg: »Führst dich vor mir auf, als hättest du in deinem Leben alles richtig gemacht. Bei dir geht es immer nach Plan, jedes Wort, jeder Schritt. Sogar meine Spiele genau nach der Uhr, und das auch sonntags, wenn so viel Zeit ist. Und jeden Pfennig ins schwarze Büchlein. Mein Taschengeld ist gar keins, weil ich dieses verdammte Buch führen muss. Alles muss da rein, jede Feder, jeder Bleistift, sogar die Löschblätter zu einem Pfennig das Stück. Bist wie ein Revisor, falls du weißt, was das ist. Kein Wunder, dass mein Vater dich schon nach drei Jahren sitzenließ!«
Ja, das hatte wohl ausgesehen wie ein Sieg damals, vor allem wegen ihrer Tränen und weil sie danach tagelang still war.
Jannick Erdmann dachte: Wie konnte ich das nur tun? Wenn ich stattdessen Bert Manski verprügelt hätte, der immer meine Schultasche in anderer Leute Gärten warf, oder wenn ich überhaupt nur irgendwann einmal versucht hätte, einen der vielen, die mich quälten, zu verprügeln, das wäre, selbst wenn ich dabei den Kürzeren gezogen hätte, ein Sieg gewesen. Aber meine Mutter?
Ihm fiel der Zwanzigjährige ein, der sich schon anders präsentierte, zwar immer noch schüchtern und befangen, aber doch schon so, dass es ihm manchmal durch eine lockere Geste und ein derbes Wort gelang, den anderen zu verbergen, wie sehr die Angst sich breitmachte in seinem Bauch.
Er gehörte zu den ersten Bundeswehrjahrgängen, und bei den Soldaten ging es ihm ähnlich wie in der Schule. Er litt unter der ständigen Anwesenheit anderer, empfand ihre Nähe als Bedrohung und das Zusammensein mit ihnen als permanentes Austragen von Rivalität, als den lästigen Zwang, sich immer wieder gegen sie behaupten zu müssen. Aber, im Unterschied zu dem Abc-Schützen von einst, wusste der Soldat Jannick Erdmann, dass es entscheidend darauf ankam, die Bewährungsängste nicht zu zeigen und so zu tun, als sei man gelassen und habe schon wer weiß welche Wagnisse überstanden. Es fiel ihm schwer, dieses Spiel zu spielen, vor allem, es durchzuhalten.
Und noch einmal ein Sieg, der gar keiner war. Der Zufall kam ihm dabei zu Hilfe. In der zweiten oder dritten Woche seines Kasernendaseins, nach einem Quartierwechsel, fand der Unteroffizier vom Dienst unter seiner Matratze eine flache Schachtel, die wohl vom Vorgänger dort vergessen worden war. Vor den Augen der Stubengenossen öffnete der Kapo sie und warf, was er mit spitzen Fingern da herausfischte, auf den Tisch, wobei er mehrmals ausrief: »Ein ganz dicker Hund ist das!«
Was schließlich vor aller Augen dalag, war in der Tat verfänglich: ein Stapel Fotos von nackten Mädchen, ein paar Präservative, ein Damenhöschen, das in einer Streichholzschachtel Platz gefunden hätte, und dann noch etwas, was nicht nur nach Meinung des Unteroffiziers, sondern auch im Urteil des später hinzugezogenen Kompaniechefs als das eigentlich Belastende galt: eine Schachtel in der Schachtel. Der Unteroffizier öffnete sie, roch daran und stellte fest: »Normaler Tabak ist das jedenfalls nicht!« Natürlich hätte Jannick Erdmann die Chance gehabt, die Herkunft des verfänglichen Sortiments aufzuklären. Doch in diesem Augenblick, als er spürte, dass die auf ihn gerichteten Blicke seiner Stubengenossen nicht Ekel und Ablehnung, sondern in überwiegendem Maße Erstaunen und Anerkennung, ja, Bewunderung ausdrückten, witterte er in der Rolle des Überführten eine größere Chance für sich als in dem Bemühen, seine Unschuld zu beweisen, beging also die Flucht nach vorn und nutzte den Eklat zur Schaffung eines wenn auch sehr zweifelhaften Ansehens. Er gestand und nahm sogar den über ihn verhängten Arrest in Kauf. Doch auf die Dauer half ihm das nicht. Schon bald deckten die Stubengenossen auf, dass er der Held oder auch der Unhold, als der er sich zu Beginn ausgewiesen hatte, gar nicht sein konnte.
Später hatte er dann, jedenfalls nach außen hin, doch einen respektablen Weg eingeschlagen. Er hatte sich mit Wissen gewappnet, war Lehrer geworden und also ausgerechnet an die Stelle zurückgekehrt, die seine ältesten und heftigsten Ängste erzeugt hatte.
Merkwürdig, dachte er, dass ich sogar ein ganz guter Lehrer geworden bin, einer, den die Kinder mögen.
Vom Flur her hörte er, dass seine Familie zum Aufbruch rüstete.
Er gähnte, warf noch einen letzten Blick auf die Janus-Figur, schloss die Augen. Bald darauf schlief er ein.
2.
Eine halbe Stunde später ging er in die Küche und kehrte dann mit Kaffee und Keksen ins Zimmer zurück. Die Wintersonne warf ein fahles, hartes Licht in den Raum. Er setzte sich an seinen Schreibtisch. Plötzlich spürte er, dass er sich freute, allein zu sein, und zugleich erschreckte ihn diese Feststellung.
Er stand wieder auf, stellte sich ans Fenster. Verrückt!, dachte er. Es ist verrückt! Sie sind mir doch nicht im Weg, und dennoch habʼ ich das Gefühl, mir seien ganz unerwartet ein paar schöne Stunden geschenkt worden.
Er zündete sich eine Zigarette an, blies den Rauch genussvoll gegen die Gardinen, deren gelbliche Verfärbung schon oft Carolas Unmut erweckt hatte, und beobachtete, wie der graublaue Rauch durch die engen Maschen kroch.
Wieso freue ich mich, allein zu sein?, fragte er sich. Weiß ich doch schon jetzt, dass ich spätestens ab fünf auf die Uhr sehe und darauf warte, dass sie zurückkommen, und mir, wenn sie um Viertel vor sechs noch nicht da sind, Sorgen mache.
Erst jetzt zog er seine Schuhe an. Ein Schuhanzieher war ganz in der Nähe, lag in der Schreibtischschublade, weil Carola es hasste, wenn er die Hacken heruntertrat. Trotzdem stampfte er sozusagen freihändig in die noch ziemlich neuen braunen Slipper, verbog das Leder. Er musste drei-, viermal kräftig zutreten, bis es glatt anlag. Das tat ihm sogar weh, aber es tat ihm auch gut.
Er hatte jetzt keine Lust, Aufsätze zu korrigieren, wollte sich die Hefte später vornehmen, wenn die drei wieder da wären, oder kurz vor ihrer Rückkehr mit der Arbeit beginnen.
Er nahm die Specksteinfigur, stellte sie auf den Schreibtisch, setzte sich davor und drehte sie diesmal so herum, dass ihm weder das heitere noch das ernste Gesicht, sondern eines der beiden seltsam geformten Doppelohren zugekehrt war.
Er überlegte: Wer bin denn nun ich? Der Schattenmann oder der andere? Ich glaube, ich habe von beiden etwas, bin keiner ganz und dann doch wieder mehr als beide zusammen. Ich bin der Schattenmann, aber ich habe nicht die Härte, die von seinem Mund ausgeht; und ich bin auch der Heitere, aber mir fehlt die Gelassenheit dieses Specksteinlächelns. Andererseits habʼ ich einiges, was keiner der beiden mir zeigt. Ich glaube, jeder Mensch ist so vieles und lebt von dem, was er ist, nur einen Bruchteil aus, ähnlich wie die Eisberge immer nur ihre Spitzen zeigen, während der Anteil des Unsichtbaren ein Vielfaches davon beträgt.
Wer ich wohl geworden wäre, wenn mein Vater sich nicht aus dem Staub gemacht, sondern mich früh genug in den Wind gehalten hätte, statt mich meiner Mutter zu überlassen?
Wie hätte mein Weg ausgesehen, wenn ich nicht in Deutschland, sondern an irgendeinem anderen Platz dieser Welt aufgewachsen wäre? Im Norden von Sonora vielleicht, als Kind armer mexikanischer Eltern, das heimlich über die Grenze gehen muss, um drüben, auf der anderen, der gesegneten Seite, in der Baumwollernte zu arbeiten? Dann wäre ich wohl ein tapferer kleiner Bursche geworden, der sich durchbeißt und dem es immer wieder gelingt, den Jägern an der Grenze durch die Lappen zu gehen. Dann wäre ich mit zwanzig ein Mann gewesen, den das Gelächter der anderen kaltlässt, oder sogar einer, bei dem niemand zu lachen wagt.
Denkbar wäre auch, als Sohn des Plantagenbesitzers geboren zu sein, für den diese Mexikaner arbeiten. Dann hätte ich, schon als Kind, die Felder kontrolliert, zu Pferde, und hätte vom Sattel aus den Indios und Mestizen meine Macht gezeigt, natürlich nicht mit der Peitsche, die Zeiten sind längst vorbei, aber mit Blicken und Worten.
Gut wäre auch gewesen, mit fünfzehn oder sechzehn auf ein Schiff zu gehen und um die Welt zu fahren. Dann wäre ich Offizier geworden oder sogar Kapitän, jedenfalls jemand, über den keiner lacht.
Jannick Erdmann fand, dass die Verteilung der Chancen etwas bestürzend Zufälliges hatte, und er überlegte, ob das einmal Ausgeteilte nicht vielleicht doch korrigierbar sei. Ihm fielen Beispiele ein, Fälle, in denen es mutigen und ausdauernden Männern gelungen war, den durch die elterlichen Lebensumstände abgesteckten kleinen Weg zu verlassen und stattdessen den großen zu wagen. Heinrich Schliemann. Hans Christian Andersen. Ja, sogar Karl May fiel ihm ein, der sich aus Armut, Krankheit und Kriminalität befreite, schließlich Ruhm und Wohlstand erreichte.
Aber ich will ja gar nicht den Glanz des großen Schicksals, dachte er, sondern ich lehne mich dagegen auf, aus der Vielfalt der Möglichkeiten nur eine einzige zugeteilt bekommen zu haben, und das ein für alle Mal. Es ist erst wenige Tage her, dass ich vor meiner Klasse den »Malte« zitiert habe. »Das Geheimnis seines noch nie gewesenen Lebens breitete sich vor ihm aus…« Und dann, ein paar Zeilen weiter, die Einfälle, die vielen Möglichkeiten, etwas anderes zu sein, als man war: der Bukanier auf der Insel Tortuga, der Belagerer von Campeche, der Eroberer von Veracruz. Alles Mögliche konnte man sein, sogar ein ganzes Heer oder ein Anführer, zu Pferd oder zu Schiff. Aber auch ein Vogel, ungewiss welcher. Doch am Schluss stand die Zeile: »Nur dass der Heimweg dann kam.«
Ist es nicht genau das, was ich schon immer, schon seit meiner Jugend gekannt habe, das Spiel mit einer beliebigen Existenz? Sind das nicht meine Träume? Und habe nicht auch ich es immer wieder erlebt, dass danach der Heimweg kam?
Ja, überlegte er, sie sind zu anfällig, die Träume. Man müsste ihnen mehr Raum geben, sie mit Vitalität füllen, müsste verhindern, dass schon der kleinste Hauch von Wirklichkeit wie ein Sturmwind in sie hineinbläst und sie zerspellt. Denn sie sind ja meine Zuflucht, mein Refugium, sind der Ersatz fürs Abenteuer, das es in meinem wirklichen Leben nicht gibt. Und plötzlich, er hatte die ganze Zeit an seinem Schreibtisch gesessen, mal auf den Januskopf, mal nach draußen in die Winterlandschaft gesehen, fragte er sich: Warum eigentlich geht es in meinem Alltag so armselig zu? Und wusste die Antwort nur allzu gut: weil es mir am nötigen Mut fehlt. Weil mir immer wieder die Angst in die Quere kommt.
Und plötzlich grübelte Jannick Erdmann nicht mehr und träumte auch nicht. Sondern er plante. Er schob die Aktentasche, die gegen den Schreibtisch lehnte, mit dem Fuß zu sich heran, hob sie auf, öffnete sie, kramte eine Weile zwischen Lehrbüchern und Heften und zog schließlich ein Blatt Papier heraus. Vor ein paar Tagen hatte er es in seinem Fach im Lehrerzimmer vorgefunden, es flüchtig gelesen und dann achtlos in seine Schultasche gesteckt. Nun las er den Text ein zweites Mal und mit wachsendem Interesse.
Das Schreiben enthielt die Einladung zu einem Germanistentreffen in Lübeck. Für eine Woche der bevorstehenden Osterferien sollten Deutschlehrer aus dem gesamten Bundesland sich mit Kollegen aus der Hansestadt treffen, um ihre Erfahrungen im Umgang mit der Studienstufe auszutauschen. Die Teilnehmerzahl war auf dreißig Personen beschränkt. Für Unterkunft in einem Lübecker Hotel, so las er, sei gesorgt. Das Land könne wegen der angespannten Haushaltslage allerdings nur einen Zuschuss zahlen, sodass eine Eigenleistung vonDM 150.- je Teilnehmer erforderlich sei.
Er legte den Bogen aus der Hand. Für einen Moment hatte er das Gefühl, diese Fahrt in das nur achtzig Kilometer entfernte Lübeck sei wohl doch zu belanglos, als dass von ihr Veränderung ausgehen könne. Aber dann sagte er sich: So vieles ist vom Zufall abhängig, man muss ihm nur eine Chance geben. Bisher hat er in seinem Leben keine gehabt, und darum wird es gut sein, für ein paar Tage allein in einer anderen Stadt zu sein. Ich werde durch fremde Straßen gehen und nie gesehene Häuser betrachten und mich vielleicht nach einem Gesicht umwenden, weil es mir auffällt.
Er nahm einen Kugelschreiber zur Hand, zog den Bogen wieder zu sich heran und füllte den Antwort-Coupon aus. Die Frage, ob gegen ein Aufgeld vonDM 60.- Unterbringung in einem Einzelzimmer gewünscht werde, beantwortete er mit Ja. Er schnitt den Coupon ab, steckte ihn in einen Umschlag, adressierte und frankierte ihn, klebte ihn aber noch nicht zu. Er steckte den Brief in seine Aktentasche.
Als Carola und die Kinder kamen, saß er über seinen Klassenarbeiten. Nina zog sich gleich zurück, um ebenfalls für die Schule zu arbeiten. Ralph, in dem Gefühl, an diesem Tag genug geleistet zu haben, ging an die Förde.
Jannick Erdmann schob die Sessel zurecht und setzte sich mit seiner Frau an den flachen runden Tisch. »Übrigens muss ich in den Osterferien für eine Woche verreisen«, sagte er. »Dienstlich.« Er zeigte ihr die Einladung. Sie las die Mitteilung, legte dann den Bogen auf den Tisch. Er erwartete einen Einwand, zum Beispiel, dass es an der Zeit sei, mal wieder zu zweit zu verreisen, aber Carola sagte nur: »Schade um deine Ferien.«
»Die Tagung dauert ja noch nicht mal eine ganze Woche«, sagte er, »nur von Montag bis Freitag.«
»Die Sache ist doch freiwillig, nicht?«
»Ja. Aber da ich nun mal Deutschlehrer der Studienstufe bin und mich all die Jahre um solche Dinge herumgedrückt habe, ist es schon wichtig, da mitzumachen, zumal die anderen nicht können. Der Niemeier lässt sich operieren, und Frau Thorwaldsen hat eine Auslandsreise vor. Ja, und die anderen fahren mit dem vierten Semester nach Berlin, das weißt du ja.«
Es verhielt sich alles tatsächlich so, aber er verschwieg sein privates Motiv, und damit war die erste, wenn auch indirekte Lüge auf dem Tisch. Er hatte das gewusst, hatte in dem Augenblick, als er sich zu der Reise entschloss, begriffen, dass ein Ehemann, der sich im Alter von dreiundvierzig Jahren daranmacht, sein Leben zu ändern, entweder auf die Lüge angewiesen ist oder auf die Konfrontation. Und da er, um beruhigt reisen zu können, unbedingt auch den häuslichen Frieden brauchte, hatte er sich für die Lüge entschieden. Er wusste, das war inkonsequent. Zum Feldzug gegen seine Ängste hätte es gehört, seiner Frau zu erklären: »Du, ich fahre in den Ferien für ein paar Tage weg. Ich muss endlich mal allein sein.« Aber das hätte seinem Vorhaben wahrscheinlich geschadet, es vielleicht sogar vereitelt. Wie er bislang gelebt hatte, bescheiden, fürsorglich, hätte er mit einer so brüsken Erklärung Carola verletzt.
Sie griff über den Tisch hinweg nach seiner Hand. »Ich finde es gut, dass du diese Reise machst«, sagte sie. »Ich schaffe derweil im Haushalt einiges weg. Es ist sicher nicht zu früh, Ninas Umzug nach Hamburg schon ein wenig vorzubereiten. Die viele Wäsche. Etwas Geschirr verpacken. Ihre Bücher zusammensuchen. Ralph fährt in den Ferien ja nach Westensee. So sind wir beiden Frauen also allein, und das ist gut.«
Sie ging aus dem Zimmer. Jannick Erdmann kehrte an seinen Schreibtisch zurück, arbeitete aber nicht, sondern nahm eine Autokarte zur Hand, entfaltete sie und begann, sich auf die kleine Reise zu freuen, so als verhieße sie ihm das Nachholen aller bislang versäumten Abenteuer.
3.
Er konnte nicht einschlafen, griff aber nicht, wie sonst, nach den Tabletten, sondern genoss das Wachliegen, fühlte sich wohl, dachte an die Fahrt nach Lübeck, die mehr sein würde als eine kurze räumliche Trennung von der Familie.
Er lag auf dem Rücken, starrte ins Dunkel und versuchte, leise zu atmen, damit Carola nicht wach wurde. Ich habe etwas Geld, von dem niemand weiß, überlegte er und dachte dabei an die kleine Kassette mit den Zwanzig-Mark-Scheinen, die in seinem Schrankfach im Lehrerzimmer stand. Seit vielen Jahren legte er von Zeit zu Zeit einen Schein da hinein. Weil Carola und er ein gemeinsames Konto unterhielten, war es ihm niemals möglich gewesen, einen größeren Betrag für seinen ganz persönlichen Gebrauch abzuheben. Aber im Grunde hatte er ein solches Bedürfnis auch nie gehabt, und so war diese ›schwarze Kasse‹, in der sich über die Jahre hin eintausendachthundert oder sogar zweitausend Mark angesammelt haben mochten, eine Reserve, über deren Verwendung er sich bislang keine Gedanken gemacht hatte. Nun beschloss er, die Kassette zu leeren, um sich für Lübeck mit einem finanziellen Polster auszustatten.
Natürlich waren mit diesem Plan auch gleich die Skrupel da, aber dann sagte er sich: Ach was! Es ist kein Betrug an meiner Familie, wenn ich ein paarmal die bestimmt nicht sehr opulente Germanistenmahlzeit schwänze und mich insSchabbelhausoder in dieSchiffergesellschaftsetze und dort für zwei Stunden so tue, als wäre ich einer, der aus Kopenhagen oder Amsterdam kommt, sich die Hansestadt ansehen möchte und dabei mit den noblen Küchen beginnt.
Und schon eine Viertelstunde später – er hatte sich leise auf die Seite gedreht und kehrte seiner Frau den Rücken zu – ertappte er sich bei dem Gedanken, das heimlich Gesparte vielleicht doch nicht ganz so harmlos anzulegen. Travemünde!, dachte er. Da stand, keine zwanzig Kilometer von Lübeck entfernt, flankiert von Park und Strand, das große imposante Haus, in dem Abend für Abend die kleine weiße Kugel im Kessel schepperte, ausrollte, in eines der siebenunddreißig mit Zahlen versehenen Kästchen hüpfte und über Glück oder Unglück derjenigen entschied, die um den Tisch saßen und ihr Spiel machten.
Er hatte noch nie ein Casino betreten, kannte aber das Spiel, hatte darüber gelesen und sich auch dann und wann und nie ohne ein leichtes Schaudern den heldischen Bericht über eine am Spieltisch gemeisterte Nervenprobe angehört. Einmal hatte er sich sogar, wenn auch mit Widerstreben und nur, weil man ihn sonst wohl einen Pfennigfuchser und Prinzipienreiter genannt hätte, in privatem Kreis am Roulettespiel beteiligt. Er konnte sich nicht mehr daran erinnern, ob er gewonnen oder verloren hatte. Nur eines wusste er noch genau: dass ihn selbst diese harmlose Nachahmung der großen, sich allabendlich in den Spielbanken wiederholenden Wagnisse deprimiert hatte.
In dieser Nacht sah er die Dinge anders, denn wenn sein verändertes Konzept dazu führen sollte, dass er fortan ohne seine Ängste leben würde, dann war es eben notwendig, zu jedem Risiko bereit zu sein. Ihm kam ein Wort von Oscar Wilde in den Sinn, eines, dessen Richtigkeit er bislang angezweifelt hatte, wie ihm überhaupt dieser Autor nie so ganz geheuer gewesen war. Vor vielen Jahren hatte er dessen »Bildnis des Dorian Grey« gelesen, und vielleicht hatten ihn schon damals die heimlichen Ausschweifungen des Romanhelden zwar abgestoßen, doch zugleich, ohne dass er sich dessen bewusst geworden war, fasziniert. Oscar Wilde hatte über das Geld gesprochen, und Jannick Erdmann, in seiner unfreiwilligen, aber nicht unwillkommenen Nachtwache mit diesem Thema befasst, glaubte nun plötzlich den Worten, die er bis dahin als reinen Zynismus empfunden und abgelehnt hatte. »Als ich jung war«, so hatte Wilde es formuliert, »glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben; jetzt, wo ich alt bin, weiß ich, dass es das Wichtigste ist.«
Ich habe, dachte er, ein halbes Menschenalter dazu gebraucht, um zu erkennen, was andere schon mit zwanzig begreifen: dass Geld vorzüglich dazu geeignet ist, Ängste zu beseitigen, denn es bedeutet Macht, Macht über Menschen, oder wenn nicht das, so doch den Vorteil, von ihnen unabhängig zu sein.
Ganz leise stand er auf, schlüpfte in seine Hausschuhe und schlich zur Tür, öffnete sie behutsam, trat hinaus auf den Flur. Carola schien nichts bemerkt zu haben. Jedenfalls blieb sie liegen, und er wusste, das hätte sie nie getan, wenn sie zu so später Stunde seine Schritte gehört hätte.
Er ging in die Küche, wollte zunächst nichts als einen Apfel, wurde aber plötzlich, beim Anblick der vielen Speisen, zwar nicht hungrig, aber doch gierig und nahm sich von fast allem, was da war: Brot, Butter, Käse, Wurst, Gewürzgurken, Radieschen, verspürte plötzlich den diffusen Drang, sich überall, und seiʼs am familiären Vorrat, seinen Anteil am Wohlleben zu sichern, kochte sogar ein Ei und schenkte sich ein Bier ein. Er trug das gefüllte Tablett ins Wohnzimmer, setzte sich an seinen Schreibtisch und hielt Mahlzeit, während die Janus-Figur zwischen Eierbecher und Salzfass stand und ihm eines ihrer Doppelohren hinhielt.
Danach schob er alles beiseite, auch den Speckstein, zündete sich eine Zigarette an, nahm Papier und Kugelschreiber zur Hand und begann, den Bogen mit Zahlen zu füllen. Im Nu war er der Versuchung erlegen, mit den Gewinnmöglichkeiten des Roulettespieles umzugehen, als seien sie letzten Endes doch verlässliche Größen und das Ergebnis berechenbar.
Aber dann fiel ihm die Geschichte von den beiden Schach spielenden Königen ein. Der Verlierer sollte mit Weizenkörnern bezahlen, und zwar in einer Menge, die sich, bei Verdoppelung pro Feld, aus den vierundsechzig Schachbrettfeldern ergab, was der eine der beiden Spieler für eine Geringfügigkeit hielt. Selbst als sein Gegner es ihm noch einmal erklärte, auf das erste Feld entfalle ein Korn, auf das zweite entfielen zwei Körner, auf das dritte vier und so weiter, schien es ihm immer noch um einen niedrigen Preis zu gehen. Er verlor, und es stellte sich heraus, dass die Weizenernte der ganzen Welt nicht ausreichen würde, diese Schuld zu begleichen. Und ich, dachte Jannick Erdmann, habe höchstens zweitausend Mark in meinem Kasten.
Er zog einen kräftigen Strich durch seine Zahlenreihen, knüllte den Bogen zusammen und warf ihn in den Papierkorb. Vielleicht, so überlegte er, sollte ich ganz forsch den Saal betreten, mich gar nicht erst hinsetzen, meine zweitausend Mark insgesamt auf eines der Felder mit einfacher Chance setzen und, wenn ich verliere, eine Minute später wieder draußen sein, weiterhin an der Germanistentafel speisen und abends, wenn die Diskussion zu Ende ist, durch Lübecks Straßen gehen, einfach nur so, mir die Altstadt ansehen, den Hafen, den Marktplatz und später in meinem Hotelzimmer das Alleinsein genießen. Wenn ich aber gewinne, bleibe ich, stecke den abgezogenen Einsatz tief in die Tasche und mache mit dem Überschuss ein paar riskante Spiele im Bereich der hohen Chancen. Vielleicht verlasse ich das Casino mit zehntausend Mark in der Hand, kaufe mir am nächsten Tag ein paar flotte Sachen zum Anziehen, gehe abends insSchabbelhausund danach durch die Straßen, in dem Bewusstsein, bedenkenlos jede Luxus-Bar betreten zu können.
Oder ich mache es von vornherein ganz anders, lasse die meisten Scheine im Kasten, nehme mir zweihundert Mark heraus, versuche gar nicht erst irgendwelche Kunststücke auf dem grünen Tuch, sondern gehe für das Geld ins Bordell.
Einmal beobachten, wie ein Kleid sich öffnet, das nicht bei mir zu Hause im Schrank hängt! Einmal eine Brust fühlen, von der ich eine Stunde vorher nicht wusste, dass es sie gibt! Einmal ganz junge Beine berühren, denn natürlich gehʼ ich zu einer, die nicht älter ist als Marlies Menke. Vorher möchte ich eine Zigarette mit ihr rauchen, ihr dabei gegenübersitzen und ihren schönen Schoß betrachten.
Ihm wurde warm bei diesen Gedanken, und mit Erschrecken spürte er seine Erregung.
Plötzlich kam Nina ihm in den Sinn, die in demselben Alter war wie seine Traumfiguren. Mein Gott, Nina!, dachte er; wenn ich mir vorstelle, dass womöglich ein Dreiundvierzigjähriger…
Er stand auf, war mit einem Male unzufrieden, fand es auch gar nicht mehr in Ordnung, nachts zwischen zwei und drei so viel gegessen zu haben. Er räumte das Geschirr weg, leerte den Aschenbecher, löschte das Licht und schlich zurück ins Schlafzimmer.
Als er sich hingelegt hatte, hörte er, wie Carola sich bewegte.
»Kannst du nicht schlafen?«
»Nein«, sagte er. »Ich wachte plötzlich auf und konnte nicht wieder einschlafen.«
»Wie spät ist es?«
»Gleich drei.«
»Musst du morgen das erste Schiff nehmen?«
»Ja.«
Sie schaltete die Nachttischlampe ein, richtete sich halb auf. »Hast du irgendwelche Sorgen? Oder warum schläfst du nicht?«
»Nein, keinerlei Sorgen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht habe ich zu schwer gegessen.«
»Aber wir haben doch ganz normal gegessen.«
»Ja, ja. Vielleicht habʼ ich auch irgendwas geträumt. Ich hole den versäumten Schlaf morgen Mittag nach.«
»Mir ging es vorgestern so. Da konnte ich nicht einschlafen. Es waren die Gedanken. Manchmal überfallen sie einen, ohne dass man sich wehren kann, grad vorm Einschlafen, und dann rotieren sie im Kopf, pausenlos. Vorgestern dachte ich plötzlich daran, wie es wohl in ein paar Jahren sein wird, wenn Nina und Ralph aus dem Haus sind. Ich kann mir die Stille gar nicht vorstellen.«
»Ja«, sagte er, »dann wird es vielleicht ein bisschen einsam werden hier bei uns.«
»Ich habʼ aber auch schon was anderes gehört«, Carola richtete sich noch weiter auf, »nämlich, dass Eltern wieder neuen Schwung kriegen und zu sich selbst finden, wenn plötzlich kein Kind mehr da ist, das sie beansprucht. Bei Römers war es so. Sie haben drei Kinder, und als das letzte, der Rudi, aus dem Haus war, fingen sie an zu reisen. Große Reisen. Nach Amerika und Indien. Im vorigen Jahr haben sie Verwandte in Buenos Aires besucht und danach, die beiden allein, halb Brasilien bereist. Frau Römer erzählte davon wie ein junges Mädchen, das mit seinem Freund durch die Welt getrampt ist. Ich fand das großartig.«
»Ralph braucht noch fünf, vielleicht sogar, wenn es bei den jetzigen Zensuren bleibt, sechs Jahre, bis er mit der Schule fertig ist. Und dann bin ich fast fünfzig.«
»Fünf Jahre vergehen schnell, und fünfzig ist kein Alter. Ich finde, wir sollten uns etwas vornehmen für die Zeit danach. Dann könnte es noch mal so ähnlich werden, wie es am Anfang war. Wir sollten versuchen, wieder ein bisschen so zu werden wie damals, als wir jung verheiratet waren. Beweglich. Schwungvoll.«
»Zwei studierende Kinder kosten viel Geld. Da bleibt für Amerika und Indien und Brasilien nichts mehr übrig.«
»So meine ichʼs ja gar nicht. Es brauchen doch keine Weltreisen zu sein. Wir könnten uns jeder ein neues Fahrrad kaufen und dann mal wieder die Ostsee abfahren, von Lübeck bis Flensburg. Und dann die Nordsee. Von der dänischen Grenze bis zur holländischen. Von mir aus auch mit dem Zelt. So viel Geld wird uns ja wohl noch bleiben, dass wir uns solche Radtouren leisten können.«
Jannick Erdmann empfand ein gewisses Unbehagen beim Anhören solcher Pläne. Er liebte Carola und konnte sich nicht vorstellen, sie je zu verlassen, aber was er vorhatte, musste auf alle Fälle ohne sie stattfinden und auch ohne ihr Wissen.
Er wollte das Thema wechseln, fragte: »Wie es Nina wohl ergehen wird, wenn sie von zu Haus weg ist? Ich kann mir ihr Leben in Hamburg gar nicht richtig vorstellen. Ein kleines Zimmer irgendwo in dieser großen Stadt und darin eine Neunzehnjährige, die vor kurzer Zeit noch ein Kind war.«
»Du, ich glaube, Nina freut sich auf die Zeit.«
»Aber sie wird auch Heimweh haben.«
»Natürlich, das gehört dazu, und wenn ihr wirklich mal die Decke auf den Kopf fällt, setzt sie sich in den nächsten Zug und fährt nach Hause.«
Sie schwiegen eine Weile, und dann sagte er: »Manchmal frage ich mich, ob Nina und Ralph mit uns zufrieden sind. Ich meine, mit dem, was wir ihnen bieten.«
»Das ist keine gute Frage«, antwortete Carola, »Kinder ziehen nicht Bilanz. Sie halten den Eltern nicht die Dreieinhalbzimmerwohnung vor und nicht den Mittelklassewagen, und sie vergleichen auch nicht mit dem Luxus in anderen Häusern. Aus Instinkt machen sie so was nicht. Und wenn doch, dann meistens positiv. Dann vergleichen sie das, was ihre Eltern erreicht haben, mit dem wenigen, das andere Eltern geschafft haben. Es stimmt, unsere Kinder sind weich und verwöhnt, aber sie sind auch sensibel und haben viel Sinn für Gerechtigkeit und wollen nicht verletzen. Viel eher würden sie ihren Vater fragen, was er während der Nazizeit gemacht hat und wie er als Soldat gewesen ist. Sie fragen, so verrückt das klingen mag, nach Tugenden. Das hast du übrigens auch getan, genauer gesagt, du hast die Untugenden deines Vaters verurteilt.«
»Stimmt, und jetzt habʼ ich manchmal Zweifel, ob das richtig war. Ob zum Beispiel meine Mutter mir alles korrekt dargestellt hat. Als Heranwachsender ergriff ich manchmal Partei für ihn, aber immer nur dann, wenn ich mit ihr Ärger hatte und sie treffen wollte. Das war natürlich eine Gemeinheit. Im Grunde habʼ ich ihn immer verurteilt, habʼ nie verstanden, wie man eine Frau und ein Kind allein lassen kann. Heute frage ich mich, ob da nicht irgendetwas war, was ihn wegtrieb. Eine innere Unruhe, für die er nichts konnte. Vielleicht das Gefühl, mit seiner Rolle als Ehemann und Vater den Stillstand besiegelt zu haben, nichts Neues mehr erwarten zu können und lebenslänglich auf dem toten Gleis zu stehen. Vielleicht war sein Weggang die Korrektur eines Irrtums.«
»Was seine Schuld nicht verringern würde.«
»Sicher nicht. Nur, lebt nicht jeder Mensch mit irgendeiner Unordnung in seiner Seele? Mit Fehlern? Großen oder kleinen? Mein Vater hatte den Mut, Schuld auf sich zu laden, indem er wegging. Aber man sollte auch fragen: Was wäre geworden, wenn er geblieben wäre und sein Leben lang die Sehnsucht, wegzugehen, vor meiner Mutter und mir verborgen gehalten hätte? Für ihn wäre es dann vielleicht die lebenslange Tragödie geworden.«
»So wurde es eine für deine Mutter.«
»Wer weiß, ob sein Bleiben sie ihr erspart hätte.«
»Mir scheint, du hast zum ersten Mal ernsthaft über deinen Vater nachgedacht. Wieso eigentlich? Wieso plötzlich jetzt?«
»Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich im Unterricht so viel über Freiheit geredet habʼ, über die Freiheit des Einzelnen, die nicht restlos verlorengehen darf in der Bindung an andere. Ich habe auch erklärt, dass man es respektieren soll, wenn jemand meint, einen neuen Weg gehen zu müssen.«
»Auch wenn andere dabei auf der Strecke bleiben?«
»Unter Umständen auch dann. Als mein Vater damals nach Chile ging, hatte er vielleicht das Gefühl, etwas für sein Leben unendlich Wichtiges zu versäumen, wenn er diesen Schritt nicht täte.«
»Aber er hätte deine Mutter und dich mitnehmen können.«
»Vielleicht gerade das nicht. Vielleicht war das äußere Ziel, also Chile, weniger wichtig als das innere, nämlich allein wegzugehen. Wer weiß das? Vorstellen könnte ichʼs mir. Aber ich glaube, jetzt sollten wir das Licht ausmachen, sonst schlafe ich morgen vor meiner Klasse ein. Machst du mir zum Frühstück einen doppelt starken Kaffee?«
»Natürlich.« Carola strich ihrem Mann übers Haar. Dann löschte sie das Licht.
4.
Der Frühling hatte die Förde verschönt. Die schmutzig-weißen Eiskrusten waren verschwunden. Sogar die Möwen schienen sich geputzt zu haben, so blank leuchtete ihr Gefieder vor dem Hintergrund aus blauem Himmel und stahlgrauem Wasser. An den Ufern begann es grün zu werden. Vereinzelt sah man auch schon Segel über die Bucht kreuzen, und auf dem Kitzeberger Golfplatz fanden sich die ersten Besucher ein.
Drei Wochen waren vergangen, seit Jannick Erdmann den Entschluss gefasst hatte, sein Leben zu ändern. Während dieser Zeit hatte sich sein Verhalten gegenüber den Mitmenschen geändert, nicht einschneidend, aber doch so, dass Carola und die Kinder ihr Vergnügen hatten und dass ein Kollege einmal seinem Nachbarn im Lehrerzimmer zuflüsterte: »Was ist denn mit dem Erdmann los? Der hat ja eine verdammt gute Phase.«
Als der Abreisetag gekommen war, stand Jannick Erdmann mit Carola vor dem Haus. Ralph war schon am Tag davor zu einem Freund nach Westensee gefahren. Nina schlief noch. Es war halb acht. Um neun, so hatte es in den Tagungsunterlagen geheißen, sollten sich die Teilnehmer im Hotel einfinden. Sogar ein Prospekt mit Lageskizze war bei den Papieren gewesen. Das gutbürgerliche Haus, so hieß es da, war ein Hotel der gehobenen Mittelklasse; es lag etwas abseits von einer Hauptverkehrsstraße zwischen Bahnhof und Holstentor.
»Nun gönnʼ dir aber auch genügend freie Zeit!«, sagte Carola. »Schließlich sind es deine Ferien.«
»Keine Sorge!«, antwortete er. »Man hat uns das Programm nicht allzu vollgepackt. Ich rufe dich heute Abend an. Grüß Nina! Und macht ihr euch auch ein paar schöne Tage!« Er küsste seine Frau, stieg ins Auto, fuhr los.
Als er die östlichen Stadtrandbezirke verlassen hatte und an den offenen Frühjahrsfeldern entlangfuhr, war ihm, als habe er eine jahrzehntelang erduldete Fron abgeschüttelt und fahre nun geradewegs in die Freiheit. Er war glücklich, sang vor sich hin, pfiff. Plötzlich aber, so als sei er zur Besinnung gekommen, spürte er die Übertreibung, schämte sich fast. Ich führe mich auf wie ein Kind, dachte er, das jahrelang sein Taschengeld gespart hat und nun zum Jahrmarkt fährt. Oder wie jemand, der zu einer Weltreise aufbricht oder gradʼ aus dem Gefängnis kommt! Ja, das sagte er sich, und dennoch, so als sei da nun mal eine Automatik in Gang geraten, die nicht mehr aufzuhalten war, sang und pfiff er weiter und unterließ es dann auch, sich selbst in die Parade zu fahren. Denn zumindest einen Umstand gab es, der die Dimension seines Unternehmens erweitert hatte. Er fuhr nicht zu dem Germanistentreffen. Vor acht Tagen hatte er in der Schule den Bescheid bekommen, dass seine Meldung zur Teilnahme zwar innerhalb der gesetzten Frist eingegangen, der Kreis der Interessenten jedoch überraschend groß sei und darum diejenigen, die sich erst spät entschlossen hätten, nicht berücksichtigt werden könnten. Die Nachricht hatte ihn verärgert und enttäuscht, aber dann war er zu dem Entschluss gekommen, trotzdem nach Lübeck zu fahren, auf eigene Rechnung und mit eigenem Programm.
Nach dem Unterricht war er ins Schulamt gefahren und hatte sich dort einen ganzen Satz Unterlagen, inklusive Hotelprospekt, besorgt. So war er, mit authentischem Material hinreichend gewappnet, seiner Frau gegenübergetreten, hatte sich mit ihr über einige der im Programm aufgeführten Themen unterhalten und vor ihr wie auch vor den Kindern den Eindruck bestehen lassen, er nehme an dem Treffen teil.
Der Umstand also, dass er während der nächsten Tage unbegrenzt Zeit haben würde, beflügelte ihn, als er nun am Steuer seinesPeugeotsaß, eine von Ninas Cassetten hörte und durch das Gebiet der holsteinischen Seen in Richtung Süden fuhr.
Wenig später betrat er das Foyer des Hotels. Das Zimmer, das man ihm zuwies, lag im zweiten Stock und war von mittlerer Größe. Die Einrichtung entsprach der gut geführter Häuser.
Er leerte seinen Koffer, hängte die Garderobe in den Schrank und verteilte die anderen Reise-Utensilien. Dann zog er sich aus und schlüpfte in seinen Bademantel. Er ließ Wasser in die Wanne im Badezimmer einlaufen, zündete sich eine Zigarette an, setzte sich auf den Wannenrand. Wieder befiel ihn, ähnlich wie vorher am Steuer seines Wagens, ein Gefühl der Freiheit. Und wieder auch hielt er es zunächst für unangemessen und dann doch für gerechtfertigt. Und er fand Argumente, die letzten Endes alle auf dasselbe hinausliefen: Niemand steht hinter dieser Tür und wartet darauf, dass ich endlich herauskomme! Ich darf hier rauchen, ohne dass jemand das kritisiert oder wortlos das Fenster aufreißt! Ich kann so lange baden, wie ich will, fünfzehn, zwanzig Minuten, ja, eine halbe Stunde, und brauche mich nicht in hektischer Eile abzutrocknen! Ich kann mir sogar ein Bier mit in die Wanne nehmen und nachher den Fernseher anstellen, obwohl es Vormittag ist! Ich kann mich auf einem der Betten ausstrecken, und kein Staubsauger wird mich vertreiben! Mein Gott, ich kann mich eine Stunde lang mitten ins Zimmer stellen und brauche nicht eine Sekunde lang das Gefühl zu haben, jemandem im Weg zu sein!
Er drehte den Wasserhahn zu, hängte seinen Bademantel auf und stieg in die Wanne. Es war grotesk: Zwanzig Jahre lang hatte er den Aufenthalt in der Badewanne immer auf sechs, sieben, höchstens auf zehn Minuten beschränkt, und darum kannte er es gar nicht anders, als dass sich beim Ausstrecken im warmen Wasser neben dem Behagen sofort auch Bedauern einstellte, darüber nämlich, dass der wohlige Zustand so bald schon wieder vorüber sein würde. Jetzt aber tauchte er bis über die Ohren ins Wasser und blieb lange reglos liegen.
Er dachte daran, dass er sich für die Telefongespräche mit Carola eine Strategie zurechtlegen musste. Das Telefon, so ging es ihm durch den Kopf, war zwar ein nützliches Ding, und er empfand es als angenehm, abends von seinem Zimmer aus mit Carola sprechen zu können, doch es hatte auch Nachteile. An- und Abwesenheit zum Beispiel konnten immer überprüft werden. Ich rufe sie jeden Abend an, überlegte er, und berichte ihr von den Diskussionen in Sachen Germanistik, nicht zu ausführlich, aber auch nicht zu kurz.
Er stieg aus der Wanne, trocknete sich ab, zog den Bademantel wieder an, setzte sich an den kleinen Schreibtisch. Dort stand die Janus-Figur, die er am Morgen noch schnell in einen Pullover gewickelt und in den Koffer gelegt hatte.
Er zählte sein Geld. Rund zweitausenddreihundert Mark. Das war nicht wenig, aber auch nicht viel, gemessen daran, dass Unterkunft und Verpflegung ihn nun, da er auf eigene Rechnung unterwegs war, weit mehr kosten würden als zunächst angenommen. Für seine Extravaganzen blieben allenfalls eintausendsiebenhundert Mark.
Er steckte die Scheine in die Tasche des Bademantels, rief den Zimmer-Service an, bestellte Kaffee.
5.
Es war dunkel geworden, und er war unterwegs. Gegen fünf Uhr hatte er imRatskeller