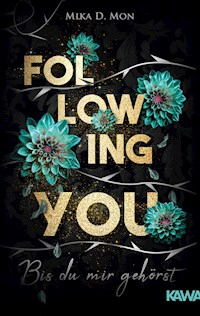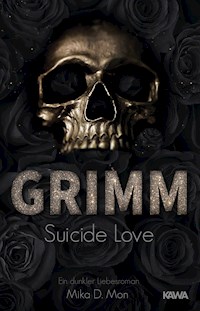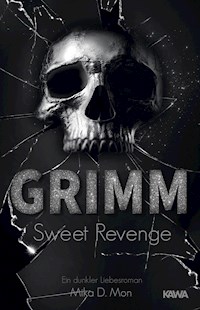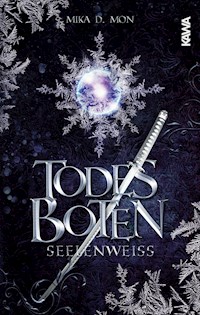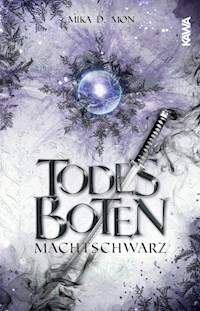Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampenwand Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Following You
- Sprache: Deutsch
"Es gibt Ereignisse im Leben, die Narben auf der Seele hinterlassen, welche so tief sind, dass man sie nicht mehr zu verbergen vermag."Der spannend-romantische zweite Band der Following You Reihe.ER: Dein Leben liegt in Trümmern. Es ist meine Schuld. Der Sturm, den ich entfesselt habe, holt uns beide ein. Wir können nicht vor ihm fliehen. Wir müssen kämpfen, selbst, wenn es unseren Tod bedeutet.Komm, meine Prinzessin, nimm meine Hand und entdecke mit mir zusammen deine Dunkelheit.Traust du dich?SIE: Ich stehe in den Scherben meines Lebens und meiner Selbst. Wer muss ich sein, damit ich überleben kann? Ich werde mich nicht unterkriegen lassen. Eine Königin steht auf und zieht ihr Schwert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Following You
Bis du nicht mehr fliehen kannst
Mika D. Mon
Inhalt
Vorwort
Deeper. Darker. D.Mon
Dark Romance
1. Sie
2. Er
3. Er
4. Sie
5. 2 Wochen später …
6. Er
7. Sie
8. Er
9. Sie
10. Er
11. Sie
12. Er
13. Sie
14. Er
15. Sie
16. Er
17. Sie
18. Sie
19. Er
20. Sie
21. Er
22. Sie
23. Er
24. Sie
25. Er
26. Sie
27. Er
28. Sie
29. Er
30. Sie
31. Sie
32. Sie
33. Er
34. Sie
35. Er
36. Sie
37. Sie
38. Sie
39. Er
40. Sie
Band 3
Danksagung
Valentine Mine:
Unser Licht gegen die Dunkelheit
Angels deserve to die:
Bücher von Mika D. Mon
Über die Autorinnen
Vorwort
Du stehst auf gefährliche Männer, prickelnde Gefühle und verbotene Liebe?
Dann bist du bei uns genau richtig. Bei uns findest du Dark Romance mit Tiefgang. Bücher, die dich fesseln und nicht mehr loslassen!
Deeper. Darker. D.Mon
Mika D. Mon
Following
You
Bis du nicht mehr fliehen kannst
Gewidmet all denen, die Narben auf ihrer Seele tragen.
Dark Romance
www.mikadmon.de
©2020 Mika D. Mon,
Freiherr vom Stein-Str.5 35085 Ebsdorfergrund
1. Auflage
Covergestaltung: Mika D. Mon, Einstrom.com
Coaching & Marketing: Einstrom.com
Druck: Druckerei Engelmann, Christian Engelmann, Weststraße 48, 09212 Limbach-Oberfrohna
ISBN: 978-3-96698-635-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Sie
Mein Hals wird von einem brennenden Kloß zugeschnürt, der mich zu ersticken droht, als ich an Seth denke. Sein markantes Gesicht mit den dunklen Schatten unter den braunen Augen taucht in meinem Geist auf. Ich kneife meine Lider zusammen und versuche es zu verdrängen. Ich weiß, dass ich froh sein sollte, zurück zu sein, und irgendwie bin ich es auch. Dennoch fühle ich mich innerlich verletzlich und roh. Wie eine offene Wunde.
Es ist fremdartig und vertraut zugleich, auf unser Haus zuzugehen. Wie in einem Traum. Mein Vater hat einen regelrechten Betonbunker für uns erschaffen und sogar Personenschützer eingestellt. Ich kam mir vor wie eine Gefangene in meinem eigenen Heim. Und doch waren all seine Vorsichtsmaßnahmen nicht genug – seine Ängste, dass uns etwas zustoßen könnte, haben sich aller Vorsorge zum Trotz bewahrheitet.
Ich bin entführt worden, damit mein Vater erpresst werden konnte. Weil sein Pharmaunternehmen ein Medikament entwickelt hat, welches demenzkranken Patienten helfen würde. Natürlich machen einige Unternehmen sehr viel Geld mit den Krankheiten der Menschen und sind nicht erfreut, wenn ihre teuren, aber minderwertigen Produkte von einem günstigeren und effektiveren Präparat verdrängt werden. Es war mir klar, dass diese Firmen sich wehren würden. Aber ich dachte, dass sie es über Anwälte und teure Deals machen würden. So wie ich es von einer hochentwickelten Gesellschaft im 21. Jahrhundert erwartet hätte.
Es war naiv von mir, das zu glauben. Wenn es um Gier, Neid und Geld geht, kehren die Menschen zurück zu ihren animalischsten Vorgehensweisen und versuchen wenn nötig, ihr Territorium mit Gewalt zu verteidigen. Selbst wenn das bedeutet, einem unschuldigen Mädchen Körperteile abzuschneiden, sie zu schänden und sogar zu ermorden.
Und um sich selbst nicht die Finger schmutzig zu machen, heuern die schicken Männer in Anzügen und glänzenden Lackschuhen Organisationen an, welche die Drecksarbeit für sie erledigen.
Auftragsmörder.
Männer ohne Gewissen.
Männer, die ihr Geld mit Grausamkeiten und Blut verdienen.
Männer wie Seth.
Seth, der von meinem Vater engagiert war, mich zu beschützen. Seth, der ein doppeltes Spiel gespielt hat, um sich in eine feindliche Organisation einzuschleichen. Der mich bewacht, entführt und befreit hat. Der mich von Anfang an fasziniert hat. Seth, der vor einigen Sekunden davongefahren ist und mich ohne Vorwarnung, ohne meine Meinung zu hören oder meine Gefühle zu beachten, nun zurück in die Welt wirft, aus der er mich vor einigen Tagen entführt hatte.
Ich steige die Treppen zur Haustür nach oben und drücke den Klingelknopf, da ich meine Handtasche mit meinem Schlüssel, meinem Handy und meinem Geldbeutel nicht wiederbekommen habe.
Es dauert nicht lange, bis ich Schritte und Gemurmel höre. Ich schaue in die Überwachungskamera neben dem Eingang und winke müde, da ich mir denken kann, dass mein Vater, Dimitri oder wer auch immer die Tür öffnen wird, zunächst überprüft, wer dieser nächtliche Besucher sein mag.
Plötzlich wird die Tür aufgerissen und mein Vater steht vor mir. Seine Haare sind grauer als vor ein paar Wochen, sein Gesicht dünner und voller Furchen und Falten. Er sieht müde und abgekämpft aus, doch in dem Moment, als mein Blick seinen trifft, fangen seine trüben Augen an zu leben.
»Viktoria«, haucht er und schließt mich fest in seine Arme.
»Papa!« Ich drücke mich an ihn und vergrabe mein Gesicht an seiner Brust. Es tut gut, seine Wärme und seine Liebe zu spüren. Erst in seiner Umarmung fühle ich mich wirklich Zuhause. Nicht dieser Betonklotz, in dem wir wohnen.
»Gott, ich bin so froh, dass du lebst. Mein Schatz, geht es dir gut?« Er zieht mich noch einmal eng gegen sich, ehe er mich von sich drückt und mich von oben bis unten begutachtet. Er umfasst mein Kinn und dreht meinen Kopf, um meine Blessuren zu sehen. Dass ich von Samuel zusammengeschlagen worden bin, hat mein Vater am Telefon live miterlebt.
»Es ist alles okay, Papa.« Ich versuche, ihn zu beruhigen, indem ich ein Lächeln auf meine Lippen kämpfe. »Ich lebe und ich bin wieder hier.«
Die rauen Hände meines Vaters streichen verzweifelt über mein Gesicht und meine Schultern, ehe er mich wieder an sich zieht. An seiner zitternden Brust kann ich vermuten, dass er weint. Ich lege meine Arme um ihn und halte ihn fest, dabei blicke ich über seine Schulter hinweg in den Hausflur.
Dimitri und Ansgar, die beiden Personenschützer, die mein Vater angeheuert hat, stehen einige Schritte hinter uns und sehen aus, als wäre ihnen soeben ein gigantischer Stein vom Herzen gefallen. Sie haben ihre strammen Körperhaltungen abgeworfen und lassen die Schultern erleichtert sinken. Um Dimitris Mundwinkel spielt ein leichtes Lächeln, als ich ihn anblicke.
Neben den beiden Bodyguards befinden sich noch mehr Personen im Flur. Eine große, schlanke Frau Ende fünfzig in schickem Hosenanzug und ein etwas jüngerer Mann in Jeans und Jackett. Beide sehen autoritär aus, doch auch in ihren Gesichtern spiegelt sich Erleichterung.
»Herr König, würden Sie bitte mit Ihrer Tochter in das Haus kommen und die Tür schließen?«, meldet sich die Dame zu Wort.
»Ja, ja. Natürlich.« Mein Vater löst sich nur zögerlich und widerwillig von mir. Er greift nach meiner Hand und hält sie fest, während er mich mit sich nach drinnen zieht.
»Unsere Kollegen haben den schwarzen Maserati bereits gesichtet und die Verfolgung aufgenommen«, verkündet die Frau und hält ihr Smartphone in die Höhe. »Frau König«, wendet sie sich an mich, »ich bin Kriminalkommissarin Lübke. Meine Aufgabe und die meines Kollegen Kommissar Freibach ist es, schwere und organisierte Kriminalität zu verfolgen.«
Sie schüttelt meine freie Hand kräftig und redet sofort weiter auf mich ein. Irgendwas über Entführung, verschiedene kriminelle Organisationen und die Dringlichkeit, dass ich ihr alles erzähle. Der Schwall ihrer Worte überfordert mich derart, dass ich nicht in der Lage bin zu antworten.
Die Information, dass der Maserati, in dem sich Seth befindet, von der Polizei verfolgt wird, frisst alle Kapazitäten in meinem Gehirn auf. In mir wütet der Drang, sie abzuhalten. Zu behaupten, dass der schwarze Wagen der Falsche ist. Dass das nicht derjenige ist, den sie suchen. Doch meine Zunge liegt wie ein Stein in meinem Mund. Schwer und unbeweglich.
Als ich keine Antwort gebe, sondern nur schweigend und apathisch mit meinem Vater ins Wohnzimmer gehe, fängt Frau Lübke wieder an, auf mich einzureden.
»Frau König, Ihre Erfahrungen in den letzten Tagen sind der Schlüssel zu …«
Sie wird unterbrochen, als sich Dimitri räuspert. Irritiert hält sie inne und sieht ihn an.
»Die Mafia wird morgen auch noch bestehen, Frau Lübke«, sagt er nur, woraufhin sie mit dem Kiefer mahlt, aber schweigt. Stattdessen wendet sie sich ab, holt ihr Mobiltelefon hervor und kontaktiert den Rettungsdienst, während sie den Raum verlässt.
Kurz überlege ich, sie davon abzuhalten und bin der festen Überzeugung, dass ich keinen Arzt brauche – doch vermutlich würde sie sich ohnehin nicht aufhalten lassen.
Ich lasse mich zusammen mit meinem Vater auf das Sofa sinken und lehne mich an ihn, während er einen Arm um mich legt.
»Es tut mir so leid, meine kleine Prinzessin, dass es soweit gekommen ist. Dass du das alles durchmachen musstest, nur weil ich dieses Medikament unbedingt auf den Markt bringen wollte. Ich wusste, wie gefährlich es ist, wie groß die Unternehmen sind, mit denen ich deswegen in Konflikt geraten würde. Ich dachte, ich könnte uns beschützen, aber letztendlich habe ich versagt.« Die Stimme meines Vaters bricht und er umfasst meine Hand mit seiner.
»Nein, Papa!«, erwidere ich energisch. »Du darfst dir keine Vorwürfe machen. Du hast alles in deiner Macht stehende getan und alles versucht, um uns zu schützen. Dimitri und Ansgar sind fantastische Personenschützer. Außerdem hast du noch mehr gemacht. Mich noch von anderen bewachen lassen! Dass das alles passiert ist, war nicht deine Schuld!«
In Wahrheit war es Seth, der mich entführt und dieser Situation ausgeliefert hat. Hätte er nicht dieses doppelte Spiel gespielt und mich einfach nur beschützt, so wie mein Vater es beauftragt hatte, wäre mir nie etwas zugestoßen. Immerhin war er es gewesen, der mich entführt und diesen Los Caídos ausgesetzt hatte. Einer Mafia-Gruppierung, die von den Feinden meines Vaters beauftragt worden war, ihn mit meinem Leben zu erpressen, um das Medikament nicht auf den Markt zu bringen. Doch obwohl ich versuche mir Seth als schuldigen einzureden, gelingt es mir nicht, mich selbst davon zu überzeugen. Vielleicht, weil ich ihm tief in meinem Inneren nicht als Schuldigen sehen will.
»Das Wichtigste ist, dass ich wieder hier bin und dass es mir gut geht!«
»Du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich bin, mein Schatz«, antwortet mein Vater.
Es dauert nicht lange, bis der Krankenwagen ankommt und mich die Sanitäter noch vor Ort inspizieren. Wie erwartet stellen sie nichts Bedenkliches fest, was meinen Vater sehr erleichtert. Dennoch werden einige Fotos von meinen Wunden zu Dokumentationszwecken gemacht.
Gleichzeitig kommt eine Polizeipsychologin an, die, wie sich herausstellt, die letzten Tage auch meinen Vater betreut hat. Sie zieht sich mit mir in die Küche zurück und versucht dort weitaus feinfühliger als Frau Lübke mit mir zu sprechen.
Aber selbst mit der sensiblen Psychologin möchte ich nicht reden. Die Erlebnisse sind noch zu nah und ich habe Angst, Seth und die anderen mit meinen Aussagen in Gefahr zu bringen. Ich weiß, dass es hier um mehr geht als um meine Entführung. Um die Bekämpfung von organisiertem Verbrechen. Im Moment bin ich jedoch noch nicht in der Lage, meine Erfahrungen zu schildern. Die Taubheit in meinem Inneren ist zu erdrückend und der Gedanke, dass Seth in diesem Moment vor der Polizei flieht, vielleicht sogar schon geschnappt wurde, kreist unentwegt durch meinen Kopf.
Was, wenn sie ihn erwischen und er für immer eingesperrt wird? Er hat Glück, dass ihm die deutsche Justiz droht und nicht zum Beispiel die amerikanische, denn dort hätte er ein ganz anderes Strafmaß zu erwarten. Ich versuche, mich mit dem Gedanken zu beruhigen, dass er im schlimmsten Fall Lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung erhalten würde. Vielleicht wäre das ja auch gar nicht so verkehrt. Immerhin ist er ein Mörder.
Kaum habe ich es geschafft, mich mit diesem Gedanken halbwegs zu beruhigen, spielen sich Horrorszenarien vor meinem inneren Auge ab, wie er auf der Flucht vor der Polizei verunglückt oder geschnappt und erschossen wird, weil er sich nicht ergibt. Als Kind habe ich meine lebhafte Fantasie geliebt, doch in diesem Moment verfluche ich sie.
Ich fange vor der Psychologin an zu schluchzen, doch auch diesmal kommen keine Tränen. Ich stehe auf und laufe auf und ab, um mich abzulenken.
»Alles gut, Frau König. Sie haben vermutlich schlimme Dinge erlebt. Es ist vollkommen natürlich und in Ordnung, jetzt die Gefühle herauszulassen«, sagt die Psychologin ruhig. »Versuchen Sie nur tief ein- und auszuatmen.«
Ich weiß, dass ich kurz vorm Hyperventilieren bin. Aber in mir wütet ein Orkan aus verschiedensten Gefühlen. Angst, Enttäuschung, Erleichterung, Panik, Sorge und gleichzeitig hämmern die beiden Hälften meines gebrochenen Herzens gegen meine Brust. Ich kann den Sturm in mir nicht herauslassen. Ihn nicht zeigen. Niemand würde verstehen, wieso ich mir solche Gedanken wegen meines Entführers mache.
Aber ich weiß, dass Seth nicht freiwillig Auftragsmörder geworden ist. Grimm sagte mir bereits, dass er dazu gezwungen wird, und soweit ich das mitbekommen habe, wird er von der Organisation, für die er arbeitet, erpresst. Irgendwelche Schulden, die sein Vater ihm nach seinem Selbstmord hinterlassen hat, die er jetzt abarbeiten muss.
Während ich in der Küche auf und ablaufe, versuche ich erneut, die Gedanken an ihn loszuwerden.
Wie soll ich meiner Familie und meinen Freunden jemals die Wahrheit sagen? Wie kann ich Seth, Grimm und Ace beschützen, ohne andere Menschen zu gefährden?
Als ich mich einigermaßen beruhigt habe, setze ich mich wieder hin und sehe die Psychologin an. Diese lächelt freundlich und verständnisvoll.
»Alles gut, Frau König. Jetzt sind Sie in Sicherheit.«
Sicherheit? Ich weiß, dass dieses Wort ab jetzt nur noch eine Illusion ist. Das, was mir die letzten Tage zugestoßen ist, war nur ein Vorbote dessen, was geschehen wird. Seth hat Luis Angelo umgebracht, um mich zu beschützen. Er hat einer Mafia-Organisation nicht nur ans Bein gepisst, sondern einen regelrechten Krieg vom Zaun gebrochen.
Selbst wenn diese Mafiosi davon absehen, mich und meine Familie mit in diesen Krieg hineinzuziehen, sind es zumindest die Pharma-Konzerne, die ihr Ziel noch nicht erreicht haben. So oder so – es ist längst noch nicht vorbei.
Er
Wenn man zu lange in den Schatten gelebt hat, schmerzt es, wieder in das Licht zu blicken.
Ich war mir bereits sicher gewesen, dass das Haus der Königs von der Polizei überwacht wird, und habe daher absichtlich in einiger Entfernung gehalten, um Kiki aus dem Auto zu lassen. Leider haben mich die Drecksbullen dennoch entdeckt und jetzt auf ihrem Radar. In dem Moment, in dem das Blaulicht hinter mir angeht und die Sirenen ertönen, ist der schwarze Maserati Segen und Fluch zugleich.
Ich bin schneller als die Polizeiwagen von der Stange, aber ich bin auch auffällig wie ein bunter Hund. In Frankfurt fahren zwar so einige Protzkarren herum, nichtsdestotrotz sind sie die Minderheit. Während die Sirenen hinter mir jaulen, trete ich das Gaspedal gewaltsam durch. Die Reifen quietschen und der Wagen schießt nach vorne, während ich in den Sitz gepresst werde. Meine Fingerknöchel treten weiß hervor, als ich das Lenkrad fest umfasse.
»Fuck«, zische ich und schaue über den Rückspiegel nach hinten. Die blinkenden Lichter der Polizeiwagen blenden mich und ich kneife die Augen leicht zusammen.
Zum Glück kenne ich einige Schleichwege. Sie werden den Bullen nicht gefallen und Ace noch viel weniger.
»Sorry, Ace«, murmle ich und reiße das Lenkrad herum, während ich die Handbremse anziehe. Mit quietschenden Reifen drifte ich um eine scharfe Kurve und nehme so eine private Durchfahrt. Mit mörderischer Geschwindigkeit rase ich über den schmalen Weg und ignoriere dabei, dass die Reifen den Schotter hochschleudern und ich eine Mülltonne über den Haufen fahre, die scheppernd umkippt und ihren Inhalt verteilt. Am Ende der Durchfahrt biege ich wieder auf eine öffentliche Straße ab, bekomme die Kurve nicht ganz und schlittere in einen anderen Wagen hinein.
Er hupt, bremst, die Reifen quietschen, ich sehe Qualm hinter mir aufsteigen und höre lautes Krachen, als der Hintermann ihm auffährt. Ein erneuter Blick in den Rückspiegel verrät mir, dass es einer der Bullen durch meine Abkürzung geschafft hat. Die anderen stecken irgendwo hinter dem Unfall fest.
»Hartnäckige Zecke«, knurre ich und trete erneut das Gaspedal durch. »Ich hasse Autofahren.«
Mein Abstand zur Polizei erhöht sich sprunghaft, als die Pferdestärken des Wagens mir einen Schub nach vorne geben. Vor mir leuchtet eine rote Ampel im Dunkel der Nacht und einige Autos vor mir fahren über die Kreuzung. Keine Zeit, zimperlich zu sein. Mit Vollgas rase ich auf die Kreuzung zu und kann nur hoffen, dass die Leute aufgrund der lauten Polizeisirenen vorsichtig fahren.
Ich verfehle nur knapp ein anderes Auto, welches sich noch schnell über die Ampel schummeln wollte und nicht mit einem voranrasenden Maserati gerechnet hatte. Ich weiche ihm aus, meine Hinterräder rutschen kurz weg, doch die Elektronik des Wagens korrigiert das Manöver, sodass die Reifen schnell wieder Grip auf der Straße finden.
Die kleine Unachtsamkeit hat jedoch ausgereicht, damit der Polizeiwagen aufholt. Auch von anderen Seiten höre ich wieder Sirenen. Ich weiß, dass ich nicht mehr viel Zeit habe. Sie werden versuchen, mir alle Wege abzuschneiden und wenn nötig Straßensperren errichten. Wenn ich Pech habe, schicken sie sogar einen Hubschrauber, der mich im Auge behält und meine Positionen durchgibt.
Ich muss diese Verfolgungsjagd schnell beenden. Wir haben schon viel zu lange GTA gespielt und ich habe verdammt noch mal keine Lust, bei einem Autounfall draufzugehen oder im Knast zu landen.
Die Kippe zwischen meinen Lippen ist inzwischen heruntergebrannt, aber ich hatte noch keine Zeit, die Überreste loszuwerden. Daher belasse ich sie vorerst dort und knete den immer heißer werdenden Filter überlegend mit meinen Schneidezähnen. Irgendwann spucke ich sie einfach auf den Boden des Wagens und trete mit dem freien Fuß drauf. Wie soll ich die Polizei nur loswerden?
Ich rase unter einer Brücke entlang und sehe direkt vor mir, wie zwei weitere Streifenwagen mit Blaulicht auf meine Straße einbiegen.
Meine einzige Chance ist es, irgendwo hinzufahren, wo so viele Autos sind, dass ich nahezu darin untergehe. Ein Parkhaus zum Beispiel. Das Problem ist, dass dort mit Sicherheit Kameras sind und ich eventuell in der Falle sitze. Dennoch sehe ich im Moment keine andere Möglichkeit.
Ich schnappe mein Handy, welches in der Mittelkonsole hin- und hergeschleudert wird, wähle Ace’ Kontakt und klemme es mir zwischen Schulter und Ohr, damit ich beide Hände zum Lenken frei habe.
»Wieso fährst du mit über hundert durch die Stadt?!«, meldet sich Ace kurz nach dem ersten Freizeichen aufgebracht.
»Du kannst das sehen?«
»Willkommen im einundzwanzigsten Jahrhundert, Seth! Was tust du, verflucht?!«
»Hol mich beim Parkhaus Alte Oper ab! Warte direkt an der Ausfahrt!«, knurre ich ins Telefon und lege auf.
In diesem Moment versuchen die Polizeiwagen vor mir, mich auszubremsen. Ich sehe ihre Rücklichter aufleuchten und weiß, dass ich in der Falle sitze, wenn ich jetzt darauf eingehe. Die Polizisten werden sich darauf konzentrieren, vor allem die anderen Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Sie werden also keine waghalsigen Manöver wagen. Ich allerdings schon.
Während sie bremsen, gebe ich noch einmal Vollgas und krache mit Wucht von hinten in die Wagen hinein. Die Beamten sind zäh und verlieren nicht die Kontrolle, wie ich es erwartet hatte. Ich muss ausholen und ein anderes Auto rammen, um mir Platz zu machen. Das Metall kreischt, als es aufeinandertrifft. Es hört sich an wie ein Unfall und fühlt sich auch so an. Gut, es ist ja auch einer. Ein Ruck geht durch meinen gesamten Körper. Dann trete ich das Gaspedal erneut durch und schaffe es an dem Wagen vorbei.
Ich muss mich beeilen und gleichzeitig hoffen, dass Ace schnell genug ist. Oder dass er überhaupt kommt und seinen Kragen riskiert.
Es wäre dem Drecksack durchaus zuzutrauen, dass er seine edlen Flossen aus der Geschichte raushalten will. Ich habe ihm bereits genug Ärger eingebrockt. Auf die Polizei direkt am Rockzipfel kann er sicher verzichten. Ich brauche einen Plan B, falls er nicht auftaucht. Letztendlich bleibt mir nur die Flucht zu Fuß. So oder so muss ich den Wagen im Parkhaus loswerden. Dann verlasse ich das Haus zu Fuß. Irgendwie. Wird schon klappen.
Mit diesem völlig unausgereiften Plan steuere ich das Parkhaus an. Ich bemühe mich, die Polizei an meinen Fersen abzuschütteln oder wenigstens etwas Abstand zwischen uns zu bringen. Im Parkhaus brauche ich definitiv Zeit, um ungesehen davonzukommen.
Ich versuche mein Glück in Seitengassen und mit Schleichwegen, aber meine Verfolger sind hartnäckig. Als wir uns bereits ganz in der Nähe des Parkhauses befinden, bleibt mir nur noch eine Verzweiflungstat. Ich biege erneut, mit quietschenden Reifen, in eine private Durchfahrt von einem Hotel ab und ignoriere einfach die heruntergelassene Schranke. Die rot-weiß gestreifte Stange bricht mit einem lauten Krachen und landet hinter mir auf der Straße. Ich brettere durch den Privatparkplatz und durchbreche auch die Schranke bei der Ausfahrt ohne Rücksicht auf Verluste.
Das Heulen der Sirenen ist leiser geworden und ein Blick in den Rückspiegel bestätigt meine Vermutung: Die Polizei ist mir nicht gefolgt und fährt den Umweg außen herum.
Auf dem Weg zur Alten Oper kann ich meinen Vorsprung noch etwas ausbauen. Als ich in die enge Spur zum Parkhaus einbiege, sind die Sirenen weiter entfernt. Möglicherweise haben sie nicht mal gesehen, dass ich hierhin abgebogen bin, und suchen mich draußen. Ich nehme mir sogar die Zeit, einen Zettel an der Schranke zu ziehen, um keinen Alarm oder so etwas auszulösen, und fahre dann nach unten, suche mir den kürzesten Weg zur Ausfahrt und atme erleichtert auf, als ich Ace’ Mercedes AMG direkt bei der Schranke warten sehe.
Ich mache mir nicht die Mühe einzuparken, sondern halte mitten auf der Fahrbahn an und steige aus. Auch die Tür des Mercedes öffnet sich und ein völlig fassungsloser Ace kommt aus dem Wagen. Mit einer ringbesetzten Hand fährt er sich durch sein braunes Haar und sein Mund klappt auf.
»Mein Maserati«, jammert er entsetzt.
»Bisschen Schwund ist immer«, murmle ich, spucke genervt auf den Boden und werfe keinen Blick mehr auf den Maserati zurück. Es ist mir klar, dass die Luxuskarre vollkommen zerschrammt, zerkratzt und zerbeult sein muss. Für mich sind Autos jedoch nur Gebrauchsgegenstände und dieser hier hat mir gute Dienste als Fluchtwagen geleistet. Ace sieht das allerdings etwas anders. Für ihn sind Autos wie Babys. Manchmal nennt er sie sogar so.
Ich steige in den Mercedes ein.
»Lass uns abhauen.«
Er
Ace labert mich voll, während ich aus dem Beifahrerfenster starre. Erst meckert er darüber, wie ich so unvernünftig sein kann, dann beschwert er sich, dass die Überwachungskameras uns aufgezeichnet haben und er jetzt ein neues Auto kaufen muss.
»Es ist dir aber schon klar, dass mein Maserati mehr wert war als alle Schulden, die dein Vater jemals hatte?«
Ich stoße die Luft genervt aus. »Schreibs auf meine Rechnung.«
»Deine Ruhe möchte ich mal haben. Hast keine Kohle, um dir mal vernünftige Klamotten zu kaufen, aber fährst mein Auto zu Schrott.«
»Was hast du gegen meine Klamotten?« Ich runzle die Stirn.
»Deine Stiefel fallen bald auseinander. Das Leder ist doch schon ganz abgeplatzt. Deine Hose ist total ausgewaschen und du trägst immer diese eine Lederjacke mit der Kapuze, im Sommer und im Winter. Hast du keine anderen Jacken?«
»Nein.«
Ace seufzt resigniert.
Wir konnten das Parkhaus unbehelligt verlassen und fahren gemütlich durch die Innenstadt zu dem Hochhaus, in dem Ace wohnt. Auf dem Beifahrersitz versuche ich, mich so klein wie möglich zu machen, was nicht einfach ist, da ich eben nicht klein bin. Dennoch bin ich überzeugt davon, dass die Polizei unsere kriminelle Ausstrahlung regelrecht riechen kann, sobald sie in unsere Fenster schaut.
Ace versprüht den rohen Charme eines Zuhälters und ich sehe genau so aus wie der Auftragskiller, der ich bin. Ein Glück, dass Grimm nicht hier ist, denn sein skelettierter Anblick hätte den Rahmen gesprengt.
»Wieso hast du das Mädchen weggeschickt?«, fragt Ace plötzlich. Allein an sie zu denken, flutet meinen Körper mit einer schmerzhaften Kälte, die sich von meiner Mitte ausbreitet und langsam durch meine Venen frisst.
»Es ist besser so für sie.«
»Wieso glaubst du das?«
Ich wende meinen Blick vom Fenster ab und werfe meinem Kumpel einen Was-soll-die-Frage-Blick zu, den er mit einem interessierten Augenbrauenheben quittiert.
»Weil das, was wir vorhaben, verdammt nochmal ein Selbstmordkommando ist, Ace«, kläre ich ihn über das Offensichtliche auf. »Wie hoch stehen die Chancen, dass wir es überleben, wenn wir uns mit Daimos Kahlish und den Los Caídos gleichzeitig anlegen, mh? Ich habe keine Lust, Kiki da mit reinzuziehen. Es war mein Auftrag, sie zu beschützen, und nicht, ihr Leben zu ruinieren. Was ich sowieso schon gemacht habe. Wenn ich Glück habe, konzentrieren sich die Los Caídos jetzt auf uns und interessieren sich nicht mehr für diesen bescheuerten Krieg zwischen den Pharmakonzernen.«
»Ich hoffe, du hast recht«, sagt Ace ernst und biegt in seine Tiefgarage ein. »Wenn dem Mädchen etwas passiert, will ich nicht in deiner Haut stecken.«
Wow. Danke. Penner.
Ace ist ein Schauspieler, ein Trickster und doch manchmal so gnadenlos ehrlich, dass es mir die Sprache verschlägt.
Aber er hat recht. Meine Entscheidung, Kiki wegzuschicken und in ihr altes Leben zurückzulassen, kann auch nach hinten losgehen. Wenn mein Plan nicht aufgeht und die Los Caídos die Königs mit in unseren kleinen Krieg ziehen, dann wird Kiki die Erste sein, die auf ihrer Abschussliste steht. In diesem Fall wäre sie bei mir sicherer.
Aber es würde auch bedeuten, dass sie nie wieder ein normales Leben führen kann. Dass ich ihr all ihre unverwirklichten Träume entreißen würde. Ein Leben mit mir bedeutet, auf der mörderischen Klinge des Todes zu tanzen. Immer nur einen Schritt davon entfernt, draufzugehen.
Nein, das kann ich ihr nicht antun. Genauso wenig, wie ich es meiner Schwester antun kann. Ich muss die beiden aus diesem Teil meines Lebens fernhalten. Rory weiß von nichts. Für sie bin ich nur der schwer arbeitende Bruder, der es doch nicht schafft, die Lücke auszufüllen, die unser Vater hinterlassen hat. Aber Kiki kennt mein Geheimnis. Bei ihr ist es zu spät, meine Maske wieder aufzusetzen.
Während ich mir mein Gehirn zermartere und alle möglichen Wege und Fälle durchgehe, parkt Ace den Wagen und wir steigen aus.
Schweigend gehen wir zum Aufzug und fahren nach ganz oben. Wir beide sind in unsere eigene Welt versunken, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie es in Ace gerade aussieht. Er lehnt an der Fahrstuhlwand, die Arme genauso verschränkt wie ich und schaut ernst ins Leere.
Ob er sich Sorgen macht? Ob er Angst hat? Ace ist nicht der Typ, seine Emotionen nach außen zu tragen. Zumindest nicht die Echten. Als sich unsere Blicke kreuzen, zupft ein Grinsen an seinen Mundwinkeln. Genau wie ich trägt er eine Maske. Bloß sieht seine fröhlich aus im Gegensatz zu meiner. Meine ist mehr so »sprich mich nicht an oder ich schlage dir den Schädel ein«-mäßig.
Als wir mit dem Aufzug oben ankommen, seufze ich resigniert auf. Kikis Wohlergehen geht mir nicht aus dem Kopf. »Ich muss sichergehen, dass ihr nichts passiert.«
Ace wirft mir einen mahnenden Blick zu, als er an mir vorbeigeht, um seine Wohnungstür zu öffnen. Wir betreten die große Penthousewohnung, die letztendlich nur ein gigantischer, im fernöstlichen Stil eingerichteter Raum ist.
»Kommt nicht in Frage. Wir können uns nicht noch mehr Fehler leisten, Seth. Wenn es um die Kleine geht, bist du unkonzentriert. Wir haben jetzt einen Krieg zu gewinnen. Also konzentrier dich auf unsere Mission, klar?«
»Was?«, knurre ich. »Willst du mich verarschen, Ace?«
»Nein, Seth. Ich will unsere Ärsche retten. Hör zu- …« Er bleibt mitten im Raum stehen und dreht sich zu mir um. Seine eisblauen Augen blitzen gefährlich auf, als er in meine blickt. Er tritt an mich heran, sodass wir nur noch eine Handbreit voneinander entfernt sind.
Ich spüre die Bedrohung, die von ihm ausgeht. Sie kriecht wie ein elektrisierender Parasit unter meine Haut und breitet sich in mir aus, bis sich meine Muskeln automatisch anspannen. Bereit, zu kämpfen, wenn es sein muss. Aber Ace will nur reden. Es ist lediglich der animalische Überlebensinstinkt, der sich in mir regt.
»Du hattest die Wahl und du hast dich dafür entschieden, sie fortzuschicken. Ich habe keine Lust, dass du alles riskierst, indem du jetzt die ganze Zeit mit den Gedanken bei ihr bist. Wir haben keine Zeit, Babysitter zu spielen. Ihr Vater ist reich genug, sich und sie zu beschützen. Entweder du konzentrierst dich jetzt oder du kannst deine Freiheit an den Nagel hängen. Verstanden?«
Ich knirsche mit den Zähnen und balle meine Fäuste. Ich hasse es, dass Ace in der Lage ist, mir Befehle zu erteilen. Es wäre so einfach, mein Messer zu ziehen und ihm seine Kehle aufzuschneiden. Er würde es erst bemerken, wenn es bereits zu spät ist und das rote Lebenselixier aus der klaffenden Wunde sprudelt.
Aber genau das mache ich aus zwei Gründen nicht.
Erstens: Ich brauche ihn, um die Los Caídos zu besiegen und Deimos Kahlish loszuwerden.
Zweitens – und das ist das viel größere Problem – ich mag den Scheißkerl einfach.
Schnaubend drehe ich mich von ihm weg. »Ist gut. Ich werde sie in Ruhe lassen.«
Sie
Es gibt Ereignisse im Leben, die Narben auf der Seele hinterlassen, die so tief sind, dass man sie nicht mehr zu verbergen vermag.
Bisher habe ich mich für eine unerschütterliche Frohnatur gehalten, die nichts so schnell aus der Bahn werfen kann. Ich dachte, nachdem meine Mutter uns verlassen und mein Vater mich wie einen kostbaren Kanarienvogel eingesperrt hatte, dass mich nichts mehr in die Knie zwingen könnte. Als ich meiner Mama hinterhersah, wie sie mit zwei riesigen Koffern unser Haus für immer verließ, habe ich tagelang geweint. Mich in Selbstmitleid gesuhlt und an mir gezweifelt.
Sie hatte mir die Entscheidung überlassen, ihr nach Berlin zu folgen und mein ganzes Leben zurückzulassen. Bis zu dem Tag, an dem sie ging, hatte ich die romantische Vorstellung, dass meine eigene Mutter sich niemals gegen mich entscheiden würde. Dass sie nicht gehen würde, wenn ich mich dazu entschied, hierzubleiben. Doch sie hat mir bewiesen, dass auch die Liebe einer Mutter manchmal an ihre Grenzen stößt.
Und auch wenn ich es nicht wollte, wuchs irgendwo in mir der Keim eines Hirngespinstes heran: Sie hat mich nicht genug geliebt. Und wieso? Weil ich nicht gut genug war. Es musste an mir liegen. Ich weiß, dass es nicht so ist. Aber es gibt Gedanken, die man nicht unterdrücken kann. Sie kommen leise und heimlich. Unbemerkt schlägt die dunkle Saat wurzeln und schlingt ihre Ranken um die Seele und den Geist.
Ja. Ich hatte damals eine Wahl gehabt und eine Entscheidung getroffen. Und dennoch hatte ich gehofft, dass die Lippen meiner Mutter folgenden Satz formen würden: »Ohne dich gehe ich nicht!«
Eines Abends, als ich mich in den Schlaf weinte, kam mein Vater zu mir. Er setzte sich neben mich auf mein Bett und nahm meine Hand. Er sah mir in die Augen und sagte:
»Eine Königin steht auf und zieht ihr Schwert.«
Er spielte damit auf unseren Familiennamen König an. Es war ein Spruch, den er mir schon immer predigte, wenn ich hinfiel und weinte oder wenn ein Spielzeug kaputt ging. Ich hatte schnell gelernt, was dieser Satz bedeutet: Lass dich nicht unterkriegen. Das Leben geht weiter. Steh auf und kämpfe.
Seit diesem Tag habe ich nie wieder um meine Mutter geweint. Denn ich verstand: Es änderte nichts. Sie würde nicht zurückkommen und es half nichts, im Selbstmitleid zu versinken.
Doch trotz all dem muss ich jetzt lernen, dass ich nicht so unverwundbar bin, wie ich gedacht habe. Die Ritterrüstung dieser Königin hat Risse bekommen. Seitdem Tag, an dem ich einem Mann aus Notwehr ein Auge zerstach, suchen mich diese Bilder heim. Ich träume davon. Spüre noch in meinen Händen, wie das Plastik über den Schädelknochen schrammt.
Doch das sind noch die harmlosen Träume. Viel schlimmer sind die, in denen ich wehrlos gefesselt bin und mehrere Männer auf mich einschlagen und mir meine Kleidung vom Leib reißen. Jeder Traum endet damit, dass sie alle nacheinander aufplatzen, bevor sie mich vergewaltigen können. Nichts als blutige Häufchen aus Fleisch und Blut bleiben von ihnen zurück.
In all diesem Massaker steht ein Mann. Groß und bedrohlich. Ich weiß, dass es Seth ist, auch wenn ich sein Gesicht nicht sehe. Er blickt mich aus seinen dunklen, von Schatten umrahmten Augen an und dann geht er. Lässt mich gefesselt zurück in diesem Gemetzel aus Blut und Gedärmen. Erst dann wache ich schweißgebadet auf.
Manchmal werde ich auch in meinen Träumen von einer unbekannten Gestalt verfolgt. Keine Ahnung, ob ich damit verarbeite, gestalkt worden zu sein, oder ob es die Angst ist, dass diese kriminellen Typen immer noch hinter uns her sind.
Den ersten Tag nach meiner Heimkehr verbringe ich mit meinem Vater und damit, die Kommissare der Kripo zufriedenzustellen. Sie reden auf mich ein und fragen mich nach jedem Detail. So gut es geht, versuche ich, die Wahrheit zu sagen, und lasse dabei lediglich aus, dass sich eine verdrehte Romanze zwischen mir und meinem Entführer entwickelt hat. Auch Seths Namen erwähne ich nicht.
Am zweiten Tag kommt Leonie zu mir nach Hause, um mich zu besuchen. Sogar mein Vater ist sensibel genug zu wissen, dass ich jetzt meine beste Freundin brauche, und verkneift sich jeden bissigen Kommentar.
»Kiki«, sagt Leonie, als sie mein Zimmer betritt und die Arme ausbreitet. Ich laufe ihr entgegen und lasse mich von ihrer Umarmung einfangen. Fest drücke ich mich gegen sie, nehme ihren Duft tief in meine Lunge auf. Es tut gut, sie zu riechen und sie zu sehen. Sie sieht aus wie immer mit ihren roten Haaren und dem Biker-Look. Jedoch tiefe Sorge steht ihr auf die sonst ebenmäßige Stirn geschrieben.
»Gott, ich bin so froh, dass du lebst.« Ihre Stimme ist leise und belegt, weil sie mit den Tränen ringt. Als ich zu ihr hinaufblicke, sehe ich ihre blauen Augen feucht glitzern.
»Es ist alles gut, Leo«, versuche ich, sie zu beruhigen und lächle sie warm an. »Ich lebe. Ich bin wieder da. Es war die Hölle – aber jetzt ist es vorbei! Also, hey … Kopf hoch!«
Leo sieht mich an, als zweifle sie an meinem Verstand, dann schüttelt sie den Kopf und zieht mich erneut in eine Umarmung.
»Ich hab’ echt keine Ahnung, wie man reagiert, wenn die beste Freundin entführt wurde und gerade erst wiedergekommen ist. Was tut man dann? Was sagt man? Du weißt, dass ich in diesem emotionalen Kram nicht die Allerbeste bin. Ich … ich weiß gar nicht, was ich machen soll.«
»Ist schon gut, Leo. Die Situation ist auch für mich total merkwürdig. Ich meine, bei uns im Wohnzimmer sitzen quasi zwei deutsche FBI-Agenten. Ich bin entführt worden. War eingesperrt in irgendeine Dachgeschoss-Wohnung hier in Frankfurt. Kriminelle Typen haben mich gefesselt und geschlagen, damit mein Vater auf den Deal eingeht und sein Medikament nicht auf den Markt bringt. Das ist alles so abgedreht, dass ich es selbst gar nicht glauben kann. Ich dachte immer, so etwas passiert nur im Fernsehen.« Ich drücke mich absichtlich harmloser aus, als es war, um meine Freundin nicht noch mehr zu verunsichern. Allerdings geht mein Plan nicht auf.
Leo schaut mich zweifelnd mit schmalen Lippen an.
»Ach komm, jetzt zieh nicht so ein Gesicht. Mir geht es doch gut!« Ich nehme ihre Hand und ziehe sie mit mir zu meinem Bett.
Wir lassen uns auf der flauschigen, weißen Tagesdecke nieder und ich behalte ihre Hand in meiner. »Lass uns lieber einfach froh sein, dass ich zurück bin, okay?«
»Aber Kiki, willst du denn gar nicht darüber reden, was dir passiert ist? Wie konnten sie dich überhaupt entführen – ich meine dieser Wachhund da draußen«, sie zeigt mit dem Daumen zur Zimmertür, vor der Dimitri steht, »folgt dir auf Schritt und Tritt. Wie konntest du da …« Ihre Stimme versagt. »Fuck, es tut mir so leid! Ich habe dich auch noch dazu angestiftet, ihn loszuwerden und dich von zu Hause rauszuschleichen! Ich … ich wusste nicht, dass …«
»Leo! Jetzt hör auf! Ich bin erwachsen und ich treffe meine Entscheidungen ganz allein! Außerdem bin ich nicht in der Nacht entführt worden, als wir auf der Studentenparty in dem Nachtclub waren. Du konntest nichts dafür! Red‘ dir so einen Unsinn bloß nicht ein!«
Leonie seufzt und sieht mich resigniert mit einem angehobenen Mundwinkel an. »Du bist so ein Sturkopf.«
Ich grinse und klopfe mir mit der Faust gegen meinen Dickschädel. »Jap. Und stolz drauf. So und jetzt lass uns endlich mal was Schönes machen. Die letzte Zeit war schwer genug. Ich bin einfach froh, zu Hause zu sein und dass du hier bist. Und du hast dir ebenso in den letzten Tagen genug Sorgen gemacht. Du musst jetzt auch etwas ausspannen!«
»Okay, was wollen wir machen?«, fragt Leo lächelnd. »Einen Film schauen? Playstation spielen?«
»Erst das eine, dann das andere!«, entscheide ich und starte die Playstation an meinem Fernseher, über welche ich auch Streaming-Dienste nutzen kann.
Kurz darauf liegen wir zusammen auf meinem Bett und Leonie hält mich fest. Ich kuschle mich an ihren schlanken Körper und lächle in mich hinein. Mein Ohr liegt auf ihrer Brust, in welcher ich ihr Herz schnell schlagen hören kann. Wenigstens für die Zeit mit ihr schaffe ich es, die schrecklichen Bilder aus meinem Kopf zu verbannen. Doch in dem Moment, in dem der Film beginnt, auf den wir uns geeinigt haben, und ich mich wirklich sicher und glücklich fühle, geschieht etwas Merkwürdiges mit mir.
Plötzlich breitet sich eine Kälte in meiner Brust aus, während gleichzeitig Schweiß aus allen Poren schießt. Meine Herzfrequenz beschleunigt sich und mein Atem wird flacher. Ich verstehe nicht, was passiert, und setze mich auf.
Leonie schaut mich erst verwirrt und dann besorgt an. »Ist alles okay? Du bist ganz blass.«
»Ich… ich weiß nicht«, antworte ich atemlos und springe regelrecht vom Bett auf. »Ich glaube, ich falle in Ohnmacht.«
»Was?! Wieso?« Auch Leonie ist sofort alarmiert auf ihren Beinen und legt mir beruhigend eine Hand auf den Rücken, während sich ihre blauen Augen mit Schrecken weiten. »Leg dich aufs Bett und leg die Beine hoch!«
»Nein, lass uns lieber irgendwas tun. Bitte lenk mich irgendwie von diesem schrecklichen Gefühl ab!« Ich habe keine Ahnung, was in mir passiert. Woher dieser merkwürdige Ausbruch kommt oder was er zu bedeuten hat. Für einen Moment denke ich sogar darüber nach, Dimitri zu holen oder den Notarzt zu rufen. Aber ich entscheide mich dagegen und stehe mit zitternden Händen und Beinen da, während ich versuche, meine Atmung zu beruhigen.
»Okay. Lass uns nach unten gehen und dir ein Glas Wasser holen!« Leonie schnappt sich meine Hand und zieht mich mit sich.
Dimitri sieht uns stirnrunzelnd an, als wir so eilig aus dem Raum stürmen und die Treppe hinablaufen. Mit etwas Abstand folgt er uns bis in die Küche.
Leonie öffnet mehrere Schranktüren, bis sie die Gläser findet und eines für mich mit kühlem Wasser aus dem Hahn befüllt.
Ich nehme es dankbar entgegen und setze es an meine trockenen Lippen. Während ich mich auf einen Küchenstuhl sinken lasse, trinke ich es mit langsamen, kleinen Schlucken.
»Und? Geht‘s?«, fragt Leonie besorgt.
Auch Dimitri sieht mich fragend an. »Was ist denn los?«
»Nichts«, antworte ich ausweichend und mache eine wegwerfende Bewegung mit der Hand. »Ich glaube, ich hatte nur ein paar Kreislaufprobleme. Es geht schon wieder besser.«
»Sicher?«, fragen Leonie und Dimitri wie aus einem Mund.
Ich atme tief ein, fülle meine Lunge mit dem überlebenswichtigen Sauerstoff. Tatsächlich lässt die Kälte in meinem Inneren langsam nach und die Schwärze vor meinen Augen zieht sich etwas zurück. Bestätigend nicke ich. »Sicher. Das Wasser hat geholfen.«
»Sie sollten sich nicht übernehmen, Viktoria. Sie brauchen Zeit, um alles zu verarbeiten.« Dimitri blickt mich fürsorglich an.
»Ja, ich weiß. Ich werde mehr achtgeben. Dabei haben wir nur gelegen. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte!« Nachdem ich das Glas geleert habe, stehe ich vorsichtig auf. Meine Beine fühlen sich noch etwas weich und zittrig an, aber wenigstens habe ich nicht mehr das Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen.
»Vielleicht spielen wir doch lieber erstmal Playstation. Ich glaube, irgendwo ruhig herumliegen kann ich jetzt nicht. Es ist mir lieber, wenn ich irgendwie abgelenkt bin.«
»Na klar, Süße. Alles, was du willst!« Leonies schmale Augenbrauen sind nach wie vor besorgt gekräuselt, aber ich sehe die Entschlossenheit in ihrem Blick, alles für mich zu tun.
Nach einer kurzen Verschnaufpause in der Küche gehen wir wieder nach oben in mein Zimmer. Leonie will gerade nach dem Playstation-Controller greifen, als ich ihre Hand festhalte.
»Danke«, sage ich leise und sehe sie an.
»Wofür?«, fragt sie verwirrt.
»Einfach für alles, Leo. Dafür, dass du du bist und dass ich dich in meinem Leben habe.«
Ihre Lippen heben sich zu einem kleinen Lächeln, während sie mich sanft ansieht.
»Kiki, du bist so viel mehr als einfach eine Freundin für mich …«
Ich lächle ebenfalls. »Du bist auch meine beste Freundin!«
Leonie blinzelt und schluckt. Es wirkt plötzlich, als hätte sie Mühe, ihr Lächeln aufrechtzuerhalten. Die Mundwinkel zittern und ich verstehe nicht, wieso.
»Na dann …« Mehr sagt sie nicht, ehe sie den Playstation-Controller nimmt.
2 Wochen später …
Ich habe mich von deinen Schatten locken lassen und mich in ihnen verirrt. Ein Teil von ihnen wird für immer an mir haften, egal wie hell das Licht sein mag, welches mich umgibt.
Es ist jetzt zwei Wochen her, dass ich nach Hause zurückgekommen bin. Zwei Wochen, seitdem ich den Albträumen entflohen bin. Und dennoch suchen sie mich noch jede Nacht heim. Auch heute lege ich mich mit einem verkrampften Magen ins Bett und ziehe die Bettdecke bis zum Kinn herauf.
Ich werfe noch einen Blick zum Fenster. Es ist in der letzten Zeit zu einer Art Zwang geworden, den ich nicht unterbinden kann. Irgendwo in mir lodert die Hoffnung, dass ich ihn draußen sehe. Dass er zu mir zurückkommt. Obwohl ich mir einrede, dass ich das gar nicht will, weil er ein Schwerverbrecher ist, kann ich diesen Keim der Hoffnung nicht ersticken. Es ist total bescheuert, das weiß ich. Ich kannte Seth nicht lange. Er hat mich entführt und meine Familie in große Schwierigkeiten gebracht. Ganz abgesehen davon, dass er mir das Herz gebrochen und mich, ohne mit der Wimper zu zucken, aus seinem Leben geworfen hat.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: