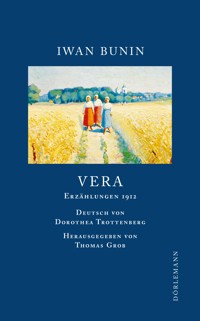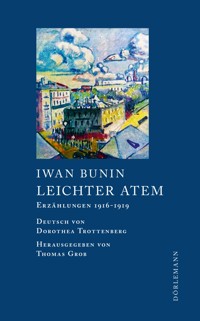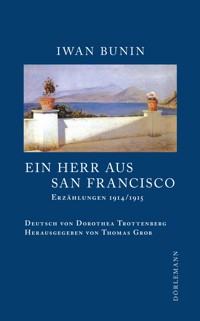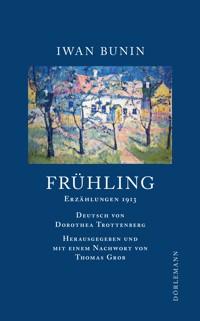
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1913 – das Jahr vor der Weltkriegskatastrophe – fiel in die Zeit boomender russischer Großstädte und der ungelösten Fragen in der russischen Provinz. Russlands Weiten sind geprägt von Niedergang und diffuser Erwartung. Auf der Höhe seiner Erzählgewalt verfolgt Iwan Bunin sein literarisches Großprojekt, das Bild dieser Welt zu zeichnen.Der Bauer, der zur Unzeit sein Getreide verkaufen sollte, oder derjenige, der seinem Herrn Geschichten von Gewalt gegen Gutsbesitzer erzählt, der Seminarist, der sich für etwas Besseres hält, die brutal verprügelte Kupplerin, der in alle Geheimnisse eingeweihte Pferdedoktor, der missratene, gequälte Sohn, die Frau, die ihr Leben in der Erinnerung an einen jugendlichen Sommer voller Liebe verbringt, und nicht zuletzt der Städter, der kurz in seinem provinziellen Kindheitsort Halt macht – in all diesen und anderen Figuren, in jeder dieser präzisen wie poetischen, anrührenden Skizzen, findet sich ein Stück dieser Welt wieder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Iwan Bunin
Frühling
Erzählungen 1913
Aus dem Russischen vonDorothea Trottenberg
Herausgegeben und mit einem Nachwort versehenvon Thomas Grob
DÖRLEMANN
Die Übersetzung folgt der Ausgabe Bunin, I. A.:Polnoe sobranie sotschinenij I. A. Bunina.Petrograd: A. F. Marks 1915 (Bd. VI)eBook Ausgabe 2016Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten© The Estate of Ivan Bunin© 2016 Dörlemann Verlag AG, ZürichUmschlag: Mike Bierwolf unter Verwendung eines Gemäldesvon Kasimir MalewitschSatz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, LemfördeISBN 978-3-03820-931-7www.doerlemann.com
Inhalt
Iwan Bunin
Der Prophet Elias
Bei Semjon Nowikow, der mit seinem Bruder, dem einarmigen Nikon, in Owsjany Brod lebte, hatte es in der Fastenzeit vor dem Apostel-Petrus-Tag gebrannt. Die Brüder kamen überein, fortan getrennt zu leben, und da Semjon Owsjany Brod verlassen wollte, baute er sich an der Landstraße eine Kate aus Holzbalken.
Zum Eliastag bekamen die Zimmerleute einen Tag frei, und Semjon mußte auf der Baustelle übernachten. Nachdem er mit der großen Familie seines Bruders zu Abend gegessen hatte, in drangvoller Enge, zwischen Fliegen und Kindergeschrei, rauchte er seine Pfeife an, warf den Halbpelz über und sagte:
»Hier bei euch ist es so stickig. Ich gehe zur Baustelle und übernachte dort. Ich fürchte, das Werkzeug könnte gestohlen werden.«
»Nimm wenigstens die Hunde mit«, riet ihm die Frau.
»Ach was!« versetzte Semjon und ging allein.
Es war eine mondhelle Nacht. Vor lauter Gedanken an seinen künftigen Hof bemerkte Semjon gar nicht, daß er vom Dorf aus über die breite Trift den Berg hinaufgestiegen war und schon gut eine Werst auf der großen Landstraße zurückgelegt hatte, bis zu seiner Kate – den First schon aufgesetzt, das Dach aber noch nicht gedeckt, so stand sie mit ihren dunklen Fensterhöhlen in der weiten Landschaft, am Rand des Kornfelds; die Enden der frischen Balken, das Werg zwischen den Fugen und die Späne auf der Schwelle leuchteten stumpf im Gegenlicht des Mondes. Der goldgelbe Julimond, der sich in der Ferne über den Schluchten von Owsjany Brod erhoben hatte, stand niedrig und war verschleiert. Sein warmes Licht ergoß sich über das reife Korn, das matt und fahl schimmerte, als wäre es Sand. Nach Norden hin war es schon vollkommen finster. Dort senkte sich eine Wolke herab. Der leichte Wind, der von allen Seiten her blies, frischte mitunter auf, fegte ungestüm über Roggen und Hafer, und das Korn raschelte trocken und unruhig. Die Wolke im Norden schien reglos, wurde aber immer wieder von einem unheimlichen, flüchtigen goldenen Flackern durchzuckt.
Semjon zog aus Gewohnheit den Kopf ein und betrat die Kate. Drinnen war es dunkel und schwül. Das gelbe Mondlicht, das durch die leeren Fenster hereinsah, mischte sich nicht mit der Dunkelheit, es steigerte sie nur. Semjon warf den Halbpelz auf die Hobelspäne, die mitten in der Stube lagen, genau auf einem Lichtstreifen am Boden, und streckte sich auf dem Rücken aus. Er sog noch ein wenig an der erloschenen Pfeife, steckte sie in die Tasche, dachte ein Weilchen nach und schlief ein.
Doch dann kam Wind auf, er wehte durch die Fenster und vom Flur her auch durch die Tür. Dumpfes Donnergrollen erhob sich in der Ferne. Semjon erwachte. Der Wind wurde stärker – er brauste nun in einem fort über das aufgebracht rauschende Korn, und das Mondlicht wurde noch trüber. Semjon trat aus der Kate, ging ums Haus herum zu dem trocken und heftig raschelnden, leichentuchblassen Hafer und blickte zu der Wolke hin. Sie war düster, schiefergrau, und nahm den halben Himmel ein. Der Wind blies ihm direkt ins Gesicht, wirbelte ihm die Haare durcheinander, störte die Sicht. Auch die Blitze, die jetzt immer bedrohlicher und heftiger aufflammten, störten die Sicht, blendeten ihn. Semjon bekreuzigte sich und kniete nieder: In der Ferne, inmitten des Hafermeers, zeichnete sich vor der Wolkenwand eine kleine Schar ab, die sich auf Semjon zubewegte, mit entblößten Häuptern, weiß gegürtet, in neuen Halbpelzen – mühsam trugen sie eine riesige, nach alter Tradition gemalte Altar-Ikone. Die Schar war verschwommen, durchscheinend, aber die Ikone war gut zu erkennen: das furchterregende, strenge Antlitz, rötlich schimmernd auf der schwarzen, von Kerzen versengten, wachsbespritzten Tafel, die mit altem, graublauem Silber eingefaßt war.
Der Wind wehte Semjon die Haare aus der Stirn, blies sie angenehm zur Seite, und Semjon verneigte sich voller Furcht und Freude vor der Ikone bis zum Boden. Als er den Kopf wieder hob, sah er, daß die Schar stehengeblieben war und die Ikone ungeschickt in die Höhe hielt, während sich auf der Wolke wie ein Kirchenbild ein riesiges Tableau abzeichnete: Der weißbärtige, mächtige Elias selbst, der in einem flammenden Gewand wie Gott Zebaot auf den fahlblauen unteren Wolkenschwaden thronte, und über ihm im Schiefergrau zwei grün-orangefarben leuchtende Regenbogen. Mit blitzenden Augen, die Stimme mit dem fernen Donnergrollen verschmelzend, sagte Elias zu Semjon:
»Halt dich gerade, Semjon Nowikow! Hört, ihr Fürsten und Bauern, ich werde nun zu Gericht sitzen über ihn, den abgabepflichtigen Bauern aus dem Kreis Jelezk, Bezirk Predtetscheski, über Semjon Nowikow.«
Und das ganze sandbleiche Feld ringsum, mit all seinen Ähren und Kornraden, stiebte auf, wogte Elias entgegen und verneigte sich vor ihm, und im Rauschen der Ähren sprach Elias:
»Ich grollte dir, Semjon Nowikow, ich wollte dich strafen.«
»Wofür, Väterchen?« fragte Semjon.
»Es ziemt sich nicht, daß du, Semjon Nowikow, mir, Elias, Fragen stellst. Du sollst Rede und Antwort stehen.«
»Es mag nach deinem Willen sein«, sagte Semjon.
»Im vorletzten Jahr habe ich mit einem Blitz Pantelej erschlagen, deinen Ältesten: Warum hast du ihn bis zum Gürtel in die Erde gegraben, ihn durch Zauberei ins Leben zurückzubringen versucht?«
»Verzeih, Väterchen«, sagte Semjon und verneigte sich. »Es war schade um den Jungen. Und bedenke doch: Er sollte im Alter der Ernährer sein.«
»Im letzten Jahr habe ich deinen Roggen mit Hagel und Stürmen gepeitscht: Warum hast du beizeiten davon erfahren, den Roggen noch auf dem Halm verkauft?«
»Verzeih, Väterchen«, sagte Semjon und verneigte sich. »Es war eine Vorahnung, und ich war in großer Not.«
»Nun, und dieses Jahr, zur Fastenzeit vor dem Apostel-Petrus-Tag, habe ich da nicht dein Haus niedergebrannt? Warum hast du es so eilig zu bauen, sonderst dich ab?«
»Verzeih, Väterchen«, sagte Semjon und verneigte sich. »Mein einarmiger Bruder ist ein Pechvogel: Von ihm kommt alles Unglück, so scheint es mir.«
»Schließ die Augen. Ich will überlegen, mich beraten, wie ich dich strafen kann.«
Semjon schloß die Augen und senkte den Kopf. Der Wind rauschte, und Semjon mühte sich verstohlen, durch das Rauschen zu verstehen, was Elias mit den Bauern flüsterte. Doch nahebei dröhnte Donnergrollen, und er konnte nichts hören.
»Nein, wir werden uns nichts überlegen«, sagte Elias mit lauter Stimme. »Gib du mir selbst einen Rat.«
»Soll ich die Augen öffnen?« fragte Semjon.
»Das ist nicht nötig. Der Blinde kann besser überlegen.«
»Wunderlich bist du, Väterchen«, sagte Semjon mit einem ernsten Lächeln. »Was gibt es da lange zu überlegen? Ich werde dir eine Kerze für drei Rubel aufstellen.«
»Du hast kein Geld. Hast alles für den Bau ausgegeben.«
»Dann werde ich nach Kiew fahren, oder nach Belgorod«, sagte Semjon zögernd.
»Das ist Müßiggang, da läufst du nur die Bastschuhe ab. Und wer soll sich um die Wirtschaft kümmern?«
Semjon überlegte.
»Nun, dann töte das Mädchen, Anfiska. Sie ist doch erst im dritten Jahr. Ein zärtliches, liebenswertes Mädchen, ehrlich gesagt – es wird uns leid tun um sie, aber was soll man machen? Es ist besser, sie zu opfern als den Kleinen.«
»Hört, ihr Rechtgläubigen«, sagte Elias laut. »Ich bin einverstanden!«
Und ein solches Feuer zerriß die Wolke, daß Semjons Lider beinahe barsten, und ein solcher Schlag spaltete die Himmel, daß die ganze Erde unter ihm erbebte.
»Heilig Herr Gott Zebaot!« flüsterte Semjon. »Ei der Daus!«
Als Semjon erwachte und die Augen aufschlug, sah er nur eine Staubwolke, das leere, wogende Kornfeld und sich selbst, wie er inmitten der Ähren kniete. Ein hoher Staubwirbel fegte über der Straße dahin, und der Mond war nun völlig verhangen.
Semjon sprang auf die Füße. Ohne noch einen Gedanken an den Halbpelz, an die Äxte und die Fügehobel zu verschwenden, eilte er dem wirbelnden Staub entgegen, nach Hause, ins Dorf. Auf dem Weideplatz überraschte ihn dichter Regen. Über den dunklen Schluchten waren finstere Wolken aufgezogen. Dahinter versank der rote Mond. Das Dorf lag in tiefem Schlaf, doch das Vieh auf den Höfen war unruhig, die Hähne krähten aufgeregt. Als er auf seine alte, halb abgebrannte Kate zulief, vernahm Semjon darin Weibergeschrei. An der Schwelle stand der einarmige Nikon, im Halbpelz und ohne Mütze, mager und für sein Alter zu runzelig, und blickte stumpf und ratlos drein.
»Ein Unglück hat dich getroffen«, sagte er, und an seiner Stimme war zu erkennen, daß er noch nicht ganz wach war.
Semjon rannte hinein. Die Weiber liefen zeternd im Dunkeln umher und suchten nach Schwefelhölzchen. Semjon riß eine Schachtel hinter der Ikone hervor und zündete die Öllampe an: Die Wiege, die beim Ofen aufgehängt war, schwang von der einen Seite zur anderen – die Weiber waren bei ihrem Umherlaufen dagegengestoßen –, in der Wiege lag bläulich angelaufen das tote Mädchen, und auf ihrem Köpfchen glomm noch das bunte Flickenhäubchen.
Seit jener Zeit lebte Semjon glücklich.
Sabota
Der sonnige Herbstabend ist kühl. Hinter den Höfen des großen Dorfes, das sich den Abhang hinunter bis zu den Wiesen und dem kleinen Quellfluß erstreckt, hinter den Getreidedarren, dem Grün von Weidengebüsch und hohem Hanf leuchten gelb die neuen Garbenhaufen und Getreideschober. Die Dorfstraße liegt im Schatten, die Sonne senkt sich hinter Höfen und Tennen – und im Gegenlicht leuchten die lehmigen Hügel jenseits der Wiesen grellrot, blitzen auf diesen Hügeln die Fensterscheiben in der Kate des Müllers.
Der alte Awdej Sabota1, ein wohlhabender Bauer, macht sich auf in die Stadt.
Vor seinem Hof, auf dem Weg zwischen Hof und Scheune, döst eine vor den Wagen gespannte grauschwarze Stute mit schmalen Spreizhufen, langen Wimpern, grauen Barthaaren und breiter, rauher Unterlippe. Awdej hat graues Kraushaar, er ist groß und finster, und auf seinem flachen Rücken zeichnen sich unter dem ausgeblichenen Kattunhemd die Schulterblätter ab. Er tritt neben den mit Stroh vollgestopften Wagen, einen Hammer in der Hand, ein paar Nägel zwischen den Lippen, und würdigt niemanden eines Blickes.
Er hat Kummer.
Die ganzen letzten Tage hindurch hat er gegrübelt, sich gequält: Soll er den Hammel verkaufen? Der Hammel ist alt, aber eigentlich darf man ihn nicht verkaufen, es ist nicht die Zeit. Getreide müßte man verkaufen. Der Herbst ist warm und sonnig, die Ernte hervorragend, ein Schober ist schon abgedroschen – man braucht das Getreide nur aufzuschütten und in die Stadt zu fahren. Doch die Preise für Roggen und Hafer sind entsetzlich niedrig. Kein Körnchen darf man verkaufen, mag die Not auch noch so drängen … Nachdem er eine Woche lang hin und her überlegt hat, ist Awdej nun entschlossen, sich besser von dem Hammel zu trennen.
Doch er ist gealtert in dieser Woche, hohlwangig geworden und grau im Gesicht. Sein Blick ist hart und finster. Er macht sich zum Aufbruch bereit, ohne jemanden anzusehen.
Seine Tochter, im Kalikounterrock, ohne Jacke und nur in Wollstrümpfen, läuft ein paarmal schüchtern und flink über den Weg zwischen Haus und Scheune. Auch sie will weg – zum Polterabend ihrer Freundin, doch aus Scheu vor dem Vater, aus Scheu vor ihrer verstohlenen Freude, vor ihrer Sorglosigkeit neben seiner Sorge versucht sie unbemerkt an ihm vorbeizuschlüpfen. Ihr kleiner Bruder, ein dickbäuchiger Junge mit einer riesigen alten Mütze auf dem Kopf, der sich die von Rotz verätzten Lippen leckt, fuchtelt und knallt in einem fort mit einem Peitschenfetzen, bis er mitten auf dem Weg hinfällt. Dem Vater zuliebe packt sie hastig sein eisiges, molliges Händchen und trägt ihn in solcher Windeseile ins Haus, daß er nicht einmal einen Schrei ausstoßen kann.
Die Alte steht auf der Schwelle und hat ihre klagenden Augen auf Awdej geheftet.
Sie hält den einen dünnen, grauen Arm auf dem vorstehenden Bauch und hat den anderen, mit dem sie das Kinn abstützt, in den Handteller gestemmt. Sie ist dunkel und runzelig, hat große Zähne und eine Duldermiene. Ihr Rock aus grobem, hausgewebtem Stoff ist kurz, ihre Beine sind lang und sehen aus wie Stöcke, die Füße, rissig vor Schmutz, Kälte und Schrunden, gleichen Hühnerklauen. Der Bauch steht vor, der Rücken ist krumm von schwierigen Geburten und schweren gußeisernen Töpfen. Im Ausschnitt ihres von Asche dunklen Hemdes sieht man schlaffe, hängende Brüste, wie die einer alten Hündin, und zwischen diesen an einer speckigen Schnur ein großes kupfernes Kreuz.
Die Sorgen haben sie zur lebenslangen Dulderin gemacht – und Awdej zum Eigenbrötler.
Der Wagen ist rissig vor Trockenheit und fällt fast auseinander. Awdej tastet in den ausgedroschenen Garben im Wagenkasten und nagelt da und dort Bretter fest, die sich gelöst haben. Es weht ein spätnachmittäglicher Wind, der Awdejs Hemd von hinten über dem Gürtel bläht, die Furche auf dem breiten, mageren Rücken entblößt und den strammen Hosenbund zeigt, der tief in den Körper einschneidet. Die Hose hängt auf Altmännerart an ihm herab – als sei sie leer. Der Hund ist herbeigelaufen und beschnüffelt die abgetretenen, glänzenden, frisch mit Teeröl gefetteten Stiefel, in deren ausgebeulte Schäfte die Hose gestopft ist. Awdej holte aus und versetzte dem Hund mit dem Hammer einen Schlag in die Flanke.
»Bring den Halbpelz und pack mir Brot ein«, fauchte er die Alte an.
Als er den letzten Nagel eingeschlagen hatte, schob Awdej die Mütze in den Nacken und ging entschlossen auf das offene Tor des mit Dung übersäten Hofes zu. Die eine Hälfte lag im Schatten, die andere war mit goldenem Licht beglänzt. In der schattigen Hälfte hockten die Hühner auf der Hühnerstange, einem von ihrem kalkhaltigen Kot weiß gewordenen Querbalken, und ließen die Augen zufallen. Die aufgeplusterten Tauben drängten sich unter dem Dachüberhang in der Ecke zusammen. Sie gurrten leise, als Awdej kam … Wie diese ganze Wirtschaft stets sein Herz erfreute, die Hühner, die Tauben, der warme Hof mit seiner Dungschicht, seinen mit Kuhfladen und Lehm verputzten Ställen aus Weidengeflecht! Auf einem alten Wagen, der keine Vorderkarre mehr hatte und seit langem im Dung eingesunken war, lag ein Stück Seil. Awdej packte es und ging zu dem Stall, in dem der Hammel eingesperrt war.
»Väterchen, die Mutter fragt, ob sie eine Gurke dazulegen soll?«, rief das Mädchen und blickte durchs Tor.
»Weiß sie das nicht selbst?« versetzte Awdej schroff. »Ist es vielleicht das erste Mal?«
Hinter der Gittertür des Stalls raschelte Stroh. Der große, schraubenhörnige Schafbock mit dem dichten, gekräuselten, rauchgrauen Fell stolzierte mit verwundertem Hammelblick und in geckenhafter Hammelmanier über das Stroh und schlug leicht mit seinem fetten Schwanz. Awdej riß die Tür auf, stürzte sich mit dem ganzen Körper auf den Hammel, warf ihn zu Boden und wand hastig das Seil um seine dünnen Beine. Der Hammel wunderte sich noch mehr, gab aber keinen Laut von sich, sondern machte nur große Augen. Awdej schob eine Hand unter das verknotete Seil und schleppte den Hammel unter Aufbietung aller Kräfte auf dem Rücken durch den Dung zum Tor hinaus, zum Wagen. Der Hammel hatte seine weißen Augen aufgerissen, was ihn einem Türken ähnlich sehen ließ, schlug leicht und flink mit dem Schwanz und leckte mit seiner rauhen Zunge Awdejs Hand …
Eine halbe Stunde später ist Awdej unterwegs.
Schwerfällig knarzend schleppt sich der nach Straße und Teer riechende Wagen von Hügel zu Hügel, vorbei an Bauernkaten und Scheunen, bald durch den Schatten, bald durch die Sonne. Hinten liegt ein hanfener Futtersack mit Heu, vorne auf den ausgedroschenen Garben liegt still und ruhig der gefesselte Hammel. Awdej, im Halbpelz, die Mütze tief in die Stirn gezogen, die Peitsche unter dem Arm, die Pfeife zwischen den Zähnen, geht in gemächlichem Reisetempo hintendrein und bläst von Zeit zu Zeit süßen, nach Honigklee duftenden Rauch über die Schulter.
Da ist auch schon das letzte Haus. Die Sonne steht nicht so tief, wie es vom Dorf her aussah: Der Hang fällt hinter dem Dorf steil ab, da ist die baumlose, breite Landstraße, die Biegung nach links, in Richtung Stadt. Die Flügelreste reglos ausgestreckt, steht die Windmühle da wie schon vor sechzig Jahren, als Awdej noch ein Kind war. Daneben lautstark johlende kleine Jungen, sie hüpfen auf einem Bein und spielen Butterloch2 … »Wartet nur ab, bald ist es vorbei mit dem Spielen!« denkt Awdej. Ein sabbernder, kahlgeschorener Narr in einem Frauenhemd, der aussieht wie eine Vogelscheuche, kommt ihm entgegengehumpelt und glotzt noch dümmer als der Hammel … Awdej lächelt traurig: »Narren haben viel Glück und wenig Kummer!«
Unten am Hang ergießt sich das kleine Flüßchen als breiter Flußlauf über weiße Kieselsteine; von dem Kies und dem unaufhörlich sickernden Wasser ist notdürftig eine Brücke auf die andere Seite geschlagen. Der Flußlauf glitzert blendend, der gelbliche, steinige Hang hinter ihm ist mit spiegelnden, fröhlichen Flecken und bunt schillernden Lichtreflexen übersät. Über die Brücke kommen ein paar Wochenendjäger: ein großer Brauner, eine Renndroschke, in der rittlings, einer hinter dem anderen, zwei Männer sitzen, von deren Rücken zwei Gewehrläufe abstehen. Awdej zieht die Hanfleine straff, zügelt seine Stute und wartet, bis die Entgegenkommenden die schmale, schwankende Brücke überquert haben. Einer der beiden hat eine Jagdtasche, vollgestopft mit Wachteln, und auf den Knien des anderen liegt ein Hase, schon starr und mit blutigen Barthaaren. Awdej schaut hin, aber er sieht alles wie im Traum. Ihm ist alles einerlei – wie einem Kranken.
Schließlich hat auch er die Brücke überquert. Er steigt hügelan, dann hügelab in eine Senke und wieder hügelan … Hartes, den Sommer über verdorrtes Gras leuchtet rostrot an den steinigen Erhebungen der alten, verlassenen Straße. Diese Erhebungen wollen kein Ende nehmen. Bis zur Stadt sind es etwa fünfundzwanzig Werst, doch sie war Awdej schon immer, sein Leben lang, sehr weit entfernt vorgekommen. Er bezwingt eine Erhebung nach der anderen, geht gedankenverloren vor sich hin blickend. Er hat die Sonne im Rücken, sie färbt sich rot und sinkt allmählich. Awdejs Schatten auf dem Gras und der längliche Schatten von Wagen und Pferd sind von einem hellen Glanz umgeben. Ringsum freie Felder, man hat einen weiten Blick. Ein Elsternschwarm nächtigt unbehaust, herbstlich, am Rand der gelben Stoppelfelder. Am Horizont eine Reihe Telegraphenmasten, die in den endlosen Feldern verschwinden. Hinter einem Güterzug, der mit einer langen Kette roter Waggons schnell entschwindet, ballt sich Rauch zu purpurroten Schwaden. Awdej steht Zügen bis heute feindselig gegenüber. Einmal in seinem Leben ist auch er mit der Eisenbahn gefahren. Und er hat sich geschworen, das nie wieder zu tun: Andauernd dreht sich einem der Kopf, andauernd ist einem angst und bange …
Bei den Geleisen angekommen, die die Landstraße kreuzen, wartet Awdej vor dem Bahnübergang an der geschlossenen Schranke. Unangenehm früh brannte jetzt im Herbst das Licht im Bahnwärterhäuschen.
Danach kommt die Chaussee, die langweiligste Straße der Welt …
Awdej ist siebenundsechzig Jahre alt: Bald ist es Zeit zu sterben. Besondere Not hat er nie gekannt, vor Elend und Unglück hat Gott ihn bewahrt.
»Erzähl etwas Interessantes, das in deinem Leben vorgefallen ist«, hat der junge Herr einmal zu ihm gesagt.
»Ich habe, Gott sei Dank, nichts dergleichen erlebt«, hat Awdej geantwortet. »Ich bin nun schon über die sechzig hinaus, aber, Dank sei Gott, etwas Interessantes habe ich nicht erlebt.«
Doch sein Leben lang hatten die Sorgen an ihm genagt. Geizig ist er, sagten die ärmeren Nachbarn über ihn. Pah, du Bettelbruder hast gut reden! dachte sich Awdej darauf jedes Mal erbost.
Die Sonne ist untergegangen, es weht ein kalter Wind. Awdej deckt den Hammel mit Stroh zu, zieht die Mütze tiefer in die Stirn, steckt die Hände in die Ärmel und geht gemessenen Schrittes am Rand der Chaussee hinter dem knarzenden Wagen her.
Seine breite Greisennase läuft bläulich an, wird kalt, der Wind bläst seinen grauen Bart schräg zur Seite. Die buschigen grauen Brauen sind streng gerunzelt, in den erloschenen Augen liegt Schwermut.
Alltag
Es schien, als würden diese blaßblauen Wolken, unter denen die Strohdächer grau schimmerten, die Weidenbüsche grünten und die farbigen Vierecke der umliegenden Felder bunt leuchteten, ewig am Horizont stehen. Der sonnenlose Junitag war besonders lang.
Der Sohn des Popen, bei dem der Seminarist Slutschewski zu Besuch war, fuhr mit dem Popen zusammen Mist. Das Tor neben der länglichen weißen Kate war sperrangelweit geöffnet. Zwei mit brauner Jauche bespritzte Wagen und zwei wohlgenährte Pferde standen mitten auf dem aufgegrabenen Hof am Pferch. Der Popensohn schuftete für drei: Er stach die Mistgabel tief in die warmen Schichten, stellte das linke Knie unter die Gabel und zerrte sie mit einem schmatzendem Ploppen wieder heraus. Der Pope, ein dunkler, großgewachsener Mann nur im Unterhemd, in rosafarbenen langen Unterhosen und schweren Stiefeln mit ausgebeulten Schäften, stand ihm nicht nach: Wacker warf er seine blauschwarzen Haare über die Schultern zurück, fuhr mit der Mistgabel in den Dung, wendete die dampfenden Stücke und klatschte sie wuchtig auf das Fuhrwerk. Vater und Sohn gingen jedes Mal mit schweißüberströmten Gesichtern, aber angeregt und froh über die ihnen auf dem Weg zum Feld bevorstehende lange Ruhepause, zum Tor hinaus.
»Herr Schaljapin3, gesellen Sie sich doch zu uns!« rief der Pope munter, während er hinter den Rädern herging, die Seilzügel in Händen hielt und die leichten Schöße seines aufgeknöpften Leibrocks flattern ließ.
Der Seminarist, der auf der Vortreppe saß, hörte in diesem Scherz einen unaufrichtigen, eigennützigen Ton heraus, gab aber nicht klein bei.
»Das Schlimme ist«, ließ er sich vernehmen, »wenn man ins Schwitzen gerät und einen Windstoß abbekommt – dann ist es nämlich aus mit Schaljapin. Mit der Stimme, Vater Pjotr, treibt man keine Scherze. Sonst wäre ich natürlich mit dem größten Vergnügen bereit.«
Der Seminarist, ein dunkeläugiger Jüngling mit einem breiten, blassen, hochmütigen Gesicht, blickte den sich entfernenden Fuhrwerken nach, auf die grauviolette Straße und auf die feuchten, rostbraunen Brocken, die darauf verstreut waren. Der Kirchendiener kam vorbei, er blieb kurz stehen, klagte über sein Schicksal und fing wieder von seinem verstorbenen Sohn an. Seine wuchtigen, lilaroten, von Alter und Trunksucht geschundenen Hände lagen unruhig flatternd auf dem Gehstock und ließen diesen hin und her schaukeln. Riesige, geteerte Stiefel guckten unter dem braunen Leibrock hervor. Eine silberne Medaille an einem roten Band schmückte seine Brust. Das Gesicht und die große Nase waren rosa, fleischig und von tiefen Furchen durchzogen. Aus den hervorquellenden, eitrigen Augen flossen wie immer Tränen; die dunkelroten, zu einem Zopf geflochtenen Haare ringelten sich zu drahtigen Löckchen, wie bei alten Frauen, die zu viel trinken. Der Kirchendiener sprach eintönig, stieß mühsam jede Silbe einzeln hervor: Jede seiner Silben zitterte und hüpfte.
»Vater Pjotr hat Glück!« sagte er. »Er hat einen Gehilfen. Und meiner liegt im Grab! Als er heranwuchs, waren alle hellauf entzückt von ihm. Manchmal habe ich mit ihm geprahlt: ›Keinen Sohn habe ich, sondern ein Genie!‹ Und stets sagten alle: ›Wenn er nach Ihnen kommt, Stepanytsch, ist das besser als jedes Genie!‹ Dann war er erwachsen, und geschickter wirtschaften als er, glauben Sie mir, konnte keiner im ganzen Dorf! Schwindsucht im Endstadium, er lag im Sterben, aber er gab sich nicht geschlagen. ›Sie müssen nächstens sterben‹, sagt der Feldscher. ›Nein‹, sagt er, ›ich kann nicht sterben, wenn der Roggen noch nicht eingebracht ist.‹ Wir mähen, binden Garben, und er sitzt bei Tagesanbruch auf der Vortreppe, blickt auf die Wolken, und ich sage noch zu ihm: ›Was sitzt du da und guckst?‹ Und er darauf: ›Kommen Sie, Papa, solange das Wetter hält, können wir mit zwei Fuhrwerken gleichzeitig einbringen.‹ ›Du meine Güte, wie willst du das denn anstellen? Ich wollte einen Bauern anheuern.‹ ›Nicht nötig, nicht nötig, das schaffen wir selbst.‹ ›Wie sollen wir das denn schaffen‹, sage ich, ›allein an Roggen sind es vierunddreißig Schober.‹ Aber er ließ einfach nicht locker … Und ist dann, können Sie sich das vorstellen, zwölfmal am Tag aufs Feld gefahren! Ausruhen wollte er auch nicht recht, kaum sitzt er mal im Kühlen und trinkt ein wenig Kwas, schon ist er wieder auf dem Wagen. Sogar mich hat er übertroffen. Es ist kaum hell, die Hähne krähen noch nicht, da weckt er mich schon: ›Stehen Sie auf, schneller, stehen Sie auf, es ziehen Wolken auf!‹ In drei Tagen waren wir mit allem fertig – alles eingefahren und gedroschen, das ganze Stroh weggeräumt … Er jagt mich los, eine Kornschwinge holen, ich leihe mir eine von Danilkin, wir worfeln das Getreide, fegen den Dreschboden … Kaum ist das letzte Korn im Speicher, kommt er ins Haus und sagt: ›So, jetzt sieht es schon ganz anders aus. Papa, wo sind die Kerzen? Zündet die Kerzen an.‹ Wir zünden die Kerzen vor den Heiligenbildern an, er legt sich auf den Diwan – und dann war es vorbei!«
»Nicht übel«, dachte der Seminarist ironisch, während er sich das anhörte.
Als der Kirchendiener weg war, nahm er seinen Spazierstock, setzte seinen funkelnagelneuen grauen Hut auf, warf sich den silberglänzenden Regenmantel über die Schultern und schlenderte durch das Dorf. Als er zum Dorfanger kam, blickte er hinüber zu der Kirche, die sich vor einer Wolke fahl abhob, und dann zu den geöffneten Fenstern des staatlichen Schnapsladens; er wollte schon eintreten und einen Schwatz mit dem Verkäufer halten, aber dann überlegte er es sich anders und ging in Richtung des Kirchhofs. Der Verkäufer war ganz versessen aufs Lesen. Von morgens bis abends lag er auf seinem hohen Doppelbett, stützte sich auf die Ellbogen und verschlang Seite um Seite von Wokrug sweta4. »Sofort, sofort«, murmelte er jedes Mal, wenn jemand den Laden betrat. »Lassen Sie mich nur noch bis zum Punkt lesen.« Wenn er sich dann mit dem Kunden unterhielt, hörte er ihm nicht zu, lachte an den falschen Stellen und wartete nur darauf, daß er wieder ging. Alle naselang unterbrachen ihn seine Frau oder die Bauern bei der Lektüre, woraufhin er sie mit ratlosen, wirren Blicken bedachte. »Zeit, das Futter für die Kühe zu mischen!« schrie etwa seine Frau erbost und riß die Tür auf. »Noch ein Viertel, schnell!« brüllte ein Bauer fröhlich und blickte zum offenen Fenster herein. Er aber begriff überhaupt nicht, wer ihn da rief und wozu. In seinem Kopf ging alles durcheinander, die Inseln im Stillen Ozean und die Prärien, das Kreuz des Südens und Grönland, Brasilien und die Kaffern, die holländischen Kolonisten und die Riesenschlangen, die Flüsse im tropischen Dschungel und die Nilpferde … »Was hat denn der Stille Ozean damit zu tun?« überlegte der Seminarist, als er die verlassene Straße hinunterspazierte. Ihm entgegen kam der Dorfschulzengehilfe, ein langer Kerl in einem roten Hemd und ausgetretenen Stiefeln, von denen einer mit einer Schnur am Fuß festgebunden war. Auf seiner Schulter lag eine einläufige Flinte.
»Wohin des Weges?« fragte der Seminarist.
»Den Saatkrähen einen Denkzettel verpassen«, erwiderte der Dorfschulzengehilfe.
Er war dem Seminaristen gut bekannt: Er war schon mehrmals gekommen und hatte nach Zeitungen für seine Selbstgedrehten gefragt. Seine halbzerfallene Kate stand am Rand des Dorfes, neben dem Kirchhof. Als der Seminarist daran vorbeiging, flatterte gackernd ein Huhn durch das kaputte Fenster hinein. Die Tenne hinter dem Haus war leer, ohne Stroh, ohne Korndarre, Heugabeln mit nur einer Zinke lagen herum und wurden allmählich vom Gras überwuchert, ebenso wie ein Wagenkasten mit zwei neuen, gelben Rippen, der mit dem Boden zuoberst lag, und ein ausgetrocknetes Teerfaß … An einem Weidenbusch hing kopfunter ein totes Küken – eine Vogelscheuche, obwohl hier niemand von irgendetwas verscheucht werden mußte. Im stolzen Bewußtsein seiner Entfremdung von dieser elenden Lebensweise, seiner Träume von Moskau und vom Konservatorium, betrat der Seminarist den Kirchhof auf der Anhöhe hinter dem Dorf, warf lässig den Kopf zurück und stellte pfeifend und mit dem silberglänzenden Regenmantel raschelnd seinen Adamsapfel zur Schau.
Auf dem Kirchhof streifte zwischen Kletten, Winterheckzwiebeln und den Grabhügeln ein rotbraunes Pferd mit strohgelber Mähne umher. Es schlug mit dem spärlichen Schwanz und rupfte das dünne, trockene Gras. Auf einem großen, frischen Grab, einem Hügel aus graublauem, lockerem Lehm, lag ein Bauer, der sich bis über den Kopf mit seinem langen Bauernmantel zugedeckt hatte. Friedlich, mit gesenkten Schwänzen und leise kollernd, spazierten die Puten des Krämers umher. Im Gänsemarsch zogen sie zu dem Bauern – um plötzlich alle aufs Mal auf ihn loszustürzen und mit ihren Schnäbeln auf seinen Bauernmantel und seinen Kopf einzuhacken. Der Bauer sprang auf und schleuderte ein paar Handvoll Lehm nach ihnen: Die Puten hüpften hoch und schwirrten mit dem Gefieder … Der Seminarist tat, als hätte er den Bauern nicht bemerkt, und ging vorüber.
Über den Gräbern der Herrschaften wuchsen zwei Birken. Einst waren sie von einer hölzernen Umzäunung eingefaßt, hinter der eine Bank gestanden hatte. »Ich werde herkommen, hier sitzen, der Toten gedenken und trauern«, so hatte der gedacht, der das alles angelegt hatte. Und war kein einziges Mal hergekommen. Das Dorf hatte mit der Zeit die Umzäunung und die Bank in Stücke gebrochen und weggetragen. Schweine hatten die Grabhügel aufgewühlt, Kälber die Stämme der Birken abgenagt … Pfeifend und mit ironischem Lächeln kehrte der Seminarist wieder um. In der Nähe des Grabes, auf dem der Bauer sein Schläfchen zu halten versuchte, stand ein vermodertes überdachtes Grabkreuz. Ein Fliegenschnäpper kam darunter hervorgeflattert. Der Seminarist ging näher heran: Unter dem Dach lag neben einer regenbogenfarbig schillernden kleinen Ikone aus Folie ein winziges rundes Vogelnest. Aus lauter Langeweile wollte der Seminarist es herausreißen und betrachten, um es dann zu zerrupfen und fortzuwerfen. Doch der Bauer schlug die Augen auf und spähte aufmerksam unter dem Mantel hervor.
»Haben Sie es hinter sich?« fragte er.
Die Frage kam unerwartet. Der Seminarist drehte sich um und zog die Brauen in die Höhe.
»Was meinst du?« fragte er.
»Na, ob Sie ausstudiert haben?«
Der Seminarist schlenderte zu dem Grabhügel hinüber.
»Ach, das meinst du!« sagte er, setzte sich und blickte mit gespielter Zerstreutheit ringsum. »Ja, bis zum Herbst habe ich ausstudiert. Woher kommst du?«
»Aus Rassochino«, antwortete der Bauer. »Aus dem Bezirk komme ich. Unterwegs dachte ich mir, ich könnte mein Pferd ein bisschen füttern … Und Sie? Geistlicher?«
»Ja … Aber hauptsächlich lerne ich singen.«
»Wie das denn, singen?« fragte der Bauer gähnend. »Im Chor vielleicht?«
»Nein, Bruder, nicht im Chor«, sagte der Seminarist und stützte sich auf seinen Spazierstock. »Ich werde auf der Bühne singen. Aber das begreifst du nicht … Ich bereite mich aufs Theater vor.«
Der Bauer grinste.
»Aber nicht doch, das begreife ich sogar sehr gut«, versetzte er. »Bloß führt das zu überhaupt nichts, damit sieht es ganz schlecht aus. So werden Sie nicht viel verdienen.«
»Was du nicht sagst!«
»Die reine Wahrheit«, versetzte der Bauer ruhig und überzeugt. »Da werden Sie kein Vermögen machen. Nein, schlagen Sie besser den kirchlichen Weg ein, oder bleiben Sie bei Ihrem Handwerk – dem Volk Hühner und Weißbrot wegzunehmen. Aber das Theater, nein – das ist das Allerletzte.«
»Warum denn das?«
»Na weil es das Allerletzte ist. Da gibt es nur dummes Zeug. Sie sollten besser auf mich hören, ich sage schon nichts Verkehrtes. Ich bin kein Simpel, ich habe meine Erfahrungen. Den Bauern hier habe ich jetzt einiges voraus, vergangenes Jahr war ich den ganzen Sommer über in Lipezk. Ich kann mich jetzt mit jedem unterhalten …«
Eintönig blau leuchtete der niedrige, bewölkte Himmel am Horizont, blaßgrün schimmerte das Getreide am Hang gegenüber – notgedrungen mußte man sich eben mit einer solchen Unterhaltung zufriedengeben. Der Seminarist zog ein geflochtenes Zigarettenetui hervor und rauchte eine Papirossa an, eine zweite streckte er dem Bauern hin. Der Bauer nahm sie vorsichtig entgegen.
»Ich danke ergebenst«, sagte er, riß ein Schwefelholz an, blies den Rauch durch die Nase, begutachtete die Papirossa und fragte unvermittelt:
»Eine Asmoloff?«
Der Seminarist erinnerte ihn an das Theater.
»Hören Sie mal«, sagte der Bauer. »Von diesen Theatern halte ich ja überhaupt nichts. Dort, das muß man ganz offen sagen, wohnen die Teufel. Und weil geraucht wird, gibt es auch Wodka. Und wo es Wodka gibt, sind auch die Weiber nicht weit … Nein, machen Sie bloß einen Bogen darum! Wer beispielshalber im Kloster wohnt, die Mönche, die haben es gut, die haben damit kein Problem: Die amüsieren sich, schlagen über die Stränge – und Punktum. Da ist einer dicker als der andere! Die lassen den Becher kreisen, machen ihr Leben lang nichts anderes. Aber im Theater, da gibt es Wodka, da ist das Weibervolk, und er treibt sich natürlich auch dort herum. Wo es Wein gibt, da ist unweigerlich auch er.«
»Redest du etwa vom Teufel?« fragte der Seminarist.
»Na, von wem denn sonst? Natürlich. Und es ist wahr. Er ist da überall, auf Schritt und Tritt. Das habe ich längst begriffen. Was soll daran gut sein? Ich bin selber wer und gehe auch nicht dahin. Ohne Geld brauchst du nicht erst zu erscheinen – da kannst du dir für drei Rubel nicht viel erlauben. Aber das Frauenvolk fährt dahin, lauter überspannte Weiber, und die Kaufmannschaft: Die Schulden sind bezahlt – und los geht’s. Ich habe in Lipezk genug gesehen. Drei Werst entfernt gibt es da einen Garten, da fahren alle hin. Sie nehmen Schinken mit, geräucherte Wurst und Fruchtlikör … und amüsieren sich den lieben langen Tag. Schlagen das Geschirr zu Bruch, saufen – die kennen überhaupt keinen Anstand! Die Alte und der Großvater schaffen nicht mal mehr, den Samowar einzuheizen …«
Der Seminarist sagte abfällig:
»Da kann man sehen, daß du rein gar nichts begreifst, du faselst nur dummes Zeug und bringst alles durcheinander. Mal ist es Sünde, mal ›kannst du dir für drei Rubel nicht viel erlauben …‹«
»Es ist aber so!« sagte der Bauer unbeirrbar. »Vom Kapital aus gesehen ist es natürlich möglich, aber Leute wie Sie und ich, arme Schlucker, was haben wir damit zu schaffen? ›Sünde!‹« – er griente –, »versündigen kann man sich leicht, Bruder. Gestern konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Ich hab’s nicht ausgehalten, hab ein Schwein abgestochen – ich bin verwöhnt von dem guten Essen in Lipezk. Was soll’s, ein kleines Stückchen hab ich bloß gegessen, aber dieses Schwein ließ mich nicht schlafen. Kaum war ich eingedöst, ging es los – das Vieh erhebt sich und steuert direkt auf mich zu … Das kommt davon! Ich hätte kein Fleisch essen dürfen. Zu Erntedank, da darf man Fleisch essen, vom Kapital aus gesehen, aber zur Fastenzeit vor dem Apostel-Petrus-Tag – die steht den Großen Fasten in nichts nach, Bruder … Nein, mit mir ist schwer zu streiten!« sagte der Bauer unbeirrbar. »Plus und Minus heben sich gegenseitig auf.«
Der Seminarist zuckte die Achseln.
»Weiß der Teufel!« sagte er nach einer Weile. »Was du da redest, du kommst vom Hölzchen aufs Stöckchen … Sag doch bitte, was für eine Meinung haben die Leute aus dem Dorf von dir, für wen halten sie dich?«
»Die können überhaupt keine Meinung von mir haben«, sagte der Bauer. »Schlauer als ich ist keiner im ganzen Dorf. Geh hin und frag die Leute: Wer wirtschaftet besser als Nasar Pawlow Protassow? Da gibt es einfach keinen! Sogar die Alten kommen zu mir, um sich zu beraten.«
»Und dann faselst du so dummes Zeug?«
»Was heißt hier dummes Zeug? Von wegen dummes Zeug, Sie haben wohl keine gute Erziehung … Bei uns gibt es einen Schuster. Wenn der was getrunken hat, kommen die Kinder zuerst an die Reihe: Er hat eine ganze Kompanie davon, zwölf ungefähr … Die geben dann Fersengeld, jeder so gut es geht! Dabei hat er sie hervorragend erzogen! Das glaubst du nicht, auch wenn er ein Trunkenbold ist: Er hat sie so erzogen, Bruder, daß sie aufs Wort gehorchen! Heutzutage kann natürlich jeder machen, was er will … Wenn man zum Beispiel die Frauen nimmt: Wer ist denn schuld an dem ganzen Durcheinander im Staat? Wiederum die Frauen. Heutzutage dürfen sie in großer Zahl an allen Versammlungen teilnehmen, aber wozu taugen sie? Selbst wenn ihnen heutzutage auch gutes Lernen zuteil wird, aber trotzdem ist der Mann immer noch ein bisschen tüchtiger!«