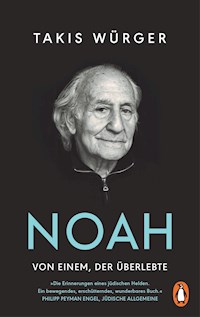22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als er vierzehn ist, verliebt sich Hannes Prager in das Mädchen Polina. Um ihr seine Liebe zu zeigen, komponiert der wundersam begabte Junge eine Melodie, die Polinas ganzes Sehnen und Wu¨nschen umfasst. Doch sein Leben nimmt eine unvorhergesehene Wendung, Hannes hört auf, Klavier zu spielen und seine und Polinas Wege trennen sich. Nach Jahren, in denen er nichts als Leere fu¨hlt, erkennt Hannes: Er muss Polina wiederfinden. Und das Einzige, womit er sie erreichen kann, ist ihre Melodie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Takis Würger
Für Polina
roman
Diogenes
Für Günce
»Das Geheimnis des Klavierspiels besteht teilweise in dem Maß, in dem es einem gelingt, sich von dem Instrument fernzuhalten.«
Glenn Gould
I
1
In den Sommerferien vor ihrem Abitur reiste Fritzi Prager mithilfe mehrerer Regionalzüge, einer Lastwagenfahrerin und eines verliebten Paares, das sie über den Brenner mitnahm, in die toskanische Stadt Lucca. Dort bezog sie in einer günstigen Pension am Piazza San Michele ein Zimmer, das nach gebratenen Zwiebeln roch. Tagsüber lag sie im Schatten der alten Stadtmauer und las die wunderbar duftenden Bücher, die sie mitgebracht hatte. Abends aß sie Focaccia mit Rosmarin und scharfem Olivenöl und lief durch die Gassen, bis ihre kleinen Zehen in den Sandalen wund gescheuert waren. Fritzi genoss, dass sie allein war, sah den Menschen zu und träumte sich in die vielen Leben hinein, die sie würde führen können, wenn sie die leidige Schule endlich abgeschlossen hätte. Irgendwann wollte sie auch mit einer Familie an einem Tisch mit rot-weiß karierter Decke sitzen und den Straßenmusikern zuhören.
An einem Abend lernte sie einen älteren Mann aus Hamburg kennen. Er sprach sie an, gab ihr zwei Negronis aus, erzählte, er sei in seiner Firma eigentlich der Chef, und legte wie zum Beweis eine dicht bedruckte Visitenkarte neben ihr Glas, was Fritzi so unbeholfen fand, dass es sie rührte. Sie trank und hörte zu. Er sei beruflich in der Toskana. Natursteinhandel, sagte er, er trage außerdem die gleiche Uhr wie der Erstbesteiger des Mount Everest, er sprach über Politik, Carrara, Parmaschinken, über eingelagerte Minerale im Cipollino-Marmor und die daraus resultierenden wellenförmigen Strukturen, über seinen vertrottelten Vorgesetzten, über Fußball, hielt dann unvermittelt inne und fragte, ob sie, Fritzi Prager, schon einmal gehört habe, dass ihr Gesicht aussehe wie das der Dienstmagd mit Milchkrug auf dem gleichnamigen Gemälde Jan Vermeers.
Fritzi fand, er rede zu viel. Aber sie mochte seine sonnenbraunen Hände und die Tatsache, dass sie mit einem fremden Mann sprach an einem toskanischen Sommerabend, der so warm und satt war, als könnte man ihn in Scheiben schneiden – obwohl sie sich gewünscht hätte, der Mann wäre Italiener und ein wenig unberechenbarer. In einer Trattoria bestellte er für sie die gefüllten Zucchiniblüten, die sie schon den ganzen Urlaub kosten wollte, er sagte, er würde Fritzi natürlich einladen. Die Zucchiniblüten waren salzig, das Fett lief Fritzi beim Reinbeißen über das Kinn, und der Mann konnte sie dann doch nicht einladen, weil er kein Bargeld dabeihatte, sondern nur goldene Karten aus Plastik. Dafür gab er Fritzi im nächsten Lokal, das über ein Kartenlesegerät verfügte, drei Gläschen Piemonteser Haselnussgeist aus. Als er sagte, in seiner Hotelbar gebe es einen Tresen, der aus einem einzigen Block grünem Silikatmarmor geschnitten war, den müsse sie gesehen haben, tat er ihr leid. Sie ging mit. Sie fand es interessant, die Nacht mit einem Mann zu verbringen, der graue Haare hatte. Sie wusste nicht, dass das Medikament, das sie eine Woche vorher nach dem Genuss eines verdorbenen Tiramisus eingenommen hatte, die Verhütungspille unwirksam machte. Die Packungsbeilage war auf Italienisch und die Apothekerin römisch-katholisch.
Einige Wochen später stieg Fritzi Prager in der staubigen Augusthitze im Zentralbahnhof Lucca in einen Zug nach Norden. Eine halbe Stunde später übergab sie sich in den kleinen metallenen Klappmülleimer neben ihrem Sitz. Sie ahnte, dass das keine Reiseübelkeit war.
Der Frauenarzt daheim in Hannover Linden untersuchte Fritzi kurz nach ihrer Rückkehr. Er hatte ihr die Pille verschrieben, die dann versagt hatte, und nahm die Angelegenheit persönlich. Er wusste, dass Fritzi eine der besten Schülerinnen ihres Jahrgangs war, und das trotz ihres prügelnden Vaters und der noch mehr prügelnden Mutter. Fritzi wollte in München Jura studieren. Jura, weil ihr die klare Sprache in dem Gesetzbuch gefiel, das sie sich in einer Buchhandlung nahe der Leibniz Universität angesehen, nicht verstanden, aber sofort ins Herz geschlossen hatte. München, weil es zwar nicht Italien war, aber an guten Tagen fast, wie Fritzi gehört hatte.
Der Arzt bot ihr an, mit ihr über alle Optionen zu sprechen. Er benutzte das Wort Missgeschick. Fritzi legte eine Hand auf ihren Bauchnabel und eine auf die plastikblau behandschuhte Hand des Arztes und sagte leise: »Herr Doktor, ich an Ihrer Stelle würde jetzt sehr vorsichtig sein.«
Im folgenden April, als das Fruchtwasser den Teppich in ihrem Zimmer ruinierte und die Wehen in ihrem Unterleib wühlten, setzte Fritzi sich den für diesen Anlass gepackten Rucksack auf und ging zu Fuß ins Friederikenstift. Die Geburt dauerte eineinhalb Tage. Der Umstand, dass Fritzi schmal gebaut und wahrscheinlich noch im Wachstum war, machte irgendwann sogar der alten Hebamme Sorgen, die ohnehin müde wurde und hungrig obendrein. Wenn Fritzi den Kleinen nicht bald auf die Welt presse, müssten sie die Zange holen oder einen Kaiserschnitt vorbereiten. Fritzi wollte keinen Kaiserschnitt. Sie wollte so schnell wie möglich das Krankenhaus verlassen, damit sie ihre schriftliche Abiturprüfung ablegen könnte. Sie versuchte, an etwas Schönes zu denken, damit sie vor Schmerzen nicht ohnmächtig würde, was sie einem Kaiserschnitt vermutlich noch nähergebracht hätte. Sie dachte an den Geruch von Herbstlaub, an warme Pfannkuchen, aus denen Erdbeermarmelade tropft. Sie dachte an das Gefühl, das sie in der Lunge spürte, als sie zum ersten Mal die Alpen überquert und geglaubt hatte, von nun an würde es bis zum Meer nur noch bergab gehen. Und sie dachte an den teuflisch starken Espresso auf italienischen Autobahnraststätten, den sie mit zwei Löffeln Zucker verrührt wie schwarzen Sirup trank. Als der Blutverlust kritisch wurde und sie merkte, dass all die guten Gedanken nicht halfen, ein Kind auf die Welt zu bringen, und weil die Hebamme sie beständig anbrüllte, sie solle verdammt noch mal pressen, begann Fritzi Prager mit einer durch die vergangenen eineinhalb Tage Kampf etwas heiseren Stimme zu singen. Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren. Ein Kinderlied von der Nordsee. Etwas Besseres fiel ihr vor lauter Schmerz nicht ein.
Hannes Prager kam bei der neunten Wiederholung des Refrains. Er war ein dicker Säugling, der aussah wie ein Greis mit blonden Haaren oder, je nach Blickwinkel, wie eine alte rote Kartoffel. Ganz still rutschte er der Hebamme in die Finger. Sie hielt ihn ans Fenster und hieb ihm zwei Mal klatschend auf den Hintern, bevor Fritzi sich vor Schmerz stöhnend aufbäumte und ihr, so sanft es ging, den Jungen entwand.
Eine Liebe durchrollte Fritzi, schön und erschütternd, und sie begriff, dass dieser stille Gnom, der sich auf ihrer Brust zu einer kleinen Kugel zusammenigelte, das wunderbarste Missgeschick war, das ihr hatte passieren können.
Später, als Fritzi mit ihrem Krankenhausbett und dem kleinen Hannes auf der Brust in ein Mehrbettzimmer gerollt wurde, lag dort bereits eine Frau, nicht viel älter als sie, kreidebleich und mit einem winzigen Mädchen im Arm.
»Hey«, sagte die Frau.
»Hey.«
»Mein Gott, ist das schön, oder?«
Die junge Frau hieß Güneş, sie kam vom anderen Ende der Stadt, plapperte pausenlos, lachte ein paarmal laut, sprach leise auf Türkisch mit ihrer Tochter und stand nach einer halben Stunde auf, als hätte sie nicht gerade ein Kind geboren, ging an Fritzis Bett und gab ihr eine in der Mitte leicht eingedellte, mit Fetakäse gefüllte Blätterteigtasche. Güneş sagte, diese Blätterteigtasche würde eine Muttermilch machen, dass der Kleine bis morgen einen halben Kopf gewachsen wäre. Sie sah genau zu, bis Fritzi die gesamte Blätterteigtasche gegessen hatte, und strahlte sie dann an. Beide Frauen bekamen keinen Besuch an diesem Tag und am nächsten ebenfalls nicht. Als mitten in der Nacht ein Aprilhagel gegen die Fenster prasselte und Fritzi wach lag und besorgt über die Zukunft und überwältigt von der Gegenwart ihrem schlafenden Sohn zusah, sagte Güneş, ohne zu ihr herüberzuschauen: »Ich kann gar nicht glauben, dass so ein Engel zur Hälfte von so einer Gurke abstammt.«
Fritzi schwieg und dachte zum ersten Mal seit Langem an den Marmorhändler.
Güneş sagte, sie würde ihre Tochter Polina nennen, das sei ein Name aus ihrem liebsten Dostojewski und gerade gut genug für das Glück auf ihrem Arm. Und sie sagte, sie schwöre auf ihr Blut, dass der Vater dieses Kind niemals halten werde.
Kurz darauf entriegelte sie die Sperrhebel des Krankenhausbettes und rollte ihr Bett nah an Fritzis heran, sodass die beiden jungen Mütter dalagen wie in einem Ehebett, was eine in das Zimmer eilende Krankenpflegerin verhindern wollte, aber Güneş nur mit dem Satz quittierte: »Sie können uns ja rausschmeißen.« Dann legten sie ihre Kinder nebeneinander und schauten dem neuen Leben zu. Ein flaumig dunkler Säugling, ein runzeliger roter, die Augen meist geschlossen. Ab und zu bewegten sie sich ein wenig und drohten in die Ritze zwischen den Matratzen zu rollen, sonst taten sie nichts, aber es war Fritzi und Güneş genug, dass sie atmeten. Nach einer Weile spürten die Kinder einander und schmiegten sich zusammen, als würden sie die Wärme des anderen in sich aufnehmen wollen.
»Wie zwei Maulwurfbabys«, sagte Güneş.
Fritzi nickte.
»Ich glaube, wir werden bis an unser Lebensende Freundinnen sein«, sagte Güneş. Und obwohl sie es sicher anders gemeint hatte, als es am Ende kommen würde, sollte sie recht behalten.
Als Hannes Prager drei Wochen alt war, schrieb seine Mutter Fritzi Prager das Abitur, mit Sondergenehmigung in einem separaten Klassenraum, damit sie zwischenzeitlich ihren Sohn stillen konnte. Er blieb fünf Stunden lang in seinem Kinderwagen liegen, schrie nicht, quengelte nicht, lauschte nur dem Kratzen des Füllfederhalters und dem beruhigenden Atem seiner Mutter.
2
Fritzi Prager entschied, vorerst nicht nach München zum Studium zu ziehen, trotz ihrer Zulassung und zweier Stipendien, die ihr das ermöglicht hätten. Sie wog ab, ihre wenigen Habseligkeiten und ihren Sohn einzupacken und direkt wieder in das Land zu gehen, aus dem er in gewisser Weise stammte. Aber als sie nachts am schimmeligen Fenster ihres Kinderzimmers stand und der Rest von Linden schlief, als sie den Gnom hin- und herschuckelte, der nur dann schlafen wollte, wenn sie sang, und, sobald sie sich eine Pause gönnte, aus vorwurfsvollen Augen zu ihr hochblickte, da fasste sie den Entschluss, erst einmal alles andere außer ihm zu vergessen. Eine Nachbarin sagte, Fritzi könne doch in Hannover Jura studieren, das sei auch nicht so wichtigtuerisch wie München, die Leibniz Universität sei von Linden aus zu Fuß zu erreichen und habe einen Kindergarten für Fälle wie Fritzi. Aber die Nachbarin hatte weder ein juristisches Staatsexamen noch mit achtzehn Jahren allein einen Jungen aufzuziehen versucht, noch war sie jemals in München gewesen, noch war sie die Mutter von Hannes Prager.
Das Kind schrie nie. Es war so still, dass Fritzi sich manchmal fragte, ob der Herrgott bei seiner Schöpfung etwas vergessen hatte. Eine Kinderärztin, die den Jungen untersuchte, während Fritzi händeringend danebensaß, kniff ihm irgendwann genervt in einen der runden Füße, worauf das Kind immerhin einen leisen Klagelaut von sich gab, der entfernt an den Ruf eines kleinen Entenvogels erinnerte.
Fritzis Eltern störten sich an ihrem nächtlichen Gesang und auch an den Fragen der Nachbarn, wer denn der Vater des Babys sei. Und besonders störten sie sich daran, dass Fritzi einmal darauf antwortete: ein Tiramisu aus Bologna. Die Fragen hatten viel damit zu tun, dass Fritzi den Lindenern zwar wegen ihres schnellen Verstandes nicht geheuer war, aber wegen ihrer elfenhaften Schönheit bewundert wurde – besonders im Sommer, wenn sie kurz abgeschnittene Jeans und zu weite Hemden trug. Man wollte wissen, wer die kleine, freche Fritzi Prager mit dem Kurzhaarschnitt hatte schwängern dürfen.
Ihre Mutter sagte, das Balg brauche mal eine ordentliche Tracht hinter die Löffel, dann würde es auch besser schlafen. Fritzi sagte, sollte irgendjemand den kleinen Hannes auch nur anrühren … Sie brachte den Satz nicht zu Ende. Fritzis Mutter nahm einen Zug von ihrer Zigarette und blies ihn in Richtung des Kindes. Sie sagte, wenn Fritzi jetzt erwachsen spielen wolle, möge sie bitte bis Ende des Sommers samt ihrem Sohn ausziehen. Es war August.
Fritzi würde arbeiten müssen und hatte gleichzeitig nicht vor, ihren drei Monate alten Jungen auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen. Sie fand mithilfe von Güneş eine Stelle als Putzkraft in einer Netto-Filiale am nördlichen Stadtrand nahe dem Flughafen. Tagsüber konnte sie lesen und nachts, wenn sie zusammen mit Güneş wischte und wienerte, das Baby in ihrem alten Schulrucksack auf dem Rücken tragen, wo es glucksend ihrem Gesang zuhörte. Güneş arbeitete in der gleichen Netto-Filiale, sie holte ihr Abitur an einer Abendschule nach und träumte davon, einen Mann zu finden, der sie weder mit dem Handrücken schlagen würde (wie Polinas Vater), noch so langweilig wäre »wie ein Hausschuh«. Güneş befeuerte diesen Traum mit einer immensen Energie, traf viele Anwärter und verließ sie meist schon, bevor sie zusammenkamen. Wenn sie dann zur Arbeit erschien, sagte sie »Hausschuh«, und die Suche begann von vorn. Aber Güneş war ein glücklicher Mensch, und noch höher als ihre Ansprüche war die Hoffnung, dass eines Tages einer in ihr Leben stolpern würde, der ihr ansatzweise gerecht werden könnte.
Manchmal legten die Frauen ihre Kinder in einen Wäschekorb, den sie mit weißen, an Flokatiteppiche erinnernde Fußmatten aus der Haushaltsabteilung des Netto auskleideten.
Der Supermarkt befand sich in der Einflugschneise des Flughafens, tagsüber donnerten die Maschinen darüber hinweg, was die Miete in der Nachbarschaft bezahlbar machte und Fritzi und Sohn erlaubte, in eine kleine Einzimmerwohnung mit Kochnische in einem Mehrfamilienhaus zu ziehen.
Fritzi hatte ihre Bücher, eine Matratze, eine beste Freundin, zwei Jeans und einige Hemden, einen Löffel und ein paar Kartons, die sie aus dem Supermarkt mitnahm und als Babybett, Kleiderschrank und Esstisch einsetzte. Das meiste Geld gab sie für Windeln aus. Mutter und Sohn fehlte es an nichts.
Die Kinderärztin war anderer Meinung. Fritzi bat einen weiteren Arzt um Rat, weil sie das Gefühl hatte, sie werde wie ein zweiter Säugling behandelt, aber der zweite Arzt und auch der dritte sagten etwas Ähnliches wie die erste Ärztin. Hannes sei zu ruhig für ein sechs Monate altes Kind, er wirke, als träumte er noch im Fruchtwasserbad. Die Mutter müsse Reize finden, die das Kind aus dieser Lethargie weckten. Fritzi massierte ihrem Sohn die dicken Oberschenkel, sie trug ihn in den Park, wo er die Blumen ignorierte, an denen er riechen sollte, stattdessen rollte er sich in ihrem Arm wie eine erschrockene Assel ein, als eine Maschine im Landeanflug über sie hinwegrauschte. Fritzi lieh sich aus dem Netto einen Wäschebottich und füllte ihn bis oben mit nach künstlichem Waldmeister riechendem Wackelpudding, und als der Wackelpeter erstarrte, setzte sie ihren Sohn hinein, der darin bis zur Kinderbrust einsank, mit den kleinen Händen ein wenig von der grünen, klebrigen Masse zerquetschte und Fritzi aus seinen dunkelgrauen Augen fragend ansah.
Hannes Prager schrie zum ersten Mal, als der in einer nahen Kükenfarm arbeitende junge Mann aus der Nachbarwohnung nach dem Genuss einer Flasche Mariacron entschied, er würde gern den Abend mit der Elfenfrau ausklingen lassen, die immer so freundlich grüßte und ihn sonst so arrogant ignorierte. Er klopfte an Fritzis Tür. Sie trug vor der milchgeschwollenen Brust den Jungen, der dem Nachbarn in seiner erwachsenen Stille vorkam wie Luzifers Ausgeburt persönlich. Fritzi sagte dem Nachbarn sanft, er solle seinen Rausch ausschlafen, sie habe schon einen brabbelnden Mann in ihrem Leben, aber sie legte ihm dabei kurz ihre Hand auf den Arm, bevor sie die Tür zudrückte, was ihn zusammen mit dem Anblick des Milchbusens vollends unzurechnungsfähig machte. Und als der Nachbar erst unschlüssig vor der Tür stand und rätselte, wie er die warme Berührung deuten sollte, und dann, einer Fehleinschätzung folgend, gegen die Spanplatte der Tür hämmerte, stieß der Junge auf Fritzis Arm einen Schrei aus, einen einzigen hohen, vibrierenden Ton, klar wie Brennspiritus, der den Nachbarn sofort ausnüchterte und in seine Wohnung zurückkehren ließ. Hannes Prager schrie ein dreigestrichenes f, ohne dass er selbst, die begeisterte Mutter oder der erschauernde Nachbar das hätten einordnen können.
Am nächsten Tag kündigte Fritzi den Mietvertrag.
Sie kaufte sich eine Zeitung und las die Wohnungsannoncen. Eine lautete:
Nur ein Zimmer, 90 Quadratmeter, ab sofort, Kananohe. Geheizt wird mit Holz. Für wen, der keine Angst vor Geistern hat: ein Traum. Im Garten: gute Aussicht und Rhabarber. 800 Deutsche Mark in bar. Heinrich Hildebrand.
Fritzi wusste nicht, was Kananohe ist, hatte keine Erklärung dafür, wie ein einzelnes Zimmer neunzig Quadratmeter groß und so teuer sein konnte. Achthundert Mark konnte sie sich nicht leisten, aber Dinge, die sie vermeintlich nicht konnte, hatten sie schon immer angezogen.
Sie wählte die Telefonnummer unter der Annonce, fuhr mit dem Fahrrad, den Sohn im Rucksack, vorbei an dem Maschendrahtzaun, der entlang der Landebahn des Flughafens verlief. Der letzte Teil der Straße war schlecht geteert, voller Schlaglöcher und führte durch ein nach Schwefelgasen riechendes Moor, das mit grünen Schildern als Naturschutzgebiet gekennzeichnet war.
Die Villa stand frei und herrschaftlich in der Weite. Sie hatte zwanzig Zimmer und war im neunzehnten Jahrhundert erbaut worden, als es keine Naturschutzgebiete gab. Die lange Auffahrt war früher von Birken gesäumt gewesen, jetzt standen nur noch vereinzelte morsche Stämme. Von den einst hellblauen Fensterläden blätterte die Farbe. Vor der Hausfront stand ein praller Birnbaum und daneben ein Baum mit blauschwarz schimmernden, vor Reife platzenden Pflaumen, von denen Fritzi am liebsten sofort welche gepflückt hätte. Es konnte gar nicht so viele Geister hier draußen geben, dass ihr diese halb verfallene Villa nicht als Traum erschienen wäre.
Ein Mann trat auf die steinerne Treppe. Fritzi stieg vom Fahrrad und schaute zu ihm hoch.
Heinrich Hildebrand trug einen Vollbart und ein mehrmals geflicktes Sakko aus Tweed in der Farbe alter Walnüsse. Es gab verschiedene Gerüchte über ihn, die sich die Dorfbewohner Kaltenweides, Engelbostels und halb Langenhagens erzählten. Er sei der reichste Mann der niedersächsischen Tiefebene, manchmal singe er wehklagende Lieder auf Wienerisch über eine Frau, die ihn verlassen habe und die seinen Zorn auf die Welt speise, den er an unschuldigen Campern auslasse. Er ziehe die schärfsten Chilis diesseits des Atlantiks. Er sei der Autor einer berüchtigten Novelle, die einmal ein kleiner Erfolg gewesen sein soll, aber nun nicht mehr gedruckt würde. Hildebrand schreibe seit vielen Jahren erfolglos an einer Fortsetzung, was erheblichen Anteil an seiner allgemeinen Menschenfeindlichkeit habe.
Die Gerüchte stimmten alle nicht, waren aber auch nicht ganz unrichtig. Außer der Vermutung, er sei reich – die war Unsinn.
Heinrich Hildebrand betrachtete Fritzi Prager mit halb geschlossenen Augen, er roch nach Knize Rasierwasser – Sandelholz, Orange, Rosmarin, Leder –, in der Hand hielt er ein langes Käsebrot. Er hob das Brot zum Gruß.
Hildebrand lebte schon lange hier und zahlte, was er ganz selbstverständlich fand, keine Miete an das niedersächsische Landesamt für Flur- und Moormanagement, dem die Villa gehörte. Mittlerweile fühlte er sich, als gehörte ihm dieses Haus und das umliegende, fünfundvierzig Hektar große Naturschutzgebiet namens Kananohe gleich dazu. Hildebrand hatte als junger Mann am Wiener Konservatorium Klavier studiert, aber das wusste kaum noch jemand, nicht mal die Gerüchtespatzen, was auch daran lag, dass seine Klavierlaufbahn keine wirkliche Laufbahn gewesen war. Damals in Wien in einer besonders heißen Sommernacht kurz vor seinem Abschlusskonzert am Konservatorium war Hildebrand auf die Idee gekommen, über den Lattenzaun des neuen und spektakulären Hietzinger Bads zu klettern, um sich schwimmend ein wenig abzukühlen. Er sprang vom Hochstuhl des Bademeisters, probierte einen Salto, überlegte es sich mitten im Flug anders, verlor die Balance, wusste ein paar Sekunden lang nicht recht, wo oben und unten war, schlug mit dem Kopf seitlich auf die schwarze Wasseroberfläche und zerriss sich das Trommelfell des linken Ohres. Es wurde nie wieder heil. Hildebrand verließ Wien links ohne Gehör und insgesamt ohne Studienabschluss, arbeitete als Zeitungsredakteur, als Beleuchter, als Aktivist, der in der Arktis Wale vor ihren Fängern beschützte. Er schrieb eine Novelle, in deren Zentrum ein gehörloser Walfänger stand und die sogar gedruckt wurde.
Seit vielen Jahren nun lebte Hildebrand in der Villa und kümmerte sich darum, dass die Menschen das Bissendorfer Moor in Ruhe ließen. Ab und an räumte er einen umgestürzten Baum von einer der wenigen Straßen, verjagte Wildcamper und hörte sonst einohrig den Moorhühnern zu. Er war schon so lange allein, dass er vergessen hatte, wie einsam er war, aber jüngst hatte er bei seinen monatlichen Einkäufen überlegen müssen, ob er sich noch Parmesan leisten konnte. Und weil echter Parmigiano Reggiano Heinrich Hildebrand wichtig war, hatte er entschieden, einen Untermieter zu sich ins Moor zu holen, obwohl er eigentlich keine Lust auf Gesellschaft hatte und sich ziemlich sicher war, dass er in seinem Alter nicht mehr für ein Leben in Gemeinschaft taugte. Er hatte sich vorgenommen, einen Mietvertrag mit der Mindestlaufzeit von einem Jahr aufzusetzen und sich dann so danebenzubenehmen, dass der Mieter schnell wieder verschwinden würde.
»Wann könnten wir einziehen?«, fragte Fritzi zur Begrüßung.
Der Mann hatte einen Händedruck, in dem Fritzis Hand verschwand, er knurrte etwas Unverständliches, in seinem Bart hingen Brosamen. Fritzi konnte Mottenlöcher in seinem Jackett erkennen, aber als er den Kopf des kleinen Hannes entdeckte, der sich in seinem Rucksack aufrichtete, griff er an Fritzi vorbei und strich ihrem Sohn mit einem Finger über die Wange.
»Zimmer ist schon weg«, sagte er, »vorhin war einer da, Werbetexter. Hat gesagt, er nimmt es und renoviert noch.«
»Darf ich es trotzdem sehen?«, fragte Fritzi.
Heinrich Hildebrand zuckte die Schultern.
Das neunzig Quadratmeter große Zimmer lag im ersten Stock. Es war einmal der Speisesaal der Villa gewesen, hatte Bogenfenster, die wahrscheinlich seit dem neunzehnten Jahrhundert nicht mehr geputzt worden waren, ein Plattenspieler thronte auf einer Kommode, neben dem Kamin verrottete ein von Holzwürmern zerfressenes Klavier, in einer Ecke stand ein staubiges Sofa. An der Wand hing das dunkle Ölgemälde einer molligen Frau, daneben ein Schwarz-Weiß-Foto hinter Glas, eine Schulklasse, in deren Mitte ein Gorilla saß, als wäre er einer der Schüler. Am Ende des Saals hing der ausgestopfte Kopf eines Hirsches, dem ein Glasauge fehlte. Das Licht, das durch die Fenster fiel, hatte an diesem Tag die Farbe von Lindenhonig und ließ die speckigen Dielen glänzen. In der Mitte des Raums lag ein verblasster gelb-blauer Orientteppich. Fritzi würde nachts nach der Arbeit mit dem Fahrrad eine halbe Stunde lang über die einsame Schlaglochpiste rattern müssen, aber das störte sie nicht. Von draußen hörte sie den Ruf eines Vogels, den sie nicht kannte. Hannes auf ihrem Arm lachte.
»Wann stellen Sie mir die Geister vor?«, fragte Fritzi.
Der alte Mann blickte sie ernst an.
»Wie gesagt, das Zimmer ist schon weg.«
»Ich kann auch renovieren«, log sie.
Er betrachtete sie.
»Was ist mit dem Vater?«, fragte er.
»Der hatte die gleiche Uhr wie der Erstbesteiger des Mount Everest.«
Heinrich Hildebrand sah sie lange an.
»Das Zimmer ist vergeben, junge Frau.«
»Ist ja schon gut. Darf ich mir wenigstens ein paar Pflaumen pflücken, bevor ich gehe?«
Heinrich Hildebrand nickte. Er ging hinter Fritzi die wippenden Treppenstufen nach unten, sah ihr zu, wie sie ihrem Sohn etwas ins Ohr flüsterte und ihn auf die Fontanelle küsste.
»Jesses«, grummelte Hildebrand in seinem tiefen Bass. Da hob der junge Hannes den Kopf, sah den alten Hildebrand an und reckte dann die kleinen, fetten Hände nach ihm. Fritzi hielt inne, griff ihren Jungen unter die Achseln und reichte ihn die Treppe nach oben.
Heinrich Hildebrand konnte sich nicht erinnern, dass er je ein Kind auf dem Arm gehabt hätte. Es roch nach Milch und Keksen und ein wenig nach Waldmeistergötterspeise. Dann legte der Bub seine unbegreiflich weiche Hand auf Hildebrands stacheligen Kehlkopf, und etwas rührte sich in ihm. Hildebrand sah die Mutter an, die misstrauisch zu ihm hochschaute, und fragte sich, ob er nicht hier oder dort eine andere Entscheidung hätte treffen können, ob Freundlichkeit nicht doch eine Möglichkeit gewesen wäre und wie es wäre, eine Frau wie diese hier zu haben, die seine Enkelin hätte sein können und blitzschlau wirkte und so energiegeladen, als könnte sie an einem Tag den ganzen Pflaumenbaum abpflücken und vielleicht sogar ein Mus aus den Früchten kochen. Er dachte an den Werbetexter mit seinem sauberen, hellblau lackierten Auto. Sein Leben lang hatte Hildebrand ein gesundes Misstrauen gegen Menschen gehegt, die ihre Freizeit damit verbrachten, ihre Blechkisten auf Hochglanz zu polieren.
»Können Sie wirklich renovieren?«, fragte Hildebrand hinter Fritzi, und der Junge blickte erstaunt um sich, als die Bassstimme von der mottenzerfressenen Seidentapete widerhallte.
»Gibt es hier wirklich Geister?«, fragte Fritzi.
»Die Diele kann kalt werden im Winter. Der Wind kracht ungebremst übers Moor direkt von der Nordsee hier auf die Haustür.«
»Wir können ja das Klavier verbrennen.«
Hildebrand musste an die Frau denken, für die er damals auf diesem Klavier gespielt hatte. Das Klavier war ein seltsames altes Ungetüm mit einem überdimensionalen Gehäuse, in dem früher eine Selbstspieleinrichtung gesteckt hatte, die aber längst ausgebaut war. Die Frau war eines Morgens weg gewesen, ohne Heinrich eine Erklärung dazulassen. Seitdem war im Speisesaal keine Musik mehr erklungen.
»Schreit er viel?«, fragte Heinrich Hildebrand und gab der Mutter das Kind zurück. Ihm schlug das Herz, weil er den Bub nicht fallen lassen wollte und gleichzeitig fürchtete, ihn zwischen seinen Händen zu zerdrücken. Fritzi nahm Hannes in ihre Arme.
»Nie.«
»Gut.«
»Sehen ein paar Ärztinnen anders.«
Hildebrand winkte ab. Er hielt nicht viel von Ärzten, sie wollten einem das Leben retten und verboten es einem dabei.
»Sie würden das Zimmer also nehmen?«, fragte er.
Fritzi war in der Diele angekommen, und durch die Haustür, die Heinrich Hildebrand hatte offen stehen lassen, fiel Spätsommerlicht auf das mahagonibraune Sternparkett.
»Wir müssten noch mal über den Preis sprechen«, sagte Fritzi.
Heinrich Hildebrand schaute Mutter und Sohn an, zwei Kinder, deren Schatten in seine Richtung fielen und die unterste Treppenstufe berührten. Das Licht ließ die Haare der Frau von hinten leuchten. Er hatte ihre feinen, langen Hände gesehen, die frisch verheilten Blasen innen an den Daumen. Heinrich Hildebrand wusste, solche Blasen bekommt nur ein Mensch, der noch nie einen Hammer gehalten hat. Sie würde diese Villa nicht renovieren. Und jetzt wollte sie die Miete drücken. Zu seinem eigenen Verwundern fing er schallend an zu lachen, so laut, dass selbst die Geister in ihren Verstecken staunten.
»Haben Sie viele Möbel?«, fragte Heinrich Hildebrand.
»Eine Matratze, aber die krieg ich zusammengerollt auf den Gepäckträger.«
»Es wird regnen. Wir nehmen den Jeep.«
»Woher wissen Sie das?«
»Das verrate ich Ihnen, wenn Sie bewiesen haben, dass Sie ein amtliches Pflaumenmus kochen.«
3
In ihrem ersten Winter im Moor radelte Fritzi nachts nach der Arbeit mit dem Fahrrad heim. Der Sohn steckte im Rucksack, in eine alte Lammfelljacke Hildebrands gerollt, die sie in einer Abstellkammer der Villa gefunden hatte. Der Wind biss Fritzi so garstig ins Gesicht, dass ihre Lippe aufplatzte. Heinrich Hildebrand wärmte sich die Socken am Kamin und die Gedanken an einer alten Aufnahme von Gustav Mahlers Auferstehungssinfonie, als Fritzi das Haus betrat. Er schaute auf ihre blutige Lippe und sagte, sie solle nicht den gesamten Hagel der Welt in die Stube tragen. Sie könne außerdem nicht ewig bei Netto schuften und durch Schneestürme radeln, sonst sehe ihr Gesicht in ein paar Jahren aus wie ein Bombenkrater und damit sei niemandem geholfen. Ob sie schon mal vom niedersächsischen Landesamt für Flur- und Moormanagement gehört habe?
Er sorgte dafür, dass Fritzi als seine Assistentin eingestellt wurde, er nannte sie von nun an gelegentlich »Adjutantin«. Bald juckelte sie mit ihrem Sohn auf dem Beifahrersitz des Jeeps durch das Moor, sammelte Plastikmüll und sägte voll jugendlicher Begeisterung Bäume mit der Kettensäge um. Wildcamper ließ sie campen, riet ihnen aber, ihre Zelte nicht unter einer der vertrockneten Birken aufzustellen und ihre leeren Raviolidosen bitte schön wieder mitzunehmen. Fritzi lernte vom alten Hildebrand, wie gefährlich die toten, hohlen Birken waren, weil sie manchmal bei der leisesten Erschütterung umstürzten. Sie lernte, dass Regen nahte, wenn der Wind flach über der Erde aus Westen blies, der Abendhimmel rot glomm und die Vögel sich Verstecke suchten. Sie lernte, Ringelnattern von Blindschleichen zu unterscheiden, dass Eichelhäher verrückt nach gerösteten Erdnüssen waren und dass Kraniche Duette sangen, wenn sie sich gegenseitig vor den Menschen warnten. Der kleine Hannes ging vor Aufregung über ein solches Duett seine ersten Schritte, um dem Gesang ein wenig näher sein zu können.
Für die alten Griechen sei der Kranich der Vogel des Glücks, erklärte Heinrich Hildebrand, aber er persönlich halte die alten Griechen für einen Haufen irrer Lustmolche und Kraniche für Kraniche.
Fritzi und Hildebrand schwiegen viel und ließen den anderen mit den jeweiligen Gedanken allein. Fritzi kochte Pflaumenmus. Danach lieh Hildebrand ihr seine vergilbten russischen Romane, die so alt waren, dass das Deutsch nicht mehr in die Zeit passte, und die Fritzi genau deshalb besonders kostbar wurden.
Als Hannes Prager vier Jahre alt war, saß er mit geschlossenen Augen auf dem Stamm einer umgestürzten Birke im Bissendorfer Moor und lauschte dem Wind, der durch eine Wiese aus vertrocknetem Pfeifengras strich. Es wurde seine erste Erinnerung.
An manchen Tagen fand Fritzi Hannes, wie er regungslos zwischen den Tümpeln stand und auf irgendetwas lauschte, und wenn er sie bemerkte, schaute er aus großen Augen zu ihr hoch, als wäre die Welt in ihren Klängen so überwältigend, dass es kaum fassbar war.
Die drei Moorbewohner hatten wenig Geld, aber sie hatten die alten Russen, die Plattensammlung, genug zu tun, Fritzi hatte ihren Sohn und Hildebrand die heimliche Nachtarbeit an der neuen Novelle. Sie alle lebten von den Sonnenaufgängen und der Ruhe. An den Schwefelgeruch des Moores gewöhnte man sich. Fritzi kochte abends oft die Leibspeise der drei, Nudeln mit gerösteten Brotbröseln, grob gehacktem Schlangenknoblauch und vorsichtig dosierten Chilis von Heinrich aus dem Garten, Pasta con la mollica, und Fritzi sagte, jeder Mensch mit mehr als drei Gehirnzellen sollte früher oder später nach Italien auswandern. So ist es, sagte der alte Hildebrand.
Güneş und ihre Tochter Polina kamen oft in die Villa ins Moor, was der alte Hildebrand erst mit längeren Pöbeleien zu verhindern versuchte, dann aber schweigend akzeptierte, als Güneş seine Hand beim Armdrücken krachend auf den von Krümeln übersäten Küchentisch hämmerte. Beim nächsten Besuch gab Güneş dem völlig verdatterten Hildebrand ihre Tochter auf den Arm und setzte sich in den Vorgarten, um sich – in Unterwäsche – zwei Stunden zu sonnen, weil sie abends einen neuen Anwärter auf die Stelle des Traummannes treffen wollte. Hildebrand vermutete, Fritzi habe ihr zu dem Trick mit dem Kind geraten, weil sie ihn damals genau so überlistet hatte. Die kleine Polina musterte ihn aus schwarzen Olivenaugen, und Hildebrand wusste nicht so recht, was er mit ihr anfangen sollte, also hob er sie einmal kurz und sehr behutsam nur wenige Zentimeter in die Luft, um sie dann etwas schneller wieder herunterzulassen. Er hatte einmal irgendwo gesehen, dass Eltern so etwas mit Kindern tun, und es nie begriffen, aber nun strahlte Polina ihn dermaßen begeistert an, dass dem alten Mann das Gletscherherz schmolz. Die Angst, das Mädchen fallen zu lassen, verflog und sonst noch alle möglichen Ängste dazu. Es war Hildebrand plötzlich einerlei, dass Güneş ihn manipulierte. Er merkte, dass er Polina eigentlich immer gemocht hatte, ein Mädchen, das Dostojewski im Namen trug, konnte man nur mögen. Als Güneş sich genug gesonnt hatte, wollte Hildebrand die kleine Polina gar nicht mehr hergeben und hätte mit ihr, obwohl ihn die morsche Schulter ein wenig piesackte, den ganzen Abend »Fahrstuhl« spielen können. Beim nächsten Besuch von Güneş und Polina nuschelte Hildebrand schon an der Tür, dass er die Kleine ja wieder hüten könne, »wenn es sein muss«. Polina gluckste, als er sie auf den Arm nahm, und Güneş haute dem alten Hildebrand auf die Schulter, dass es seinen ganzen Körper durchzuckte, und sagte: »Ab heute darfst du sie Poli nennen.«
Unter Hildebrands wachsamen Augen spielten Poli und Hannes mit dem gleichen ausgestopften Marder, knabberten die gleichen Moormöhrchen, sie saßen zwischen Peperoni und Geisterchilis im Garten, und Poli überredete Hannes, dass beide sie probierten. Hildebrand hielt das für eine gute Idee. Die Kinder weinten danach zusammen und aßen löffelweise Mayonnaise, um den Schmerz zu lindern.
Sie hatten nie aufgehört, aneinandergerollt ihren Mittagsschlaf zu machen, dabei hätten Polina und Hannes unähnlicher kaum sein können, was allerdings niemanden störte – was niemand in diesem Moor auch nur bedachte. Hannes lauschte vorsichtig in die Welt hinein wie in eine dunkle Höhle, in der Ungeheuer lauern. Polina schaute hinter jede Tür, steckte ihren Kopf in die Tümpel im Moor, um zu prüfen, was darin war, fasste jeden Käfer an und nahm die meisten davon in den Mund. Hätte sie Ungeheuer gefunden, hätte Polina mit ihnen getanzt. Ihre Haare standen in viele Richtungen vom Kopf ab wie schwarze Flammen. Wenn es kalt wurde, sammelte sie Brot in ihren Jackentaschen und legte es im Moor aus, damit die Moorhühner etwas zu essen hatten außer totem Gras und gefrorenem Regen.
Polina liebte es, sich vor Hannes zu verstecken, in der vollen Regentonne, im Gartenhaus, auf dem Birnbaum, und Hannes fand sie fast nie.
Hannes war in allem langsamer als sie, er bewegte sich behutsam, er krabbelte gerade mal, als Polina schon auf den alten Hildebrand zulief und begann, erste Sätze zu sprechen.
Hannes Pragers erstes Wort war Mama, sein zweites Wort war Mahler. Hildebrand hatte den Plattenspieler entstaubt und legte abends Schallplatten auf. Der Junge lag zusammengerollt auf dem Teppich, hörte mit geschlossenen Augen der Musik zu und bewegte ab und an einen seiner immer länger werdenden Finger, als würde er die Töne festhalten wollen. Polina lag daneben, langweilte sich und stellte Hildebrand eine Frage nach der nächsten, die wie Rätsel wirkten und so kompliziert waren, dass Hildebrand sich freute, wie schlau dieser kleine schwarzäugige Fuchs war, und irgendwann zu der Überzeugung gelangte, sie fragte ihn nur, um ihn zu ärgern, was ihn noch mehr freute. Eine Zeit lang wollte Hannes abends nur einschlafen, wenn Heinrich die Platte mit Chopins 1. Klavierkonzert auflegte, eine alte Aufnahme, die knisterte, eingespielt von Arthur Rubinstein. War der gedämpfte langsame zweite Satz vorbei, bevor Hannes die Augen zugefallen waren, musste Hildebrand die Nadel unter gegrummelten Protesten (»Diese verdammten kleinen Läusegehirne treiben mich noch in den Wahnsinn«) an den Anfang der Schallplatte setzen.
Polinas Blick war wach und listig, Hannes’ verträumt und oft so ziellos, dass Fritzi mit ihm zum Augenarzt ging. Hannes bekam eine Brille, ein Kassenmodell mit dicken Gläsern, das ihm ständig auf die Nasenspitze rutschte. Wie Polina hatte er wild tanzendes Haar, nur war seines blond und gelockt.
Wenn die Kinder am Küchentisch saßen, hörte Hannes oft nur dem Klang der Stimmen zu, sagte selten etwas, und wenn man ihn etwas fragte, musste Fritzi die Frage wiederholen. Als Polina vier Jahre alt war, wollte sie wissen, ob die Tiere nach ihrem Tod auch in den Himmel und ob die Raubtiere in die Hölle kämen und wenn ja, wie das zu rechtfertigen sei.
Sie kämen natürlich in den Himmel, sagte Hildebrand, so wie alles, was kreucht und fleucht, deswegen sei es ja der Himmel. Die Hölle sei leer, und die Einsamkeit dort mache sie erst zur Hölle, dozierte er mit einer gewissen Genugtuung in der Stimme, weil er sicher war, das würde Polina bis zur Nachspeise ruhigstellen, aber sie entgegnete nur: »Wieso ist der Himmel eigentlich blau?«
An manchen Tagen sprang der kleine Hannes Prager in Alarmbereitschaft auf, egal was er gerade tat, und stellte sich auf die obere Stufe der Treppe, die zum Garten führte. Er stand auf Zehenspitzen und starrte die Straße hinab, die in der untergehenden Sonne verschwand. So verharrte er minutenlang und atmete erleichtert aus, wenn Güneş’ alter grauer Volvo endlich auftauchte. Hildebrand wollte nicht glauben, dass Hannes das Auto aus Kilometern Entfernung hören konnte, und war sich sicher, die Kinder hatten sich abgesprochen und spielten ihm mal wieder einen Streich.
Poli wurde mit fünf eingeschult. Als Hannes Prager fünf Jahre alt war, scheiterte der Versuch, ihn im Kindergarten Engelbostel anzumelden. Die Stimme einer Erzieherin war so knatschig, dass Hannes immer wieder aus dem Raum rannte.
Hildebrand war im Geheimen froh, dass der Junge ihm noch ein wenig Gesellschaft leisten würde. Der alte Moormann betrachtete Polinas Schulbücher und ihren Lerneifer mit gerunzelter Stirn. Er fürchtete, der allgemeine Schulkanon könnte das Kind aus der so wunderbar unangepasst verlaufenden Bahn werfen, und deshalb begann er, als Korrektiv zur niedersächsischen Grundschule, den beiden Kindern aus alten Dostojewskis vorzulesen. Hannes verwirrten die vielen russischen Namen, aber er hörte den rhythmisch summenden Bass Hildebrands und war zufrieden damit. Polina hörte tatsächlich auch den Wörtern zu, gebannt und – was sie sonst eher selten war – still. Nur ab und an lachte sie laut oder fragte ernst nach, wenn sie etwas nicht verstand.
Zur Weihnachtszeit las Hildebrand den Spieler. Hannes saß auf dem Teppich und lauschte dem Knistern des Kamins, draußen jaulte der Wind, Polina zerknackte gelegentlich einen von Fritzi gebackenen, steinharten Zimtstern zwischen den Backenzähnen. Sie liebte den Roman, vor allem die Figur der Babuschka, weil die ständig solchen Radau machte. Poli hatte schon mehrmals gefragt, warum Dostojewski die langweiligen Bücher so lang geschrieben hatte und den Spieler so kurz, worauf nicht einmal Heinrich Hildebrand eine Antwort wusste. Als es spät wurde und er noch immer las, wollte die alte Babuschka den Erzähler gerade dazu bringen, trotz aller Verluste noch einmal Roulette zu spielen. Hildebrand zitierte: »Warum nicht? Was soll das wieder? Habt ihr alle Tollkraut gegessen?«
»Tollkraut?«, fragte Polina sofort hellwach, sie drückte sich hoch auf die Knie.
»Giftig«, sagte Hildebrand, »wächst manchmal auf dem alten Geröllhaufen hinterm Gartenschuppen. Diese gelben Blüten mit den violetten Äderchen. Aber jetzt müsst ihr schlafen.«
»Wieso toll?«
»Toll kann auch verrückt bedeuten.«
»Wieso?«
Hildebrand musste lächeln.
»Soll ich weiterlesen?«
»Warum nicht? Hast du wieder Tollkraut gegessen?«, fragte Poli und lachte.
Es wurde Polinas Lieblingssatz. Sie sagte ihn in diesem Winter so oft, dass Hildebrand sich bald fragte, ob er das mit dem Vorlesen nicht lieber gelassen hätte. Polina sagte den Satz vor lauter Begeisterung bald auch, wenn sie einfach nur »Ja« meinte. Nach einiger Zeit begriff sogar Hannes, wie sie es meinte. Willst du noch einen Pfannkuchen? Bleibst du noch bis zum Ende des Lieds? Kommst du morgen mit eislaufen? Die Antwort lautete: »Hast du Tollkraut gegessen?« Poli hörte nicht auf, sich über diese Formulierung zu freuen. Im Frühjahr, als ihre Klassenlehrerin sich beschwerte, dass ein solcher Satz keine adäquate Antwort auf die Frage sei, ob Polina Schwammdienst habe, besonders nicht für eine Sechsjährige, sagte Polina, das sehe Dostojewski allerdings anders, was die Lehrerin so verwirrte, dass es sie vorerst befriedete.
Als der alte Hildebrand, Fritzi, Güneş