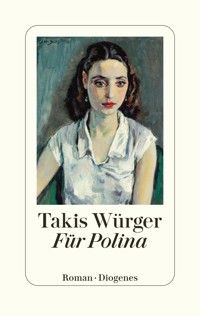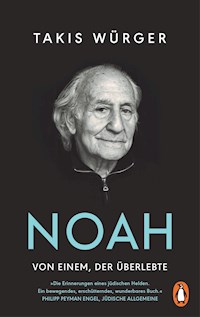11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist 1942. Friedrich, ein stiller junger Mann, kommt vom Genfer See nach Berlin. In einer Kunstschule trifft er Kristin. Sie nimmt Friedrich mit in die geheimen Jazzclubs. Sie trinkt Kognak mit ihm und gibt ihm seinen ersten Kuss. Bei ihr kann er sich einbilden, der Krieg sei weit weg. Eines Morgens klopft Kristin an seine Tür, verletzt, mit Striemen im Gesicht: "Ich habe dir nicht die Wahrheit gesagt." Sie heißt Stella und ist Jüdin. Die Gestapo hat sie enttarnt und zwingt sie zu einem unmenschlichen Pakt: Wird sie, um ihre Familie zu retten, untergetauchte Juden denunzieren? Eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht – über die Entscheidung, sich selbst zu verraten oder seine Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über das Buch
Es ist 1942. Friedrich, ein stiller junger Mann, kommt vom Genfer See nach Berlin. In einer Kunstschule trifft er Kristin. Sie nimmt Friedrich mit in die geheimen Jazzclubs. Sie trinkt Kognak mit ihm und gibt ihm seinen ersten Kuss. Bei ihr kann er sich einbilden, der Krieg sei weit weg. Eines Morgens klopft Kristin an seine Tür, verletzt, mit Striemen im Gesicht: »Ich habe dir nicht die Wahrheit gesagt.« Sie heißt Stella und ist Jüdin. Die Gestapo hat sie enttarnt und zwingt sie zu einem unmenschlichen Pakt: Wird sie, um ihre Familie zu retten, untergetauchte Juden denunzieren? Eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht — über die Entscheidung, sich selbst zu verraten oder seine Liebe.
Takis Würger
Stella
Roman
Carl Hanser Verlag
Teile dieser Geschichte sind wahr.
Bei den kursiv gedruckten Textstellen handelt es sich um Auszüge aus den Feststellungen eines sowjetischen Militärtribunals. Die Gerichtsakten liegen heute im Landesarchiv Berlin.
Für meinen Urgroßvater Willi Waga, der 1941 während der Aktion T4 vergast wurde.
Im Jahr 1922 verurteilte ein Richter Adolf Hitler zu drei Monaten Gefängnis wegen Landfriedensbruchs, ein englischer Forscher entdeckte das Grab Tutanchamuns, James Joyce veröffentlichte den Roman Ulysses, die Kommunistische Partei Russlands wählte Josef Stalin zum Generalsekretär und ich wurde geboren.
Ich wuchs auf in einer Villa außerhalb des Ortes Choulex bei Genf, mit Zedern davor, siebzehn Morgen Land und Leinenvorhängen an den Fenstern. Im Keller lag eine Planche, auf der ich Fechten lernte. Auf dem Dachboden lernte ich, Kadmiumrot und Neapelgelb am Geruch zu erkennen und wie es sich anfühlt, mit einem Stock aus geflochtenem Rattan geschlagen zu werden.
Dort, wo ich herkomme, beantwortet man die Frage, wer man ist, mit den Namen der Eltern. Ich könnte sagen, dass Vater in dritter Generation einen Konzern leitete, der Samt aus Italien importierte. Ich könnte sagen, dass Mutter die Tochter eines deutschen Großgrundbesitzers war, der sein Gut verlor, weil er zu viel Armagnac trank. »Verschnapst«, würde Mutter sagen, was ihren Stolz nicht minderte. Sie erzählte gern, dass die gesamte Führungsriege der Schwarzen Reichswehr zu seiner Beerdigung gekommen war.
Abends sang Mutter Schlaflieder von Sternschnuppen, und wenn Vater reiste und Mutter gegen die Einsamkeit trank, ließ sie den Tisch im Speisesaal an die Wand schieben, legte Schellackplatten auf und tanzte Wiener Walzer mit mir. Ich musste weit nach oben greifen, um meine Hand an ihr Schulterblatt zu legen. Sie sagte, ich würde gut führen. Ich wusste, dass sie log.
Sie sagte, ich sei der schönste Junge Deutschlands, obwohl wir nicht in Deutschland lebten.
Manchmal durfte ich ihre Haare mit einem Kamm aus Büffelhorn kämmen, den Vater ihr mitgebracht hatte, und sie sagte, wie Seide sollen sie sein. Sie ließ mich versprechen, dass ich, wenn ich als Mann eine Ehefrau hätte, dieser Frau die Haare kämme. Ich betrachtete Mutter im Spiegel, wie sie mit geschlossenen Augen vor mir saß und wie ihr Haar schimmerte. Ich versprach es.
Wenn sie in mein Zimmer kam und mir eine gute Nacht wünschte, legte sie beide Hände an meine Wangen. Wenn wir spazieren gingen, hielt sie meine Hand. Wenn wir in die Berge stiegen und sie oben sieben oder acht Gipfelkurze trank, war ich glücklich, dass ich sie stützen durfte beim Abstieg.
Mutter war Künstlerin, sie malte. In unserer Diele hingen zwei ihrer Bilder, Öl auf Leinwand. Ein Stillleben, Großformat, das Tulpen und Trauben zeigte. Und ein kleines Gemälde, die Rückenansicht eines Mädchens, das seine Arme über dem Kreuzbein verschränkte. Ich schaute das Bild lange an. Einmal versuchte ich, die Finger zu verschränken wie das Mädchen auf dem Bild. Es gelang mir nicht. Meine Mutter hatte eine so unnatürliche Drehung der Handgelenke abgebildet, dass jedem echten Menschen die Knochen gebrochen wären.
Mutter sprach oft darüber, was für ein großer Maler ich sein würde, und selten darüber, wie sie malte. Wenn es spät wurde, erzählte sie davon, wie leicht das Malen gewesen sei in ihrer Jugend. Sie hatte sich als Mädchen an der Allgemeinen Malerschule der Wiener Kunstakademie beworben und war in der Prüfung an der Kohlezeichnung gescheitert. Vielleicht war sie auch abgelehnt worden, weil damals kaum Frauen an den Akademien studieren durften. Ich wusste, ich durfte nicht danach fragen.
Mit meiner Geburt hatte Mutter den Entschluss gefasst, dass ich an ihrer Stelle die Kunstakademie in Wien besuchen würde oder mindestens die Akademie der Bildenden Künste in München. Ich sollte mich hüten vor allem, was darunter lag, vor der Kunstschule Feige und Strassburger in Berlin oder der Zeichenschule Röver in Hamburg, das seien verjudete Läden.
Mutter zeigte mir, wie man einen Pinsel hält und wie man Ölfarben anrührt. Ich gab mir Mühe, weil ich sie glücklich machen wollte, und lernte weiter, wenn ich allein war. Wir fuhren nach Paris, schauten uns in der Galerie nationale du Jeu de Paume die Bilder Cézannes an, und Mutter sagte, wenn irgendwer einen Apfel zeichne, müsse der so aussehen wie bei Cézanne. Ich durfte Mutters Leinwände grundieren, ging Hand in Hand mit ihr durch die Museen und versuchte, mir alles zu merken, wenn sie in einem Bild die Farbtiefe lobte und in einem anderen die Perspektive kritisierte. Ich sah sie nie malen.
*
Im Jahr 1929 kollabierte in New York die Börse, bei den Landtagswahlen in Sachsen gewann die NSDAP fünf von sechsundneunzig Sitzen, und in meinen Heimatort fuhr kurz vor Weihnachten eine Kutsche.
Sie glitt auf Kufen über den Schnee. Auf dem Bock saß, in einem bodenlangen Mantel aus dunkelgrünem Loden, ein Fremder. Vater würde ihn auch mit Hilfe der Gendarmerie nie finden. Es blieb ungeklärt, warum der Mann ein Ambosshorn neben sich auf dem Kutschbock transportierte.
Wir waren vielleicht ein Dutzend Jungen und warfen vom Kirchplatz aus mit Schneebällen nach dem metallenen Hahn auf dem Turm.
Ich weiß nicht, wer als Erstes auf den Kutscher warf. Die Schneekugeln kreuzten sich in ihren Flugbahnen und zerplatzten am Holz des Kutscherhauses. Ein Schneeball traf den Mann an der Schläfe, ich glaubte, es war meiner. Ich hoffte, die anderen Jungen würden mich dafür mögen. Der Mann zuckte nicht.
Er zügelte das Pony. Er ließ sich Zeit dabei, stieg vom Bock, flüsterte in das Ohr des Tieres und ging auf uns zu. Als er vor uns stand, tropfte Schmelzwasser in seinen Kragen. Wir waren jung, wir liefen nicht weg. Angst musste ich noch lernen. Der Kutscher trug etwas Kurzes, Geschmiedetes, Dunkles in der Hand.
Er sprach Urnerdeutsch, meine ich, einen Dialekt, den man selten hörte in meiner Gegend.
»Wer hat den auf mich gemünzt?«, fragte er leise und betrachtete uns. Ich hörte, wie der Schnee unter meinen Sohlen knisterte, er war überfroren und glitzerte. Die Luft roch nach nasser Wolle.
Vater hatte mir gesagt, die Wahrheit sei ein Zeichen von Liebe. Die Wahrheit sei ein Geschenk. Damals war ich mir sicher, dass das stimmte.
Ich war ein Kind. Ich mochte Geschenke. Was Liebe war, wusste ich nicht. Ich machte einen Schritt.
»Ich.«
Die Spitze des Ambosshorns durchdrang meine rechte Wange am Kiefergelenk und öffnete mein Gesicht bis zum Mundwinkel. Ich verlor zwei Backenzähne und einen halben Schneidezahn. Daran habe ich keine Erinnerung. Ich erinnere mich wieder, als ich in Mutters graue Augen schaute. Sie saß an meinem Krankenhausbett und trank Tee mit Kornbrand darin, den sie aus einer Isolierkanne einschenkte. Vater war auf Reisen.
»Ich bin so froh, dass deiner Malhand nichts passiert ist«, sagte Mutter. Sie strich über meine Finger.
Durch meine Wange zog sich ein in Karbolsäure getränkter Faden. Die Wunde entzündete sich. In den kommenden Wochen ernährte ich mich von Hühnerbrühe, die unsere Köchin täglich auskochte. Anfangs sickerte die Brühe durch die Naht.
Die Medikamente betäubten mich. Erst als ich in den Spiegel schaute, begriff ich, dass ich durch den Schlag des Kutschers die Fähigkeit verloren hatte, Farben zu sehen.
Manche Menschen können Rot und Grün nicht unterscheiden, ich hatte alle Farben verloren. Karmesin, Smaragd, Violett, Purpur, Azur, Blond, das waren für mich nur noch Namen für verschiedene Schattierungen von Grau.
Die Ärzte würden von cerebraler Achromatopsie sprechen, einer Farbsinnstörung, die manchmal bei älteren Menschen nach einem Hirnschlag auftrete.
Das verwächst sich, würden sie sagen.
Mutter legte mir einen Zeichenblock auf die Knie und brachte mir eine Schatulle Buntstifte. Die habe sie aus Zürich besorgen lassen, damit wir im Krankenhaus den Unterricht fortsetzen könnten.
»Die Farben sind weg«, sagte ich. Ich wusste, wie wichtig ihr das Malen war.
Mutter legte den Kopf schief, als hätte sie mich nicht gehört.
»Mama, Entschuldigung, ich … ich sehe die Farben nicht mehr.«
Sie ließ einen Arzt kommen, ich musste ein paar Bilder anschauen und bekam eine Flüssigkeit ins Auge geträufelt.
Der Arzt erklärte Mutter, dass das manchmal vorkomme, so schlimm sei es ja nicht, die Vorführungen des Lichtspielhauses seien ohnehin schwarzweiß.
»Entschuldigung, Mama«, sagte ich, »entschuldige bitte. Mama?«
Der Arzt sagte, es sei ein Wunder, dass in meinem Gesicht das Geflecht des Nervus facialis heil geblieben war. Hätte es Schaden genommen, wäre ich im Sprechen behindert und Speichel würde aus meinem Mund tropfen. Der Arzt sagte etwas von Glückskind. Mutter saß daneben. Sie trank in großen Schlucken.
*
Mutter schickte ein Telegramm nach Genua zu Vater. Er fuhr die Nacht durch.
»Meine Schuld«, sagte ich.
»Schuld gibt es gar nicht«, sagte er.
Er blieb im Krankenhaus und schlief auf einer Metallpritsche bei mir.
Mutter sagte: »Was sollen die Leute denken?«
Vater sagte: »Sollte uns das kümmern?«
Wenn die Narbe pochte, erzählte er mir Märchen, die er auf Reisen zu den Samthändlern von Peschawar gehört hatte. Vater schenkte mir eine alte mit Rosenmotiven verzierte Metallschatulle aus Haifa, deren Deckel klemmte und von der er sagte, sie mache Wünsche wahr, wenn wir dreimal gegen den Uhrzeigersinn über den Rand strichen. Mutter sagte, wenn der Tand nicht verschwinde, bleibe sie fort.
Mutter berührte mich kaum noch. Als ich beim Spazieren nach ihrer Hand griff, erschrak sie. Wenn sie mir gute Nacht sagte, blieb sie in der Tür stehen und schaute aus dem Fenster, obwohl es draußen finster war. Vater ging wieder auf Reisen.
Kurz nach meiner Verletzung trank Mutter einmal so, dass sie im Speisesaal liegen blieb und ich sie zusammen mit der Köchin in ihr Zimmer tragen musste.
Mutter stieg nachts allein auf die Almen und zu Hause schloss sie sich manchmal zwei Tage am Stück mit ihren Leinwänden ein. Ich war acht Jahre alt und wusste nicht, ob es meinetwegen war.
*
Mein liebster Ort wurde der See hinter dem Minoritenkloster. An einer Seite war er von einer moosigen Mauer eingefasst und an der anderen von einer Felswand.
Am See lag ich im Schilf und rauchte Zigaretten aus Tabak, den ich aus den Zigarren meines Vaters gezupft hatte. Die Köchin zeigte mir, wie man mit Hilfe eines Stocks, einer Schnur und eines verbogenen Nagels Saiblinge angelt. Später nahm die Köchin die Fische aus, füllte sie mit gehacktem Knoblauch und Petersilie, bevor wir sie über Feuer am Ufer grillten und zu heiß aßen.
Die Köchin zeigte mir, wie man den Nektar aus den Blüten des Flieders saugt.
Ich half beim Flechten des Hefezopfes und trug der Köchin die Kanne von der Melkalm zu unserem Haus. Manchmal fischten wir die Milchhaut ab und teilten sie.
In der Zeit, in der andere Jungen Freunde fanden und mit heimbrachten, wusste ich, das ging nicht, weil Mutter da war. Vielleicht ertrug ich die Einsamkeit, weil ich nicht vermissen konnte, was ich nicht kannte.
Mutter trank Arak, der sich trübte, wenn sie ihn mit Eiswasser aufgoss. Ich stellte mir vor, sie würde Milch trinken.
In den See führte ein Steg, der bei Hitze in der Sonne knackte. Einmal stand ich dort im Herbst an der vorderen Kante, als es dämmerte, und warf flache Steine übers Wasser. Wenn die Köchin und Vater keine Zeit für mich hatten und Mutter mehrere Tage durchtrank, fühlte ich mich unsichtbar.
Ich betrachtete die Felswand und fragte mich, warum ich nie jemanden hatte springen sehen.
Ich zog mich an Gräsern und Felsvorsprüngen die Steinwand hoch. Von oben konnte ich auf den Grund des Sees schauen und sah, wie sich die Algen wiegten. Ich rannte bis ans Ende der Felsen und weiter in die Luft. Der Aufprall war hart an meinen Ledersohlen, das Wasser rauschte mir in den Ohren und war kalt. Als ich an die Oberfläche kam, fiel es mir schwer zu atmen, aber ich hatte genug Luft, um einen Schrei auszustoßen. Ich sah die Wellen, die mein Aufprall im Wasser hinterlassen hatte.
Mit tropfenden Hosenbeinen trat ich auf die Küchenfliesen. Die Köchin walkte Teig und fragte, wessen Idee es gewesen sei. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Fallen kann man nur allein, dachte ich. Ich lehnte mich gegen den warmen Ofen. Die Köchin schlug mit der Hand gegen die Kacheln, dass Mehl staubte. Sie gab mir ein Handtuch.
Vater ließ mich an diesem Abend rufen. Wenn er daheim war, saß er meist in seiner Bibliothek. Er las gern und lang, russische Romane, Philosophie aus dem Orient, Haikus.
Ich wusste, dass Vater und Mutter sich nicht liebten.
Zwischen den Fingern drehte ich die Blütenrispe eines Schilfrohrs, das ich am Ufer gepflückt hatte.
»Die Patres sagen, du bist gesprungen«, sagte Vater.
Ich nickte.
»Warum?«, fragte er.
Ich schwieg.
»Weißt du, dass Schweigen manchmal schlimmer ist als Lügen?«, fragte er.
Er zog mich auf die Lehne seines Lesesessels.
Wir lauschten dem Ticken der Uhr.
»Wieso ist es schön zu fallen, Papa?«
Er dachte lange nach. Leise begann er, eine Melodie zu summen. Nach ein paar Minuten hielt er inne. »Weil wir dumm sind«, sagte er.
Wir schwiegen gemeinsam.
Er schüttelte den Kopf. Seine Hände auf meinen Schultern waren schwer, er roch wie seine Bücher.
»Was ist denn Junge? Ich kenne diesen Blick.«
»Geht es Mutter gut?«
Er atmete tief ein.
»Sie …«, sagte er. Er verzog das Gesicht. »Deiner Mutter … es ist alles in Ordnung, sei lieb zu ihr.«
Ich verstand, was er meinte und dass es leichter sein würde zu schweigen. Schweigen wurde meine Art zu weinen.
»Wir halten das aus«, sagte Vater, er legte mir eine Hand in den Nacken.
Ich nickte. Er schaute mich an. Ich wusste, ich würde immer wieder springen.
*
Wenn ich an zu Hause denke, fallen mir die Sonnenblumenfelder ein, die sich hinterm Haus bis zum Wald über die Hügel zogen.
Unsere Köchin mochte Sonnenblumen nicht, weil sie keinen Duft haben, sagte sie. Sie sagte, die Sonnenblume locke die Bienen mit ihrer Schönheit, aber in ihrem Inneren steckten keine Nektartropfen, nur hässliche Kerne.
Ich lief in die Felder, um den Geruch der Blumen zu finden, und zwischen den Blütenköpfen stellte ich fest, dass die Köchin sich irrte. An heißen Sonnentagen, wenn die Hitze in die Pollen brannte, dufteten die Sonnenblumen, zart zwar, aber ich roch sie. Und als ich ihren Duft erkannt hatte, roch ich ihn manchmal, wenn ich zum Schlafen das Fenster offen ließ.
Es war wichtig, gut riechen zu können. Ich konnte den Alkohol schon im Flur riechen, wenn ich heimkam.
Ich fragte den Imker und die Gärtnerinnen, wonach Sonnenblumen dufteten, aber niemand wusste es. Ich glaubte, es bedeutet etwas, dass ich die Blumen riechen konnte.
*
Im Jahr 1935 trank Mutter eine Flasche Kartoffelschnaps auf die Verkündung der Nürnberger Gesetze. Mutter schenkte oft nach. Ich saß daneben und zählte mit. Sie hob das Glas auf das Wohl Adolf Hitlers, den sie Adolphe nannte, als wäre er ein Franzose.
An diesem Abend, als Mutter auf dem Parkett des Tanzsaals schlief, ging ich in die Küche. Die Köchin saß weinend am Ofen und aß zum Trost frisch aufgeschlagene Buttercreme mit einem Holzlöffel. Ich strich ihr über die Wange, wie Vater es bei mir gemacht hatte, als ich klein gewesen war.
Ein paar Tage später belauschte ich einen Streit zwischen Mutter und Vater, in dem sie verlangte, dass er die Köchin entließ, deren Challa sie morgens gern aß. Mutter nannte sie Saujüdin. Vater sagte, er werde niemanden entlassen.
Mutter war fast nur noch bei ihren Leinwänden. Wenn sie nicht malte, lehnten die Leinwände verkehrt herum an der Wand auf dem Dachboden. Niemand durfte sie anschauen.
Am Abend, nachdem er sich mit Mutter gestritten hatte, kam Vater an mein Bett. Ich stellte mich schlafend, er setzte sich im Schneidersitz ans Fußende und sagte: »Junge, eine Sache …«, er machte eine lange Pause. Ich war mir nicht sicher, ob er den Satz zu Ende bringen würde. »Der Herrgott hat alles Mögliche gemacht, weißt du? Amseln und Elefanten … Gott wohnt in jedem Wesen, steht bei Lukas. Verstehst du, Junge? Wir müssen gut auf sie Acht geben, auf die Wesen.«
Mir war der Ernst in seiner Stimme unangenehm. Ich antwortete nicht. Er kniff mir in den Fuß und sagte: »Ich weiß, dass du wach bist.«
*
Im Jahr 1938 wurde in Berlin die Wanderausstellung »Entartete Kunst« eröffnet, in Deutschland brannten in einer Nacht 1406 Synagogen und Betstuben und im Spätsommer ging ich mit dem Sohn der Köchin ins Sonnenblumenfeld, wir waren schon so groß, dass wir über die Blüten schauen konnten. Der Sohn der Köchin war behindert, er konnte nicht rechnen, er konnte sich nichts merken, und er kaute ständig auf seiner Unterlippe. Ich mochte ihn.
»Riechst du sie?«, fragte ich und legte meine Hand von unten um einen Blütenkranz. Der Sohn der Köchin schüttelte den Kopf.
An diesem Tag zog ein Gewitter auf, ein Blitz würde eine alte Esche in unserem Garten spalten und der Regen die Blumen abknicken. Der Gärtner würde die Blütenköpfe sammeln, um Sonnenblumenkerne zu retten, und er würde fluchen und Gott ein Rattengesicht nennen.
Wir gingen durchs Feld, die ersten warmen Tropfen fielen auf meine Stirn. Kurz vor unserem Haus kamen wir an eine Gabelung des hartgetretenen Pfades. Der eine Weg führte nach Hause, der andere zur Melkalm.
Seit ich denken konnte, graste auf der Melkalm ein Ziegenbock, den die Bäuerin dort an ein Gatter gebunden hatte. Im Tal wussten alle, dass er Hieronymus hieß.
Sein Fell war weiß und lang, er gehörte zur Rasse der Gletschergeißen. Die Gipfelsonne hatte ihn vor Jahren erblinden lassen. Ich hätte ihn gern gestreichelt, aber er war bissig. Morgens, wenn ich Milch holte, warf ich ihm manchmal Blätter unserer Brombeersträucher hin.
Unter den Kindern des Tals war es eine Mutprobe, Hieronymus an den Hörnern zu ziehen. Einmal sah ich, wie der Sohn des Senners dem Ziegenbock in den weichen Bauch trat.
Am Tag, als wir ins Sonnenblumenfeld gelaufen waren, prasselte der Regen auf unsere Gesichter. Wir formten Trichter aus Ahornblättern und tranken Regenwasser. Ich freute mich auf unser Haus und dass es warm darin war und auf Vater, der daheimblieb in diesen Tagen. Ich dachte daran, was er über die Wesen der Schöpfung gesagt hatte, und schaute durch den Regen über die Wiesen hoch zur Melkalm. Morgens hatte der Ziegenbock am Gatter gestanden. Die ersten Blitze zuckten über den Himmel. Der Sohn der Köchin weinte. Ich nahm ihn an der Hand und brachte ihn zum Dienstboteneingang unseres Hauses. Ohne ein Wort der Erklärung drehte ich mich um und rannte in den Regen.
»Donner«, rief der Sohn der Köchin, »Donner.«
Der Regen war warm. Der Aufstieg fiel mir leicht, ein paarmal rutschte ich aus.
Ich hatte gelernt, meinen Augen zu misstrauen, und wunderte mich nicht, als die Blitze auf der Melkalm vom Gras in den Himmel schlugen. Der Donner krachte. Am Gatter kauerte Hieronymus auf dem Boden. Er hatte das Maul ins Gras gelegt und die Augen geschlossen, als wartete er auf den Tod. Vielleicht schlief er auch nur, weil ihn das Gewitter nicht interessierte.
Ich entknotete das Seil, das am Gatter festgebunden war. Hieronymus schnappte in meine Richtung. Ich blieb stehen. Manchmal tut es weh, wenn man das Richtige tut.
Hieronymus biss mir in die linke Hand. Die Zähne waren ihm Jahre vorher ausgefallen. Er biss ins Leere, dann biss er in meine rechte Hand, die ich nach ihm ausstreckte.
»Ich bin doch der mit den Brombeerblättern.«
Der Regen perlte vom Fell, das hell und borstig war. Ich zog am Strick. Ich legte Hieronymus die Hand aufs Maul. Er biss nicht mehr, er stand still. Vielleicht hat er das Gehen verlernt, weil er zu lange angebunden war, dachte ich. Ich kniete mich vor ihm in die Wiese und legte ihn mir quer über die Schultern. Seine Rippen drückten auf meine Schlüsselbeine.
Der Ziegenbock war mager, aber schwerer, als ich es mir vorgestellt hatte. Er stank nach Stall. Meine Oberschenkel zitterten.
»Entschuldigung, dass ich dich nicht beschützt habe, als du getreten wurdest«, sagte ich. Ich erzählte dem Ziegenbock an diesem Tag, was ich sonst niemandem sagte. Wie ich Mutter vermisste, obwohl sie da war. Wie ich mich unsichtbar fühlte. Dass ich nie lügen wollte, weil dann das Leben verschwendet war. Beim Abstieg stürzte ich und schlug mir die Knie auf.
Als ich durch die Zedernallee vor unserem Haus ging, war meine Hose zerrissen, Schlamm klebte mir unter den Fingernägeln. Der Ziegenbock hatte in meinen Hemdkragen gebissen.
Vater lief mir in der Allee entgegen.
»Junge.«
Als er mich umarmte, biss Hieronymus nach ihm.
»Hast du die Blitze nicht gesehen?«
Ich kniete mich in den Kies und ließ den Ziegenbock von meinen Schultern rutschen. Vater strich mir das Wasser aus den Haaren. Tränen stiegen mir in die Augen. Ich war froh, dass er sie im Regen nicht sah.
»Ein Blitz kann dich verglühen«, sagte Vater. Natürlich sah er, dass ich weinte, weil Väter das tun.
»Wir müssen Acht geben«, sagte ich.
Ich wollte ihm erklären, wie schön die Blitze in den Himmel geschlagen waren und warum ich froh war, dass der Kutscher gekommen war, und warum ich Mutter manchmal mehr liebte als ihn. Ich schwieg. Und dann brüllte ich, so plötzlich, dass ich über den Klang meiner Stimme erschrak: »Du hast dein Wort gebrochen, Papa.«
»Was ist denn, Junge?«
»Die Wahrheit. Du hast gesagt, wir sagen die Wahrheit. Aber über Mutter lügst du.«
Ich sah den Schmerz in seinem Gesicht. Ich hatte ihm nicht wehtun wollen. Das Regenwasser schmeckte süß. Er nahm mich an der Hand und ging mit mir zum Haus. Als wir im Flur standen, fragte er leise: »Hast du mal Hibiskus blühen sehen?« Er ging vor mir in die Hocke, dass er kleiner war als ich. »So ist die Wahrheit, Junge, wie Hibiskus. Irgendwann wirst du es sehen. In Ägypten findest du ganze Gärten. Wunderschön da. Ganze Gärten findest du. Und der Hibiskus blüht in tausend verschiedenen Arten.«
Hieronymus verbrachte die Nacht in unserem Gewächshaus, wo er bis zum Morgen die halbe Jahresernte Zucchini fraß. Nachts ging ich zu ihm. Er erlaubte, dass ich das Fell an seinem Hals streichelte.
Der Bauer holte ihn am nächsten Morgen, schüttelte mir die Hand, entschuldigte sich viele Male und sagte, er würde dafür sorgen, dass so etwas wie mit den Zucchini nie wieder passiere. Er schlug Hieronymus mehrmals mit der Handkante zwischen die Hörner.
Es war das Jahr, in dem die Mitglieder des Schweizer Ziegenzuchtverbands darüber nachdachten, welche Blutlinien fortgeführt werden sollten, ein Prozess, der unter dem Namen »Rassenbereinigung« in die Bücher einging. Der Verband kategorisierte die Capra Sempione, zu der Hieronymus gehörte, als nicht förderungswürdig.
Im Spätsommer erzählte Vater, dass der Bauer kurz nach der Gewitternacht Hieronymus neben die Güllegrube geführt, aus zwei Metern Entfernung mit einer doppelläufigen Repetierbüchse angelegt und dem Tier durchs Hirn geschossen habe.
Im selben Jahr ließ Mutter einen Augenarzt aus München kommen. Er sagte, dass meine Unfähigkeit, Farben zu sehen, nicht im Auge liege, sondern im Kopf. Mutter glaubte, ich müsse mich nur genug anstrengen. Sie ging mit mir auf den Dachboden.
»Jetzt wird alles wieder gut«, sagte sie.
An der Wand lehnten ihre Bilder. Mutter stellte einen Tuschkasten auf den Tisch und vertauschte die Farbtöpfe. Dann fragte sie mich, welche Farbe welcher Topf hatte.
Wenn ich richtig riet, nickte sie. Wenn ich falschlag, sagte sie, ich solle mir bitte mehr Mühe geben. Für diesen Unterricht zog sie ihre Reitstiefel an, die sie Knobelbecher nannte.
Bei einem der ersten Male auf dem Dachboden sagte sie: »Bitte, wenigstens Rot, ich bitte dich.«
Wenn Mutter getrunken hatte, hob sie manchmal die Faust, aber sie blieb sich treu in ihrem Bemühen, mich nicht zu berühren.
Nach einigen Stunden Unterricht lehnte in der Ecke des Dachbodens zwischen den Leinwänden ein Teppichklopfer aus Rattangeflecht. Sie sagte, dass es ihr mehr wehtue als mir. Gelegentlich fiel mein Gesicht durch die Schläge in den Tuschkasten.
Mutter sagte: »Wasch dich bitte, bevor du rausgehst, niemand muss wissen, dass du geweint hast.«
Einmal blieb ich so liegen, mit der Stirn in der Farbe, und merkte, dass die Töpfe unterschiedlich rochen. Die Farben waren mit natürlichen Pigmenten gefärbt. Indigoblau roch nach den Schmetterlingsblüten in unserem Gewächshaus, Neapelgelb nach Blei, Kadmiumrot nach Tonerde im Sommer, Schwarz nach Ruß, Weiß nach Kreide.
Ich mochte vor allem den Duft von Kohle. Mutter gab mir, außer den Stunden auf dem Dachboden, keinen Unterricht mehr. Die Besuche im Museum blieben aus.
Wenn ich nun für Mutter Farben erkennen musste, lehnte ich mich nah an den Tuschkasten. Manchmal nahm ich die Farbtöpfe in die Hand, damit ich besser daran riechen konnte. Mutter schlug seltener. Einmal riet ich drei Farben hintereinander richtig. Mutter strich mir über den Zeigefinger.
*
Jeden Samstag nach Schabbes, wenn es dunkel wurde, drückte die Köchin eine Kompresse aus Johanniskraut auf die Narbe in meinem Gesicht, auch noch Jahre nach der Verletzung. Sie sagte, das würde helfen, damit ich wieder fein aussehe. Manchmal umarmte mich die Köchin, bevor ich an diesen Abenden schlafen ging. Ich wartete nur darauf.
Die Köchin war die dickste Frau, die ich kannte. Täglich buk sie Kuchen, mit Heubeeren im Sommer, mit Äpfeln im Herbst, mit Mandeln im Winter. Sie sagte, ihr Kuchen sei zu kostbar für das Personal, und weil deshalb immer zu viel Kuchen da war, saß sie abends vor dem Ofen, legte sich Patiencen und aß.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: