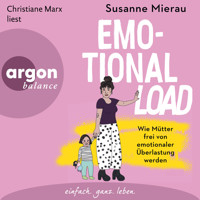12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Alle Menschen benötigen Fürsorge. Ohne Fürsorge können Kinder nicht groß werden, können Kranke nicht gesund werden, können ältere Menschen nicht alt werden. Fürsorge hält die Gesellschaft am Laufen. Doch warum wird Fürsorge als gesellschaftlicher Wert oft vernachlässigt? Die Bestsellerautorin Susanne Mierau schreibt in ihrem neuen Buch darüber, wie wichtig ein gutes Miteinander ist. Ohne Kinder würde später niemand unsere Rente bezahlen; die alten Menschen haben unseren Wohlstand aufgebaut. Und dennoch werden beide Gruppen oft als Störwesen gesehen, dennoch werden Erzieherinnen und Krankenpfleger nicht ausreichend bezahlt. Es gibt etliche Ratgeber, die Eltern erklären, wie sie Kinder besser erziehen, wie sie Familie und Job unter einen Hut bekommen – doch Mierau macht deutlich, dass es darum nicht geht: Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen zu einer neuen Haltung finden, die Strukturen grundlegend verändern. In einem flammenden, warmherzigen und lösungsorientierten Plädoyer zeigt sie, was sich verändern muss, damit dieses Land nicht sein eigenes Fundament zerstört.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Susanne Mierau
Füreinander sorgen
Warum unsere Gesellschaft ein neues Miteinander braucht
Über dieses Buch
Alle Menschen benötigen Fürsorge. Ohne Fürsorge können Kinder nicht groß werden, können Kranke nicht gesund werden, können ältere Menschen nicht alt werden. Fürsorge hält die Gesellschaft am Laufen. Doch warum wird Fürsorge als gesellschaftlicher Wert oft vernachlässigt? Die Bestsellerautorin Susanne Mierau schreibt in ihrem neuen Buch darüber, wie wichtig ein gutes Miteinander ist. Ohne Kinder würde später niemand unsere Rente bezahlen; die alten Menschen haben unseren Wohlstand aufgebaut. Und dennoch werden beide Gruppen oft als Störwesen gesehen, dennoch werden Erzieherinnen und Krankenpfleger nicht ausreichend bezahlt. Es gibt etliche Ratgeber, die Eltern erklären, wie sie Kinder besser erziehen, wie sie Familie und Job unter einen Hut bekommen – doch Mierau macht deutlich, dass es darum nicht geht: Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen zu einer neuen Haltung finden, die Strukturen grundlegend verändern. In einem flammenden, warmherzigen und lösungsorientierten Plädoyer zeigt sie, was sich verändern muss, damit dieses Land nicht sein eigenes Fundament zerstört.
Vita
Susanne Mierau, 1980 geboren, ist eine der hierzulande bekanntesten Expertinnen im Bereich bindungs- und bedürfnisorientiertes Familienleben. Als Diplom-Pädagogin hat sie zunächst an der Freien Universität Berlin in Studium und Lehre gearbeitet, bevor sie eine eigene Praxis für Familienbegleitung eröffnet hat. Ihr Blog «Geborgen Wachsen» ist – wie die dazugehörigen Social-Media-Kanäle und das Geborgen-Wachsen-Forum – seit 2012 Anlaufpunkt für Familien zu allen Fragen rund um den Familienalltag. Susanne Mierau leitet Workshops, hält Vorträge für Eltern und Fachpersonen und hat bereits diverse erfolgreiche Elternratgeber veröffentlicht. Sie ist Mutter von drei Kindern.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Lektorat Judith Schneiberg
Covergestaltung HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich
ISBN 978-3-644-01504-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Zitat
Einleitung
Zitat
Teil 1: Der Wert des Sorgens
Worüber sprechen wir eigentlich?
Wir sind immer ein «Und»
Wer für uns sorgt in Zahlen und Fakten
… unbezahlte Sorgearbeit aus Sicht der Sorgenden
Zitat
Teil 2: Die Entfremdung des Umsorgens
Vom Miteinander zum Gegeneinander
Die Entdeckung der Kindheit und ihre Folgen für das Miteinander
Eine Frage von Macht und Ohnmacht
Zitat
Teil 3: Auf dem Weg in ein neues Miteinander
Ein neues Miteinander in uns selbst verankern
Ein neues Miteinander in unseren nahen Beziehungen leben
Ein neues Miteinander in der Gesellschaft verankern
Zitat
Lass dich auf das Miteinander ein
Dank
«Es sind lose wackelnde Strickleitern, die man uns zugeworfen, die wir glücklicherweise aufgefangen und benutzt haben. Aber was wäre das für ein gigantisches, stabiles Klettergerüst, wenn alle Strickleitern oben und unten zusammengebunden wären, wenn alle Beteiligten weitere Strickleitern stricken und weiter verbinden würden, nach links, nach rechts, dann wäre es nicht mehr dem Zufall überlassen, wen du triffst und wer sich kümmert, dann würden alle hochklettern und die Hände nach unten und seitwärts reichen, und die Strickleitern würden zu Stein werden, sie würden sich selbst zementieren und weniger wackeln und endlich die Zeiten für die überdauern, die noch gar nicht geboren sind.»
Shida Bazyar[1]
Einleitung
«Wenn du gewusst hättest, wie anstrengend es ist, hättest du dann Kinder bekommen?» Es ist eine Frage, die wohl so einigen Eltern nach der Pandemie gestellt wurde. Vielleicht aber auch schon früher. Jedenfalls eher als die Frage: «Wenn du gewusst hättest, wie schön es ist, hättest du dann früher Kinder bekommen?» Mir persönlich wurde nie eine Frage der letzteren Art gestellt – in allen 14 Jahren Elternschaft mit drei Kindern nicht. Kinder sind eben anstrengend, das wissen wir doch alle: Man schläft wenig, muss Wutanfälle begleiten, Kinder werden krank, sind zappelig in Restaurants und ungehalten in Einkaufsmärkten. Wir können nicht mehr spontan ausgehen, die Nächte durchmachen und am nächsten Tag ausruhen, und manche Hotels nehmen Gäst*innen mit Kindern gar nicht erst auf. Natürlich gibt es auch die schönen Seiten des Elternseins. Aber ganz ehrlich: Was fällt uns zuerst ein, wenn wir darüber nachdenken, was es bedeutet, Eltern zu sein? Wahrscheinlich etwas in Richtung Fürsorgepflicht und Überforderung. Und wenn wir an die Versorgung von alten Menschen denken, sieht es ganz ähnlich aus. Wir fragen uns vielleicht manchmal: Muss das eigentlich so sein? Ist das «normal», dass Fürsorge so anstrengend ist? Nein, ist es nicht. Aber wir haben verinnerlicht, dass es so in Ordnung wäre und genau so der Norm entspräche. «Eltern sind eben immer müde, besonders Mütter.»
Fürsorge kann aber auch ganz anders sein und sich ganz anders anfühlen. Wir haben die Sache nur leider über Generationen hinweg total in den Sand gesetzt und nehmen jetzt als normal an, was gar nicht der Norm entsprechen sollte und uns dauerhaft schadet.
Spätestens seit «Regretting Motherhood»[2] beschäftigen wir uns (endlich!) öffentlich mit der Ambivalenz von Mutterschaft: dem Gefühl, es sich anders vorgestellt zu haben. Dem Bedauern des Elternseins. Dem Gefühl, keine gute Mutter zu sein aufgrund der allgegenwärtigen, überhöhten Mutterideale. Dem Gefühl, überfordert zu sein. Und auch mit dem Gefühl der Hilflosigkeit angesichts der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen: sich verlassen zu fühlen durch zu wenig Unterstützung, Fehlen gerechter Aufgabenverteilungen zwischen Eltern, zu wenige öffentliche, niedrigschwellige Hilfs- und Begleitungsangebote, angefangen beim Hebammen- über den Kitaplatzmangel bis hin zum Mangel von Lehrenden an Schulen, zu wenig Therapieplätze für Kinder und Jugendliche, zu wenig Kurangebote für Eltern, familienunfreundliche Infrastruktur, finanzielle Benachteiligung von Familien mit der Folge von (Kinder-)Armut etc. Die strukturellen Bedingungen der Fürsorge sehen wirklich schlecht aus.
Gerade in der Pandemie traten die Schieflage des Elternseins und seine gesellschaftliche Vernachlässigung besonders hervor. Kinder wurden benachteiligt, und Eltern (insbesondere Mütter) haben versucht, dies auszugleichen, indem sie selbst Benachteiligung, Überlastung und Verringerung des Wohlbefindens auf sich genommen haben. Wer denn, wenn nicht wir? Es hat etwas mit uns gemacht, dass wir übersehen, vergessen und in die Erschöpfung getrieben wurden, sowohl strukturell, beispielsweise in Hinblick auf Erwerbstätigkeit und Altersvorsorge, aber auch mit unserem Gefühl und unserer Einstellung, mit Erziehungsverhalten und unseren Werten, die wir weitergeben.
«Care-Arbeit» ist in den vergangenen Jahren ein bedeutsamer Begriff des feministischen und pädagogischen Diskurses geworden, weil sie allgegenwärtig und bedeutsam ist und dennoch lange Zeit beschwiegen wurde. Es ist richtig, dass die fehlende Wertschätzung, die Kümmerfalle und Unsichtbarkeit der Mehrfachbelastung von Frauen zur Sprache kommen, dass wir unsere salzigen, weiblichen Finger in die Wunde der Gerechtigkeit legen. Es ist wichtig, dass wir den Diskurs eröffnen und auf die Ungerechtigkeiten hinweisen. Es muss benannt werden, dass Familien strukturell benachteiligt werden und es auf vielen Ebenen unattraktiv ist, Kinder im Wachsen zu begleiten. Viele Probleme sind im gesellschaftlichen Diskurs bereits identifiziert worden, und es gibt durchaus gute Lösungsansätze. Um aber langfristig etwas zu ändern und vor allem darauf hinzuwirken, dass diese Lösungsansätze von jenen umgesetzt werden, die (aktuell) von den Fürsorgeproblemen nicht betroffen sind, müssen wir noch viel weiter und tiefer in die Aufarbeitung des Problems gehen.
Fürsorge ist mehr als «nur» Arbeit. Sie ist ein Wert unserer Gemeinschaft und hält sie am Laufen. Nicht nur aus der Sicht des Humankapitals, nicht nur als wirtschaftlicher Faktor, sondern auch als emotionaler, psychischer Bestandteil von Gesellschaft, als ihr Entwicklungsmotor auf menschlicher Ebene. Und genau darüber sprechen wir zu wenig neben all den politischen Problemen: über die psychischen, emotionalen, hormonellen, erzieherischen und evolutionsbiologischen Anteile von Care. Diese Aspekte hinter der Fürsorge sind wichtig, wenn es darum geht, die Notwendigkeit zur Veränderung zu verstehen. «Care» sollte nicht rein rational betrachtet werden – bzw. sollte die rationale Betrachtung die emotionalen Aspekte in ihrer Bedeutsamkeit einbeziehen. Wir sind Menschen. Wir erleben jeden Tag eine breite Palette an Gefühlen und dürfen uns davon nicht entkoppeln lassen. Menschen sind bedürftig – von der Wiege bis zur Bahre. Als Kinder genauso wie als Erwachsene, und viele der menschlichen Bedürfnisse stehen mit Fürsorge in Verbindung. Wenn aber Bedürfniserfüllung und Selbstfürsorge schon aberzogen wurden und wir verinnerlicht haben, einfach, anpassungsfähig und möglichst unkompliziert sein zu müssen, dann wird es schwer, Fürsorge als Wert neu zu begreifen und Bedürftigkeit anderer (neben der eigenen) anzuerkennen.
Zu einer Aufwertung von Fürsorge als Wert gelangen wir zudem nicht, wenn Fürsorge als weibliche Eigenschaft begriffen wird, männlich gelesene Menschen davon entfremdet werden und gleichzeitig die Position der Frau in der Gesellschaft weiterhin nur untergeordnet, bestenfalls mitgemeint, aber an vielen Stellen abgewertet bleibt. Denn Fürsorge wird als weiblich zugeordnete Eigenschaft, in einer Gesellschaft, in der Frauen keinen Wert haben, nicht die Anerkennung bekommen, die wir für eine Veränderung brauchen. Fürsorge hängt zusammen mit Gerechtigkeit und Gleichberechtigung – und ganz besonders mit der Erziehung, mit der wir den Vorstellungen über Rollenbilder den Weg ebnen. Solange wir weiterhin den vorgegebenen gesellschaftlichen Rollenbildern anhängen, sie an die nächste Generation weitergeben und sie nicht per se infrage stellen, werden wir an der Ungerechtigkeit nichts verändern. Wir müssen unsere Kategorien dekonstruieren und ganz neue Bilder erschaffen, anstatt uns nur an den vorgefertigten Definitionen abzuarbeiten.
Wir denken oft, wir wären nur am Anfang und Ende unseres Lebens in besonderer Weise auf Fürsorge angewiesen, aber das stimmt so nicht: Die Art der Fürsorge verändert sich im Leben nur, und wir erleben sie unterschiedlich – auch bestimmt dadurch, wie sie uns präsentiert wird, ob als Dienstleistung, die wir einkaufen können, oder als persönliche Zuwendung. Geben wir, oder sind wir angewiesen? Sie ist verwoben mit Selbstbestimmung und unseren persönlichen Möglichkeiten, mit Privilegien. Und auch wenn wir uns ihrer Präsenz nicht an allen Punkten bewusst sind, zieht sie sich wie ein roter Faden durch: Fürsorge ist das Garn, das die bunte Patchworkdecke unseres Lebens zusammenhält. Die Beschaffenheit dieses Garns wird in der frühen Kindheit bestimmt. Sie nimmt Einfluss auf unsere psychische und physische Entwicklung, unser Sozialverhalten, unsere Erwerbsarbeit, Partnerschaft, Hobbys. Sie bildet die Basis für uns als individuelle Menschen, aber auch die Basis unseres Zusammenlebens. «Wir werden geboren, um zu lernen, uns miteinander in Verbindung zu setzen und zu spielen», erklärt der Historiker Rutger Bregman in seinem internationalen Bestseller «Im Grunde gut».[3] «Lange haben wir angenommen, dass der Mensch ein Egoist sei, ein Tier oder Schlimmeres. Lange haben wir geglaubt, dass es sich bei der Zivilisation nur um eine dünne Schicht handele, die beim geringsten Anlass reißen würde. Dieses Menschenbild und dieser Blick auf unsere Geschichte haben sich als völlig unrealistisch erwiesen.»[4] Wir sind gut, wir sind sozial, wir brauchen einander, wir brauchen Fürsorge.
Wir müssen unseren Blick auf Fürsorge verändern, aber auch unseren Blick auf die Menschheitsgeschichte. Fürsorge ist in uns allen tief verankert. Sie ist ein Bedürfnis, das Menschen über Zeit und Raum verbindet. Weil sie aber nur von Menschen gegeben werden kann, die sie vorher empfangen haben, bleibt sie ein ewiger Balanceakt. Wenn wir allerdings wirklich verinnerlichen, dass uns damals wie heute das Gute trägt, dass wir uns nicht durch Konkurrenz und Kampf entwickelt haben, sondern durch Kooperation und Unterstützung, dann kann sich in unserer Gesellschaft wirklich etwas verändern und die gut erdachten Lösungsansätze für unsere Probleme können greifen.
Gerade heute brauchen wir Fürsorge auf allen gesellschaftlichen Ebenen ganz besonders: in Hinblick auf die Versorgung von Kindern, in Hinblick auf unsere alternde Gesellschaft, in Hinblick auf die Versorgung von (chronisch) Erkrankten, Menschen mit Behinderung, aber auch in Anbetracht der Klimakrise und weltweiten Migration. Ein Ende der Fürsorge bedeutet nicht nur das Ende eines Menschen – wie wir schon aus dem erschütternden Baby-Experiment Friedrichs II. von Hohenstaufen auf der Suche nach der «Ursprache» wissen –,[5] sondern das Ende gesellschaftlicher Fürsorge würde das Ende der Menschheit bedeuten. Die Abkehr vom emotionalen Anteil der Fürsorge, die Operationalisierung und Verwirtschaftlichung hat einige der Krisen, mit denen wir jetzt umgehen müssen, erst hervorgebracht: Wir haben durch die Entemotionalisierung den Blick für das große Ganze und Wesentliche verloren und unterhöhlen das, worauf alles aufbaut, strukturell und emotional.
Kehren wir nun zurück zum eingangs beschriebenen Gefühl, dass Fürsorge für Kinder (und andere) vor allem eine Last sei. Dieses Gefühl, dass sich auch durch die Überlastung und die zu geringe gesellschaftliche Unterstützung in den letzten Jahren auf uns gelegt hat. Eines, das wir nicht nur individuell in uns tragen, sondern das uns beständig von allen Seiten anspringt: Nicht nur die Bad News der Menschheit sind in unserem Fokus, sondern auch die Bad News der Fürsorge. So wie unsere Nachrichten voll von Schreckensmeldungen sind, drehen sich Unmengen von Serien und Filmen darum zu zeigen, wie belastend Fürsorge ist. Benachteiligung, Anstrengung, Hilflosigkeit wird uns immerzu vor Augen geführt. Manchmal sind diese Geschichten lustig, manchmal führen sie die Absurdität des heutigen Elternseins oder anderer Care-Tätigkeiten vor Augen. Sie sind aber vor allem eins: auf Probleme fokussiert. Probleme, die wir durchaus haben und die gerade in der Pandemie zum Vorschein kamen. Wir sind erschöpft. Wir müssen über Erschöpfung reden. Aber der kollektive Fokus auf die Nachteile der Care-Arbeit durch die Pandemie, das Erschöpfende des Elternseins lässt uns aus dem Blick verlieren, dass Care auch andere Seiten hat. Die Reporterin Ronja von Wurmb-Seibel hat in ihrem Buch «Wie wir die Welt sehen» über den Einfluss negativer Nachrichten auf unsere psychische Gesundheit und unser Erleben geschrieben. Sie zitiert den Traumaforscher Dr. Philip Zimbardo, der den Begriff der «prätraumatischen Belastungsstörung» geprägt hat und erklärt: «Je mehr Warnungen wir über eine Bedrohung hören, desto mehr Angst haben wir, dass wir selbst davon betroffen sein könnten. Das, was uns eigentlich schützen soll – Informationen, Warnungen, Sicherheitshinweise –, macht uns kaputt, wenn wir es zu oft hören.»[6] Die Geschichten, die wir beständig lesen und hören, formen Glaubenssätze. Sind es schlechte Geschichten, prägen sie unser Leben entsprechend.
Und da stehen wir jetzt. Neben unseren persönlichen Belastungsgeschichten, oft hervorgerufen durch strukturelle Fürsorgeprobleme, hören und lesen wir zusätzlich dauernd: Arbeit im Care-Sektor ist schlecht bezahlt, macht dich kaputt. Wer will dort schon arbeiten? Fürsorgearbeit für Angehörige ist gar nicht bezahlt, verringert dein Wohlbefinden, erschöpft dich bis zum Burnout. Kinderhaben ist keine vorwiegend schön erzählte Geschichte mehr – lassen wir einmal einige idealisierende Zeitschriftenartikel in Elternzeitschriften außen vor –, sondern besonders vom offenen Diskurs über die Belastung gekennzeichnet. Wahlweise auch von der Behauptung, dass wir Eltern heute ohnehin falsch erziehen: «Kinder bekommen heute ein zu großes Maß an Aufmerksamkeit» oder «So macht zwanghafte Erziehung Kinder zu Weicheiern» – diese provokanten und pädagogisch wie psychologisch oft überholten Meinungen erhalten in den Medien einen Raum, der ihnen nicht zustehen sollte, und sie verfestigen ein falsches Bild von Elternschaft und Erziehung. Bei all den negativen Informationen überlegen wir uns genau, ob wir überhaupt Kinder haben wollen, und, wenn ja, wie viele. Wir fühlen uns zunehmend ausgeliefert und hoffnungslos gegenüber der großen privaten und gesellschaftlichen Herausforderung, die das bedeutet.
Gerade in Bezug auf Fürsorge stehen wir hier vor einem gefährlichen Zirkelschluss: Unser Blick auf das Negative der Fürsorge, auf die Anstrengung, die Überlastung entfremdet uns von all dem Schönen, den kleinen, warmen Händen in unseren eigenen, den mühsam ausgesprochenen ersten Worten, den tapsigen ersten Schritten, den Gesprächen mit Teenager*innen über die Weltlage. Ja, auch mit Teenager*innen kann man reden und wunderbare Zeit verbringen. Sie sind keineswegs die «PuberTIERE», vor denen Eltern Angst bekommen müssen. Mit dieser Entfremdung, dieser Distanz zum positiven emotionalen Anteil von Fürsorge verlieren wir das Gefühl für sie, das wir aber dringend brauchen, um Fürsorge aufzuwerten – emotional und darüber hinaus als respektables Gut, als wertgeschätzte und als entsprechend zu honorierende Tätigkeit.
Wir brauchen beides: die Anerkennung der Lasten und gesellschaftliche und politische Veränderungen, um die Last zu verringern durch finanzielle und menschliche Unterstützung und die emotionale Aufwertung des Begriffs der Fürsorge. Wir müssen lernen, sie als etwas zu verstehen, was man nicht nur muss, was nicht immer nur anstrengend und furchtbar ist, was uns Augenringe macht und niemals durchschlafen lässt, sondern was auch ganz wunderbar sein und sich gut und warm anfühlen kann. Natürlich müssen die Geschichten der Überlastung ihren Raum haben, die gesellschaftlichen Verhältnisse angeprangert werden – etwas, das auch in diesem Buch nicht zu kurz kommen wird. Wir brauchen aber auch die Geschichten darüber, wie schön es ist, Kinder großzuziehen, welche schönen Seiten Erwerbstätigkeit im Care-Arbeitssektor hat und, ja, auch wie gut es sein kann, einen alten Menschen zu pflegen und beim Sterben zu begleiten. Wir sollten uns auch die schönen Geschichten erzählen, die positiven Beispiele, die Lösungsansätze. Vor allem aber brauchen wir eine Perspektive darauf, wie es mit unserem höchsten Gut des Menschseins weitergehen kann, wenn wir nicht daran kaputtgehen wollen, dass Fürsorge totgeschwiegen, ungerecht verteilt und missachtet wird.
Die gute Nachricht ist: Es ist nicht zu spät. Wir können es aufhalten. Und zwar nicht «nur» durch politische Veränderungen. Nicht nur durch «die da oben, die was ändern müssen». (Wie wir sehen werden, ist dieses Denken nämlich schon ein Teil des Problems.) Sondern durch unsere eigene Sichtweise, ein Umdenken über individuelle Werte, durch eine Öffnung unserer Herzen, die uns alltägliche Handlungen verändern lässt – und vor allem durch Gemeinschaft. Mit einem neuen Blickwinkel verändern wir uns, und wir verändern die Menschen in unserer Umgebung. Wir verändern Familie, Freund*innenschaft und Erziehung, wir verändern die Menschheit. Wir tragen den Wandel hin zur Gemeinschaft gemeinsam. Lasst uns die schönen Seiten der Fürsorge, der Bedürfnisorientierung und -befriedigung erkunden und sehen, wie wir Fürsorge neu denken und damit die Welt umgestalten können.
«Enge Bindungen an andere Menschen sind das Zentrum, um das herum sich das Leben eines Menschen dreht, nicht nur als Säugling, Kleinkind oder Schulkind, sondern auch während der Adoleszenz und der Erwachsenenzeit bis hinein ins hohe Alter. Aus diesen engen Bindungen zieht ein Mensch Kraft und Lebensfreude, und durch das, was er beiträgt, gibt er anderen Kraft und Lebensfreude. In dieser Frage sind sich die moderne Wissenschaft und die traditionellen Weisheitslehren einig.»
John Bowlby[7]
Teil 1:Der Wert des Sorgens
Es gibt eine Anekdote über die berühmte amerikanische Ethnologin Margaret Mead: In einem Seminar soll sie von einer Studentin gefragt worden sein, was ihrer Meinung nach das erste Zeichen der Zivilisation gewesen sei. Die Studentin erwartete, dass Mead Tontöpfe oder Schleifsteine oder Ähnliches nennen würde. Doch Mead erklärte, dass das erste Zeichen der Zivilisation der Fund eines Oberschenkelknochens sei, der gebrochen gewesen und geheilt war. In der Natur würden wir sterben, wenn ein Oberschenkel gebrochen wäre, man nicht vor Feinden weglaufen und sich keine Nahrung besorgen könnte. Ein Oberschenkelknochen, der ausheilen konnte, zeigt, dass es einen Menschen gegeben haben musste, der sich um die verletzte Person gekümmert, sie gestützt und gepflegt hatte. Einer anderen Person durch eine missliche Lage zu helfen, sei der Beginn der Zivilisation. Die Studentin war erstaunt.[8]
Ich versuche, mir die Szene vor meinem inneren Auge vorzustellen: Die Person mit dem Oberschenkelbruch, wie mag sie ausgesehen haben? Wie war es zu dem Bruch gekommen? Vielleicht bei der Nahrungsmittelbeschaffung? Ein Unfall beim Erkunden der Umgebung? Und die pflegende Person, die Nahrung bereitete, beim Laufen stützte, so gut es ging, wer ist sie wohl gewesen? Welches Geschlecht hatten die Person mit dem Bruch und die pflegende Person? Und obwohl wir nichts über die Geschlechter dieser beiden Menschen wissen und nichts an der Anekdote eine Zuweisung zulässt, haben wir uns wahrscheinlich alle die kümmernde Person als Frau gedacht – vielleicht als Partnerin oder Mutter. Die Person mit dem gebrochenen Bein können wir uns möglicherweise ebenso als Frau vorstellen, aber wahrscheinlicher ist es, dass wir sie uns als Mann denken. Der Grund dafür ist, dass wir dieses Bild alle verinnerlicht haben: Männer gehen auf die Jagd, gehen Gefahren ein, beschaffen Nahrung, sind den größeren körperlichen Risiken ausgesetzt (von der Geburt der Nachkommen einmal abgesehen)[9], während Frauen sich kümmern. Gerade aus den Bildern in Museen, aber auch den Bildern der Bücher unserer Kinder springt uns diese Rollenaufteilung an, obwohl längst belegt ist, dass diese Darstellung so nicht stimmt.[10]
Gehen wir noch einen Schritt weiter und überlegen uns: Welchen Wert messen wir der Tätigkeit dieser kümmernden Person bei, die laut Mead damit den Beginn der Zivilisation abbildet, und welchen Wert messen wir der Tätigkeit der Person mit dem gebrochenen Oberschenkel bei? Wie verteilen wir Anerkennung und Macht in diesem Beispiel, und was hat das mit ihren Tätigkeiten zu tun?
Die Einordnung, die wir hier vornehmen, wird wahrscheinlich unserer Vorstellung von Arbeit und Fürsorge entsprechen, wie sie sich uns eingeprägt hat: Punkt für Punkt ergibt sich im Laufe unseres Lebens ein impressionistisches Bild davon, wie «echte Arbeit» für uns aussieht. Was wir selbst in unserer Ursprungsfamilie vorgelebt bekommen haben, was uns in Kindergarten und Schule erzählt wurde, was Medien wie Bücher, Serien, Filme vermitteln, welche Strukturen wir im Erwachsenenleben erfahren: Jeder kleine Punkt, der durch die Erlebnisse unseres Lebens entsteht, bildet gemeinsam mit anderen unser inneres Bild. Was wir als Arbeit definieren, ist geprägt durch unsere Kultur und unsere Erfahrungen in ihr. Würden sich andere Punkte in anderen Erfahrungsfarben zusammenfügen, ergäbe sich ein ganz anderes Bild. Wie so vieles ist auch unsere Definition von Arbeit nicht absolut. Sie besteht nur, weil sie sich genau so in uns eingeprägt hat und wir sie genau so weitergeben. Wir haben gelernt, dass mit dem Wort «Arbeit» Erwerbsarbeit in einer bestimmten Form gemeint ist, nicht aber all jene Tätigkeiten rund um das Pflegen und Umsorgen anderer Menschen. Das Wort «Arbeit» verbinden wir mit finanzieller Entlohnung. Was nicht finanziell entlohnt wird, gilt im Umkehrschluss in unseren Gedanken meist nicht als Arbeit.
Auch wenn wir nach einem Tag des Umsorgens eines kleinen Kindes müde und erschöpft auf dem Sofa zusammensinken und unser «Netflix and chill» schnell in ein leise schnarchendes «nur chill» übergeht, bezeichnen viele von uns die anstrengenden Handgriffe und Gefühlsbegleitungen des Tages nicht als Arbeit. Denn das Umsorgen von Menschen, das hierzulande größtenteils weiblich gelesene Personen übernehmen, hat keinen vergleichbaren Wert wie Erwerbsarbeit – weil es «nur» Kümmern ist. Dabei ist dieses Kümmern unersetzbar, etwas, von dem wir alle abhängen und das geleistet werden muss. Kümmern ist alternativlos und unverhandelbar. Wer sich nicht um andere Menschen kümmert, die sonst nicht versorgt wären, riskiert, dass diese sterben: verhungern, erfrieren, an den Folgen von Einsamkeit erkranken.
Selbst wenn wir damit unseren finanziellen Verdienst bestreiten, weil wir für eine sorgende Erwerbsarbeit entlohnt werden, ist die Anerkennung von Fürsorgetätigkeiten als Erwerbsarbeit noch immer gering. Eine Freundin, seit Jahrzehnten als Erzieherin in verschiedenen Kitas tätig, berichtete mir von folgender Situation: Beim morgendlichen Verabschieden der Eltern, wie sie es als Erzieherin im Kinderladen immer gemeinsam mit den Kindern machte, wünschte sie einem der Väter auf seine Verabschiedung hin ebenso einen schönen Tag. Daraufhin ging dieser mit den Worten: «Na ja, ich muss ja heute arbeiten.» – Diese kleine Alltagsanekdote, die so oder so ähnlich viele Beschäftigte im Care-Arbeitssektor erzählen könnten, legt bereits einige wunde Punkte des Care-Themas offen: die fehlende Anerkennung des Sorgens als Arbeit; die Auslagerung von Fürsorge als Dienstleistung; damit einhergehend die Entfremdung vom tatsächlichen Arbeitsaufwand und der Bedeutung fürsorgender Tätigkeiten, verbunden mit dem Verlust der generellen Wertschätzung von Fürsorge; außerdem die Geschlechterverteilung in der Erwerbsarbeit.
Worüber sprechen wir eigentlich?
Bevor wir uns der Frage nach dem Wert des Sorgens genauer widmen, müssen wir uns zunächst ein wenig der Begrifflichkeit nähern, mit der wir umgehen. So banal es klingen mag, können wir nämlich Dinge und Sachverhalte, für die wir keine passende Bezeichnung haben, nur schwer be-greifen und dementsprechend schwer damit umgehen. «Sprache verändert unsere Wahrnehmung. Weil ich das Wort kenne, nehme ich wahr, was es benennt», erklärt die Bestsellerautorin Kübra Gümüşay in ihrem Buch «Sprache und Sein»,[11] und fährt später fort: «Wenn Sprache unsere Betrachtung der Welt so fundamental lenkt – und damit auch beeinträchtigt –, dann ist sie keine Banalität, kein Nebenschauplatz politischer Auseinandersetzungen.»[12]
Stellen wir uns beispielsweise vor, wir würden einer anderen Person sagen, sie solle uns bitte einen Apfel aus dem Obstkorb holen, aber es gäbe den Begriff «Apfel» noch nicht: Wir würden wahrscheinlich beschreiben, wie ein Apfel aussieht. Vielleicht würden wir dabei Merkmale nicht erwähnen, die für die andere Person ganz entschieden einen Apfel ausmachen. Vielleicht käme es deswegen zu Missverständnissen und die andere Person gäbe uns eine Nektarine statt eines Apfels. Wir wären darüber enttäuscht, dass wir das falsche Obst gereicht bekommen und auch, dass dieser andere Mensch nicht versteht, was wir ausdrücken wollten. Dabei haben wir es in diesem Beispiel mit einem Ding, einem Objekt zu tun. Noch schwieriger wird es, wenn es darum geht, beispielsweise Gefühle oder Sachverhalte zu beschreiben, solange wir keine Worte dafür haben. Wie würden wir Trauer beschreiben, wenn wir kein Wort dafür hätten? Oder Erschöpfung? Und wie kannst du sicher sein, dass dein Gegenüber das, was du mit «Erschöpfung» meinst, nicht als Trauer versteht? Wir brauchen Worte, die unser Erleben und Empfinden in Sprache umsetzen, um uns mitzuteilen, um verbindliche Übereinstimmungen mit anderen festzulegen und auf Dinge hinzuweisen. Wenn uns passende Worte fehlen, kann das dazu führen, dass wir nicht leben können, wie wir es brauchen. Uns fehlt schlichtweg das sprachliche Werkzeug, um uns mit anderen zu verständigen und zu einigen.
Auf der anderen Seite heißt das, dass Worte, die wir nutzen, eine enorme Wirkmacht haben: Wenn Kinder immer als «Bälger» oder gar «Terrorzwerge» bezeichnet werden, macht das etwas mit unserer Vorstellung von Kindern, mit unserer Erwartungshaltung ihnen gegenüber. Genauso, wenn wir immer über «die Muddis» sprechen oder unsere eigenen Eltern mit «der Alte» oder «die Alte» betiteln oder eine Person auf der Straße mit «die Behinderte da». – In diesen Fällen diskriminieren wir explizit, wir benutzen geringschätzige oder zumindest geringschätzig gemeinte Worte. Aber allein durch die Tatsache, dass wir aus Einzelnen einen Teil einer Gruppe machen, ihnen ihre Individualität rauben, Menschen und auch Sachverhalte also reduzieren, dehumanisieren wir sie.
Gerade im Bereich des Sorgens um andere bilden wir schnell Gruppen, denken wir an «die Kinder», «die Alten», «die Eltern». So als wären sie alle gleich, entwickelten sich gleich, hätten gleiche Bedürfnisse. Wenn wir Kinder haben, merken wir jedoch bald, wie verschieden sie alle sind und dass allgemeine Lösungen kaum helfen. Nicht anders ist es bei allen anderen Menschen jenseits des Kindesalters. Die Dehumanisierung durch diese Art der externen Gruppenbildung und Normierung zieht oft weitere physische oder psychische Gewalt nach sich,[13] auch auf struktureller Ebene. Durch die versuchte Einpassung in vorgegebene Rahmenbedingungen für eben diese Gruppe, der ein Mensch zugewiesen wird, wird seine Individualität ausgeblendet – sei es in Seniorenheimen oder Kindertageseinrichtungen. Wir richten uns nach einer Norm, schaffen dafür Strukturen, aber all jene, die rechts oder links von diesem Mittel liegen, brauchen vielleicht andere Bedingungen, damit es ihnen wirklich gut geht. Weil wir aber über «die Kinder», «die Alten», «die Behinderten» reden und diese Art der Benennung unsere Vorstellungen prägt, beachten wir diese individuellen Bedürfnisse nicht und fügen der oder dem Einzelnen mittels dieser Gruppenzusammenfassung Gewalt zu.
Oft dehumanisieren wir, ohne es zu merken, und spüren die Folgen unserer Sprache auf andere nicht. Die Beschränktheit des Sprachgebrauchs wirkt sich auf unser Gegenüber aus, dessen Selbstwahrnehmung und Wohlempfinden, aber es macht auch etwas mit unserem eigenen Denken und Handeln. Die Sprache, die wir nutzen, ist gerade in Bezug auf alle zwischenmenschlichen Aspekte und unseren Umgang miteinander entscheidend. Ich möchte an dieser Stelle nicht tiefer auf das etwas abgegriffene (und durchaus umstrittene) Beispiel eingehen, dass es in der Sprache der Inuit Hunderte Worte für Schnee gibt. Der Sprachwissenschaftler Prof. Dr. Anatol Stefanowitsch benennt in Bezug darauf jedoch einen Aspekt, der auch für unser Thema wichtig ist: «Eingefleischte Skifahrer (…) kennen sie [Worte für Schnee] fast alle – und zwar nicht, weil sie in einer anderen Umwelt leben, sondern, weil sie mehr Anlässe und eine größere Notwendigkeit haben, differenziert über Schnee zu sprechen.»[14] – Haben wir zu wenig Notwendigkeit und Anlass, uns über das Sorgen und Miteinander differenziert zu unterhalten, und auch deswegen ein Wortfindungsproblem? Reden wir zu wenig über das Umsorgen, sodass wir zu wenige Worte dafür haben?
Blicken wir auf andere Sprachen, finden wir darin teilweise Worte für Sachverhalte und Empfindungen, die es in unserer Sprache auf diese Weise nicht gibt und die nicht direkt zu übersetzen sind. So gibt es konkrete Begrifflichkeiten rund um das Umsorgen und Miteinander: Bei den Bantu gibt es den Begriff «Ubuntu» für das Gefühl des Einklangs zwischen allen Menschen, im Arabischen das Wort «Asabīya», das die emotionale Verbindung einer Gemeinschaft beschreibt, und in der Sprache der Aborigines findet sich «Kanyininpa» für ein inniges Halten und Gehaltenwerden zwischen zwei Menschen, während es beispielsweise im Walisischen das Wort «Cwtch» gibt für eine besondere Art der Umarmung, die einen sicheren Raum bietet.[15] Selbst wenn wir diese Worte in unsere Sprache übersetzen, in dem wir sie umschreiben, ahnen wir, dass es oft nicht das eigentliche Gefühl wiedergibt, das hinter ihnen zu stehen scheint, weil diese Worte mit einer bestimmten (Verhaltens-)Kultur verbunden sind, die wir nicht erlernt und verinnerlicht haben.
Manchmal bekommen wir einen Einblick in die Unzulänglichkeit unserer Sprache, wenn Kinder mit ganz neuen Wortkreationen zu uns kommen, um etwas Bestimmtes auszudrücken. Schon 1907 veröffentlichten die Eheleute Clara und William Stern eine Abhandlung über die Kindersprache und gingen dabei auch auf die «Urschöpfungen» von Kindern ein: Worte, die Kinder in der frühen Kindheit selbst bilden.[16] Manchmal werden solche Neologismen dann zu einem Teil der Familiensprache und bezeichnen Rituale und Umgangsformen, die in dieser Familie vorherrschen und einen Teil des Umgangs miteinander ausmachen. Worte wie «knuscheln» als Mischung aus knuddeln und kuscheln oder «Mampa» als Bezeichnung des Kindes, wenn es «Mama» und «Papa», die beide anwesend sind und gleichwertig für die Bedürfniserfüllung, gleichermaßen anspricht. Worte können aus Anlässen und Notwendigkeiten entstehen, wenn ein Kind hierfür bislang keinen passenden Ausdruck hat.
Die Bestsellerautorin und Podcasterin Luvvie Ajayi Jones beschreibt die Tradition des Oríkì ihres Stammes, der Yorùbá, in der es darum geht, sich als Teil der Gemeinschaft zu sehen und mit ihr verbunden zu sein: Oríkì ist ein persönliches Mantra, das gesungen oder gesprochen wird an Geburtstagen, bei Feierlichkeiten und zum Abschied beim Tod. Es rühmt sowohl die Verwandtschaft, als es auch das eigene Schicksal bejaht. Es kann sowohl die Geburtsorte der Eltern beinhalten als auch die Besonderheit des eigenen Namens erklären, die mit dir verbundenen Menschen preisen und einen Blick darauf schenken, wer du bist und sein wirst mit all deinen besonderen Eigenschaften. Jones erklärt, dass es uns allen guttäte, ein ganz persönliches Oríkì zu haben und es uns immer wieder gerade dann aufzusagen, wenn wir uns nicht gut fühlen, wenn wir innere Stärke brauchen oder Widrigkeiten entgegenblicken. Als ich ihr Buch gelesen habe, habe ich auf ihre Anregung mein Oríkì erstellt: Susanne Mierau aus dem Hause Ihlow, Erste ihres Namens, Schwester von Dreien, Mutter von Dreien, Freundin und Partnerin, Trägerin von Geborgenheit im Herzen, Begleiterin ins Leben und in den Tod, Kämpferin der Worte. – Das klingt sehr pathetisch und auch ein wenig unbescheiden, was Jones durchaus genau so anregt, aber in diesen wenigen Worten ist viel enthalten von meinem Leben, den Menschen, mit denen ich verbunden bin, und meinem Wirken. Was macht es mit mir, wenn ich mir selbst diese Worte immer wieder vorsage, wenn sie an Feierlichkeiten vorgetragen werden und ich damit immer wieder eingebettet werde in mein eigenes Sein und meine Verbindungen? Oft wird die Arbeit mit positiven Affirmationen empfohlen, um das eigene Selbstbild zu stärken: Wir werden dazu aufgefordert, unserem Spiegelbild morgens Sätze entgegenzubringen wie «Ich bin stark», «Ich bin liebenswert», «Ich bin richtig!». Die Wirkungsweise dieser Affirmationen ist ohnehin umstritten:[17] Bei Menschen, die ein negatives Selbstbild haben, können solche für sie selbst nicht glaubhaften Sätze zu einer kognitiven Dissonanz führen, die das Problem noch verschärft. Aber wenn wir uns bei Gelegenheit an unsere tatsächlich positiven und bestehenden Verbindungen erinnern, ändert sich vielleicht auch unser Blick auf unsere Verbundenheit und das Gefühl dafür? Und vielleicht entwickeln wir auf dieser Basis neue Worte für das, was wir da an Verbindung fühlen?
Passende Worte machen das scheinbar Unsagbare sagbar, geben die tiefe Bedeutung wieder, die in dem steckt, was wir ausdrücken wollen. Wir müssen also offensichtlich eine Sprache finden für das, über das wir reden wollen, um es zu formen und zu verändern. Wenn wir es nicht tun, haben wir vielleicht verlernt, uns als selbst schöpfend und selbstwirksam zu erleben.
Aber blicken wir zunächst auf die Worte, die wir tatsächlich nutzen. Wenn wir über das Sorgen und Kümmern um andere sprechen, fällt uns wahrscheinlich zunächst das Wort «Fürsorge» ein. Tatsächlich wird es oft im Kontext des Sorgens um Kinder und Alte genutzt. Ein Wort, das eigentlich so schön klingt, weil es sagt: «Ich sorge für dich!» Zu wissen, dass es Menschen gibt, die sich um uns sorgen, gibt uns ein Gefühl der Sicherheit und Verbundenheit. Was «Fürsorge» für uns persönlich bedeutet, kommt wahrscheinlich dem recht nahe, wie es im Duden definiert wird: «aktives Bemühen um jemanden, der dessen bedarf» und «öffentliche, organisierte Hilfstätigkeit zur Unterstützung in Notsituationen oder besonderen Lebenslagen».[18] Das ist bereits eine ehrenwerte und gesellschaftlich bedeutsame Haltung: Wir unterstützen jene, die Unterstützung benötigen. Unser Blick ist auf das hilfsbedürftige Individuum gerichtet, auf einen konkreten Bedarf – allerdings nicht so sehr auf eine gegenseitige, alltägliche Unterstützung oder gar auf die Vorbeugung von Überlastung. «Fürsorge» schafft eine Hierarchie zwischen dem Sorgenden und der Person, die Sorge empfängt. In diesem Sinne bewertet sie und lässt eine Asymmetrie entstehen. Ein gutes Beispiel dafür ist, wie wir die Interaktion zwischen Erwachsenem und Kind in der Regel verstehen: Als Elternteil sind wir fürsorgend, weil wir die Sorge um das Wohl des Kindes tragen und das Kind als sichere Bezugsperson ins Leben begleiten. Unser Blick richtet sich dadurch besonders auf das Kümmern der erwachsenen Person und verortet Fürsorge gar nicht bei dem Kind, um das es sich zu kümmern gilt. So gerät aus dem Sichtfeld, dass Beziehungen, auch wenn sie asymmetrisch sind, nicht einseitig sind. Natürlich sollten die erwachsenen Bezugspersonen «größer, stärker, weise und gütig»[19] sein, aber auch wenn das Kind in der Kindheit keine pflegenden und versorgenden Tätigkeiten in Bezug auf die Bindungsperson(en) übernimmt – und dies auch nicht muss –, sind Kind und Elternteil immer in einer Interaktion: Fürsorge zwischen Elternteil und Kind ist keine reine Tätigkeit, sondern bedeutet immer auch Bindungsbeziehung. Fürsorge ist nichts, was Eltern «nur» geben können im Sinne einer abzuarbeitenden Tätigkeit – auch wenn es sich manchmal so anfühlen mag im stressigen Alltag Tausender Handgriffe. Das Sorgen um einen anderen Menschen resoniert mit der anderen Person und ihren Bedürfnissen, und sie gibt so auch etwas in die Beziehung zurück. Nicht in dem satirischen Sinne, wie wir ihn aus dem gängigen Meme «Sie geben uns ja so viel zurück» zum Beispiel auf Twitter kennen: «Das Kind hat heute Morgen ins Bett gekotzt. Sie geben einem so viel zurück!» Wir lesen es und schmunzeln – wir kennen alle diese anstrengenden Situationen. Und doch nimmt uns diese Betrachtung etwas von dem Umstand, dass wir tatsächlich in Beziehung sind und auch das Kind auf uns einwirkt.
Weder die überzogene Romantisierung des Verhältnisses von Eltern und Kindern ist hilfreich noch die beständige satirische Überspitzung. Die Ausrichtung darauf, was wir durch unsere Kinder alles NICHT zurückbekommen oder als Erschwernisse empfinden, lässt uns vergessen, dass wir durchaus miteinander in Beziehung sind, dass Bindung ein dyadisches System ist und wir miteinander in Wechselwirkung stehen. Elternsein ist keine Einbahnstraße. Dass wir es so denken, auch aufgrund unserer Wortwahl, ist bereits ein Schritt in die Überlastung, die so viele von uns wahrnehmen. Wir denken das Umsorgen als Tun in Bezug auf eine andere Person, aber nicht als System, als Miteinander. Doch so, wie wir nicht nicht kommunizieren können, wie es der Psychoanalytiker Paul Watzlawick erklärt hat, können wir nicht gänzlich beziehungslos kümmernd interagieren.