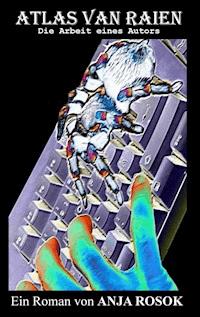Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Sprich-drüber
- Sprache: Deutsch
"Hier ´rüber! Flanke! Gib ab!" Der Morgen beginnt fair - bis diese blöde Bemerkung fällt ... und dann die Sache unter dem Torbogen. Mit wem kann er darüber reden? Warum weiß seine Schwester davon? Was weiß sie genau? Je mehr Gabor darüber nachgrübelt, desto mehr verstrickt sich sein Umfeld. Was ist, wenn man anders ist, als andere meinen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabor Gay ist einer der Wettbewerbsbeiträge zum Peter-Härtling-Preis 2015.
Dies ist eine fiktive Geschichte.
Alle Charaktere, Namen, sämtliche Orte, Handlungen und Dialoge sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen und ihren Reaktionen sind rein zufällig und von der Autorin nicht beabsichtigt. Beabsichtigt ist das „Drüber-Nachdenken“.
Gabor Gay ist der erste Jugendroman der Serie „Sprich-drüber“. Der zweite folgt bald.
Was ist, wenn man anders ist, als andere meinen?
Inhaltsverzeichnis
Flanke
Frau Rubberneck
Fachsimpelei
Fotoalben
Finstere Stimmung
Frikadellen statt Kuchen
Foulspiel
Feiertagsgäste
Freier Montagmorgen
Ferngespräche
Friedrich Eugen Spet
Fake
Freistunde statt Mathe
Frosch im Hals
Freunde
Flanke
„Hier ´rüber! Flanke! Gib ab!“ Tim rannte neben ihm und wartete auf den Pass.
Anstatt seinem Klassenkameraden zuzuspielen, preschte Gabor vor.
Einer schnaubenden Dampfwalze wollte sich niemand in den Weg stellen.
Mit einem Bluff trieb er seine Gegenspieler zur Seite und schoss.
Der Ball flog genau zwischen dem Torwart und den Schulrucksäcken hindurch.
„TOOOR! TOOOR! Unser Held!“
Auf der Bank unter dem Baum jubelten die Mädchen. Sie trampelten mit ihren Füßen auf das Holz der Sitzfläche. Wie Hühner auf der Stange gackerten sie.
„Peinlich.“ Gabors Gesicht lief rot an. Bei dummen Sprüchen über seine Verlegenheit hätte er sein Aussehen mit Anstrengung begründet.
Aufgrund seiner hellen Haut mutierte er bei kleinster Gelegenheit zur Tomate. Das merkte er nun und war angespannt. Doch keiner hänselte ihn.
Stattdessen kamen die Jungen seiner Mannschaft herangestürmt, klopften ihm auf die Schulter und umarmten ihn. „Ausgleich. Endlich!“
„Gab´, give me five!“ Tim streckte ihm die Hand hin und Gabor schlug ein. Es klatschte laut.
„Aber beim nächsten Mal gibst du ab, okay?“
„Geht klar“, versprach Gabor.
Sie trotteten in ihre Hälfte des Schulhofs zurück und stellten sich auf, um den Gegenangriff abzuwehren. Das Spiel ging weiter.
Den Ball abgeluchst stürmte Gabor wieder vor.
„Seht euch unseren Gabor Ronaldo an“, kommentierte Natalie sein Dribbling. Gekonnt spielte er den Ball durch seine eigenen Beine an Klaus vorbei.
„Sie werden dich entdecken und für die Nationalmannschaft aufstellen.“ Die Mädchen grölten.
„Blöde Weiber“, schimpfte Tim, als er zu Gabor aufrückte und parallel lief.
„Lass sie! Das sind Kichererbsen.“ Gabor zwinkerte ihm zu. „Achtung, das wird deiner.“ Er schoss hinüber. Im Doppelpass passierten sie das Spielfeld und näherten sich dem Tor. Wie versprochen gab Gabor den Ball ab. Tim holte zum Schuss aus und knallte das Ding direkt in die Arme von Chet. Dieser zog den Bauch ein, krümmte sich und fiel hart auf die Knie.
„Ouh, das tat weh.“ Dem Mädchenchor verging das Kichern, als sie sein Gesicht sahen. Jedoch nur für einen Moment. Dann tuschelten sie wieder.
„Hey“, schrie Gabor Tim an, „habe ich gesagt, du sollst ihn gleich abschießen?“ Entrüstet lief er zu Chet. Dieser saß auf dem Boden und versuchte, die Tränen zu unterdrücken. Zuerst hielt er seine Knie ganz fest. Dann löste er die Hände vorsichtig. Blut kam aus dem Riss seiner Jeans.
„Was wird mein Vater dazu sagen, wenn ich schon wieder eine neue Hose brauche?“
„Das ist nur eine Hose. Die Knie sind schlimmer.
Darf ich mal sehen?“ Gabor fasste ihn an. Chet zuckte zurück. „Sorry. Tut es sehr weh?“
„Geht so.“
„Soll ich deinen Bruder suchen?“
„Bloß nicht. Der wartet irgendwo auf seine Freundin.“
„Freundin? Wer? Erzähl? Kenn ich die?“ Tim war ganz Ohr.
„Ist ganz frisch und wohl noch top secret. Hab´ keine Ahnung.“ Chet winkte ab.
„Kannst du aufstehen?“, fragte Gabor.
„Weiß nicht.“
„Komm, ich helfe dir.“ Gabor griff ihm unter die Arme und wollte ihn hochziehen. Chet stöhnte leise auf, was der Mädchenchor überhörte. Sie waren zu sehr mit ihrem neuen Singsang beschäftigt: „Gabor, unser Sani. Gabor, unser Sani. Gabor, unser …“
„Hört auf zu gackern! Macht euch nützlich und holt Klopapier“, rief Gabor ihnen zu. Irina stupste Natalie an. Diese rannte sofort ins Schulgebäude.
Mit einem Schwung Papierhandtücher kam sie zurück.
„Hier. Ich habe einige nass gemacht. Die hier sind trocken.“ Sie gab Gabor die Tücher. Er schaute sie dankbar an. Als er ihr die nassen abnahm, berührten sich ihre Hände. Nun errötete Natalie.
Gabor überging es und wandte sich Chet zu.
„Tut mir leid. Konnte ja nicht ahnen, dass Tim dich gleich abknallt.“
„Was soll das heißen?“ Tim stand jetzt neben ihnen. „Das wäre ein glatter Durchschuss geworden, wäre er mit dem Ball nach hinten geflogen und nicht so dumm nach vorn´. Mann!
Das hätte uns die Führung gebracht.“
Gabor legte den Kopf schief.
„Guck´ nicht so giftig!“, sagte Tim, „der einzige Vorwurf, den du mir machen kannst, ist der, dass ich nicht fest genug durchgezogen hab´.“
„Dran vorbei gibt es für dich nicht, was?“ Natalie sprach aus, was Gabor und Chet dachten.
Zwischenzeitlich hatte sich Chet die Hosenbeine hochgekrempelt und verarztete seine Knie mit den Tüchern, die sie ihm reichten.
Die Mädchentraube unterm Baum löste sich auf.
„Nataliiiie. Kommst du mit? Oder kann dein heldenhafter Sani nicht ohne seine Assistenzärztin sein? Schwester Nattiiie, Tupfer bitte.“
Mit entschuldigendem Blick verabschiedete sich Natalie, klatschte Tim die restlichen Papiertücher vor die Brust und folgte den Mädchen zum Schultor hinaus. Bevor sie in der kichernden Mädchentraube unterging, blickte sie kurz zurück.
„Weiber.“ Tim sammelte eins der Tücher auf, das zu Boden gefallen war.
Gabor schnaufte. „Sollen wir noch einmal versuchen, dich aufzurichten?“
Der zierliche Chet nickte. In seinen dunkelbraunen Augen standen Tränen.
„Tim, fass mit an!“
Tim gehorchte und sie stellten Chet auf die Beine.
Leicht eingeknickt stand er da.
„Wird es gehen? Schafft ihr es alleine?“
Da beide ihm zunickten, hob Tim die Rucksäcke auf und schulterte diese. Zu den Anderen gewandt sprach er: „Jungs, das war´s für heute.“ Klaus, Micha, Tobi und die Übrigen hoben ihre Hand an die Stirn und verabschiedeten sich im militärischen Gruß. „Bis morgen, Leute“, sagten sie im Chor. Schon waren sie samt Lederball verschwunden.
Ein Schwung Zehntklässler kam um die Ecke und bog in den Schulhof ein. Sie kickten sich einen Kronkorken zu. Dann sahen sie die drei Jungen.
„Was macht ihr denn noch hier? Meine Schwester ist schon längst zu Hause. Bei euch ist nach dem ersten Block der Unterricht ausgefallen. Seid ihr Streber? Oder was?“, fragte Bernd der Bärtige. So nannten sie ihn, seitdem der erste Flaum an seinem Kinn erschienen war.
„Sieh, doch. Zu blöd zum Laufen“, hänselte sein Kollege, „ist der Kleine hingefallen? Hat er Aua gemacht? Ups.“
„Hey, trag es wie ein Mann. Rauch´ dir eine auf den Schreck … und dann geh´ anständig vom Schlachtfeld.“ Der große Dunkelhaarige der Clique sah aus wie ein Schrank. Hinter dem Ohr zog er eine selbstgedrehte Zigarette hervor und wollte sie Chet zustecken. Dieser schüttelte ab und duckte sich hinter Gabor weg. „Was ist, bist du noch zu klein dafür? Ohh.
Jammer-Jammer-schade.“
„Lass ihn in Ruhe. Du siehst doch: Er ist alle Stufen hinuntergerauscht.“
„Das hättet ihr mal sehen sollen!“, ergänzte Tim.
Beide deuteten mit dem Kopf zum Schulgebäude hin.
„Also gib den Stängel her, bevor es jemand mitkriegt. Er raucht ihn später.“ Gabor griff nach der Zigarette und winkte den Zehntklässlern zum Abschied, als wären sie seine dicksten Kumpel.
Seinen beiden Freunden grinste er verschmitzt zu. Schon setzten die drei Fußballspieler ihren Weg fort.
„Danke“, hauchte Chet, als sie außer Hörweite waren.
„Wofür?“ Gabor lächelte.
„Kennst du die Typen?“
„Die wohnen bei ihm, gleich im Nachbarblock.
So dicke ist er mit denen.“ Tim kreuzte, soweit das Tragen der Rucksäcke es zuließ, seine Zeigefinger ineinander. Er zwinkerte Chet zu.
„Aber nur, wenn ich mal nicht kann.“
„Ach, was. Glaub´ ihm nicht.“ Gabor winkte ab.
„Früher haben wir oft zusammen Fußball gespielt. Seit einem halben Jahr haben die nur noch Weiber, Partys und Mist im Kopf. Nicht mein Ding, ehrlich.“
Chet sah zu Gabor auf und drückte sich leicht an seine Schulter. Alle drei staksten die Hauptstraße hinunter. An der Bushaltestelle warf Chet die nassen Papiertücher in den Mülleimer. Beim heutigen Heimweg schafften sie es, jede Fußgängerampel bei Rot zu erreichen und waren dankbar für die Humpelpausen. Nach drei Kreuzungen bemerkten sie, dass die Clique ihnen folgte.
„Bei denen wird sicher auch nur Unterricht ausgefallen sein“, beruhigte Gabor die aufkeimende Nervosität seines verletzten Freundes.
Der Straßenverkehr wurde ruhiger. Es war deutlich zu spüren, dass sie den Randbezirk der Stadt erreichten. An einer T-Kreuzung blieben sie stehen. Die Zehntklässler waren nicht mehr zu sehen.
„So, Jungs. Hier verdrücke ich mich. Kommst du mit, Gab´?“ Da Gabor verneinte, gab Tim ihnen die Rucksäcke und verabschiedete sich. „Dann bemuttere ihn mal schön weiter, unseren kleinen Chet-Champion.“ Er klopfte Chet auf die Schulter und sagte: „Narben machen dich interessanter.
Glaub´mir: Stehen die Weiber voll drauf. Bis morgen, Jungs.“ Dann bog Tim nach links ein.
Die Allee begrenzte den Park. Sie war gesäumt von Platanen und für Autos nur in einer Richtung befahrbar.
Bis die beiden Jungen die Rucksäcke geschultert hatten, blickten sie Tim nach. Dann drehten sie sich um und nahmen die Straße, die nach rechts vom Park wegführte.
Chet hatte sich bei Gabor wieder eingehakt und humpelte vorwärts. „Du musst das nicht machen.“
„Ob ich nun so oder so herum laufe. Ist doch peng. Hab´ Zeit. Keine Schule, keine Hausaufgaben. Das Essen wartet auch noch nicht auf mich.“
„Aber ...“
„Lass gut sein.“
Schweigend gingen sie nebeneinander her.
Gabor musste seine Schritte anpassen. Er war groß, größer als seine Klassenkameraden. Chet reichte ihm gerade einmal bis zur Schulter. Seine Haare dufteten nach Gel.
Irgendwann fanden die beiden einen gemeinsamen Rhythmus, der Chet das Humpeln erleichterte.
Dann durchbrach Gabor das Schweigen.
„Möchtest du jetzt die Zigarette haben?“
Chet schaute sich erschrocken um. Als er niemanden ihnen folgen sah, blickte er fragend zu Gabor auf.
„Naja, ich meine: Ich könnte dir auch …“ Nun blickte sich Gabor um.
Die Häuserreihen standen in diesem Teil der Stadt dichter als auf der Seite, auf der er wohnte.
Mehrstöckige Altbauten säumten die Gehwege.
Zur Straße waren vereinzelt Rabatten bepflanzt worden, die nach Hundekot und Narzissen dufteten. Neben ihnen wuchs ein Strauch, der wohl von den Bewohnern dieses Altbaus eingepflanzt worden war.
„Also … ich kann dir auch …“ Er griff zur Seite.
„… diesen Stängel Weidenkätzchen geben … anstatt der stinkenden Zigarette.“ Unter Mühe pfriemelte er an dem jungen Zweig herum, bis er ihn abreißen konnte.
Währenddessen dachte er an seinen Vater, der Mutter immer Blumen mitbrachte, wenn er das Gefühl hatte, sie trösten zu müssen. Rauchen tat niemand in seiner Familie. Außer Opa. Gabor erinnerte sich an Opas gelbe Finger. Die dunklen Haare auf seinen Unterarmen hatten immer nach Tabak gerochen. Jedes Mal, wenn sie vom Besuch der Großeltern nach Hause kamen, musste seine Mutter die Kleidung sofort in die Waschmaschine stopfen. Seit Opa fort war, war der Kontakt abgerissen. Gabor wusste nicht, ob er noch rauchte oder in der Zwischenzeit schon davon gestorben war.
Als Gabor Chet die Weidenkätzchen hinhielt, schaute ihn ein dunkles Augenpaar an. Die langen Wimpern machten seine Augen in dem zierlichen Gesicht noch größer.
„Ach, war nur ein Scherz.“ Gabor ließ den Zweig fallen und steckte sich stattdessen die Zigarette in den Mund. „Sieht cool aus oder?“
Chet zog den Nasenflügel hoch. Dann zog er Gabor direkt durch den Torbogen in den Innenhof des Hauses Nummer siebzehn hinein.
Frau Rubberneck
Gabor hörte seine Mutter an der Tür rappeln.
Hektisch verfehlte sie das Loch und schimpfte, als der Schlüssel zu Boden fiel.
Der kurze Flur und die Mahagoni-Eingangstür trennten sie voneinander. Gerne hätte er ihr geöffnet und sie in die Arme genommen. Aber ihr Ansturm schlechter Laune half ihm nicht.
Nicht jetzt. Nicht nachdem, was er gerade erlebt hatte.
Er glitt von der Couch, switchte die Wiederholung der Pseudo-Gerichtsshow aus und hastete auf Zehenspitzen in sein Zimmer. Seine Zimmertür berührte er kaum. Sie blieb - wie er sie heute früh hinterlassen hatte - halb geöffnet im Raum stehen und ließ Sonnenlicht über den Teppich in den Korridor fallen. Schnell krabbelte Gabor unter die Bettdecke und verhielt sich mucksmäuschenstill.
Die Wohnungstür schlug ungebremst vor die Garderobe.
„Mist“, fluchte seine Mutter erneut.
„Wo bleibt die Hetzkampagne?“ Gabor wartete.
In seinem Kopf spulte sich die Szene ab, bei der mit übertriebener Körpergestik hassvergiftete Worte aus dem Mund seiner Mutter sprudelten: „Wofür hat man denn einen Mann im Haus?! Hat dein Herr Vater es immer noch nicht für nötig gehalten, den Stopper zu montieren?“
Auf Gabors Angebote, ihr dabei zu helfen, es selbst zu erledigen, hätte sie gekontert: „Nein, nein, mein Schatz. Das soll Daddy machen. Dafür ist er zuständig.“ Abschließend hätte sie ihm über die blonden Locken getätschelt und die Diskussion im Keim erstickt.
Da sie nicht wissen konnte, dass heute der Unterricht ausfiel und Gabor schon längst zu Hause war, blieb das Theater aus.
Stattdessen knallte sie den Schlüssel auf das Sideboard und eilte knisternd mit den Einkaufstüten in die Küche. Ohne auszupacken, kam sie zurück, griff zum Telefon und drückte energisch eine Tastenkombination, die sie aus dem Kopf heraus kannte.
„Hi, Mutter, grüß´ dich. Hast du ein paar Minuten?“
Da sie innehielt, war Gabor klar: Oma hatte Zeit.
Es dauerte eine ganze Weile, bis seine Mutter wieder zu Wort kam: „Was ich dir eigentlich sagen wollte.“ Erneut war sie gezwungen, eine Redepause einzulegen.
„Oma hat bestimmt ihren typischen Einwand:
Nur-noch-das-mein-Kind“, dachte Gabor, drehte den Kopf und stierte an die Wand. „Hat Vorteile“, schmunzelte er und spürte die Wärme der Daunen am Ohr, „Mum wird ruhiger.“
Vielleicht würde er ihr gleich alles erzählen.
Vielleicht.
Dann schreckte er auf.
„Mutter! Jetzt hör´ mir einfach mal zu!“
„Oh, oh. Von wegen ruhiger.“ Gabor drehte sich um und lauschte.
„Gerade eben ist mir Frau Rubberneck über den Weg gelaufen. … Ja, genau: DIE Frau Rubberneck … Sicher! Rein zufällig.“
„So ein Quatsch. Die alte Hexe hat ihr aufgelauert. War klar, dass die sofort petzt.“
Gabor schnaufte. „Warum mussten wir auch ausgerechnet ihr in die Arme laufen?“ Er strich mit den Fingerspitzen über seine Lippen.
„Ja, Mutter, ich weiß, wie Frau Rubberneck tickt.
Aber ab und an bin ich dankbar für ihre Informationen.“
Bevor Oma dazwischen reden konnte, sagte sie schnell: „Sie hat unseren Jungen gesehen … zusammen mit diesem Chet.“
Gabor drückte die Hand fest vor Mund und Nase.
Er atmete stoßweise. Ein kräftiger Atemzug brachte ihm den Geruch ins Gedächtnis zurück.
Von seiner Handinnenfläche aus schnüffelte er über den Handrücken, den Arm entlang bis zur Schulter. Das Duftgemisch von Chets Haargel und Deo überwog. Währenddessen lauschte er der Personenbeschreibung, die seine Mutter seiner Großmutter gab.
Denn, obwohl Oma viele seiner Freunde kannte, konnte sie sich Namen einfach nicht merken.
Mag sein, dass sie nur feststellen wollte, wie die augenblickliche Einstellung zu der jeweiligen Person war, von der Mutter sprach. Wer weiß?
Auf jeden Fall ließ sie sich stets kurze Erklärungen zu ihnen geben, bevor man in der eigentlichen Sache weiterkam.
„Chet, du weißt schon. Dieser zierliche Junge, der Italiener. Der, der immer etwas zurückhaltend ist.
…Nein, das ist nicht gut. … Ich trau ihm nicht.
Stille Wasser sind tief. Wahrscheinlich hat er es faustdick hinter den Ohren … Du kennst ihn nur nicht…Er ist der Mittlere der sechs Kinder.
Meinst du, sie können sich ausreichend kümmern, bei den zwei Nachzüglern und dem Geschäft mit der Eisdiele? Außerdem wohnt er drüben auf der Slumseite. Wer weiß, welchen Einfluss das hat.“
Seine Mutter hatte eine genaue Vorstellung davon, wie das soziale Gefüge im Randbezirk der Stadt aufgeteilt war. Für sie gab es nur reich und arm. Dazwischen gab es nichts. Wohnte man auf der Seite im alten Viertel der Stadt, gehörte man gleich zur niederen Gesellschaft. Sie schimpfte diese Seite die Slums, weil in den Innenhöfen der Altbauten die Mülltonnen freistanden. Ratten kreuzten in den Morgen- und Abendstunden die Gehwege.
Auf der anderen Seite, rund um den Park, lebten die bessergestellten Familien. Sie selbst konnten sich erlauben, im oberen Teil des Tulpenholzrings zu wohnen. Von ihm aus gingen die Straßen mit den Baumnamen ab. All diese Bäume waren vor Jahren im Park angepflanzt worden und wurden gehegt und gepflegt. Zwischen ihnen Fußball zu spielen, war strengstens verboten.
Der Tulpenholzring führte außen um das Gebiet herum. Erst am unteren Ende, an dem mit den hohen Hausnummern, mündete er in die Holzfäller-Straße ein, in der Chet wohnte.
„Mutter, Frau Rubberneck hat, als sie vom Gassigehen kam … Ja, sie hat immer noch die kleine, kläffende Töle.“
Es klingelte.
„Mist, Marie-Aurelia kommt. Jetzt hast du es geschafft. Ich muss Schluss machen. Ruf dich später wieder an.“
„Typisch. Unser Goldstück muss immer dazwischenplatzen.“ Gabor ärgerte sich, dass seine Schwester wieder einmal Mutter für sich einnahm, auch wenn sie es durch die verschlossene Tür nicht ahnen konnte. Sie war eben ein Talent in solchen Dingen. Für ihn wäre es wirklich wichtig gewesen, hätte er der brühwarmen Erzählung weiterlauschen können.
Aber sie hatte es - wie so oft schon - auch jetzt geschafft.
„Hallo Marie-Goldstück, hast du deinen Schlüssel vergessen?“, begrüßte ihre Mutter sie und gab ihr einen Kuss auf die Stirn.
Genau wie Gabor es sich vorstellte, strich sich Marie den Kuss fort und fuhr mit beiden Händen über ihre blonden Locken, die sie dabei drehte und bis zu ihrem Busenansatz glatt strich.
„Sie hat überhaupt keinen Busen und tut immer so weiblich.“ Ihn stieß das Getue ab. Dieses und das, was folgte.
„Mama, danke fürs Aufmachen. Ich habe dir Blumen mitgebracht.“ Sie holte einen Zweig aus ihrer Schultasche.
„Marie-Aurelia, das sind Weidenkätzchen, die stehen unter Naturschutz. Du darfst sie nicht abreißen, Kind.“
„Habe ich nicht. Die lagen schon auf dem Weg.
Ich habe sie lediglich aufgehoben, damit sie etwas zu trinken bekommen.“
„Urg, wie albern! Wo ist die kleine Kröte hergelaufen?! Oha, wenn Mama das wüsste.“
Gabor dachte an den Trumpf, den er damit gegen sie in der Hand hatte. Bei passender Gelegenheit würde er ihn ausspielen. „Wart´s nur ab, Marie.“
„Wie auch immer, Kleines.“ Mutter nahm ihr strahlend den Zweig ab.
„Soll ich dir in der Küche helfen?“
„Jawoll, Goldstück, setz´ noch einen drauf. Du spürst doch ihre Stimmung.“ Gabor wusste, dass sie nun den Kopf schief hielt, mit den Wimpern klimperte und ihre Schmolllippe aufsetzte. Es widerte ihn an, dass sie so berechnend war. Seine Mutter tat genau das, was sie immer tat, wenn es ihr zu viel war, es aber niemandem zeigen wollte.
Sie lächelte.
„Morgen wieder. Ich bin froh, heute allein in der Küche wüten zu können. Ich bin gleich schon fertig.“
Marie hörte gar nicht hin. Sie war längst auf die Couch gehüpft und schaltete den Fernseher ein.
„Die Richtershow läuft“, freute sie sich.
„Schalt das ab!“
„Biiiitte, nur noch die Zusammenfassung“, bettelte Marie.
„Nein.“
„Da haben zwei Jugendliche für Zigaretten einen Kiosk-Mann überfallen und niedergeschlagen“, überschlugen sich ihre Worte, „wissen die denn nicht, dass Rauchen gefährlich ist.“
„Mach es aus!“, schimpfte Mutter aus der Küche, „wieso läuft das eigentlich?“
„Gabor hat geguckt.“
„Die zweite Petze heute“, fluchte Gabor in sein Kissen hinein.
„Gabor hat bis zum Nachmittag Schule.“
„Hat er nicht!“
„Wieso?“
„Ist bei den Achtern ausgefallen. Und außerdem:
Die Couch ist warm, der Ranzen liegt im Sessel und unterm Tisch stehen seine stinkenden Schuhe. Bäh!“
„WAS?“ Jetzt war ihr klar, warum die Tür ungebremst vor die Garderobe geknallt war.
Mutter drehte sich um. Schnell. Zu schnell. Sie haute die Schale, die sie soeben mit den eingekauften Eiern gefüllt hatte, direkt vor die Kante der Kühlschranktür. Mit lautem Krach schlug ihr die offene Tür die Schale aus der Hand. Noch versuchte sie, mit beiden Händen die Eier zu jonglieren. Doch zehn an der Zahl waren zu viel.
Ein markerschütternder Ruf peitschte durch die Wohnung bis ins Kinderzimmer.
„GAAABOR! Gabor-Alexander.“ Sie pausierte und trat unbeholfen durch das Meer gelber Eidotterbojen. „Warum meldest du dich nicht?
Seit wann bist du schon zu Hause?“
Gabor hatte sich den Arm über die Augen gelegt.
Er tat, als schliefe er.
Erst als das Telefon klingelte, wachte er auf.
Marie-Aurelia meldete sich: „Nein, Oma, Mama ist nicht da. Sie musste noch einmal einkaufen.
Eier. Nein, hatte sie nicht vergessen. Wir wollen nämlich Eierpfannkuchen machen. Nein, sie hatte auch nicht zu wenige gekauft. Soll sie dir selber sagen.“
Gabor konnte sich vorstellen, wie seine Schwester auf einem Bein stand. Mit dem anderen ihre Wade ´rauf und ´runter kratzte und verlegen ihre Haare kräuselte. Zu gerne hätte sie über die Situation, die sich ihr geboten hatte, gelacht. Doch das tat sie lieber mit ihren Freundinnen.
„Richtig. Gabor schläft. Soll ich ihn wecken?“ Insgeheim schmunzelte sie. Die Gelegenheit, ihrem Bruder einen Schrecken zu versetzen, musste sie ausnutzen. Bevor sie das tun konnte, hörte Marie das Knistern in der Leitung.
„Oma?!“, fragte Gabor. Schnell hatte er den Hörer in seinem Zimmer abgenommen.
Für den Fall, dass die Telefongespräche mit seinen Freunden abends länger dauerten und zeitgleich bereits die Achtuhr-Nachrichten liefen, hatte sein Vater ihm den Anschluss gelegt. Das war praktisch. Er musste sich zwar aus dem Bett schälen, konnte aber in seinem Zimmer bleiben.
Der einzige Nachteil war, dass das Abnehmen des Hörers ein lautes Knistern verursachte. Das Auflegen war hingegen kaum zu hören.
„Aurelia - leg´ auf!“, ermahnte Gabor seine Schwester.
„Nö!“, trotzte diese, „war zuerst dran.“
„Sofort!“
„Tue es bitte, mein Kind“, schaltete sich Oma dazwischen. „Was ich mit Gabor bespreche, geht nur uns etwas an.“
Marie-Aurelia schwieg. Die anderen beiden spürten, wie sie schmollte.
„Aber bei meinen Geheimnissen …“
Oma unterbrach sie sofort: „… darf er auch nicht zuhören, wenn du es nicht willst. So ist das halt.