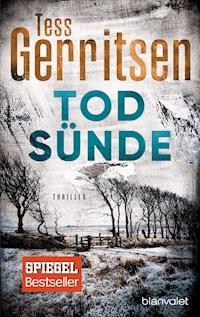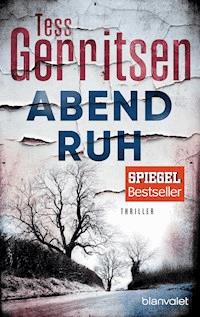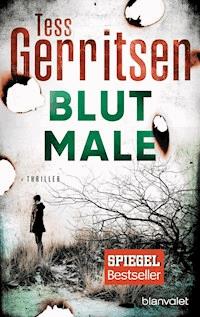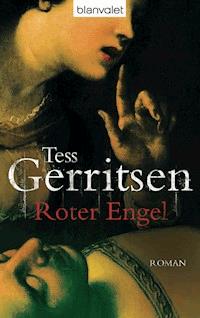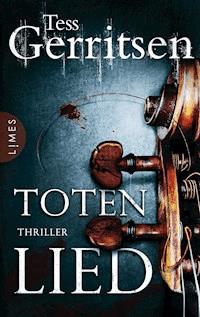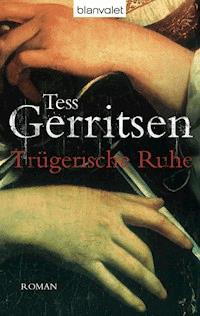9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es sieht nicht gut aus für Miranda Wood: Man hat ihren Ex-Geliebten Richard in ihrem Bett gefunden - erstochen. Aber so schnell, wie sie im Gefängnis sitzt, so schnell ist sie auch wieder auf freiem Fuß. Jemand hat die Kaution für sie gestellt. Bloß wer? Miranda kann nur Vermutungen anstellen. Ist es jemand, der ihr helfen will, oder jemand, der sie benutzt? Zum Glück sucht Miranda nicht als Einzige nach dem wahren Täter. Chase Tremain, Richards Halbbruder, ist ebenfalls auf der Suche nach dem Schuldigen. Kann Miranda wenigstens ihn davon überzeugen, dass sie es nicht gewesen ist? »Tess Gerritsen ist eine der besten in ihrem Metier« USA Today
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
HarperCollins®
Copyright © 2020 für die deutsche Ausgabe by HarperCollins in der HarperCollins Germany GmbH, Hamburg
© 1993 by Tess Gerritsen Originaltitel: »Presumed Guilty« Erschienen bei: Harlequin Enterprises Ltd, Toronto
Covergestaltung: zero-media.net, München Coverabbildung: FinePic®, München E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783959679046
www.harpercollins.de
1. KAPITEL
Er rief um zehn am Abend an, genau wie immer.
Noch bevor Miranda das Gespräch annahm, wusste sie, dass er es war. Sie wusste auch: Wenn sie den Anruf ignorierte, würde das Telefon einfach weiterklingeln und sie langsam, aber sicher in den Wahnsinn treiben. Unruhig ging sie in ihrem Schlafzimmer auf und ab. Ich muss nicht drangehen. Ich muss nicht mit ihm reden. Ich schulde ihm nichts, absolut gar nichts.
Das Klingeln endete. In der plötzlichen Stille hielt sie den Atem an und hoffte, dass er diesmal klein beigeben würde, dass er diesmal endlich begriff, dass sie es ernst meinte, was sie ihm gesagt hatte.
Sie zuckte zusammen, als das Telefon erneut zu klingeln begann. Jeder Ton kratzte wie Sandpapier an ihren zum Zerreißen gespannten Nerven.
Schließlich hielt sie es nicht mehr aus und nahm ab, obwohl sie wusste, dass das ein Fehler war. »Hallo?«
»Du fehlst mir«, sagte er. Sein Flüstern klang wie immer, und darin schwangen die alten Intimitäten, die sie verbanden und die sie genossen hatten.
»Ich möchte nicht, dass du mich anrufst«, sagte sie.
»Ich konnte nicht anders. Schon den ganzen Tag wollte ich dich anrufen. Miranda, es ist die Hölle ohne dich.«
Tränen brannten in ihren Augen. Sie holte Luft, drängte die Tränen zurück.
»Können wir es nicht noch einmal versuchen?«, flehte er.
»Nein, Richard.«
»Bitte. Dieses Mal wird alles anders.«
»Es wird nie anders werden.«
»Doch, das wird es …«
»Es war ein Fehler. Von Anfang an.«
»Du liebst mich immer noch. Ich weiß, dass du mich liebst. Gott, Miranda, all diese Wochen, jeden Tag in deiner Nähe. Und ich darf dich nicht berühren. Darf nicht einmal mit dir allein sein …«
»Du wirst dich nicht länger damit herumquälen müssen, Richard. Du hast mein Kündigungsschreiben erhalten. Es ist ernst gemeint.«
Am anderen Ende der Leitung herrschte lange Schweigen, als hätten ihre Worte ihm einen Schlag in die Magengrube versetzt. Sie fühlte sich euphorisch und zugleich schuldbewusst. Schuldbewusst, sich endlich von ihm befreit zu haben, endlich wieder selbst über ihr Leben bestimmen zu können.
»Ich habe es ihr gesagt«, klang es leise aus dem Hörer.
Miranda reagierte nicht.
»Hast du mich gehört? Ich habe es ihr gesagt. Alles über uns beide. Und ich war bei meinem Anwalt. Ich habe die Bedingungen meines …«
»Richard«, fiel sie ihm ins Wort. »Das ändert alles nichts. Ob du nun verheiratet bist oder geschieden, ich will dich nicht mehr sehen.«
»Nur noch ein Mal.«
»Nein.«
»Ich komme zu dir. Jetzt gleich …«
»Nein.«
»Du musst mich sehen, Miranda!«
»Ich muss überhaupt nichts!«, rief sie.
»In fünfzehn Minuten bin ich bei dir.«
Ungläubig starrte Miranda auf den Telefonhörer in ihrer Hand. Aufgehängt, verdammt, er hatte einfach aufgehängt, und in fünfzehn Minuten würde er an ihre Tür klopfen. Da hatte sie es geschafft, die letzten drei Wochen so tapfer durchzuhalten, Seite an Seite mit ihm zu arbeiten, höflich zu lächeln, sich nichts anmerken, ihrer Stimme nichts anhören zu lassen. Und jetzt war er unterwegs zu ihr, würde ihr die Maske ihrer Selbstbeherrschung vom Gesicht reißen, und schon würde alles wieder von vorn beginnen und sie in derselben Falle enden, aus der sie sich gerade erst mit Mühe und Not befreit hatte.
Sie rannte zu ihrem Kleiderschrank und zerrte ein Sweatshirt heraus. Sie musste fort von hier, irgendwohin, wo er sie nicht finden und sie allein sein konnte.
Hastig floh sie aus der Haustür, die Eingangstreppe hinunter und eilte raschen, entschlossenen Schrittes die Willow Street entlang. Mittlerweile war es halb elf, und draußen war es menschenleer. Durch die Fenster, an denen sie vorbeikam, sah sie Lampenschein, die Silhouetten von Familien, die es sich daheim gemütlich gemacht hatten, ab und zu den flackernden Feuerschein eines offenen Kamins. Wieder einmal spürte sie den alten Neid in sich aufsteigen, die Sehnsucht, ebenfalls solch einem Kreis der Liebe anzugehören, die Glut in ihrem eigenen Kamin zu schüren. Dumme Träume.
Vor Kälte zitternd, verschränkte sie ihre Arme vor der Brust. Die Luft war kühl, nicht ungewöhnlich für August in Maine. Inzwischen war sie wütend, wütend, weil ihr kalt war, wütend, weil sie sich aus ihrem eigenen Zuhause hatte vertreiben lassen. Wütend auf ihn. Aber sie blieb nicht stehen, sondern ging weiter.
An der Bayview Street wandte sie sich nach rechts in Richtung Meeresufer.
Nebel kam auf. Er schluckte das Licht der Sterne und kroch als düsterer Schatten die Straße entlang. Sie eilte hindurch, ließ eine Spur wirbelnder Nebelschwaden hinter sich. Von der Straße bog sie auf einen schmalen Pfad ab, folgte diesem bis zu einer Reihe von Granitstufen, die inzwischen rutschig vor Nässe waren. Unten am Steinstrand stand eine Holzbank, die sie als ihre Bank betrachtete, weil es sie immer wieder hierherzog. Dorthin setzte sie sich, zog die Beine hoch an die Brust und starrte aufs Meer hinaus. Irgendwo draußen in der Bucht ertönte der glockenartige Klang einer Boje. Schwach konnte sie ihr grünes Licht für die Fahrwasserrinne ausmachen, das im Nebel auf und ab tanzte.
Inzwischen musste er an ihrem Haus angelangt sein. Ob er wohl klopfen würde, bis ihr Nachbar, Mr. Lanzo, sich beklagte? Oder ob er aufgeben und einfach wieder nach Hause fahren würde, zurück zu seiner Frau, seinem Sohn und seiner Tochter?
Sie ließ den Kopf auf ihre Knie sinken und versuchte, das Bild der glücklichen kleinen Familie Tremain aus ihren Gedanken zu verscheuchen. Obwohl – als glücklich hatte Richard sie nie dargestellt. Zerrüttet bis zur Belastungsgrenze, so hatte er seine Ehe beschrieben. Nur die Liebe zu Phillip und Cassie, seinen Kindern, hatte ihn davon abgehalten, sich schon vor Jahren von Evelyn scheiden zu lassen. Inzwischen waren die Zwillinge neunzehn und damit alt genug, die Wahrheit über die Ehe ihrer Eltern zu ertragen und zu akzeptieren. Was ihn jetzt von der Scheidung abhielt, war die Sorge um Evelyn, seine Frau. Sie brauchte Zeit, sich damit abzufinden, und wenn Miranda noch ein wenig Geduld bewahrte, wenn sie ihn einfach nur genug liebte, so, wie er sie liebte, dann würde alles sich zum Guten wenden …
Oh ja. Hatte es sich nicht wunderbar zum Guten gewendet?
Miranda lachte leise auf. Sie hob den Kopf, schaute hinaus aufs Wasser und lachte noch einmal. Es war kein hysterisches, kein verbittertes Lachen, sondern ein Lachen der Erleichterung. Ihr war, als wäre sie gerade von einem langen Fieber genesen; als wäre ihr Kopf endlich wieder frei, als könnte sie endlich wieder klar denken. Der feuchte Nebel fühlte sich gut in ihrem Gesicht an, ein kühler Hauch, der ihre Seele zu reinigen schien. Und diese Reinigung hatte sie bitter nötig gehabt! Die Schuldgefühle von Monaten hatten sich wie mehrere Schichten Dreck auf ihr abgelagert, bis sie unter dem ganzen Schmutz kaum noch sich selbst sehen konnte, ihr wahres Ich.
Das war jetzt vorbei. Diesmal war es wirklich vorbei.
Sie lächelte beim Blick auf das Meer. Jetzt gehört meine Seele wieder mir. Sie spürte, wie sie von innerer Ruhe und Gelassenheit erfüllt wurde wie seit Monaten nicht mehr. Innerlich befreit erhob sie sich von ihrer Bank und machte sich auf den Weg nach Hause.
Schon von Weitem entdeckte sie seinen blauen Peugeot, den er an der Kreuzung Willow und Spring Street abgestellt hatte. Er wartete also noch auf sie. Sie blieb neben dem Auto stehen, schaute hinein, musterte die schwarzen lederbezogenen Sitze, die Schaffellauflagen – all das war ihr nur zu vertraut. Der Tatort. Der erste Kuss. Ich habe dafür bezahlt, schmerzlich bezahlt. Jetzt ist er an der Reihe.
Sie wandte sich ab und eilte entschlossen auf ihr Haus zu, stieg hinauf zur Veranda. Die Haustür war unverschlossen, so, wie sie sie hinterlassen hatte. Drinnen brannte noch Licht. Im Wohnzimmer war er nicht.
»Richard?«
Keine Antwort.
Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee lockte sie in die Küche. Die Kaffeekanne stand auf der Warmhalteplatte, ein zur Hälfte gefüllter Becher auf der Arbeitsfläche. Eine der Küchenschubladen war sperrangelweit geöffnet. Sie gab ihr einen heftigen Stoß, sodass sie krachend zufiel. Schau an. Du bist also einfach hereingekommen und hast es dir bequem gemacht, wie? Sie griff nach dem Becher und leerte den Inhalt in die Spüle. Dabei trafen Kaffeespritzer ihre Hand; sie waren nur noch lauwarm.
Durch den Flur ging sie in Richtung Badezimmer. Auch hier brannte Licht, der Wasserhahn tropfte. Sie schloss ihn ganz. »Du hast nicht das Recht, einfach hereinzukommen!«, schrie sie. »Dies ist mein Haus. Ich könnte die Polizei rufen und dich wegen Hausfriedensbruchs verhaften lassen.«
Damit wandte sie sich ihrem Schlafzimmer zu. Noch bevor sie die Tür erreichte, wusste sie, was sie in dem Zimmer erwartete, womit sie würde fertigwerden müssen: Er würde auf dem Bett liegend auf sie warten, nackt, fröhlich grinsend. So hatte er sie beim letzten Mal begrüßt, aber diesmal würde sie ihn hinauswerfen, ob er nun bekleidet war oder nicht. Diesmal erwartete ihn eine Überraschung.
Im Schlafzimmer war es dunkel. Sie schaltete das Licht an.
Er lag lang ausgestreckt auf dem Bett, genau wie erwartet. Die Arme hatte er weit ausgebreitet, die Beine in den Laken verheddert. Und er war nackt. Aber auf seinem Gesicht lag kein Grinsen, sondern erstarrtes Entsetzen. Der Mund war zu einem stummen Schrei geöffnet, die Augen blickten leer und tot in eine Ewigkeit voller Schrecken. Ein Ende der Bettdecke hing blutgetränkt über die Bettkante, und bis auf das leise rhythmische Geräusch der langsam zu Boden tropfenden dunkelroten Flüssigkeit war es völlig still in dem Zimmer.
Miranda tat zwei Schritte in den Raum hinein, bevor ihr übel wurde. Sie fiel auf die Knie, rang keuchend nach Luft und würgte. Erst als sie schließlich den Kopf wieder heben konnte, sah sie das Küchenmesser neben sich auf dem Boden liegen. Sie brauchte kein zweites Mal hinzuschauen. Sie erkannte den Griff, die dreißig Zentimeter lange Stahlklinge und wusste genau, woher das Messer stammte: aus der Küchenschublade.
Es war ihr Messer; ihre Fingerabdrücke würden darauf sein.
Und jetzt war es rot von Blut.
Chase Tremain fuhr die ganze Nacht hindurch bis zum Morgengrauen. Der Rhythmus der Straße unter den Rädern seines Wagens, die Armaturenbeleuchtung, das Autoradio, aus dem irgendwelche Melodien drangen, all das trat zurück, bis es wenig mehr als den verschwommenen Hintergrund eines Traums bildete. Eines äußerst üblen Albtraums. Real war nur das, was er sich während der Fahrt immer wieder sagte, was er wieder und wieder in seinem Kopf wiederholte, während er dem dunklen Highway folgte.
Richard ist tot. Richard ist tot.
Überrascht stellte er fest, dass er die Worte laut aussprach. Der Klang dieser Worte in der Dunkelheit seines Autos riss ihn kurz aus seinem tranceartigen Zustand. Er warf einen Blick auf die Uhr: vier Uhr morgens. Jetzt fuhr er schon seit Stunden, und vor ihm lag die Grenze zwischen New Hampshire und Maine. Wie viele Stunden noch? Wie viele Meilen? Er fragte sich, ob es draußen kalt sein mochte, ob die Luft nach Meer roch. Das Auto war zu einer Zelle geworden, die ihn von allen äußeren Reizen abschirmte, einem in sich geschlossenen Fegefeuer aus glühenden grünen Lichtern und Fahrstuhlmusik. Er schaltete das Radio aus.
Richard ist tot.
Wieder hörte er diese Worte, spielte sie im Geiste erneut ab aus der vagen Erinnerung an jenen Anruf. Evelyn hatte sich nicht die Mühe gemacht, den Schlag abzumildern. Er hatte noch gar nicht ganz begriffen, dass er seine Schwägerin am Telefon hatte, als sie ihm die Neuigkeit um die Ohren schlug. Keine Vorrede, keine Frage, ob er gerade sitze, keine Warnung. Nur die schlichten Tatsachen, übermittelt von Evelyns vertrautem halbem Flüstern. Richard ist tot, hatte sie gesagt. Ermordet. Von einer Frau …
Und dann, gleich im nächsten Atemzug: Ich brauche dich, Chase.
Damit hatte er nicht gerechnet. Chase war der Außenseiter, das Mitglied der Familie Tremain, das normalerweise von niemandem angerufen wurde, derjenige, der seine Sachen gepackt und den Staat, die Familie für immer hinter sich gelassen hatte. Der Bruder mit der peinlichen Vergangenheit. Chase, der Ausgestoßene. Chase, das schwarze Schaf der Familie.
Chase, der Erschöpfte, dachte er und versuchte, die Spinnweben aus Schlaf, in denen er sich zu verfangen drohte, abzuschütteln. Er öffnete das Fenster, sog tief den kalten Luftzug ein, den Duft nach Nadelbäumen und Meer. Den Duft von Maine. Er brachte wie nichts anderes all seine Kindheitserinnerungen zurück. Wie er über die Steine am Strand kletterte, bis zu den Knöcheln im Seetang. Die frisch gesammelten Muscheln, die in seinem Eimer klapperten. Das Nebelhorn, das seine klagenden Rufe durch den Dunst schickte. All das wurde schlagartig wieder in ihm lebendig mit diesem einen Hauch von Seeluft, diesem Parfüm seiner Kindheit, einer schönen Zeit, den Tagen, an denen er noch geglaubt hatte, Richard sei der mutigste, klügste und beste Bruder, den man nur haben konnte. Den Tagen, bevor er Richards wahre Natur durchschaut hatte.
Ermordet. Von einer Frau.
Das wiederum war für Chase keine echte Überraschung.
Er fragte sich, wer sie sein mochte und was in ihr eine solche Wut entfacht haben konnte, dass sie seinem Bruder ein Messer in die Brust rammte. Oh, es fiel ihm nicht schwer, das zu erraten. Eine Affäre, die sich als enttäuschend erwiesen hatte. Eifersucht wegen einer neuen Geliebten. Die unvermeidliche Trennung. Und dann Wut darüber, benutzt und belogen worden zu sein. Eine Wut, die keinen Platz mehr für vernünftige Überlegungen oder Selbstschutz ließ. Chase konnte sich das gesamte Szenario nur zu gut ausmalen. Er konnte sich sogar die Frau vorstellen, eine Frau genau wie all die anderen, die durch Richards Leben getrieben waren. Natürlich würde sie attraktiv sein, aber zugleich etwas Verzweifeltes an sich haben. Vielleicht war ihr Lachen zu laut, ihr Lächeln zu automatisch, vielleicht verrieten die feinen Fältchen um ihre Augen, dass sie eine Frau auf dem absteigenden Ast war. Ja, er konnte die Frau deutlich vor sich sehen, und dieses Bild erregte sowohl sein Mitleid als auch seinen Widerwillen.
Und Zorn. Auch der Groll, den er immer noch gegen Richard hegte, änderte nichts daran, dass sie Brüder waren. Sie teilten gemeinsame Erinnerungen, hatten zusammen so manchen Nachmittag damit vertrödelt, auf dem Meer dahinzutreiben, waren gemeinsam auf der Mole spazieren gegangen, hatten sich im Dunkeln Witze erzählt, sich über andere lustig gemacht und gekichert. Ihr letzter Streit war ein sehr ernster gewesen, aber irgendwie war Chase immer davon ausgegangen, dass sie sich wieder versöhnen würden. Dass sie Zeit hatten, sich auszusprechen und wieder Freunde zu werden.
Das hatte er geglaubt, bis ihn jener Anruf von Evelyn erreichte.
Seine Wut steigerte sich, traf ihn wie die Welle einer Springflut. Gelegenheiten, die nie mehr kommen würden. Keine Chance, ihm noch einmal zu sagen: Du bist mir wichtig. Keine Chance mehr für ein Weißt du noch …? Die Straße verschwamm vor seinen Augen. Er blinzelte, packte das Lenkrad fester.
Und fuhr weiter, hinein in den Morgen.
Um zehn erreichte er Bass Harbor. Um elf war er an Bord der Jenny B, das Gesicht dem Wind zugewandt, die Reling der Fähre fest umklammert. In der Ferne erhob sich Shepherd’s Island wie ein grüner Buckel aus dem Dunst. Der Bug der Jenny B hob und senkte sich mit den Wellen, und Chase spürte, wie ihn die vertraute Übelkeit packte und Magensäure nach oben drängte. Immer noch derjenige, der seekrank wird, schoss es ihm durch den Kopf. In einer Familie passionierter Segler war Chase die Landratte, der Sohn, der lieber festen Boden unter den Füßen hatte. Die Siegespokale für die Segelregatten waren alle an Richard gegangen. Ob Optimist, Schaluppe oder welcher Bootstyp auch immer, Richard konnte den passenden Pokal präsentieren. Und hier lag das Gewässer vor ihm, auf dem er sich seine Fertigkeiten angeeignet hatte, mit dem Wind gleitend, gegen den Wind kreuzend, Kommandos rufend. Spinnaker hoch, Spinnaker runter. Chase hatte all das immer nur als Hektik ohne Sinn und Verstand gesehen. Und dann war da noch diese elende Übelkeit …
Tief sog er die salzige Meeresluft ein und spürte, wie sich sein Magen wieder beruhigte, als die Jenny B anlegte. Er ging zurück zu seinem Wagen und wartete geduldig, bis er die Fähre verlassen konnte. Vor ihm waren acht Autos dran, allesamt mit Nummernschildern aus anderen US-Staaten. Halb Massachusetts schien jeden Sommer hierher in den Norden zu kommen. Man konnte Maine beinahe stöhnen hören unter dem Gewicht all dieser verdammten Autos.
Er wurde vorwärts gewunken. Chase legte den Gang ein und fuhr die Rampe hinauf auf die Insel.
Verwundert nahm er zur Kenntnis, wie wenig der Ort sich im Laufe der Jahre verändert zu haben schien. Dieselben alten Gebäude säumten die Sea Street: die Inselbäckerei, die Bank, FitzGerald’s Café, das Billigwarenhaus, Lappin’s Gemischtwarenhandel. Ein paar neue Namen zierten alte Geschäfte. Aus dem Vogue Beauty Shop war Gorham’s Books geworden, der Baumarkt beherbergte jetzt ein Antiquitäten- und Landhausmöbelgeschäft sowie ein Maklerbüro. Großer Gott, was für Veränderungen die Touristen doch mit sich brachten.
Er bog in die Limerock Street ein. Auf der linken Seite, immer noch im alten Backsteingebäude, residierte der Island Herald. Ob sich im Inneren des Gebäudes wohl irgendetwas verändert hatte? Er erinnerte sich noch gut an die Blechverkleidung der Decken, die abgewetzten Schreibtische, die Wand, an der die Porträts der Herausgeber hingen, allesamt Tremains. All das stand ihm vor Augen, bis hin zur Remington-Schreibmaschine auf dem alten Schreibtisch seines Vaters. Natürlich gab es längst keine Schreibmaschinen mehr. Inzwischen standen überall Computer, gefällig in der Form und sehr unpersönlich. So jedenfalls würde Richard den Zeitungsverlag leiten: Raus mit dem Alten, rein mit dem Neuen.
Und jetzt würde der nächste Tremain übernehmen.
Chase fuhr weiter und bog in die Straße Chestnut Hill ein. Eine halbe Meile weiter oben, ziemlich nah am höchsten Punkt der Insel, stand das Anwesen der Tremains. Ihn hatte es immer an eine monströse gelbe Hochzeitstorte erinnert mit seinen viktorianischen Türmchen und den Holzverzierungen im Zuckerbäckerstil. Das Haus jedoch war inzwischen in vornehmem Grau und Weiß gestrichen worden. Es wirkte jetzt zurückhaltender, dezenter, eine verblasste Schönheit. Chase hatte das alte Hochzeitstortengelb beinahe besser gefallen.
Er stellte den Wagen ab, holte seinen Koffer aus dem Kofferraum und ging die Einfahrt hinauf. Noch bevor er die Verandatreppe erreichte, wurde die Haustür geöffnet, und dort stand Evelyn, die auf ihn gewartet hatte.
»Chase!«, rief sie. »Oh, Chase, du bist gekommen. Gott sei Dank, bist du hier.«
Und damit fiel sie ihm in die Arme. Automatisch drückte er sie an sich, spürte, wie ihr Körper bebte, fühlte ihren Atem an seinem Hals. Er ließ zu, dass sie sich an ihn klammerte, solange sie das brauchte.
Schließlich löste sie sich von ihm und schaute zu ihm hoch. Ihre leuchtendgrünen Augen waren immer noch so faszinierend wie früher. Ihre Haare, schulterlang und honigblond, hatte sie zu einem französischen Zopf geflochten. Ihr Gesicht war verquollen, die Nase rot und verkniffen. Sie hatte versucht, das mit Make-up zu verbergen. Irgendein rosa Puder klebte an einem ihrer Nasenlöcher, und die Wimperntusche hatte einen schmutzigen Schatten auf ihrer Wange hinterlassen. Chase konnte kaum glauben, wirklich seine schöne Schwägerin vor sich zu haben. War es möglich, dass sie ehrlich trauerte?
»Ich wusste, du würdest kommen«, flüsterte sie.
»Sofort nach deinem Anruf habe ich mich auf den Weg gemacht.«
»Danke, Chase. Ich wusste nicht, an wen ich mich sonst wenden sollte …« Sie trat einen Schritt zurück und schaute ihn an. »Du Ärmster, du musst völlig erschöpft sein. Komm rein, ich mache dir einen Kaffee.«
Zusammen betraten sie die Eingangshalle. Ihm war, als wäre er zurück in seine Kindheit versetzt worden – so wenig hatte sich geändert. Dieselben Eichenböden, dieselbe Beleuchtung, dieselben Gerüche. Beinahe konnte er sich vorstellen, sich umzudrehen, durch den Flur ins Wohnzimmer zu schauen und dort seine Mutter an ihrem Schreibtisch zu sehen, wie sie eifrig schrieb. Sie hatte sich nie für eine Schreibmaschine erwärmen können. Mit Recht war sie der Meinung, dass eine Klatschkolumne nur interessant genug sein musste, um von einem Redakteur auch in Suaheli akzeptiert zu werden. Wie sich herausstellte, hatte der Redakteur sich nicht nur für ihre Kolumne entschieden, sondern auch für sie selbst. Alles in allem eine praktische Ehe.
Seine Mutter hatte nie gelernt, auf der Maschine zu schreiben.
»Hallo, Onkel Chase.«
Chase blickte auf. Oben an der Treppe standen ein junger Mann und eine junge Frau. Das konnten doch nicht die Zwillinge sein! Erstaunt beobachtete er, wie die beiden die Treppe herunterkamen, Phillip vorneweg. Als Chase seine Nichte und seinen Neffen das letzte Mal gesehen hatte, waren sie beide schlaksige Teenager gewesen, die noch nicht ganz in ihre großen Füße hineingewachsen waren. Beide waren groß, blond und schlank, aber das war es auch schon mit der Ähnlichkeit. Phillip bewegte sich mit der anmutigen Sicherheit eines Tänzers, ein eleganter Fred Astaire mit einer Partnerin, die – nun ja, ganz sicher nicht Ginger Rogers war. Die junge Frau, die ihm auf der Treppe nach unten folgte, ähnelte eher einem Pferd.
»Ich kann nicht glauben, dass das Cassie und Phillip sind«, sagte Chase.
»Du warst zu lange fort«, erwiderte Evelyn.
Phillip trat vor und schüttelte Chase die Hand. Das war die Begrüßung durch einen Fremden, nicht einen Neffen. Seine Hand war schlank, zartgliedrig, die Hand eines Gentlemans. Er hatte den aristokratischen Touch seiner Mutter geerbt, die gerade Nase, die fein gemeißelten Wangenknochen, die grünen Augen. »Onkel Chase«, sagte er betrübt. »Ein schrecklicher Anlass, nach Hause zu kommen, aber ich bin froh, dass du hier bist.«
Chase wandte seinen Blick Cassie zu. Als er seine Nichte das letzte Mal gesehen hatte, war sie ein lebhafter kleiner Affe mit unendlich vielen Fragen gewesen. Er konnte kaum glauben, dass sie zu dieser mürrischen jungen Frau herangewachsen war. Konnte die Trauer dafür verantwortlich sein? Ihre schlaffen Haare hatte sie so straff zurückgebunden, dass ihr Gesicht äußerst kantig wirkte: große Nase, kaninchenartiger Überbiss, breite, hohe Stirn, in die sich kein Haarsträhnchen verirrte und die Konturen weicher scheinen ließ. Nur an ihren Augen konnte man noch die Zehnjährige erkennen, die sie weit hinter sich gelassen hatte: Ihr Blick war direkt, scharf und intelligent.
»Hallo, Onkel Chase«, sagte auch sie in einem erschreckend geschäftsmäßigen Ton für ein Mädchen, das gerade seinen Vater verloren hatte.
»Cassie, willst du deinem Onkel nicht einen Kuss geben? Er hat den weiten Weg auf sich genommen, um uns zur Seite zu stehen«, sagte Evelyn.
Cassie trat vor, bedachte Chase mit einem steifen Wangenkuss und trat schnell wieder zurück, als wäre ihr diese vorgetäuschte Zurschaustellung von Zuneigung peinlich.
»Du bist richtig erwachsen geworden«, meinte Chase, und das war das Netteste, was ihm einfiel.
»Ja, so geht das.«
»Wie alt bist du jetzt?«
»Fast zwanzig.«
»Dann müsst ihr beide inzwischen das College besuchen.«
Cassie nickte, und ihre Lippen verzogen sich zu einem schwachen Lächeln. »Ich studiere an der Universität von Süd-Maine. Journalismus. So wie ich das sehe, wird der Herald schon bald einen neuen …«
»Phillip studiert in Harvard«, fiel Evelyn ihr ins Wort. »Genau wie sein Vater.«
Cassies Lächeln erstarb, bevor es sich ganz entfaltet hatte. Sie warf ihrer Mutter einen verärgerten Blick zu, drehte sich um und ging die Treppe hinauf.
»Cassie, wohin gehst du?«
»Ich muss mich um meine Wäsche kümmern.«
»Aber dein Onkel ist gerade erst angekommen. Komm her und setz dich zu uns.«
»Warum, Mutter?«, fauchte Cassie über ihre Schulter nach hinten. »Du kannst dich bestens allein um ihn kümmern.«
»Cassie!«
Jetzt wandte sich das Mädchen um und funkelte Evelyn zornig an. »Was?«
»Du blamierst mich.«
»Nun, das ist ja nichts Neues.«
Evelyn, inzwischen den Tränen nahe, wandte sich an Chase. »Siehst du, wie es hier läuft? Ich kann mich nicht mal auf meine eigenen Kinder verlassen. Chase, ich komme nicht allein mit all dem zurecht. Ich kann es einfach nicht.« Mühsam ein Schluchzen unterdrückend, wandte sie sich ab und ging hinüber ins Wohnzimmer.
Die Zwillinge schauten einander an.
»Jetzt hast du es schon wieder getan«, sagte Phillip. »Das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt zum Streiten, Cassie. Kannst du denn kein Mitgefühl mit ihr haben? Kannst du nicht wenigstens versuchen, mit ihr auszukommen? Nur die nächsten paar Tage.«
»Ist ja nicht so, dass ich es nicht versuche, aber sie treibt mich zum Wahnsinn.«
»Na schön, dann sei doch wenigstens höflich.« Er schwieg einen Moment. »Du weißt, dass Dad sich das wünschen würde.«
Cassie seufzte. Dann kam sie schicksalsergeben wieder die Treppe herunter und folgte ihrer Mutter ins Wohnzimmer. »Ich schätze, wenigstens das bin ich ihm schuldig …«
Kopfschüttelnd schaute Phillip seinen Onkel an. »Und wieder eine nette Episode aus dem Leben der reizenden Familie Tremain.«
»Läuft das schon länger so?«
»Schon ein paar Jahre. Du siehst gerade die schlimmsten Auswüchse. Man sollte meinen, dass wir uns nach gestern Nacht, nach Dads Tod, enger zusammenschließen würden. Stattdessen fliegt erst recht alles auseinander.«
Gemeinsam gingen sie ins Wohnzimmer, wo Mutter und Tochter so weit wie nur möglich voneinander entfernt Platz genommen hatten. Beide hatten sich wieder gefangen. Phillip setzte sich zwischen sie und untermauerte damit seine Rolle als permanenter menschlicher Stoßdämpfer. Chase entschied sich für einen Sessel in einer Ecke – der entsprach seiner Vorstellung von neutralem Boden am ehesten.
Durch die Erkerfenster fiel Sonnenlicht auf den glänzend polierten Holzboden. Das Schweigen im Raum wurde vom Ticken der Uhr auf dem Kaminsims noch unterstrichen. Alles sieht ganz genauso aus wie früher, dachte Chase. Dieselben Hepplewhite-Tische, dieselben Queen-Anne-Stühle. Genau so war ihm alles aus seiner Kindheit im Gedächtnis. Evelyn hatte nicht die kleinste Kleinigkeit verändert, und dafür war er ihr dankbar.
Chase wagte einen Vorstoß in das gefährliche Schweigen hinein. »Ich bin am Zeitungsgebäude vorbeigefahren, als ich durch die Stadt kam«, sagte er. »Es hat sich kein bisschen verändert.«
»Genauso wenig wie die Stadt«, meinte Phillip.
»Alles noch so aufregend wie immer«, warf seine Schwester trocken ein.
»Wie soll es mit dem Herald weitergehen?«, fragte Chase.
»Phillip wird die Leitung übernehmen«, erklärte Evelyn. »Das wird sowieso Zeit. Ich brauche ihn zu Hause, jetzt wo Richard …« Sie schluckte, schaute zu Boden. »Er ist so weit, dass er den Job übernehmen kann.«
»Da bin ich mir nicht sicher, Mom«, widersprach Phillip. »Ich bin erst in meinem zweiten Jahr auf dem College. Außerdem gibt es andere Dinge, die ich gern …«
»Dein Vater war zwanzig, als Grandpa Tremain ihn zum Redakteur ernannte. Stimmt doch, Chase?«
Chase nickte.
»Also gibt es keinen Grund, warum du nicht die Leitung übernehmen könntest.«
Phillip zuckte die Achseln. »Jill Vickery macht ihre Sache doch ausgezeichnet.«
»Sie ist nur eine Angestellte, Phillip. Der Herald braucht einen richtigen Kapitän.«
Cassie beugte sich vor, Schärfe im Blick. »Es gibt noch andere, die das übernehmen könnten«, erklärte sie. »Warum muss es Phil sein?«
»Dein Vater wollte es so. Und Richard wusste immer, was am besten für den Herald war.«
Schweigen folgte, unterstrichen vom stetigen Ticken der Uhr auf dem Kaminsims.
Evelyn atmete zitternd aus und ließ den Kopf in ihre Hände sinken. »Oh Gott, das wirkt alles so kaltblütig. Ich fasse es nicht, dass wir über so etwas reden. Darüber, wer seinen Platz einnehmen wird …«
»Früher oder später«, erwiderte Cassie, »müssen wir darüber reden. Über viele Dinge.«
Evelyn nickte und wandte den Blick ab.
Irgendwo in einem anderen Zimmer klingelte das Telefon.
»Ich gehe ran«, sagte Phillip und verließ das Wohnzimmer.
»Ich kann einfach nicht nachdenken«, klagte Evelyn und drückte ihre Hände an ihren Kopf. »Wenn ich es doch schaffen könnte, dass mein Kopf wieder arbeitet …«
»Es ist erst gestern Abend passiert«, meinte Chase sanft. »Den Schock zu überwinden kostet Zeit.«
»Und dann ist da noch die Beerdigung zu regeln. Sie sagen mir nicht einmal, wann sie den … Leichnam freigeben.« Sie verzog schmerzlich das Gesicht. »Ich begreife nicht, warum das alles so lange dauert. Warum der Gerichtsmediziner alles Mögliche untersuchen muss. Ich meine, können Sie denn nicht sehen, was passiert ist? Ist es nicht offensichtlich?«
»Das Offensichtliche ist nicht immer die Wahrheit«, erklärte Cassie.
Evelyn schaute ihre Tochter an. »Was soll das denn heißen?«
Phillip kam zurück ins Zimmer. »Mom? Das war Lorne Tibbetts.«
»Oh Gott.« Unsicher stand Evelyn auf. »Ich komme.«
»Er möchte dich persönlich sehen.«
Sie runzelte die Stirn. »Jetzt sofort? Hat das nicht noch Zeit?«
»Du kannst es ebenso gut einfach hinter dich bringen, Mom. Früher oder später muss er mit dir reden.«
Evelyn drehte sich um und schaute Chase an. »Ich schaffe das nicht allein. Begleitest du mich bitte?«
Chase hatte nicht die leiseste Idee, wohin es gehen sollte oder wer Lorne Tibbetts war. Im Moment wünschte er sich nichts sehnlicher als eine heiße Dusche und ein Bett, auf das er sich fallen lassen konnte. Aber das musste wohl warten bis später.
»Natürlich, Evelyn«, sagte er, stand zögernd auf und schüttelte die Beine aus, um die Steifigkeit loszuwerden, die noch von der langen Fahrt von Greenwich hierher in ihnen steckte.
Evelyn griff bereits nach ihrer Handtasche. Sie holte den Autoschlüssel hervor und hielt ihn Chase hin. »Ich … ich bin zu nervös, um zu fahren. Würdest du bitte?«
Er nahm den Schlüssel entgegen. »Wohin fahren wir?«
Mit zitternden Händen setzte Evelyn ihre Sonnenbrille auf und ließ ihre geröteten, geschwollenen Augen hinter dunklen Gläsern verschwinden. »Zur Polizei«, antwortete sie.
2. KAPITEL
Die Polizeiwache von Shepherd’s Island war in einem ehemaligen Gemischtwarenladen untergebracht, den man umgebaut und im Laufe der Jahre in immer kleinere Räume und Büros unterteilt hatte. Chase hatte das Gebäude als wesentlich eindrucksvoller in Erinnerung, aber es lag auch schon Jahre zurück, dass er es zum letzten Mal betreten hatte. Damals war er noch ein Junge gewesen, ein wilder und ungestümer noch dazu, ein frecher Bengel, für den eine Polizeiwache ganz klar eine Bedrohung darstellte. An jenem Tag, an dem man ihn hierhergeschafft hatte, weil er Mrs. Gordimers Rosenbeet zertrampelt hatte – natürlich ohne jede Absicht –, hatten die Decken höher und die Räume größer gewirkt, und hinter jeder Tür schien ungeahnter Schrecken zu lauern.
Jetzt hingegen sah er die Polizeiwache als das, was sie war: ein heruntergekommenes altes Gebäude, das dringend einen neuen Anstrich brauchte.
Lorne Tibbetts, der neue Polizeichef, passte hervorragend in dieses enge Labyrinth. Falls für die Polizeiarbeit eine Mindestgröße vorgeschrieben war, hatte er es irgendwie geschafft, sie zu umgehen. Er hatte die Statur eines Zwerges, den man in eine adrette khakifarbene Sommeruniform samt optisch größer machender Uniformmütze gesteckt hatte, die vermutlich eine beginnende Glatze verstecken sollte. Auf Chase wirkte er wie ein kleiner Napoleon in Gala-Uniform.
Was ihm an Körpergröße abging, machte Chief Tibbetts durch seine gesellschaftlichen Umgangsformen mehr als wett. Er schlängelte sich zwischen den Schreibtischen und Aktenschränken hindurch, um Evelyn mit der übertriebenen Beflissenheit zu begrüßen, die einer Frau ihres sozialen Standes in dieser Stadt zukam.
»Evelyn! Es tut mir so leid, dass ich Sie bitten musste, zu kommen.« Er legte ihr eine Hand auf den Arm und drückte ihn. Was Trost und Ermunterung spenden sollte, ließ Evelyn zurückschrecken. »Und es war eine grässliche Nacht für Sie, nicht wahr? Wirklich eine grässliche Nacht.«
Evelyn zuckte die Achseln, einerseits, um seine Frage zu beantworten, andererseits aber auch, um sich aus seinem Griff zu befreien.
»Ich weiß, wie schwer es ist, mit dieser Sache fertigzuwerden. Und ich wollte Sie nicht damit belästigen, nicht heute. Aber Sie wissen ja, wie das ist. All diese Berichte, die geschrieben werden müssen.« Er warf Chase einen täuschend flüchtigen Blick zu. Der kleine Napoleon, so stellte Chase fest, hatte scharfe Augen, die alles sahen.
»Das ist Chase«, erläuterte Evelyn und fuhr mit der Hand über ihren Blusenärmel, als wollte sie Chief Tibbetts Pfotenabdruck fortwischen. »Richards Bruder. Er ist heute Morgen aus Connecticut gekommen.«
»Oh, ja.« Tibbetts’ Blick zeigte, dass er den Namen sofort erkannte und richtig einordnen konnte. »Ich habe ein Bild von Ihnen in der Sporthalle der Highschool hängen sehen.« Er reichte ihm die Hand. Sein Händedruck war mehr als kräftig, der Händedruck eines Mannes, der seine geringe Körpergröße auszugleichen versuchte. »Sie wissen schon, das Bild von Ihnen im Trikot der Basketballmannschaft.«
Chase blinzelte überrascht. »Das hängt immer noch da?«
»Da hängen die Spielerlegenden des Ortes. Warten Sie mal, Sie waren in der Klasse von 71, Point Guard, Schulauswahlmannschaft. Richtig?«
»Es überrascht mich, dass Sie das alles wissen.«
»Ich war selbst Basketballspieler. Madison High School, Wisconsin. Rekordhalter drei Mal nacheinander. Und ich habe jede Menge Körbe erzielt.«
Ja, Chase stand es klar vor Augen: Lorne Tibbetts, der randalierende Zwerg auf dem Basketball-Spielfeld. Das passte zu dem schmerzhaften Händedruck.
Die Tür zur Wache wurde plötzlich aufgerissen. »Hey, Lorne?«, rief eine Frau.
Tibbetts drehte sich um und wandte sich erschöpft der Besucherin zu, die wirkte, als hätte der Wind sie von der Straße hereingeweht. »Du schon wieder, Annie?«
»Du wirst mich nicht los.« Die Frau wechselte ihre abgewetzte Schultertasche auf die andere Schulter. »Wann bekomme ich denn nun endlich eine Stellungnahme von dir?«
»Wenn ich eine abzugeben habe. Jetzt verschwinde.«
Die Frau wandte sich unbeeindruckt an Evelyn. Die beiden hätten gut in eine Vorher-Nachher-Story in einem Modemagazin gepasst. Annie mit ihrer schlampigen Frisur, bekleidet mit einem schlecht sitzenden Sweatshirt und Jeans, hätte für Vorher gestanden. »Mrs. Tremain?«, fragte sie höflich. »Ich weiß, es ist ein ungünstiger Moment, aber mir sitzt der Redaktionsschluss im Nacken, und ich brauche nur ein kurzes Zitat …«
»Um Himmels willen, Annie!«, fuhr Tibbetts dazwischen und drehte sich zu dem Polizisten um, der am Empfangstisch saß. »Ellis, schaff sie hier raus!«
Ellis war blitzschnell auf den Beinen. »Komm schon, Annie. Setzt dich in Bewegung, es sei denn, du willst deine Story in einer Arrestzelle schreiben.«
»Ich gehe ja schon.« Annie riss die Tür auf und verschwand murrend nach draußen: »Meine Güte, hier lässt man mich einfach nicht meinen Job machen …«
Evelyn schaute Chase an. »Das war Annie Berenger, eine von Richards Starreporterinnen. Im Moment die reinste Landplage.«
»Ich kann’s ihr nicht verübeln«, meinte Tibbetts. »Genau dafür wird sie schließlich von Ihnen bezahlt, nicht wahr?« Er nahm Evelyn beim Arm. »Kommen Sie, fangen wir an. Ich bringe Sie in mein Büro, den einzigen Raum in diesem Tollhaus, in dem man nicht auf dem Präsentierteller sitzt.«
Lornes Büro befand sich am Ende des Ganges; es war das letzte in einer Reihe von Räumen, allesamt nicht größer als ein Wandschrank. Ein Schreibtisch, zwei Stühle, ein Bücherschrank und Aktenschränke belegten darin fast jeden Quadratzentimeter. Ein Farn welkte unbeachtet in einer Ecke vor sich hin. Trotz der Enge sah alles ordentlich und aufgeräumt aus, auf den Regalen lag kein Staub, der Papierkram war fein säuberlich gestapelt im Ausgangskorb abgelegt. An der Wand hing unübersehbar eine Tafel mit der Aufschrift: Die kleinsten Hunde sind die bissigsten.
Tibbetts und Evelyn nahmen auf den beiden Stühlen Platz. Ein dritter Stuhl wurde für die Sekretärin hereingebracht, die das Protokoll führte. Chase blieb stehen. Es fühlte sich gut an zu stehen, die verkrampfte Beinmuskulatur zu strecken.
Zumindest fühlte es sich etwa zehn Minuten lang gut an. Dann spürte er, wie er in sich zusammenzusinken drohte, und konnte kaum noch dem folgen, was gesagt wurde. Er fühlte sich wie der bedauernswerte Farn in der Ecke.
Tibbetts stellte Fragen, Evelyn antwortete – wie immer beinahe flüsternd mit geradezu einschläfernder Stimme. Sie beschrieb detailliert, was am Abend zuvor geschehen war. Ein typischer Abend, sagte sie. Abendessen um sechs mit der ganzen Familie. Lammkeule und Spargel, Zitronensoufflé zum Dessert. Richard trank ein Glas Wein – wie immer. Die Unterhaltung drehte sich um das Übliche, den jüngsten Klatsch aus dem Zeitungsverlag, sinkende Auflage, steigende Druckkosten, Sorgen über eine möglicherweise drohende Verleumdungsklage, Tony Graffams Ärger über jenen jüngsten Artikel. Dann wurde über Phillips Examen gesprochen, über Cassies Noten, über den dieses Jahr besonders schön blühenden Flieder und die Auffahrt, die neu gepflastert werden musste. Eine Unterhaltung, wie sie für ein gemeinsames Abendessen typisch war.
Um neun hatte Richard das Haus verlassen, um irgendwelche Arbeiten im Büro zu erledigen – das hatte er jedenfalls gesagt. Und Evelyn?
»Ich ging nach oben und zu Bett«, sagte sie.
»Was taten Cassie und Phillip?«
»Sie sind ausgegangen. Ins Kino, glaube ich.«
»Es ging also jeder seiner Wege.«
»Ja.« Evelyn ließ den Blick auf ihren Schoß sinken. »Und das war auch schon alles. Bis halb eins, als der Anruf kam …«
»Kehren wir noch einmal zu der Unterhaltung beim Abendessen zurück.«
Und alles wurde noch einmal durchgekaut. Hier und da wurden noch ein paar Details ergänzt, aber im Wesentlichen blieb alles gleich. Chase, dessen letzte Aufmerksamkeitsreserven rasch schwanden, begann in eine Art Dämmerzustand abzugleiten. Inzwischen wurden seine Beine bereits taub und holten sich den Schlaf, dem sein Gehirn sich nur zu gern ebenfalls überlassen hätte. Der Fußboden wirkte von Minute zu Minute einladender – immerhin konnte man dort liegen. Chase spürte, wie er an der Wand herunterzurutschen drohte …
Dann zuckte er, plötzlich wieder wach, zusammen. Alle schauten ihn an.
»Alles in Ordnung mit dir, Chase?«, fragte Evelyn.
»Tut mir leid«, murmelte er. »Ich schätze, ich bin einfach müder, als ich dachte.« Er schüttelte kurz den Kopf, um munter zu werden. »Könnte ich vielleicht, ähm, irgendwo einen Kaffee bekommen?«
»Den Flur entlang«, sagte Tibbetts. »In der Maschine steht eine volle Kanne, und da finden Sie auch eine Couch, wenn Sie eine brauchen. Warum warten Sie nicht einfach dort?«
»Geh nur«, meinte Evelyn. »Ich bin hier bald fertig.«
Erleichtert flüchtete Chase aus dem Büro und machte sich den Flur entlang auf die Suche nach der rettenden Kaffeekanne. Hinter der ersten Tür entdeckte er eine Toilette. Die nächste Tür war abgeschlossen. Er ging weiter und warf einen Blick in den dritten Raum. Hier brannte kein Licht, und im Dunkeln entdeckte er eine Couch, ein paar Stühle und weiteres Mobiliar in einer Ecke. In der seitlichen Wand befand sich ein Fenster, und dieses Fenster erregte seine Aufmerksamkeit, weil es nicht wie ein normales Fenster nach draußen ging; stattdessen gewährte es Einblick in einen angrenzenden Raum. Durch die Scheibe sah er eine Frau, die allein an einem kleinen Tisch saß.
Sie bemerkte ihn nicht. Sie hielt den Blick auf die Tischplatte vor sich gesenkt. Irgendetwas zog ihn magisch an, etwas an ihrem völligen Schweigen, an ihrer Reglosigkeit. Er fühlte sich wie ein Jäger, der im Wald unerwartet auf ein ahnungsloses Reh stößt.
Leise schlüpfte Chase in das dunkle Zimmer und zog die Tür hinter sich zu. Er trat ans Fenster. Ein Einwegspiegel – das war es natürlich. Er stand auf der Beobachterseite, sie befand sich auf der Spiegelseite, durch die sie nicht hindurchsehen konnte. Sie hatte keine Ahnung, dass er hier stand, nur durch gut einen Zentimeter Glas von ihr getrennt. Irgendwie fand er es verachtenswert, hier zu stehen und sie heimlich zu beobachten, aber er konnte nicht anders. Es war zu verlockend, unsichtbar zu sein, die Fliege an der Wand, der unbemerkte Beobachter.
Und die Frau erregte sein Interesse.
Sie war nicht besonders hübsch, und weder ihre Kleidung noch ihre Frisur unterstrichen ihre Vorzüge. Sie trug ausgebleichte Bluejeans und ein T-Shirt mit dem Logo der Boston Red Sox, das ihr ein paar Nummern zu groß war. Die kastanienbraunen Haare hatte sie zu einem unordentlichen Zopf zusammengeflochten. Ein paar Strähnen, die sich gelöst hatten, hingen ihr widerspenstig in die Schläfen. Geschminkt war sie kaum oder gar nicht, aber ihr Gesicht brauchte auch kein Make-up. Es war ein Gesicht, wie man es üblicherweise in Katalogen für rustikale, ländliche Mode sah – bei Models, die beim Laubharken oder beim Liebkosen von Lämmern fotografiert wurden. Gesund und strahlend, mit einer leichten Andeutung von Sonnenbrand. Ihre Augen waren hell, grau oder blau, und passten nicht ganz zum Rest des Bildes. Er konnte sehen, dass ihre Lider geschwollen und gerötet waren; offenbar hatte sie geweint. Ja, sogar jetzt wischte sie sich mit der Hand eine Träne von der Wange. Suchend schaute sie sich um. Dann zerrte sie frustriert am Saum ihres T-Shirts und wischte sich damit das Gesicht ab. Die Geste wirkte hilflos, wie etwas, was ein Kind tun würde, und die Frau wirkte dadurch noch verletzlicher. Er fragte sich, warum sie ganz allein in jenem Zimmer saß und dabei wirkte wie eine verstoßene Seele. War sie eine Zeugin? Ein Opfer?
Sie blickte auf, schaute ihn direkt an. Instinktiv rückte er ein Stück von dem Fenster weg, obwohl er wusste, dass sie ihn nicht sehen konnte. Sie sah nur ihr eigenes Spiegelbild, und das betrachtete sie passiv und erschöpft. Gleichgültig. Als ginge ihr durch den Kopf: Da sitze ich nun, sehe schrecklich aus, und es ist mir völlig egal.
Ein Schlüssel wurde im Schloss herumgedreht. Plötzlich richtete die Frau sich kerzengerade auf, wurde hellwach und aufmerksam. Noch einmal wischte sie sich das Gesicht ab und hob ihr Kinn, was ihr ein kampflustiges Aussehen verlieh. Mochten ihre Augen auch verschwollen, ihr T-Shirt nass geweint sein, aber den Mantel der Verletzlichkeit hatte sie entschlossen abgeworfen. Sie erinnerte Chase an einen Soldaten, der sich trotz seiner Todesangst für den Kampf wappnete.
Die Tür wurde geöffnet. Ein Mann trat ein – grauer Anzug, keine Krawatte, strikt geschäftsmäßig. Er rückte sich einen Stuhl zurecht. Das laute Geräusch der Stuhlbeine, die über den Boden kratzten, ließ Chase zusammenzucken. Erst jetzt wurde ihm klar, dass nebenan ein Mikrofon eingeschaltet sein musste und das Geräusch über einen kleinen Lautsprecher neben dem Fenster übertragen wurde.