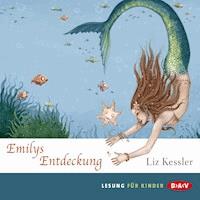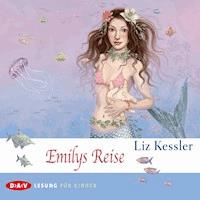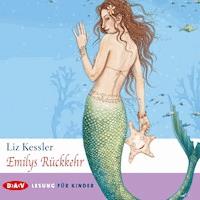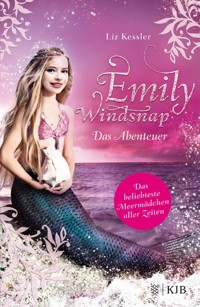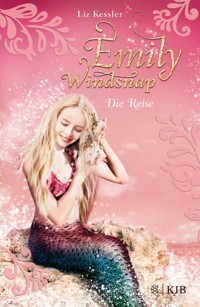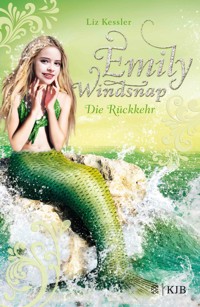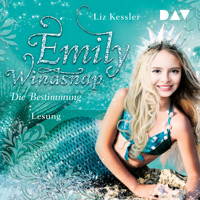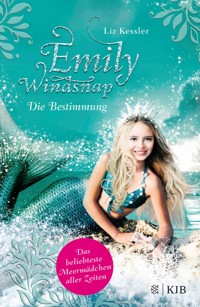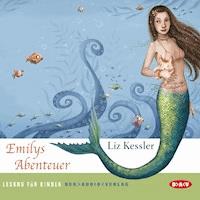11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Nach »Als die Welt uns gehörte« (Deutscher Jugendliteraturpreis 2023) ein neuer bewegender realistischer Jugendroman über den 2. Weltkrieg von Bestsellerautorin Liz Kessler für Leser*innen ab 12 Jahren Holland, 1942. Die Welt befindet sich im Krieg, die Macht der Nazis wächst von Tag zu Tag, und jüdische Familien sind in großer Gefahr. Die zwölfjährige Mila und ihre ältere Schwester Hannie werden deshalb von ihren Eltern zu einer Familie in Amsterdam geschickt, mit neuen Identitäten und der strikten Anweisung, niemandem zu sagen, dass sie Juden sind. Aber Hannie will nicht einfach alles stumm ertragen. Sie ist entschlossen, sich zu wehren, und wird als Undercover-Agentin in den niederländischen Widerstand aufgenommen: Geheimname Eisvogel! Mila ahnt nichts von den verborgenen Aktivitäten ihrer Schwester. Doch eines Tages entdeckt sie etwas, das ihr ganzes Leben und das vieler anderer für immer verändern wird … In zwei parallelen Handlungssträngen verwebt Bestsellerautorin Liz Kessler Themen wie Freundschaft, Mut, Familie, Verbundenheit, die Bedeutung der Geschichte und des Nicht-Vergessens zu einem emotionalen und mitreißenden Roman. - Zwei Schwestern, ein tragisches Missverständnis und der Sieg der Hoffnung in düsteren Zeiten - Ein fiktives, aber nicht weniger wahres Schicksal von jüdischen Kindern in den Niederlanden unter deutscher Besatzung - Mitreißender Jugendroman, der zum Nachdenken anregt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Liz Kessler
Geheimname Eisvogel
Roman
Über dieses Buch
Zwei Schwestern, ein tragisches Missverständnis und der Sieg der Hoffnung in düsteren Zeiten
Holland, 1942. Die Welt befindet sich im Krieg, die Macht der Nazis wächst von Tag zu Tag, und jüdische Familien sind in großer Gefahr. Die zwölfjährige Mila und ihre ältere Schwester Hannie werden deshalb von ihren Eltern zu einer Familie in Amsterdam geschickt, mit neuen Identitäten und der strikten Anweisung, niemandem zu sagen, dass sie Juden sind. Aber Hannie will nicht einfach alles stumm ertragen. Sie ist entschlossen, sich zu wehren, und wird als Undercover-Agentin in den niederländischen Widerstand aufgenommen: Geheimname Eisvogel! Mila ahnt nichts von den verborgenen Aktivitäten ihrer Schwester. Doch eines Tages entdeckt sie etwas, das ihr ganzes Leben und das vieler anderer für immer verändern wird …
In zwei parallelen Handlungssträngen verwebt Bestsellerautorin Liz Kessler Themen wie Freundschaft, Mut, Familie, Verbundenheit, die Bedeutung der Geschichte und des Nicht-Vergessens zu einem emotionalen und mitreißenden Roman.
Pressestimmen zur englischen Originalausgabe:
»Abwechselnde Perspektiven und Zeitsprünge sorgen für spannende Einblicke, und die zum Teil harten Passagen werden durch den Zusammenhalt der Schwestern und liebevolle Freundschaften gemildert. Eine mitreißende Geschichte, die jedem Leser Mut machen wird.« Booklist
»Eine intensive Geschichte, wunderschön erzählt.« School Library Journal
»Eine lohnenswerte Lektüre.« Publishers Weekly
Nominiert für die Carnegie Medal for Writing 2025
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischer-sauerlaender.de
Biografie
Als Liz Kessler im Alter von neun Jahren ihr erstes Gedicht veröffentlichte, hatte sie sich nicht träumen lassen, dass sie einmal eine der erfolgreichsten Autorinnen der Welt werden würde. Ihre Kinderbücher über das Meermädchen Emily Windsnap und die Feenfreundin Philippa sind internationale Bestseller und haben sich weit über sechs Millionen Mal verkauft. Für ihren Jugendroman Als die Welt uns gehörte wurde sie mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2023 (Jugendjury) ausgezeichnet.
Inhalt
[Widmung]
Prolog
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Kapitel siebenundzwanzig
Kapitel achtundzwanzig
Kapitel neunundzwanzig
Kapitel dreißig
Kapitel einunddreißig
Kapitel zweiunddreißig
Kapitel dreiunddreißig
Kapitel vierunddreißig
Kapitel fünfunddreißig
Kapitel sechsunddreißig
Kapitel siebenunddreißig
Kapitel achtunddreißig
Kapitel neununddreißig
Kapitel vierzig
Kapitel einundvierzig
Kapitel zweiundvierzig
Kapitel dreiundvierzig
Kapitel vierundvierzig
Kapitel fünfundvierzig
Kapitel sechsundvierzig
Epilog
Historische Anmerkung
Danksagung
Für die drei Frauen, die mir tagtäglich das Gefühl geben, dass ich mutig, furchtlos und stark sein kann:
meine Mutter Merle, meine Schwester Caroline
und meine Frau Laura.
Ihr alle seid großartig.
Prolog
Amsterdam 1942
Schon ehe er das Haus betrat, wusste er, dass dies der Tag war, vor dem man ihn gewarnt hatte.
Es war einerlei, dass er mal wieder seinen Schlüssel vergessen hatte: Die Haustür hing schief in den Angeln. Verstohlen blickte er die Straße auf und ab, ehe er eintrat.
Es schnürte ihm die Luft ab, während er sich im Raum umsah. Sein Blick fiel auf die umgeworfenen Stühle, das zerbrochene Glas, Schubfächer, die herausgezogen und auf den Boden geleert worden waren, auf die Vorhänge, die von den Stangen gezerrt und zu Fetzen zerrissen waren. Ein eiskaltes Gefühl ergriff seine Brust.
Er schloss die Augen, bemüht, sich nicht vorzustellen, was hier geschehen war. Gleichzeitig war sein inneres Bild grausam und eindrücklich. Er konnte das wiehernde Gelächter der SS-Männer praktisch hören, als sie das einzige Zuhause, das er je gehabt hatte, zerstörten. Fast konnte er die Tränen seiner Eltern schmecken.
Nein. Er durfte sich nicht seinen Vorstellungen hingeben. Er musste handeln. Er war auf diesen Tag vorbereitet gewesen.
Er eilte nach hinten in die Küche, ließ sich auf die Knie hinunter und öffnete einen Unterschrank. Dann kroch er hinein und drückte an die Rückwand. Ein Holzpaneel gab nach. Er kroch hindurch, dann drehte er sich um, zog die niedere Schranktür wieder zu und befestigte das geheime Paneel.
Der Raum war groß genug, dass er aufrecht sitzen konnte. Es gab Wasser, ein wenig zu essen und auf dem Boden eine alte Decke. Er tastete nach der Uhr an seinem Handgelenk. Erst vor ein paar Tagen hatte sein Vater sie ihm gegeben. Er fuhr mit dem Finger über das Zifferblatt und spürte, wie sein Puls sich etwas beruhigte, während er die Augen schloss und an das Lächeln seines Vaters dachte.
Dann rückte er in eine möglichst bequeme Haltung. Nun musste er auf die Menschen warten, die wussten, was sie zu tun hatten. Menschen, die Kindern wie ihm halfen.
»Bitte, kommt bald«, flüsterte er immer wieder in die Dunkelheit. »Bitte, holt mich.«
Kapitel eins
Liv, Gegenwart
Ich bin in meinem Zimmer bei den Hausaufgaben, als das Polizeiauto in unsere Straße einbiegt.
Instinktiv greife ich zu meinem Handy und texte an Karly. Ich drücke auf Senden und trete wieder ans Fenster.
Eine Minute später pingt mein Handy. Ich rufe die Nachricht auf und lese sie.
Geht es um den unheimlichen Typ von Haus 54, von dem wir immer sagten, dass er aus Igeln Perücken macht?
Ich grinse. Karly weiß immer, wie sie mich zum Lachen bringt. Mein Handy pingt erneut.
Oder vielleicht geht es auch um Gladys von Nummer 62, die endlich für ihren schlechten Modegeschmack büßen muss.
Gerade will ich antworten, da kommt eine dritte Nachricht an.
Nicht, dass eine, die sich von Daddy einkleiden lässt, viel von Mode versteht.
Dieser letzten Nachricht folgen ein paar lachende Smileys.
Das fühlt sich fast so an wie ein Schlag ins Gesicht direkt aus dem Handy. Aber ich ermahne mich, nicht kindisch zu sein.
Karly und ich sind seit Ewigkeiten beste Freundinnen. Seit wir in der dritten Klasse nebeneinander saßen. Sie war schon immer die Direktere von uns beiden. Ich habe ihr seit jeher gerne das Kommando überlassen. Mir war eigentlich egal, was wir machen; Hauptsache, wir machen es gemeinsam, und es bringt immer Spaß.
Oder es hat zumindest immer Spaß gebracht. In letzter Zeit nicht mehr so. Es fing an, als wir letzten Monat in die Achte starteten und für einige Fächer in verschiedene Kurse kamen. Karly hat sich mit einer neuen Mädchenclique zusammengetan und hat seitdem nicht mehr so viel Zeit für mich. Wir gehen noch immer gemeinsam zur Schule und hängen auch an den Wochenenden manchmal zusammen ab, und um ehrlich zu sein, das geht für mich in Ordnung. Na ja, nicht ganz in Ordnung, aber ich kann es nicht groß ändern, wenn es so läuft, wie sie es will. Ich würde es ihr gegenüber allerdings nie erwähnen, womöglich lässt sie mich sonst noch ganz fallen.
Ich weiß also, dass ihre Nachricht einfach witzig gemeint war. Sie hat einen bissigen Sinn für Humor. Und wenn ich gelegentlich zu ihrer Zielscheibe werde, muss ich mich einfach damit abfinden. So ist sie eben.
Die Sache mit dem von Daddy einkleiden lassen versetzt mir allerdings einen kleinen Stich. Karlys Eltern sind geschieden, und sie verbringt die Wochenenden und Ferien abwechselnd bei dem einen oder der anderen. Wir haben früher oft Pyjamapartys veranstaltet, und sie wollte immer zu mir kommen, statt ich zu ihr. Meine Mum ist Leiterin einer Wohltätigkeitsstiftung und ständig unterwegs. Dad ist Künstler. Er hat ein Atelier im Garten. Einen wie ihn nennt man wohl einen Hausmann. Karly meinte immer, was für ein Glück ich hätte, beide zu haben, und sie fand meinen Vater ganz toll.
Aber seit sie mitbekommen hat, wie ich mit Dad zum Klamottenkaufen war, macht sie sich immer über meine Kleider lustig. Sie war mit einer ihrer neuen Freundinnen zusammen – Sal –, und ich vermute mal, diese neue Freundin hat was damit zu tun.
Egal. Ich will mich nicht darüber aufregen. Ich schicke ein paar Smileys zurück, damit sie weiß, dass ich wegen ihrer Stichelei nicht sauer bin. Dann lege ich das Handy beiseite. Ich lehne mich an die Wand und schaue wieder aus dem Fenster.
Das Polizeiauto ist bereits ein Stück nähergekommen. Es fährt langsam, als ob der Fahrer nach dem richtigen Haus sucht und die Hausnummern an den Gartentoren überprüft. Es wird noch langsamer und bleibt schließlich stehen.
Vor unserem Haus.
Ich trete näher vor das Fenster, bleibe jedoch hinter dem Vorhang verborgen. Zwei Polizeibeamte helfen einer Person, hinten auszusteigen.
Es ist Bubbe. Meine Großmutter. Sie ist im Morgenmantel.
Das kann doch nicht wahr sein.
Während sie die Einfahrt entlangkommen, kauere ich mich tiefer hinter den Vorhang, seltsam erleichtert, dass Karly nicht hier ist, um das mitzuerleben. Mir wird ganz heiß bei der Vorstellung, dass sie die zerzauste alte Frau in Hausschuhen über unsere Auffahrt schlurfen sehen könnte. Das würde sie mir ständig unter die Nase reiben. Und was sie ihren neuen Freundinnen erzählen könnte! Das Gelächter.
Es klingelt an der Haustür. Ich schleiche aus meinem Zimmer und lausche vom Treppenabsatz, während Dad zur Tür geht. Ich verstehe nicht alles, nur ein paar Wortfetzen der Unterhaltung.
»… Nachbarin hat sie vor dem Haus gesehen …«
»… hat verstört gewirkt …«
»… hat gesagt, sie sei nur rausgekommen, um die Milchflaschen rauszustellen, dann sei die Tür hinter ihr ins Schloss gefallen …«
»… hat uns diese Adresse gegeben. Sagt, Sie hätten einen Zweitschlüssel …«
Ich beuge mich über das Geländer, um besser mithören zu können. »Tut mir so leid, dass Sie solche Umstände hatten«, sagt Dad. »Sie ist meine Mutter. Wir kümmern uns um sie. Ich bringe sie gleich wieder nach Hause.«
»Mum«, sagt Dad leise, nachdem die Polizisten weg sind. »Warum hast du mich nicht einfach angerufen, wie wir vereinbart hatten?«
»Das ging nicht«, erwidert Bubbe schroff. »Hatte das Handy im Haus gelassen.«
Es entsteht eine Pause, und ich halte den Atem an. Dann sagt Dad: »Es ist in deiner Tasche, Mum.«
»In welcher Tasche?«, fragt Bubbe unwirsch.
»Die du um den Hals trägst. Die ich dir besorgt habe, damit du immer weißt, wo dein Handy ist. Erinnerst du dich nicht?«
Bubbe murmelt etwas Unverständliches.
Ich habe genug gehört. Ich schleiche mich zurück in mein Zimmer und hoffe, dass Dad mich nicht nach unten ruft, damit ich mich mit ihr unterhalte.
Nicht, dass ich Bubbe nicht mag. Uns verbindet einfach nichts miteinander. Es liegen gute achtzig Jahre zwischen uns. Ich glaube, das reicht als Entschuldigung.
Es war anders, als Pop noch lebte. Pop war mein Großvater. Jeden Freitag besuchten wir die beiden für das Sabbatessen. Bubbe hielt sich die meiste Zeit in der Küche auf und kochte mit Mum. Ihr Brathähnchen war zum Niederknien, und jeden Freitag machte sie Schokoladenkuchen. Das war mein Highlight der Woche. Bubbe sagte immer, der Kuchen enthalte eine ganz besondere Zutat, aber sie verriet mir nie, was das war.
»Familiengeheimnis«, sagte sie jedes Mal und tippte sich mit dem Finger an die Nase.
Manchmal kommt es mir so vor, als sei ihr ganzes Leben ein Familiengeheimnis. Selbst zu Pops Lebzeiten hat sie nie viel von sich selbst erzählt. Dad sagt, weil sie eine schwierige Kindheit gehabt hat. Wenn ich ihn frage, was daran schwierig war, zuckt er nur mit den Schultern. »Sie hat nie darüber geredet«, sagt er dann nur. »Es ist ein Tabu, und das respektiere ich.«
Ich weiß nur eines: Bei Bubbe ist fast alles ein Tabu. Ihre Kuchenrezepte, ihre Kindheit. Kein Wunder, dass wir uns nie nähergekommen sind.
Es war Pop, der uns immer mit einem Lächeln begrüßt hat. Das war, als ob er ein Licht angeknipst hätte. Während wir auf das Essen warteten, spielten wir Rommee, und hinterher zeigte er mir Kartentricks. Ein paar davon hat er mir beigebracht. Er teilte seine Geheimnisse gern. Pop war warmherzig und offen.
Das Gegenteil von Bubbe. Sie ist kalt wie ein Eisblock. Vor allem mir gegenüber. Es ist, als habe es immer eine unsichtbare Tür zwischen uns gegeben, und ich wusste nie, wie man sie öffnen könnte. Um ehrlich zu sein, habe ich es auch nie richtig versucht.
Pop ist vor drei Jahren gestorben, kurz vor meinem zehnten Geburtstag. Die Freitagabend-Essen waren nie wieder so wie früher. Ohne das leuchtende Lächeln von Pop verschmolz alles in ihrem Haus zu einem tristen Grau. Bubbe selbst eingeschlossen. Sie hörte auf, Schokoladenkuchen zu backen, und schließlich gab es überhaupt kein Freitagabend-Essen mehr. Es war, als hätte sie mit uns abgeschlossen. Mit dem Leben.
Ihren Sohn – meinen Vater – hat sie erst sehr spät auf die Welt gebracht. Sie und Pop waren beide über vierzig. Sie pflegten zu sagen, Dad sei ihr Wunderkind. Meine Mutter verdrehte jedes Mal die Augen, wenn sie das sagten. »Es wäre ein Wunder, wenn er auch nur einmal an unseren Hochzeitstag denken würde«, sagte sie immer, und wir lachten alle.
Es fühlt sich sonderbar an, dass in dem Haus mal gelacht wurde. Jetzt gibt es nur noch trübes Licht, gedämpfte Stimmen und Erinnerungen, die unwirklich wirken.
Dann luden wir Bubbe nach dem Tod von Pop freitagabends zu uns ein, aber nach einer Weile kam sie nicht mehr. Sie zog sich sogar noch mehr hinter die unsichtbare Tür zurück und verschloss sie hinter sich. Schließlich kam ich auf die höhere Schule, und während sich meine Welt erweiterte, schien die von Bubbe zu schrumpfen.
Und jetzt ist sie hier, schlurft durch unser Haus, und ich kann nur eines denken: Bring sie bitte schnell nach Hause.
Kapitel zwei
Mila, 1942
Es war ein kühler Tag hier in Amersfoort, und es wurde sogar noch kälter, als die Sonne unterging. Ich zog die Strickjacke enger um mich und versuchte, ein Frösteln zu unterdrücken.
»Können wir das Feuer nicht schon anzünden?«, fragte ich Papa. Er saß am Küchentisch und las Zeitung. Er blickte zu mir auf, mit Augen, die so dunkel waren wie das verblassende Licht vor dem Fenster.
»Noch nicht«, sagte er. »Warte, bis Mama nach Hause kommt.«
Ich hatte den immer kleiner werdenden Holzstapel im Hof gesehen und wusste, wie schwierig es war, Nachschub zu bekommen, vor allem, weil Papa vor einem Jahr seine Stelle als Lehrer verloren hatte. Seit Hitler vor zwei Jahren die Niederlande besetzt hatte, war alles schwierig für uns.
Im Vergleich zu anderen waren wir noch gut dran. Wenigstens durften jüdische Frauen hier in Amersfoort immer noch als Sekretärinnen arbeiten. Mama verdiente nicht viel, aber jedenfalls ein bisschen. Es war mehr, als viele unserer Freunde hatten.
»Komm.« Papa rutschte auf der Bank zur Seite. »Hol dir eine Decke und setz dich zu mir. Wir können uns gegenseitig wärmen.«
Ich ging ins Wohnzimmer, um eine Decke von der Sofalehne zu holen. Aber ein Geräusch von draußen ließ mich aufhorchen. Stimmen. Ich trat ans Fenster und sah vorsichtig hinaus. Das Blut gerann mir in den Adern.
»Papa!«, rief ich. »Kannst du mal herkommen …«
Im Nu war er aufgesprungen. »Was ist los?«, fragte er und trat zu mir ans Fenster. Zwei Polizisten marschierten die Straße entlang. Sie kamen auf unser Haus zu, und sie hatten meine Schwester zwischen sich. Papa stürmte zur Haustür und riss sie auf, ehe die Polizisten klingeln konnten.
Aus dem Schatten der Diele sah ich zu. Ich hatte gelernt, mich vor Polizisten zu hüten. Selbst vor den einheimischen, holländischen, wie diesen beiden. Sie waren nicht so schlimm wie die Männer in den hohen schwarzen Stiefeln und den schweren Uniformmänteln mit dem Hakenkreuz am Ärmel, die inzwischen fast überall herumliefen, aber sie waren auch nicht viel besser.
»Was hat sie jetzt wieder angestellt?«, fragte Papa.
Hannie stand immer noch zwischen den beiden Männern. Im Vergleich zu ihnen sah sie klein aus. Hannie war mir noch nie klein vorgekommen. Für mich war sie in so vieler Hinsicht groß: Sie war größer als ich, redete mehr als ich, lachte lauter als sonst jemand im ganzen Viertel. Sie war fast drei Jahre älter als ich. Im Sommer war sie fünfzehn geworden – ohne dass wir das groß gefeiert hätten. Der Geburtstag war auf den Tag gefallen, an dem die neuen Gesetze gegen Juden in Kraft traten, also eher kein Tag zum Feiern.
Seitdem war Hannie wie verändert. Waren wir alle. Wir hatten uns immer mehr verändert, seit die Nazis Rotterdam dem Erdboden gleichgemacht und das Regime in Holland übernommen hatten.
»Wir verhalten uns einfach unauffällig und ziehen keine Aufmerksamkeit auf uns, dann kommen wir schon irgendwie durch, ja?«, sagte Mama immer wieder.
Ich folgte ihrem Rat nur zu gerne, aber Hannie war anders. Sie war nicht der Typ, der unauffällig sein konnte. Und jetzt hatte sie das wohl mal wieder in Schwierigkeiten gebracht.
»Sie trägt ihren Stern nicht, Herr Berman«, sagte einer der Polizisten vor uns auf der Türschwelle. Er sagte das leise, fast entschuldigend. Der Stern war das Neueste, was die Nazis für die Juden angeordnet hatten. Wir mussten alle einen gelben Stern tragen, auf dem Jude stand. Wenn man ohne ihn angetroffen wurde, gab es Ärger.
Ich beobachtete die Gesichter der Polizisten. Sie kannten Papas Namen. Sie mussten wohl Schüler von ihm gewesen sein, vor gar nicht so langer Zeit, wenn man von ihren jungen Gesichtern und den aufgerissenen Augen ausging. Sie waren kaum erwachsen. Sie sahen eher aus wie Jungen in den Anzügen ihrer Väter.
»Wir können sie nicht ständig in Schutz nehmen«, sagte der andere, etwas nachdrücklicher als sein Kollege. »Wenn es noch mal vorkommt, muss sie mit Bestrafung rechnen wie jeder andere.«
Selbst im Schatten des dunklen Teils der Diele begann ich zu zittern. Ich hatte mitbekommen, welche Bestrafungen den Juden inzwischen drohten. Ich ertrug den Gedanken nicht, dass meiner Schwester etwas Schlimmes passieren könnte.
Sag bitte, dass du machst, was sie anordnen, Hannie.
Das sprach ich stumm vor mich hin. Hannie stand trotzig und mit gerecktem Kinn zwischen den Polizisten.
Papa streckte die Hand aus, um sie hereinzuziehen. »Selbstverständlich«, sagte er versöhnlich. »Ich sehe zu, dass es nicht wieder vorkommt.« Während Hannie eintrat, hielt er den Männern einem nach dem anderen die Hand hin. »Entschuldigung«, sagte er. »Ihr macht eure Sache gut, Jungs. Wir werden euch keine Schwierigkeiten mehr machen.«
Die Männer schüttelten ihm die Hand, dann verschwanden sie, und nur noch wir drei standen in der dunklen Diele beieinander.
Papa sah Hannie mit keinem Blick an. »Geh in dein Zimmer«, sagte er. »Wir reden über den Vorfall, wenn Mama nach Hause kommt.«
Hannie machte auf dem Absatz kehrt und stapfte hinauf, mit lautem Gepolter auf jeder einzelnen Stufe.
Papa ging in die Küche zurück. »Kommst du, Mila?«, fragte er.
Ich blickte die Treppe hinauf. »Ich bin in einer Minute zurück«, sagte ich. »Will nur sehen, ob es ihr gut geht.«
Papa schüttelte den Kopf. »Ihr Mädels«, sagte er, aber seine Stimme klang schon sanfter. Wie immer. Er war nie lange böse auf Hannie. Keiner war das.
Ich rannte hinauf in unser gemeinsames Zimmer. Hannie packte ihre Tasche aus und zog sich um. Mit lautem Getöse riss sie Schubfächer heraus und knallte sie so krachend wie möglich zu.
Als ich ins Zimmer trat, blickte sie auf, dann fuhr sie mit dem Getöse fort.
»Das ist so ungerecht!«, sagte sie. Ich stand in der Tür, beobachtete sie und überlegte, was ich sagen sollte, um sie zu beruhigen. »Warum müssen wir blöde gelbe Sterne tragen?«
»Ich –«, fing ich an, aber sie war noch nicht fertig.
»Keiner sonst muss rumlaufen und seine Identität auf den Kleidern demonstrieren. Warum also wir? Warum sollten wir ein Abzeichen tragen, um der Welt kundzutun, dass wir Juden sind? Wir sind doch nicht mal besonders religiös. Wann waren wir das letzte Mal in der Synagoge? Wann haben wir zuletzt das Freitagsgebet gesprochen?«
»Ich – ich kann mich nicht erinnern«, sagte ich.
»Genau. Nicht mal hier in unserem Zuhause befolgen wir die Bräuche unserer Religion, müssen sie aber für alle Welt sichtbar machen?« Hannie marschierte zum Fenster. »Ich mache es einfacher für alle, was meinst du? Komm, wir brüllen es laut und deutlich hinaus, damit alle wissen, dass wir Juden sind.«
Sie machte sich am Fenstergriff zu schaffen, was mir genug Zeit ließ, um zum Fenster zu eilen und die Hand auf ihren Arm zu legen. »Hannie, lieber nicht«, sagte ich leise.
Sie sah mich an. Ihre schönen grünen Augen, die normalerweise vor Übermut funkelten, starrten mich mit kalter, finsterer Wut an. »Warum nicht?«, fragte sie mit brüchiger, aufgebrachter Stimme.
»Das macht alles nur noch schlimmer. Wir müssen machen, was Mama sagt. Uns unauffällig verhalten. Ärger aus dem Weg gehen. Das wird ja nicht ewig so weitergehen.«
Hannie seufzte, dann ließ sie sich aufs Bett fallen. Ihre Empörung war verraucht. »Ich weiß«, sagte sie. »Ich weiß ja. Es ist nur …«
Ich setzte mich neben sie. »… ungerecht«, beendete ich ihren Satz.
»Es ist so ungerecht.«
Eine Weile saßen wir stumm da. Schließlich legte sie mir den Arm um die Schultern und drückte mich. »Was täte ich ohne dich, Mimi?«, fragte sie.
»Das musst du nicht fragen, denn du wirst niemals ohne mich sein«, erwiderte ich und lehnte den Kopf an ihre Schulter.
Hannie neigte den Kopf und lehnte ihn an meinen. »Genau«, sagte sie. »Nie und nimmer.«
»Versprich mir, dass du es nicht wieder tust«, sagte ich. »Wenn sie dich bestrafen … Wenn sie dich festnehmen …«
»Ich mache es nicht mehr«, sagte sie. »Versprochen.«
Ehe wir weiterreden konnten, hörte ich, wie unten die Tür aufging. Mama war nach Hause gekommen.
»Komm«, sagte Hannie, stand auf und begann das Chaos, das sie veranstaltet hatte, aufzuräumen. »Ich fürchte, ich muss mir die Strafpredigt wohl anhören.«
Wie sich herausstellte – egal, was Papa vorhin gesagt hatte –, kam nicht zur Sprache, dass Hannie von zwei Polizisten nach Hause gebracht worden war. Mama und Papa hatten größere Sorgen. Mama hatte soeben erfahren, dass auch ihr gekündigt worden war.
»Was hast du falsch gemacht?«, fragte Hannie.
Mama wandte sich ihr zu und hob die Arme zu einem langsamen, schweren Schulterzucken.
»Ich wurde als Jüdin geboren«, sagte sie.
Kapitel drei
Liv, Gegenwart
»Sie kann nicht hierbleiben«, sagt Mum, während sie Kartoffeln auf unsere Teller verteilt. »Du weißt, dass sie nicht mehr allein leben kann. Irgendwann passiert ihr was Schlimmes.«
Bubbe hat sich wieder mal ausgesperrt. Zum Glück hatte sie sich diesmal daran erinnert, dass sie ihr Handy dabeihatte, und Dad angerufen.
»Was ist, wenn sie sich draußen beim Herumirren eine Lungenentzündung einfängt?«, fährt Mum fort.
»Sie fängt sich keine Lungenentzündung ein!«, sagt Dad ungehalten.
»Oder wenn sie einfach drauflos geht und sich verläuft?«, hält ihm Mum vor. »Sie kann nicht mehr alleine leben.«
»Aber immerhin hat sie ein eigenes Leben«, sagt Dad erschöpft. »Was bleibt ihr in Rocklands?«
Rocklands ist das Pflegeheim, das sich Mum und Dad letzte Woche angesehen haben. Nachdem sie zurückgekommen waren, hatte Dad den ganzen Abend nichts gesagt.
Mum schweigt eine Weile, ehe sie antwortet. »Dort hätte sie Tag und Nacht Menschen um sich, deren Aufgabe es ist, für sie zu sorgen«, sagt sie vorsichtig.
Mums Wohlfahrtsorganisation kümmert sich um ältere Leute. Sie kennt sich mit den Schwierigkeiten von Senioren besser aus als die meisten, und es ist schwierig, ihr da zu widersprechen. Ich weiß nicht, was gut für Bubbe wäre. Ich weiß nur, dass ich nicht will, dass sie noch mal in Hausschuhen und Morgenrock vor unserem Haus auftaucht.
Dad schweigt, also fährt Mum fort. »Sie hätte einen Park zum Spazierengehen, wo Pflegepersonal in der Nähe ist und auf sie achtet, statt dass sie sich aussperrt und im Nachthemd durch die Straßen irrt«, sagt sie. »Das Essen würde für sie gekocht. Sie hätte –«
»Okay, okay.« Dad hebt die Hände und gibt klein bei. »Verstanden. Ich hab’s gehört. Ich weiß, dass du recht hast. Nur …«
»Es ist hart. Das weiß ich, Liebling.« Mum streichelt ihm die Hand. »Es tut mir leid.«
»In Ordnung. Dann gehen wir am Samstag mit ihr auf einen Probebesuch nach Rocklands, wie man uns vorgeschlagen hat. Warten wir ab, wie es ist, wenn sie dort eine Nacht verbringt.«
»Liebling, vergiss nicht, dass ich dieses Wochenende auf der Führungskonferenz bin«, sagt Mum entschuldigend.
»Ach ja. Natürlich. Hatte ich vergessen.« Dad wendet sich mir zu. »Ich vermute mal, dass du bei Karly bist und auch keine Zeit hast?«
»Ja, tut mir leid«, sage ich und versuche zu verbergen, wie erleichtert ich bin, nicht auf einen Tagesbesuch in einem Altenheim zu müssen. »Sie hat Geburtstag.«
»Ach ja, natürlich«, sagt Dad. »Habt ihr was Schönes vor?«
»Wir gehen schwimmen.«
»Wie nett, Liv«, sagt Mum zerstreut.
Das ist es wirklich. Mehr als nett, um genau zu sein. Ich war mir nicht sicher gewesen, ob sie mich dieses Jahr tatsächlich einladen würde oder ob sie einfach nur mit ihren neuen Freundinnen abhängen wollte.
Bis Anfang der Woche hatte sie sich noch nicht geäußert. Ich war ständig drauf und dran, sie darauf anzusprechen, wollte aber keine Abfuhr riskieren, falls sie nicht vorhatte, mich einzuladen. Daher überließ ich es ihr.
Dann wartete ich gestern nach der Schule auf sie. Sie war wie üblich mit ihrer neuen Clique zusammen, ich blieb daher am Rand der Gruppe und fühlte mich unbehaglich, während sie sich voneinander verabschiedeten. Umarmungen und Küsschen und so weiter. Ehrlich, man hätte annehmen können, dass eine von ihnen für Wochen verreisen wollte, nicht, dass sie sich ja am nächsten Tag in der Schule schon wieder sehen würden.
Dann fragte Sal, das Mädchen, das ich in der Stadt getroffen hatte, ob ich zu Karlys Geburtstagsparty käme.
Ich merkte, wie ich rot wurde. Das war’s dann wohl. Meine schlimmsten Befürchtungen bestätigten sich – und das auch noch vor allen anderen!
»Uups. Entschuldige«, sagte Sal sarkastisch. »Da hab ich die Katze wohl aus dem Sack gelassen, oder?«
Karly zuckte nur mit den Schultern und bemerkte wie beiläufig, sie habe einfach vergessen, es zu erwähnen.
»Bleibt es dabei, dass wir uns um elf am Schwimmbad treffen?«, fragte Sal schnell.
Karly warf Sal einen bedeutungsvollen Blick zu. Wahrscheinlich einen ihrer super-intimen Blicke, die nicht für mich bestimmt sind.
Dann drehte sich Karly nach mir um und sagte: »Genau. Elf Uhr Samstagmorgen am Schwimmbad.«
Auf dem restlichen Heimweg kam das Thema nicht mehr auf. Ich wollte nicht, dass sie es sich doch noch anders überlegte, daher sabbelte ich allen möglichen Unsinn, bis wir zu Karlys Straße kamen.
Um ehrlich zu sein, ich bin nicht sicher, ob ich überhaupt unbedingt mit denen schwimmen gehen möchte, aber es ist besser, als gar nicht dabei zu sein.
Und dann ist Samstag, und es ist fast halb zwölf. Ich stehe seit einer halben Stunde am Schwimmbad und warte, dass die anderen auftauchen. Sogar schon länger. Bin zu früh gekommen, weil ich so aufgeregt war und sie nicht verpassen wollte.
Ich habe Karly zweimal getextet, aber sie hat nicht geantwortet. Im Geiste wiederhole ich unser Gespräch. Habe ich mich womöglich im Tag vertan? Unmöglich. Ich kenne doch Karlys Geburtstagsdatum so gut wie mein eigenes. Der falsche Treffpunkt? Auf keinen Fall. Das hier ist das einzige öffentliche Schwimmbad und einer von Karlys Lieblingsorten. Als wir noch jünger waren, sind wir fast jedes Wochenende hergekommen. Ich schließe die Augen und sehe uns quasi vor mir: Kopfsprung ins Wasser, Wettschwimmen, Lachen.
Ich lächle bei der Erinnerung, öffne die Augen und blicke mich noch einmal um. Da sehe ich sie.
Gegenüber vom Schwimmbad ist die Parkanlage, wo Leute am Wochenende ihre Hunde ausführen oder Fußball spielen. Um diese Zeit des Jahres wird immer ein Jahrmarkt aufgebaut, der ein paar Wochen stehen bleibt.
Ich kann sehen, wie sich die Walzerbahn dreht. Kreischende Leute, die die Hände in die Luft strecken. Da entdecke ich sie. Fünf Mädchen, alle in einem Wagen. Das sind sie – Karly und die anderen – schreiend und lachend.
Meine Wangen fangen zu brennen an. Meine Hände, die Karlys Geschenk halten, werden steif. Ich habe mich so bemüht, es perfekt einzupacken. Sogar mit einer goldenen Schleife.
Ich bin ja so doof.
Ich starre einen Augenblick länger zu dem Karussell, um ganz sicher zu sein. Doch das hätte ich lieber bleibenlassen sollen, denn bei der nächsten Umdrehung sieht mich eine und deutet herüber. Alle drehen die Köpfe, und ich komme mir bloßgestellt vor. Der Wagen verschwindet wieder, aber ich bin sicher, dass ich Karlys Lachen höre, während sie davonfliegt.
Ich drehe mich um und laufe los. Ich muss weg hier. An einem Abfalleimer zögere ich. Am liebsten würde ich Karlys Geschenk hineinwerfen. Nein. Das kann ich nicht machen. Ich muss ihr erst eine Chance geben, das alles aufzuklären. Das muss ein Missverständnis sein. Das würde Karly mir doch nicht antun. Eilig entferne ich mich und springe in den ersten Bus, der kommt.
Dad ist in der Diele und zieht den Mantel an, als ich eintrete. »Hey, du bist ja früh zurück«, sagt er munter.
Ich erwidere nichts.
»Spaß gehabt?«, fragt er.
»Ja«, sage ich und versuche, überzeugend zu klingen. Zum Glück weiß Dad nicht, dass ich fast die ganze Busfahrt nach Hause geheult habe.
»Ich wollte gerade los, um Bubbe abzuholen«, sagt er. »Kommst du mit?«
Ich überlege rasch. Ganz allein zu Hause sitzen und mir wie die größte Loserin der Welt vorzukommen oder bei meiner Großmutter im Altenheim rumzuhängen? Eine schwierige Entscheidung.
»Klar, warum nicht?«, sage ich.
Dad drückt mich kurz. »Meine tüchtige Kleine!«, sagt er.
Zwanzig Minuten später sitzen wir in Bubbes Küche und machen eine Liste, was sie für das Wochenende in Rocklands mitnehmen sollte.
Als ich mich im Raum umsehe, verspüre ich einen kurzen Stich. Fast kann ich Pops Lachen hören, der eine versteckte Spielkarte hinter meinem Ohr hervorzieht. Fast kann ich das Brathähnchen in Bubbes Backofen riechen und ihren Schokoladenkuchen mit der Geheimzutat schmecken. Ich habe nie herausgefunden, was das war.
Am liebsten würde ich sie jetzt fragen, mache es aber nicht. Dad hat mir eingeschärft, nicht zu viele Fragen zu stellen. Es quält Bubbe, wenn wir sie daran erinnern, dass ihr Gedächtnis nachlässt, sagt Dad.
Die Gefühle, die in ihrer Küche hochkommen, schockieren mich. Die Erinnerungen an meine Kindheit und wie sehr ich mich immer freute, freitagabends herzukommen. Ich kann es mir kaum noch vorstellen.
Alles kommt mir kleiner vor als früher. Als ob die Räume geschrumpft sind, genau wie Bubbe, die jetzt mit Dad in ihr Schlafzimmer schlurft, um fertig zu packen.
»Geschafft!«, ruft Dad aus dem Schlafzimmer.
Als wir das Haus verlassen, ergreift Bubbe meinen Arm und hängt sich bei mir ein. Ich komme mir wie ein Elternteil vor und sie ist mein Kind, wobei ich nicht weiß, wie ich der Verantwortung gerecht werden kann.
Mit der freien Hand bedeutet sie mir, näher zu kommen. Ich bücke mich, sodass mein Gesicht näher bei ihrem ist, und sie flüstert mir was ins Ohr.
»Weinbrand«, sagt sie und sieht mich an.
Ich weiß nicht, was sie meint, und werde von dem Gefühl erfüllt, das immer häufiger einsetzt, wenn wir zusammen sind: peinliche Verlegenheit.
Dann spricht sie wieder. »Die Geheimzutat«, flüstert sie.
Der Kuchen! Sie redet von dem Schokoladenkuchen. Ich lache los.
Bubbes Mund verzieht sich zu einem Lächeln. Ich weiß nicht, wann ich sie das letzte Mal habe lächeln sehen. Plötzlich ergreift mich ein abartiges Gefühl: Sie sieht schön aus.
Dad dreht sich nach uns um. »Worüber kichert ihr zwei eigentlich?«, fragt er.
Bubbe zieht mich näher heran und legt einen Finger auf die Lippen. »Pscht«, sagt sie. »Unser Geheimnis.«
»Nichts«, sage ich zu Dad.
Ihr Gesicht ist immer noch ganz nah, und sie überrascht mich erneut.
»Alles wird gut für dich, glaub mir«, flüstert sie. »Lächle nur immer so reizend, wie du jetzt lächelst.«
Ich starre sie einen Moment an und wundere mich, wie sie mich plötzlich besser durchschaut als sonst jemand. Und dann drücke ich ihren Arm, und zusammen gehen wir zum Auto.
Kapitel vier
Mila, 1942
»Mila, schaust du auch zu?« Mama rief mich an den Küchentisch. Wir erwarteten Gäste zum Abendessen, und sie backte einen Schokoladenkuchen nach einem speziellen Familienrezept. Es war das erste Mal, dass ich ihr dabei half.
Sie zog die Küchenschublade auf und entnahm ihr eine kleine Flasche Weinbrand. Sie war noch ungefähr zu einem Viertel voll.
Mama bemerkte meinen erstaunten Blick. »Den habe ich für einen Notfall aufgehoben«, sagte sie.
»Wieso sind Gäste zum Abendessen ein Notfall?«, fragte Hannie, die gerade in die Küche kam.
Mir war der Grund dafür egal. Ich freute mich einfach nur, dass es wieder Schokoladenkuchen gab. Es war inzwischen so schwierig, Zutaten zu bekommen. Beide Eltern waren jetzt arbeitslos, dazu noch die Kriegsrationierungen – wir hatten seit Monaten nicht mehr so gegessen.
Mama öffnete die Flasche und rührte einen Esslöffel Weinbrand in die Teigmischung.
Ich war entsetzt. »Weinbrand im Schokoladenkuchen?«
»Die Geheimzutat. Das war ein Familiengeheimnis, und jetzt gebe ich es an euch weiter.«
»Keine Sorge, Mama, wir nehmen es mit ins Grab«, sagte Hannie und legte den Finger auf die Lippen.
Mama lachte. Vorsichtig nahm sie den Kuchen und schob ihn in den Backofen. »So, könnt ihr mal den Tisch decken, Mädels? Die Gäste sollen die guten Stühle bekommen. Und nehmt bitte das schöne Besteck«, sagte sie. »Dann zieht frische Sachen an und wascht euch das Gesicht, ehe ihr zurückkommt.«
Hannie runzelte die Stirn. »Wer sind diese Leute, für die es so wichtig ist, was wir anziehen? Wir kennen sie ja nicht mal.«
Mama krempelte die Ärmel auf, um abzuwaschen. Doch in dem Moment trat Papa durch die Tür. Sie warfen sich einen Blick zu, als ob sie sich ein geheimes Zeichen gaben.
Mir lief es kalt über den Rücken. »Mama, Papa, was geht hier vor sich?«, fragte ich.
Hannie war empört. »Ihr müsst uns sagen, wer sie sind!«, forderte sie. »Und warum wir sie mit dem Feinsten bewirten, nachdem wir monatelang nur Abfälle gegessen haben?«
Da war er wieder. Der Blick zwischen unseren Eltern.
Schließlich nickte Papa. »Kommt, setzt euch. Es ist wohl an der Zeit, dass wir es euch sagen. Aber es ist ein Geheimnis«, sagte er.
»Wie der Weinbrand?«, fragte ich lächelnd, während wir uns um den Tisch setzten.
Papa kniff die Augen zusammen. »Nein, Mila. Es ist kein Witz. Es ist eine ernste Sache. Ernster als alles, was uns je geschehen ist, und ihr müsst beide hoch und heilig schwören, keinem davon zu erzählen.«
Ich sah zu Hannie und wartete darauf, ihrem Beispiel zu folgen. Sie legte eine Hand aufs Herz. »Wir sagen nichts, Papa«, sagte sie sehr ernst, und ich tat es ihr nach.
»Unsere Besucher heißen Herr und Frau Van de Berg, und ihr werdet eine kleine Weile bei ihnen wohnen«, sagte Papa. »Das hoffen wir zumindest. Heute Abend kommen sie, um euch kennenzulernen, um zu sehen, ob ihr geeignet seid, und um Vorkehrungen zu treffen.«
Ich starrte Papa an. In seinen Worten lag so viel, das mir schleierhaft war, dass ich nicht wusste, wo ich anfangen sollte.
Hannie ergriff für uns beide das Wort. »Wir sollen bei ihnen wohnen?«, fragte sie. »Ab wann?«
Papa schluckte. »Bald«, sagte er. »Vielleicht in ein paar Wochen.«
»Warum?«, fragte ich.
»Mimi«, hub er an. So nannte er mich nicht oft. Es war immer Hannies Kosename für mich gewesen, doch Mama und Papa benutzten ihn nur, wenn sie unbedingt mussten: wenn ich hingefallen war und mir das Knie aufgeschlagen hatte und ich mich nicht beruhigen wollte; wenn ich Albträume hatte und zu viel Angst davor hatte, wieder einzuschlafen. Oder wenn sie mir eröffneten, dass meine Schwester und ich zu fremden Leuten gesteckt wurden.
»Hier ist es nicht mehr sicher«, fuhr Papa fort. »Mama und ich sind beide ohne Arbeit und ohne Aussicht auf neue Arbeit in absehbarer Zeit. Man hat uns aufgefordert, unser Haus zu verkaufen; es kann uns jetzt jeden Tag von den Nazis genommen werden, und der Almosen, den wir von der Obrigkeit bekommen, reicht uns kaum für einen Monat. Öffentliche Verkehrsmittel dürfen wir nicht mehr benutzen. Und jetzt noch die Ausgangssperre für Juden.«
Hannie hatte es gerade noch vor zwanzig Uhr nach Hause geschafft. Die neue Zeit, ab der Juden in ihrem Haus bleiben mussten.
»Ich passe besser auf«, sagte Hannie schnell. Ihre Stimme klang nicht mehr so forsch wie sonst. Sie klang wie ein Kind, nicht wie die hartgesottene Fünfzehnjährige.
»Du kannst nichts dafür«, sagte Papa. Er griff ihr unters Kinn und hob es an. »Sieh mich an, Hannie.«
Sie sah mit glasigem Blick zu ihm auf.
»Es ist nicht deine Schuld, dass unser Land von Leuten besetzt wurde, die uns nur wegen unserer Religion, in die wir geboren wurden, hassen«, sagte Papa. »Nichts davon ist deine Schuld. Gar nichts. Verstanden?«
Hannie nickte.
Mama nahm meine Hand. »Es ist nur für eine kurze Zeit«, sagte sie. »Stellt es euch wie einen Ferienaufenthalt vor. Ihr könnt mit anderen Kindern spielen, ihr bekommt anständiges Essen, ihr geht zur Schule, spielt im Park –«
»Wie soll das denn gehen?«, entfuhr es Hannie. »All das dürfen Juden doch nicht.«
Mama zögerte, ehe sie antwortete. Als sie sprach, war ihr Flüstern so leise, dass ich sicher war, sie falsch verstanden zu haben.
»Ihr seid keine Juden mehr«, sagte sie.
»Wie meinst du das?«, fragte ich.
»Hier drinnen seid ihr immer Juden.« Papa berührte seine Brust. »In euren Herzen, im Geiste. Aber für eure Umgebung nicht.«
»Wir müssen also lügen?«, fragte Hannie. »Ich dachte, lügen sei immer unrecht.«
Papas Antwort war schroff. »Lügen ist auch unrecht, außer man hat es mit etwas zu tun, das noch viel unrechter ist und Lügen notwendig macht.«
»Denkt es euch mehr als vortäuschen, nicht als lügen«, sagte Mama. »Und denkt dran, es ist ja nicht für lange.«
»Wie lange?«, fragte ich. Ich konnte das kindische Jammern in meiner Stimme hören und wünschte, lieber zornig und aufgebracht zu klingen wie Hannie.
»So lange es eben dauert, um euch in Sicherheit zu wissen«, sagte Papa. »Und dann kommt ihr wieder nach Hause, und es gibt jede Woche Schokoladenkuchen, so wie früher.«
Mama drückte meine Hand. »Und sogar mit der Geheimzutat«, sagte sie mit einem schwachen Lächeln.
Ehe wir weitere Fragen stellen konnten, stand Mama auf, öffnete Fächer und Schubladen und holte Geschirr und Servietten heraus. »So. Kommt, bereiten wir alles vor«, sagte sie munter. »Sie werden bald hier sein.«
Während wir zusammen den Tisch deckten, versuchte ich, mir nicht auszumalen, was sie uns gerade gesagt hatten.
Ich verhielt mich, als hätte mich ihre muntere Stimme überzeugt.
Und ich tat so, als hätte ich nicht bemerkt, wie sie sich eine Träne fortwischte, während sie mir die Teller reichte.
Kapitel fünf
Liv, Gegenwart
Montags haben wir in der ersten Stunde Geschichte. Das ist eine der Unterrichtsstunden, die Karly und ich noch gemeinsam besuchen.
Seit dem beschämenden Debakel am Samstag haben wir uns nicht mehr gesprochen. Ich hatte ihr an dem Tag noch dreimal getextet. Gestern hat sie schließlich mit einem kurzen Text geantwortet: Sorry. Vergessen, dir die Planänderung mitzuteilen. Besser als gar nichts, denke ich mal.
Karly sitzt schon am Platz, als ich die Klasse betrete. Ich gehe zu ihr hinüber. Sie starrt auf ihr Handy und sieht mich erst, als ich mich gerade hinsetzen will. Sie blickt auf. »Der Platz ist belegt«, sagt sie.
»Oh. Ich …«
Ich was? Ich dachte, wir wären Freundinnen? Ich sitze doch immer hier? Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe?
Aber natürlich sage ich nichts dergleichen. Karly hat sich sowieso wieder ihrem Handy zugewandt und hört nicht mal zu. Mir brennen die Wangen. Ich stehe da und komme mir blöd vor. Wahrscheinlich starrt mich die ganze Klasse an.
Einen Augenblick später kommt Sal herein, direkt auf uns zu. Karly legt sofort ihr Handy weg und lächelt sie an. »Hier«, sagt sie, »den Platz habe ich für dich freigehalten.«
Sal drängt sich an mir vorbei und lässt sich neben Karly nieder. Sofort fangen sie zu tuscheln und zu kichern an – genau wie Karly und ich sonst.
Ich schleiche mich nach hinten. Neben einem Mädchen namens Gabi, das ich nicht gut kenne, ist ein freier Platz. Aber sie lächelt mir ein wenig zu, als ich näherkomme. »Kannst dich hersetzen, wenn du magst«, sagt sie und deutet auf den Stuhl.
»Danke«, sage ich erleichtert und setzte mich neben sie. Da betritt auch schon Miss Forshaw die Klasse.
»So, aufgepasst«, sagt Miss Forshaw, und es wird still im Raum. »Heue kommt ein neues Thema dran. Möchte jemand raten, welchen Teil der Geschichte wir uns ansehen?«
Ein Junge in den vorderen Reihen hebt die Hand. »Die Wikinger, Miss?«
»Nein, Thomas, nicht die Wikinger.«
»Die Tudors, Miss?«, fragt ein Mädchen in unserer Nähe.
»Auch nicht die Tudors, Adrienne«, sagt Miss Forshaw.
Ich bemerke, wie Karly Sal etwas ins Ohr flüstert, und sofort ruft Sal: »Die Höhlenmenschen vielleicht, Miss?«
Die Antwort bekomme ich nicht mit, denn Sal und Karly schütten sich aus vor Lachen. Sal blickt über die Schulter in meine Richtung, und ich begreife, um was es bei ihrem Scherz geht. Vor ein paar Wochen hatte ich eine Postkarte von einem Bild von Dad mit in den Kunstunterricht gebracht. Sal hatte gemeint, es sähe wie Höhlenmalerei aus. Karly hatte ihr beigepflichtet, obwohl sie Dads Bilder immer schön fand. Sie machen sich also über mich lustig. Mal wieder. Ich begreife nicht, was