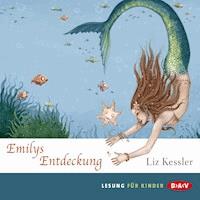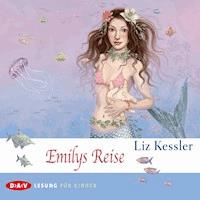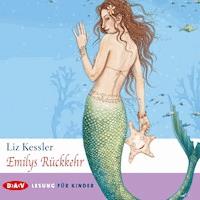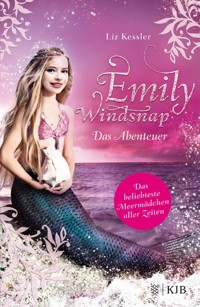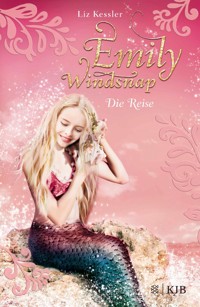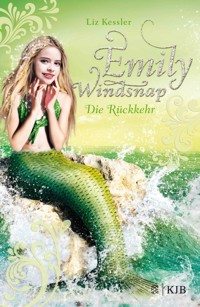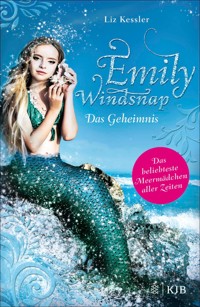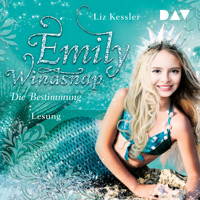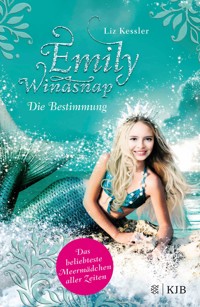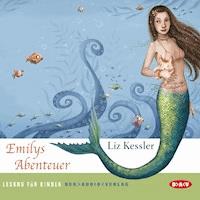14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautorin Liz Kesser erzählt in ihrem ersten Jugendroman eine unmögliche Liebesgeschichte – herzzerreißend und hoffnungsvoll zugleich! Als Joe von seinem Zimmer aus seine Familie in einem Umzugswagen davonfahren sieht, ahnt er, dass etwas Schreckliches geschehen ist. Und als er kein Fenster, keine Tür mehr öffnen kann und niemand seine Rufe hört, wird seine Ahnung zur Gewissheit: Er ist tot, er ist nur noch ein Geist. Als die sechzehnjährige Erin kurz darauf in dasselbe Zimmer einzieht, spürt sie sofort, dass sie nicht die Einzige darin ist. Zwischen Joe und Erin scheint die Trennung von Leben und Tod aufgehoben, und die beiden verlieben sich ineinander. Sie sind fest entschlossen, einen Weg zu finden, entgegen jeder Logik zusammen zu sein. Doch dann lernt Erin Olly kennen, Joes Bruder, der so real ist wie die Sonne und die ganze lebendige Welt da draußen. Erin muss sich entscheiden – nicht nur zwischen zwei Brüdern, sondern auch zwischen Traum und Realität, zwischen Tod und Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Liz Kessler
Meine Liebe ist jetzt
Aus dem Englischen von Eva Riekert
FISCHER E-Books
Inhalt
Dieses Buch ist dem Team der Folly Farm gewidmet, in Dankbarkeit für ihre Inspiration und Kreativität, das Austauschen von Ideen, das Lachen und den Spaß und einfach für das tolle Teamwork.
Wenn du zu mir kommst,
nehme ich dich ehrenvoll auf
mit Respekt und Güte.
Wenn du zu mir kommst,
lasse ich mein eigenes Leben fahren
und nehme deines an.
Wenn du zu mir kommst
im gleißenden Licht der Sonne,
die hinter die Baumwipfel taucht,
Dann weiß ich, dass du es bist,
und halte dir die Treue.
Komm bald. Komm schnell.
June Crebbin, 2014
1
Joe
»Was zum Teufel –«
Ein Laut wie ein Pistolenknall durchdringt meinen Traum, und ich schnelle hoch, zitternd, hellwach.
Ich taste meinen Körper ab. Scheint alles in Ordnung zu sein. Kein Blut.
Ein rascher Blick durch das Zimmer. Es ist dunkel. Die Zimmertür ist geschlossen. Habe ich sie gestern Abend zugemacht? Vielleicht habe ich es vergessen. Das wird es wohl gewesen sein. Der Knall. Nur die Tür, die im Wind zugefallen ist. Vielleicht habe ich außerdem das Fenster offen gelassen.
Ich schiele hin. Es ist zu, die Vorhänge bewegen sich nicht. Kein Wind, kein Luftzug. Um genau zu sein, ist hier rein gar nichts, stelle ich fest, als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. Also wirklich nichts. Nada.
Ich liege auf dem Boden.
Wo ist mein Bett? Wo ist mein Schrank? Mein Schreibtisch? Meine Kleider, die auf dem Boden verstreut lagen, hingeworfen, als ich gestern Abend ins Bett gegangen bin?
Ich versuche, mich an den Moment zu erinnern. Geht nicht. Muss wohl verpeilt gewesen sein.
Mir tut alles weh. Kein Wunder, nach einer Nacht auf dem Boden.
Ich strecke die Glieder. Das wird mein Bruder mir büßen. Es gibt solche und solche Scherze. Also wirklich, mein gesamtes Inventar zu klauen, nur so aus Spaß oder um mir was zu beweisen. Ich find’s gar nicht witzig – und was genau will er mir eigentlich beweisen? Dass ich zu viel schlafe?
Dad sagt immer, dass mich wach zu bekommen so ist, als müsse man einen Toten erwecken. Aber trotzdem, alle Möbel rauszuschaffen, ohne dass ich etwas gemerkt habe, ist ganz schön krass.
Ich stehe mühsam auf. Meine Beine sind wie aus Blei. Mein Körper schlaff wie eine Stoffpuppe. Keine Kraft. Ich kann kaum stehen. Ich lehne mich an die Wand und grüble, was passiert sein könnte.
Was ist mit mir los? Habe ich einen Kater? Ich versuche, mich an gestern Abend zu erinnern. Habe ich gefeiert? War ich aus, war ich betrunken?
Ich kann mich an nichts erinnern. Nichts, gar nichts, null. Wortwörtlich alles gelöscht.
Es durchrieselt mich eiskalt, kreist wie ein düsterer Wirbel in meinem Bauch, wird immer stärker.
Was zum Teufel passiert hier?
Ich stolpere zur Tür und greife nach der Klinke. Aber ich kriege sie nicht zu fassen. Meine Hände zittern. Ich greife immer daneben, rutsche ab – kann sie nicht mal spüren. Die Anstrengung ist zu viel für mich.
Das macht mir jetzt echt Angst. Ich kann nicht mal die Tür aufmachen? Ich bin ja noch übler dran, als ich dachte. Vielleicht bin ich immer noch betrunken.
Wie auch immer. Ich muss hier raus. Ich lehne mich an die Tür und rufe. »Olly!«
Keine Antwort.
Ich trommle dagegen, dann versuche ich es noch mal.
»OLLY! Mum! Dad!«
Als Antwort ein schwaches Echo. Dann wieder nichts. Stille. Keiner ist da. Keiner.
Wo sind sie denn nur alle? Warum bin ich nicht bei ihnen? Welcher Tag ist heute? Wochenende?
Alle Fragen bleiben offen, Panik steigt in mir hoch und versengt mich innerlich wie ein verästelter Blitz, der durch den Nachthimmel fährt.
Ich schleppe mich zum Fenster und lasse mich auf die Fensterbank sinken, um mich von diesem Kraftakt zu erholen.
Einen Moment lang schließe ich die Augen, um zu mir zu kommen. Während ich dasitze, kommt mir die vage Erinnerung, schon öfter so dagesessen zu haben. Ein Bild zuckt mir durch den Kopf: wie ich mich anlehne, mit angezogenen Knien, und mit tintenbefleckten Händen Gedichte oder Lieder in ein zerfleddertes Notizbuch kritzle.
Dann erlischt das Bild wieder.
Der kurze Erinnerungsblitz hilft mir nicht weiter. Eher vergrößert er den Sturm der Verwirrung, der in mir tobt.
Ich blicke aus dem Fenster. Die Sonne scheint. Der Garten steht voller blühender Narzissen, an den Bäumen hängen blassrosa Blüten.
Jetzt sehe ich sie endlich, sie stehen zusammengedrängt neben dem Baum. Olly, Mum, Dad. Sie reden miteinander.
Ihr Anblick gibt mir etwas Kraft, ich stehe auf und will das Fenster öffnen. Wie bei der Türklinke scheinen meine Hände ins Leere zu greifen. Meine Finger gehorchen mir nicht.
Warum bekomme ich den Griff nicht zu fassen? Ich muss doch das Fenster aufmachen. Muss nach ihnen rufen.
Ich starre hinaus auf die eng zusammenstehende Gruppe, meinen Bruder, meine Eltern. Sie sehen unglücklich aus. Was haben sie nur?
»Kopf hoch, Leute, der Tag ist herrlich, die Sonne scheint«, murmle ich düster vor mich hin.
Wieso kommt mir das bekannt vor?
Wieder ein Erinnerungsblitz: Dad sagt das zu uns – ist das einer seiner typischen Sprüche?
Dad, was hat denn der Wetterbericht mit meiner Stimmung zu tun?, denke ich unwillkürlich. Ach, genau. Das sagt Olly immer. Und Dad zuckt dazu nur die Schultern und lächelt. Mein Vater lächelt immer.
Jetzt allerdings lächelt er nicht.
Jetzt flüstere ich es ihm durch die blinde Scheibe zu.
Kopf hoch, Leute, der Tag ist herrlich, die Sonne scheint.
Ich versuche, an die Fensterscheibe zu klopfen, mit den Fäusten gegen das Glas zu hämmern.
Kein Geräusch. Meine Fäuste berühren das Fenster kaum. Ich spüre das Glas nicht mal.
Keiner schaut herauf.
Ich lasse mich wieder auf die Fensterbank sinken, hilflos, ohne etwas tun zu können außer hinauszublicken.
Mum hat einen Arm um Olly gelegt. Er schmiegt sich an sie, als wäre er noch klein. Es ist seltsam, meinen coolen großen Bruder so verletzlich zu sehen. Dad redet mit Mum. Sie nickt.
Worüber reden sie?
Dad löst sich von der traurigen kleinen Gruppe und geht über die Einfahrt auf einen großen Van zu. Er öffnet die hintere Tür und klettert hinein.
Mein Blick fällt auf das Logo auf der Seitenwand, und jetzt dreht sich mir der Magen um.
R&J Umzüge.
Umzüge?
Mein Kopf bemüht sich, die Aufschrift zu begreifen.
Sie ergibt aber keinen Sinn. Es ist, als ob jemand zehn verschiedene Puzzlespiele zusammengeschmissen und vermischt hätte. Die Teile passen nicht zueinander. Aus ihnen wird einfach nicht das Bild, das auf der Schachtel ist. Auf der Schachtel ist gar kein Bild.
Olly löst sich von Mum. Er lässt den Kopf so tief hängen, dass es aussieht, als ob sein Kinn an der Brust angewachsen wäre. Er kommt auf das Haus zu.
Endlich kommen sie mich holen! Alles wird gut. Ich hatte wohl einfach vergessen, dass …
Vergessen, dass wir umziehen?
Also echt, ja, so was zu vergessen ist ganz schön heftig. Aber immerhin haben sie mich nicht vergessen.
Kurz darauf geht die Tür zu meinem Zimmer auf, und da ist er. Ich fühle mich wie ein Mann, dem man kurz vor dem Verdursten einen Krug Wasser reicht.
»Olly!«
»Joe«, sagt Olly.
»Mann, Alter, einen Augenblick habe ich mir echt Sorgen gemacht«, sage ich, stehe vom Fensterbrett auf und lächle, während ich den Raum durchquere. Meine Beine gehorchen mir jetzt schon besser. »Ich dachte schon, ihr alle hättet mich –«
»Jetzt heißt es wohl Abschied nehmen.« Olly geht an mir vorbei. Seine Worte sind wie ein Schlag in die Magengrube, lassen mich rückwärtstaumeln. Wenn es noch da wäre, würde ich auf mein Bett fallen. Stattdessen bleibe ich mitten im Zimmer stehen, mit hängenden Armen und mit einem völlig verwirrten Kopf.
»Olly, was meinst du? Warum sagst du denn –«
»Ich kann es nicht fassen«, sagt er. Seine Stimme ist wie Metall. »Nichts von alldem. Ich kann nicht glauben, was ich getan habe, was du getan hast. Kann nicht glauben, dass ich dich nie wiedersehen werde.«
Mein Blut gefriert zu Eis.
»Olly.« Ich mache einen Schritt auf ihn zu. »Olly, Kumpel, warum solltest du mich nie wieder –«
»Wir haben aber viel Spaß zusammen gehabt, hier in diesem Zimmer, nicht? Bevor …« Er bricht ab. Sein Gesicht verschließt sich. Ich habe noch nie erlebt, dass er mich so ansieht. Als würde ich überhaupt nicht existieren.
»Ja. Klar doch. Natürlich«, erwidere ich. Dabei kann ich mich im Moment eigentlich an nichts erinnern. Abgesehen von Momentaufnahmen, die so schnell verschwinden, wie sie auftauchen, habe ich gar keine Erinnerungen – aber ich möchte ihm gerne zustimmen. Ich will, dass er mich ansieht. »Echt viel Spaß«, pflichte ich ihm bei. »Was hast du –«
Ollys Gesicht ist verschlossen wie eine zugeschlagene Tür. »Ich kann einfach nicht glauben, dass das alles vorbei ist«, flüstert er. »Also, weit weg werde ich ja nicht sein. Ich bleibe in derselben Stadt. Aber ich komme nie mehr in dieses Haus zurück. Das kann ich einfach nicht. Keiner von uns kann das.« Er redet wieder durch mich hindurch. Als ob er mich nicht sehen wollte. Nein – schlimmer als das. Als ob ich gar nicht da wäre.
»Olly, kannst du mich sehen?«, frage ich. »Kannst du mich hören?«
»Olly!« Das ist Dad, der von unten ruft.
Er wendet sich ab und ruft zurück. »Komme gleich.«
Dann, ehe ich ihn noch etwas fragen oder auf ihn zugehen kann, ehe ich irgendetwas tun kann, nickt er stumm. Ein trauriges Lächeln umspielt seine Lippen. Dann flüstert er: »Leb wohl, Joe«, wendet sich ab und geht.
In zwei Sekunden durchquere ich das Zimmer. Immer noch eine Sekunde zu langsam. Olly ist weg und hat die Tür hinter sich geschlossen. Ich greife nach der Klinke, bekomme sie wieder nicht zu fassen. Kann sie nicht berühren, kann die Finger nicht auf das Metall legen.
»Nein! Nein!«
Ich versuche, an die Tür zu hämmern, ohne jegliche Wirkung. Kein Geräusch. Ich höre nur Ollys Schritte, die auf der Treppe verhallen.
Ich lasse mich zu einem Häufchen auf den Boden sinken, lehne mich an die Tür und stütze den Kopf in die Hände.
Der Klang eines aufdrehenden Motors scheucht mich wieder auf.
Als ich am Fenster bin, sehe ich noch, wie Olly in der Einfahrt zu Mum tritt. Sie legt wieder einen Arm um ihn. Er schüttelt ihn ab. Sie sagt etwas zu ihm. Er schüttelt den Kopf.
Mum öffnet die Beifahrertür des Wagens. Ich nehme an, dass Dad schon am Steuer Platz genommen hat. Olly klettert hinein, Mum folgt ihm und schlägt die Tür zu.
Der Van ruckelt los, dann hält er noch mal an.
Ist ihnen eingefallen, dass sie mich vergessen haben?
Mum kurbelt ihr Fenster herunter. Beugt sich heraus, blickt zurück.
»Mum«, flüstere ich an die Scheibe.
Mum wirft stumm eine Kusshand in meine Richtung, dann dreht sie die Scheibe wieder hoch.
Der Motor heult auf. Der Van setzt sich in Bewegung, ohne Ruckeln diesmal, und fährt auf die Straße.
»Bitte«, flüstere ich. »Bitte fahrt nicht.« Meine Kehle brennt wie ein loderndes Feuer.
Der Van setzt den Blinker, biegt ab und ist fort.
2
Erin
Mum lässt ihr Fenster herunter, als wir uns dem Haus nähern.
»Hört mal, Mädchen«, sagt sie, dreht sich in ihrem Sitz um und lächelt mir und meiner kleinen Schwester Phoebe zu. »Was könnt ihr hören?«
Ich höre, wie sich meine Mutter unglaublich bemüht, mich davon zu überzeugen, dass ich das die ganze Zeit gewollt habe. Dass wir das alle gewollt haben.
»Das Meer!«, ruft Phoebe beflissen. Dafür bekommt sie ein noch breiteres Mum-Lächeln. Dann sieht Mum mich an. Ihr Blick sagt so viel wie: Bitte, Erin, versuch doch, glücklich auszusehen. Wir tun das für dich.
Ich bemühe mich nach Kräften, mein schlechtes Gewissen abzuschütteln und meine Angst zu verbergen. Beides soll meine Familie nicht belasten. Mum hat recht. Ihre unausgesprochenen Worte – die ich so laut höre, als ob sie durch ein Megaphon kämen – entsprechen ja der Wahrheit.
Das geschieht alles wegen mir. Das mindeste, was ich tun kann, ist, Dankbarkeit vorzutäuschen.
»Schön, Mum«, bringe ich hervor.
Sie nickt mit verhaltenem Lächeln. Wir sehen uns an. Die unausgesprochenen Worte erstarren zwischen uns zu Eis.
Dann bricht Dad den Bann. Er biegt in die Einfahrt, die Phoebe und ich noch nicht gesehen haben und die er und Mum ein einziges Mal besichtigt haben, stellt den Motor ab und sieht auf die Uhr.
»Der Umzugswagen kommt erst in ein paar Stunden«, sagt er. »Wer hat Lust auf ein Eis und will ein bisschen im schönen eiskalten Wasser planschen?«
»Ich!«, schreit Phoebe. Sie löst schon ihren Sicherheitsgurt und steigt aus dem Auto.
Mum wirft mir einen Blick zu.
»Geh du doch schon mal mit Phoebe an den Strand runter, ja?«, sagt sie zu Dad, als wir aussteigen. »Erin und ich schauen uns erst mal kurz das Haus an. Wir kommen dann nach.«
Ich weiß, was sie vorhat. Ich soll mich sicher fühlen. Ich soll alles unter Kontrolle bekommen, indem sie mir das Haus zuerst zeigt. Die Sache ist, dass sie damit nicht ganz unrecht hat. Ich möchte tatsächlich wissen, wo wir ab jetzt wohnen werden, ehe ich rumlaufe und so tue, als wäre der Strand das Größte.
Phoebe zerrt schon an Dads Ärmel. »Komm! Ich möchte ein Eis!«
»Okay, wenn du meinst.« Dad gibt Mum einen raschen Kuss auf die Wange und drückt meine Schulter. »Bis nachher.«
Mum nimmt meine Hand, als wir den Weg entlanggehen. Er ist ein bisschen zugewachsen, sieht aber so aus, als ob er liebevoll angelegt wurde. Gesprungene Steinplatten, zerzauste Stauden rechts und links, ein paar von diesen Solarleuchten, die im Boden stecken, windschief und kaputt.
Mum klimpert mit einem Schlüsselbund vor meiner Nase, als wir uns der Tür nähern. »Übernimmst du die ehrenvolle Aufgabe?«
Ich nehme den Schlüssel und schließe auf. Mum stupst mich, und wir treten ein.
Erster Eindruck? Ganz okay. Ein bisschen kalt. Ein bisschen dunkel. Aber ich finde es nicht grässlich. Ein großer Raum, fast ganz weiß gestrichen, abgesehen von ein paar Natursteinen. Ein bogenförmiger Durchgang in der Mitte. Ich denke mal, es waren ursprünglich zwei Zimmer. An einem Ende ein kleiner Fenstersitz. Ich gehe hin und blicke aus dem Fenster in den Vorgarten. Die Scheibe ist halb zugewuchert von Ranken. In der oberen linken Ecke ist ein staubiges Spinnennetz. Aber es ist hübsch hier. Friedlich.
Mum ist am anderen Ende des Raums. Sie winkt mich zu sich. »Hier geht’s in die Küche.« Ich folge ihr. Es ist ein schmaler, langer Raum mit einer langen Anrichte auf einer Seite. Am Ende ist Platz für unseren Küchentisch.
»Schön«, sage ich.
»Schau mal.« Mum schließt eine Tür auf, die in einen kleinen Hinterhof führt, der mit Steinplatten gefliest ist. In der hinteren Ecke steht ein Holzschuppen. Er hat etwas an sich. Alles hat etwas an sich. Irgendwie … ich weiß nicht. Traurig. Verloren. Verlassen.
»Ich geh mal nach oben«, sage ich.
Die Treppe vom Wohnraum führt zu einem Flur mit geschlossenen Türen. Hinter der ersten, direkt vor mir, ist ein kleiner Abstellraum. Dads Rumpelkammer, denke ich sofort. Dann fällt es mir wieder ein. Er braucht keine Rumpelkammer mehr. Sein Trödel kommt ja in einen Laden.
So haben sie mich rumgekriegt – sie haben mich überzeugt, dass das hier tatsächlich das ist, was sie machen wollen. Dad hat seinen verhassten Bürojob gekündigt, Mum will ihr Hobby, das Restaurieren von Möbeln, zu einem richtigen Job machen. Zusammen wollen sie versuchen, ihren Lebensunterhalt damit zu verdienen, alte Einrichtungsgegenstände aufzupolieren und sie mit Gewinn zu verkaufen. Das Ganze in dem Küstenort, in dem sie sich kennengelernt und ineinander verliebt haben. Vor mehr als zwanzig Jahren.
Klingt nett, oder? Man nehme außerdem eine verkorkste ältere Tochter und eine jüngere, die man aus dem Leben gerissen hat, das sie liebte, und das neue perfekte Leben kann beginnen.
Na ja.
Ich mache kehrt und schaue im Vorübergehen ins Badezimmer. Badewanne. Dusche. Klo. Waschbecken. Nichts Besonderes. Rechts von mir ist noch eine Treppe. Ich ignoriere sie fürs Erste und wende mich der Tür vor mir zu.
Als ich nach der Türklinke greife, überläuft mich ein Schauer. Als wäre jemand über mein Grab gelaufen. Ich habe es nie ausstehen können, wenn jemand das gesagt hat, aber dieser Satz kommt mir jetzt in den Sinn. Irgendwo muss ein Fenster offen stehen. Meine Arme sind von Gänsehaut überzogen. Ich reibe sie, schüttle den Schauer ab und drücke auf die Klinke.
Einen Moment sperrt sich die Tür, als ich sie öffnen will. Hat sich innen etwas verklemmt?
Ich drücke etwas fester dagegen, und auf einmal geht sie so leicht auf, dass ich fast ins Zimmer falle.
Es gefällt mir sofort.
Ich weiß nicht, warum genau. Es fühlt sich einfach wie mein Zimmer an. Es ist mein Zimmer, muss es sein.
Ich gehe umher und mache mich damit vertraut. Dunkler Holzboden, einfache saubere Tapete, cremefarben mit feinen senkrechten Streifen. Ab und zu sehe ich eine kahle Stelle, die aussieht, als ob jemand ein Stück Klebefolie abgerissen hat. Was da wohl mal hing?
Ich gehe durchs Zimmer. Am hinteren Ende gibt es einen begehbaren Wandschrank. Ich blicke hinein. Er ist dunkel und lang und liegt unter der Treppe, die zum Dachboden führt. Genau richtig, um sich als Kind ein Versteck einzurichten. Sogar eine Matratze hätte darin Platz, ein guter Ort für Mitternachtspartys.
Ich gehe wieder zurück. In der Wand zum Vorgarten befindet sich ein großes Erkerfenster. Es hat einen Sitzplatz, wie das kleine Fenster unten, nur größer. Ich stelle mir vor, zusammengekauert auf dicken Kissen dort zu sitzen, in mein Notizbuch zu schreiben und mich in ein Gedicht oder eine Geschichte zu vertiefen.
Ich ziehe die dünne Gardine beiseite. Der Blick auf den Vorgarten, wie unten. Jenseits der Straße liegen Reihen von Häusern, und man sieht einen Streifen Meer.
Ich setze mich auf das kalte Fensterbrett. Ja, da müssen unbedingt ein paar Kissen hin. Aber auch jetzt habe ich schon das Gefühl, angekommen zu sein.
Ich sehe mich um. Mein Bett könnte an die gegenüberliegende Wand passen. Die Kommode in die Ecke gegenüber vom begehbaren Wandschrank. Der Schreibtisch in die andere Ecke. Ich sehe es alles vor mir.
Auch wenn es noch leer ist, kann ich mir mein Leben hier vorstellen. Es ist nur ein Zimmer, aber es … ich weiß nicht … es strahlt irgendwie Energie aus.
Typisch, ich denke dummes Zeug wie immer. Ich sollte nicht mehr so rumspinnen – ich sollte mich wie eine normale Sechzehnjährige verhalten, nicht wie eine ältere Therapeutin. Wahrscheinlich habe ich zu viel Zeit mit älteren Therapeutinnen verbracht.
Zum ersten Mal fühlt es sich wirklich an, als könnten wir hier ein neues Leben beginnen. Ich kann mir vorstellen, dass es klappt.
Eigentlich gut so, denn es ist ja meine Schuld, dass wir hier sind.
Ich reiße mich zusammen. Nichts von alldem war meine Schuld. Ich kann fast hören, wie meine Therapeutin das sagt – und ich kann es so problemlos wiederholen, dass es mir die meisten Leute abnehmen würden.
Selbst daran zu glauben ist aber nicht so leicht. Wenn dir die anderen in jeder freien Minute einreden, wie wertlos du bist und dass es ohne dich allen viel bessergehen würde, dann setzen die Worte sich fester als alle Argumente, die andere dagegensetzen.
Und wenn sie alles, womit du dich gegen ihr Mobbing wehren willst, als Waffe gegen dich verwenden, verlierst du allmählich den Glauben, dass etwas, das sich gut anfühlt, wahr sein kann. Ihre Worte, ihr Lachen, der Hass – das bleibt alles tief in dir kleben, und wenn es da erst mal ist, kann man es kaum lösen, ohne sich selbst zu zerreißen.
Aber daran soll ich jetzt nicht denken. Ich soll nach vorne sehen. Das haben wir beschlossen. Ein Neuanfang für uns alle; kein Was-wäre-Wenn, kein Zurückblicken.
Und zum ersten Mal, seit Mum und Dad die Idee hatten, umzuziehen und einen Neuanfang zu machen, spüre ich den Hauch einer Möglichkeit, dass es funktionieren könnte.
»Erin!« Mums Stimme unterbricht meine Gedanken. »Bist du so weit? Wir sollten los, wenn wir noch an den Strand wollen, bevor die Umzugsleute hier sind.«
»Ich komme, Mum.« Ich stehe auf und gehe zur Tür, sehe mich aber noch ein letztes Mal um. »Bis bald«, flüstere ich. Dann trete ich zu Mum in den Flur, und wir machen uns zum Strand auf, um die anderen zu finden.
Was ziemlich einfach ist. Es ist ein kühler, windiger Abend, und Dad und Phoebe sind die Einzigen, die dort sind. Mum winkt, und sie schlendern auf uns zu.
Phoebes unablässiges Plappern bedeutet, dass ich nicht viel sagen muss, während wir gemeinsam durch den Hafen wandern. Ich nicke und sage »Mhm, ja, schön hier«, wenn Mum uns auf die Läden und Cafés an der Promenade aufmerksam macht. Ich hake mich bei Dad ein und lächle, während wir gemeinsam über das Kopfsteinpflaster stapfen. Ich lasse meinen Gedanken freien Lauf, während wir durch die altmodischen Gassen wandern und nach dem leerstehenden Laden suchen, den sie übernehmen. Wir müssen immer wieder umdrehen, weil wir uns fast an jeder Ecke verlaufen.
Ich schiebe den Gedanken fort, wie sehr ich hoffe, dass ich mich in diesem neuen Leben nicht verlaufe, nicht verlorengehe. Nicht noch einmal. Es ist ein Neuanfang.
Joe
Ich bin wach.
Aber wo bin ich?
Ich zwinge mein Gehirn zum Nachdenken. Wann war ich zuletzt wach? Es könnte Jahre her sein. Oder zumindest Monate. Ich habe das Gefühl, ständig in einem Wechsel von Schlafen und Wachen zu sein.
Etwas geschieht. Als ob etwas gegen meinen Rücken drückt. Was ist das? Tritt mich jemand? Mir wird klar, dass ich an der Tür lehne. Ich komme auf die Füße, muss mich hochrappeln, als würde ich von den Toten auferstehen. Dann geht die Tür auf, und ein Mädchen fällt praktisch ins Zimmer.
Ich weiche aus, teils vor Schreck, teils, um ihr aus dem Weg zu gehen, ehe sie uns beide umwirft.
»Wer bist du, verdammt nochmal?«, frage ich. Ich erschrecke vor meinen eigenen Worten. Meine Stimme klingt fremd, tief und rau.
Wann habe ich das letzte Mal etwas gesagt?
Ich sehe sie mir an. Sie trägt Jeans mit einem Riss am Knie und einen weiten blauen Pullover. Ihr Haar ist dunkel und steckt unter einer Wollmütze. Ein paar Strähnen fallen ihr ins Gesicht, als ob sie sich dahinter verstecken möchte. Sie trägt einen Nasenring.
»Hey«, sage ich. Diesmal deutlicher.
Sie antwortet nicht. Tut, als könnte sie mich überhaupt nicht hören.
Sie geht in meinem Zimmer umher, als ob es ihres wäre, streicht über die Wände, schaut in meinen Wandschrank, bleibt mitten im Raum stehen, wie um ihr Reich zu begutachten.
Ich reiße mich zusammen und folge ihr durchs Zimmer. Dabei bemerke ich, dass es leer ist – und da kommt mir eine Erinnerung.
Mein Zimmer. Ich bin aufgewacht, und es war nichts mehr drin. Wann war das?
Es ist immer noch leer. Bis auf das Mädchen.
»Hör mal, du kannst mich doch nicht einfach ignorieren«, sage ich zu ihr, als sie sich gerade wieder vom Schrank abwendet.
Sie beachtet mich nicht.
»He!« Ich greife nach ihrem Arm, aber sie ist schon weitergegangen. Zum Fenstersitz. Meinem Fenstersitz. Meinem Lieblingsplatz.
Sie setzt sich.
»Hey!«, sage ich lauter. Allmählich werde ich sauer. Was bildet sie sich ein? »Das ist mein Sitz.«
Sie ignoriert mich weiter und starrt einfach aus dem Fenster. Ich beobachte sie einen Moment. Ihr Ausdruck ist irgendwie seltsam. Erinnert mich an etwas. Oder an jemanden. Ich brauche eine Weile, um darauf zu kommen, an wen. An mich selbst.
Noch eine Erinnerung. Ich sitze auf der Fensterbank. Um Zuflucht zu finden, der Welt zu entfliehen.
Mein Ärger verfliegt ein bisschen. Ich habe aber immer noch keine Ahnung, was hier vor sich geht. Doch dann fällt mir wieder etwas ein. Ich erinnere mich, wie ich selbst aus dem Fenster gesehen habe. Aber es war anders. Der Garten fing an zu blühen, gelbe Narzissen überall. Jetzt ist er kahl. Nasses Laub auf dem Weg; wuchernde nasse Stauden, die flach und vernachlässigt daliegen.
Was ist mit dem Garten passiert? Was ist mit mir passiert? Ich schlucke das kalte Gefühl, das mir in die Kehle steigt, hinunter und versuche, mich zu erinnern. Nein, das ist eine Lüge. Ich will mich nicht erinnern. Ich will die Wahrheit nicht erfahren. Um genau zu sein, würde ich alles tun, um sie zu verdrängen.
Das Mädchen sitzt immer noch auf der Fensterbank. Wer zum Teufel ist sie? Kenne ich sie? Ich greife nach ihr, diesmal vorsichtiger. Meine Hand hält über ihrem Arm inne – ich weiß nicht, warum. Etwas hält mich ab. Dann schüttle ich mich. Sei kein Idiot. Also greife ich nach ihrem Arm.
Meine Hand gleitet glatt durch ihn hindurch.
Ich mache einen Satz zurück, als ob ihre Haut mich verbrennen würde, mich verseuchen.
Ein Geist! Ich habe ein Gespenst in meinem Zimmer!
Wirklich? Ist das möglich?
Ist irgendwas an dieser ganzen Situation zu verstehen?
Ich packe meine Hand und starre, starre einfach nur. Habe ich Drogen genommen? Halluziniere ich? Was zum Teufel passiert hier?
»Erin!«
Eine Stimme von draußen. Das Mädchen – Erin – antwortet. »Ich komme, Mum.« Ihre Stimme – sie löst etwas in mir aus. Ihr Ton. Irgendwie weich, aber auch abweisend. Offen, aber verhalten. Kann man so viel aus drei Wörtern heraushören?
Erin steht auf und geht durchs Zimmer.
Ich stehe mitten im Raum. An der Tür hält sie inne. Sie dreht sich um, eine Hand auf dem Türgriff, und ich schwöre, dass sie mich direkt ansieht, mir in die Augen blickt, als ob sie bis in mein Innerstes sehen könnte, aber auch, als ob sie einfach durch mich hindurchblicken würde. »Bis bald«, flüstert sie. Sagt sie das zu mir?
Und dann ist sie fort.
Zu spät, um ihr zur Tür zu folgen. Ich will hinaus. Möchte ihr nachgehen, möchte mehr wissen. Aber sie schließt die Tür, und ich weiß, noch ehe ich es versuche, dass ich den Griff nicht zu fassen bekomme. So viel ist mir vom letzten Mal in Erinnerung geblieben.
Kurz darauf höre ich murmelnde Stimmen und zwei Paar Füße, die nach oben ins Schlafzimmer von Mum und Dad gehen.
Mum und Dad.
Ein Bild von meinen Eltern taucht abrupt vor mir auf. Ich sehe ihre Gesichter vor mir, kann den Schmerz in mir spüren, während ich sie beobachte, spüre die Tränen, die nicht hinunterrollen, weil sie in mir zu Eis geworden sind.
Mein Vater weint ganz ungeniert. Meine Mutter gibt mir einen Kuss auf die Wange. Das Bild lässt mich auf die Knie stürzen, als ob mir jemand einen Stoß in den Bauch versetzt hätte.
So schnell, wie es aufgetaucht ist, ist das Bild wieder verschwunden. Aber die Erinnerung bleibt, wie eine Wunde, ein dumpfer Schmerz. Und mit dem Schmerz kommt die Erkenntnis, der ich ausgewichen bin – die ich aber nun nicht mehr ignorieren kann.
In diesem Haus spukt es nicht.
Zumindest spuken hier nicht ein Mädchen und seine Mutter.
Ich erinnere mich. Wie ich im Bett liege. Wie alle um mich herumstehen, meine Hand halten, meine Wangen küssen, sagen, wie sehr sie mich geliebt haben. Ich erinnere mich an den Tag, an dem sie Abschied genommen haben. Der Tag, an dem ich gestorben bin.
Das Mädchen ist kein Geist.
Ich bin der Geist.
3
Erin
»Beeilt euch, Mädchen, wir kommen sonst zu spät.« Dad ruft die Treppe hinauf, und ich muss grinsen. Wir sind Hunderte von Kilometern fortgezogen, um in einer fremden Stadt neu anzufangen, aber einige Dinge ändern sich einfach nie. Genau das hat er, solange ich zurückdenken kann, an jedem Schultag die Treppe hinaufgerufen.
Dass seine Worte so vertraut klingen, tröstet mich, gibt mir Sicherheit. Was gut ist, denn ansonsten erscheint mir an diesem Morgen alles trostlos und unsicher.
Eine Erinnerung schießt mir durch den Kopf. Wie ich meine Schultasche packe. Voller Hoffnung. Aufgeregt. Der erste Schultag in der siebten Klasse. Meine Freundinnen aus der Grundschule gehen auf drei unterschiedliche Highschools in verschiedenen Stadtteilen. Nur zwei meiner engsten Freundinnen und ich kommen auf dieselbe Schule. Ich renne die Treppe hinunter auf die Einfahrt und auf die Straße.
Das Auto kam zu schnell; das haben später alle gesagt. Es war nicht meine Schuld.
Mein Bein war dreifach gebrochen, die Kniescheibe zertrümmert. Aber das war nicht das Problem.
Das Problem war, was der Unfall unter der Oberfläche anrichtete – was man nicht sehen konnte, was aber viel dramatischer war als mein gebrochenes Bein.
Das Problem war, dass ich keine Straße mehr ohne Panikattacken überqueren konnte.
Das Problem war, dass ich fast die ganze erste Hälfte des Schuljahrs versäumte – und damit die Gelegenheit, meinen Platz in der neuen Schule zu finden.
Ich habe ihn nie gefunden.
»Schätzchen, du wirst noch zu spät kommen.« Mums Stimme neben mir unterbricht meine Gedanken.
Ich schüttle die Erinnerung ab und sehe Mum an. Sie legt mir die Hand auf den Arm. »Alles in Ordnung, Liebling?«
Ich nicke.
Phoebe ist hinter mir. »Komm schon, Schwesterherz«, sagt sie. Ihr Mantel ist nicht zugeknöpft, ihre Bluse hängt heraus, sie ist so unbekümmert, so sorglos. Ich schiebe einen Anflug von Neid beiseite und folge ihr durch die Haustür.
Dad parkt das Auto am Ende der Straße, in der sich die Schule befindet. Phoebe sitzt wartend hinten im Auto, während Dad sich mir zuwendet. Er fasst mir unters Kinn und dreht meinen Kopf in seine Richtung. »Ein neuer Anfang, okay?«
Ich nicke. Ich kann jetzt nichts sagen. Ich bin zu sehr damit beschäftigt, meinen Puls zu beruhigen und langsam ein- und auszuatmen.
»Das hier ist ein kleines Seestädtchen«, sagt er jetzt. »Alle sind freundlich. Es ist was ganz anderes. Sei einfach du selbst, dann wirst du gut aufgenommen.« Er lächelt mir zu.
Mein Kopf befiehlt meinem Mund zurückzulächeln.
Mein Mund gehorcht, was Dad zu reichen scheint, denn er gibt mir einen Kuss und tätschelt mir das Knie. »Braves Mädchen. Bis heute Abend.«
»Wir kommen zu Fuß nach Hause«, erinnere ich ihn. Die Schule liegt nur anderthalb Kilometer von unserem Haus entfernt. Dad wollte uns heute hinfahren, weil wir beide einen Haufen neuer Bücher und Sachen mitnehmen müssen. Aber auf keinen Fall will ich ausgelacht werden, weil ich von meinen Eltern von der Schule abgeholt werde.
»Seid ihr sicher, dass ihr den Weg findet?«
»Wir kommen klar!«, sagt Phoebe und macht die Wagentür auf.
»Okay, aber wartet aufeinander, ihr zwei.«
Sie steigt aus. »Machen wir. Versprochen.«
Phoebes Unterricht hört vor meinem auf. Sie ist in der Siebten, und ich bin in der Zwölften. Sie steht ganz am Anfang der Highschool, und ich komme in die Oberstufe, auch ein neuer Abschnitt, daher muss keine von uns mitten in etwas hineinplatzen.
Das würde ich nämlich kein zweites Mal schaffen.
Phoebe hätte auch damit keine Probleme. Man könnte sie in jede neue Situation schubsen, sie würde sofort Freunde finden. So ist sie einfach. Immer so strahlend und herzerwärmend, dass alle sie gern um sich haben.
So ziemlich das Gegenteil von mir.
Ich steige aus. Dad beugt sich über den Beifahrersitz. »Wird schon werden«, sagt er, und zum ersten Mal wird mir klar, dass er sich Sorgen um mich macht. Natürlich tut er das. Er hat ja alles miterlebt, selbst wenn ich nie erzählt habe, wie es wirklich war. Er und Mum sahen nur, wie ich über zehn Kilo Gewicht verlor und mich immer mehr in mich selbst zurückzog. Sie fanden mich an dem Tag, als ich …
Nein. Daran denke ich nicht. Jetzt nicht. Ein neuer Anfang. Ich hole tief Luft. So tief ich kann. Ich mache, was mir meine Therapeutin beigebracht hat: stelle mir vor, dass mein Atem von meinen Zehen durch den ganzen Körper strömt – dann atme ich aus und werde die alte Luft los.
Und ich mache, was mir immer hilft, mir einzubilden, dass ich meine Situation im Griff habe. Ich mache eine mentale Liste.
Drei Gründe, keine Angst zu haben:
Keiner weiß hier etwas über mich.
Die alten Mobber muss ich nie mehr sehen.
An einem Ferienort an der See sind die Leute nett zu einem.
Der dritte Punkt ist eine Vermutung, denn ich kann ihn nicht belegen, aber er hört sich an, als ob er stimmen könnte. Und diese Gedanken helfen mir, mein Atem wird ruhiger.
»Ich weiß, Dad«, sage ich schließlich und werfe die Tür zu.
»Bis später, Dad«, sagt Phoebe unbekümmert. Gemeinsam gehen wir die Straße entlang.
»Wir treffen uns nach der Schule hier«, sage ich zu ihr, als wir durch das Schultor treten. »Ich komme später als du. Warte einfach auf mich, okay?«
»Ich kann wirklich allein nach Hause gehen«, sagt sie. »Du musst mich nicht begleiten. Ich kenne den Weg.«
»Nein. Warte auf mich. Wenigstens an den ersten paar Tagen. Wir kennen uns hier noch nicht so richtig aus – besser, gemeinsam zu gehen.«
Phoebe sieht mich an. Mit einem Blick, wie ihn nur Elfjährige draufhaben. Der besagt, dass sie besser versteht, wie es auf der Welt zugeht, als du es je verstehen wirst.
Erinnerungen machen sich breit, ehe ich es verhindern kann. Allein auf dem Heimweg. Auf Umwegen vorbei an den Feldern und dem Treidelpfad am Kanal, damit ich keine Straßen überqueren muss. Mit meinen Lieblingssongs im iPod-Kopfhörer. Ganz in die Musik vertieft, dann plötzlich umzingelt.
Kaylie, Heather, Darcy. Wer noch? Wie viele waren es beim ersten Mal? Sechs, sieben? Mehr? Damals waren es nur alberne Namen. Traumatussi. Beim ersten Mal. Jede Woche erfanden sie etwas Neues, jeder neue Name trieb mich immer tiefer in meinen Schutzpanzer.
Ich sehe Phoebe an und versuche, ihrem Blick nicht auszuweichen. Weiß sie es? Weiß sie, dass ich sie mehr brauche als sie mich?
»Ja, du hast recht«, sagt sie schließlich und beugt sich vor, um mich kurz zu drücken. »Mum bringt mich um, wenn mir auf dem Heimweg was passiert und ich nicht auf dich gewartet habe.«
Ich lache über ihre Logik und über ihre Großzügigkeit. Sie mag ja fünf Jahre jünger sein als ich, aber sie hat es miterlebt; auch sie weiß, was ich durchgemacht habe.
Ich gebe ihr einen raschen Kuss auf den Kopf. »Dann bis nach der Schule«, sage ich.
Eine Sekunde später, nachdem sie sich kurz übers Haar gestrichen hat, um meinen Kuss wegzuwischen, ist sie auf und davon.
Und ich stehe allein auf dem Schulhof.
Ich lerne zwei Dinge an diesem ersten Schultag. Erstens: Schule bleibt Schule, ob in der Großstadt oder in einem kleinen Ferienort. Überall gibt es Lehrer und Hausaufgaben und Schüler, die sich alle kennen. Zweitens: In der Oberstufe geht es wenigstens nicht mehr um französische Grammatik oder um quadratische Gleichungen.
Für mich war immer klar, dass ich englische Literatur, englische Sprache und Geschichte als Wahlfächer nehmen wollte. Beim vierten Fach war ich mir nicht sicher. Schließlich entschied ich mich für Psychologie, kurz bevor wir hierherzogen. Wahrscheinlich, weil ich mich in der letzten Zeit für Psychologie zu interessieren begann. Kann man doch mal versuchen. Am Ende des ersten Jahres der Oberstufe müssen wir sowieso ein Fach wieder abwählen, daher mache ich, was Mum immer »sich alle Möglichkeiten offenhalten« nennt.
Am Schwarzen Brett sehe ich, dass es eine AG für Kreatives Schreiben gibt. Ich überlege. Einerseits habe ich Lust darauf – aber ich bin ziemlich sicher, dass es bedeutet, meine Texte laut vorlesen zu müssen, und so etwas würde ich in Millionen Jahren nicht machen. Also schreibe ich mich nicht ein.
Als Neuling wird mir eine Partnerin zugeteilt, die Brooke heißt. Sie führt mich eine halbe Stunde lang im Eiltempo durch die Schule. »Hier gibt’s Mittagessen. Die besten Klos zum Tratschen sind die hier. Zum Schminken eher diese. Der Raum für Englisch ist dort. Psychologie den Gang entlang und dann links, da ist auch die Kantine. Noch Fragen?«
Ich sage, dass ich alles begriffen habe. Ihr Lächeln sagt so viel wie: Ich bin nett, aber ich habe nur gemacht, was ich soll, und habe meine Schuldigkeit jetzt getan. Dann sagt sie noch, ich soll sie ansprechen, wenn ich etwas brauche, und überlässt mich meinem Schicksal. Ich sehe sie den restlichen Tag nicht wieder.
Was mir recht ist. Ich möchte schließlich keinem zur Last fallen, und ich mag auch nicht mit irgendjemandem, den ich gar nicht kenne, Smalltalk machen, nur um keine Stille aufkommen zu lassen.
Danach ist der Tag in erster Linie damit ausgefüllt, Kurspläne zu organisieren, die Gänge entlangzuschlurfen und denen zu folgen, die dieselben Fächer haben wie ich. Am Ende des Tages habe ich das Gefühl, alles einigermaßen im Griff zu haben.
Womit ich meine, dass ich weiß, wohin ich wann muss. Und womit ich auch meine, dass ich glaube, hinter die Hackordnung gekommen zu sein. Ich habe eine Gruppe von Mädchen ausgemacht, die zu den Coolen zu gehören scheinen. Die Anführerin ist eine gewisse Zoe, der zwei oder drei andere hinterherlaufen, die ihre Haare alle fünf Minuten im genau gleichen perfekten Schwung zurückwerfen.
Diese Mädchen kenne ich. Oder Mädchen wie diese. Zoe hat perfekte blonde Haare, perfekte Klamotten, ein perfektes Lächeln. Ein Lächeln, das dich entweder erwärmt, wenn du in ihre Nähe kommst und sie dich meint, oder vor dem du weglaufen willst, wenn es sich in ein kaltes, spöttisches Lachen verwandelt.
Ein paar ihrer Anhängerinnen haben ebenfalls blonde Haare, nicht ganz so perfekt wie ihre, aber man kann sehen, dass sie sich nach ihrem Vorbild stylen. Dieselben Angewohnheiten, die Röcke alle gleich lang. Die Einzige, die sich von den anderen unterscheidet, ist ein Mädchen mit dunklen Haaren, dunklem Teint und einem Lächeln, das natürlicher wirkt. Wenn sie nicht zu dieser Gruppe gehören würde, würde ich wahrscheinlich sogar zurücklächeln. Aber vorerst beschließe ich, lieber einen weiten Bogen um die ganze Clique zu machen.
Dann gibt es die Gruppe der Sportskanonen, die der Nerds, der Emos. Und die Einzelgänger. Genau wie überall.
Und nein, ich stoße nicht plötzlich rein zufällig auf eine perfekte beste Freundin, mit der ich auf der Stelle zusammenwachse.
Und ja, alle anderen kennen sich schon, und ich merke, dass die verschiedenen Gruppierungen fest verankert sind. Weshalb ich mich in den Pausen hauptsächlich in einer der Toiletten aufhalte (die von Brooke auf unserer Blitztour durch die Schule als »gut, wenn du mal für dich sein willst, wenn du verstehst, was ich meine« beschrieben wurde) und mein Mittagsbrot in der Bibliothek esse, während ich vorgebe, in ein Buch vertieft zu sein.
Alte Gewohnheiten sind eben nicht totzukriegen.
Aber zumindest überstehe ich den Tag ohne Panikattacke. Was heißt, dass ich mittags nicht in eine Papiertüte atmen muss.
Was bedeutet, dass mich keiner Tütentante nennt und die Klasse so zum Lachen bringt, dass der Name während der nächsten fünf Jahre an mir klebenbleibt.
Also tatsächlich, relativ gesprochen, ein ganz guter Tag.
Genauso sage ich es Mum, als wir nach Hause kommen und sie sofort ruft: »Wie ist es gelaufen?«
Sie kann nicht anders, sie macht ein erleichtertes Gesicht, als ich antworte: »Ganz gut, Mum.«
Was mich nicht ärgern sollte, aber irgendwie tut es das.
Phoebe rettet den Augenblick. »Super!«, ruft sie, dann macht sie sich über den Kühlschrank her und berichtet Mum von ihrem Tag.
»Ich bringe mal meine Sachen rauf«, sage ich und gehe nach oben, ehe Mum mich weiter ausfragen kann.
Sobald ich in meinem Zimmer bin, geht es mir besser. Dieses Zimmer hat eine seltsame Wirkung auf mich. Es beruhigt mich, hier fühle ich mich sicher.
Ich stelle meine Tasche ab, öffne die Nachttischschublade und nehme mein Notizbuch heraus. Niemals würde ich es mit in die Schule nehmen. Den Fehler habe ich ein Mal gemacht. Wenn man ein Mal gehört hat, wie die intimsten Gedanken auf dem Schulhof einer johlenden Menge vorgelesen werden, passiert einem das nie wieder.
Die Erinnerungen an die Vergangenheit wirbeln mir durch den Kopf und vermischen sich mit dem, was ich mir für die Zukunft vorgenommen habe.
Ich kuschle mich auf den Fenstersitz und fange an zu schreiben.
Liege am Boden,
zwei Mädchen mit meinem Notizbuch
lachen,
mein Gesicht heiß vor Tränen, den Kopf
gesenkt vor dem Regenschwall
meiner Worte.
Bin im Badezimmer,
der Wasserhahn läuft,
sehe mich weinen
im Spiegel,
mit roten, verquollenen Augen
und nutzlos.
Öffne eine Dose
mit gehackten Tomaten,
schneide mir in den Finger,
weiß nicht,
welches Rot von mir ist.
Höre den Satz:
Nicht deine Schuld, Erin.
Starre auf den grauen Teppich,
bis er verschwimmt,
nutzlos, ohne Gefühl,
eine Schachtel Pillen in meiner Hand.
Beginne von vorn,
es ist nicht das Gleiche,
ist es nicht, nie mehr,
ich lasse es nicht zu.
Sie kriegen mich nicht unter.
Joe
Sie sind jetzt seit zwei Wochen da. So bin ich drauf gekommen:
Nachdem ich aufgewacht war und sie das erste Mal gesehen hatte, gingen Veränderungen mit mir vor. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass jemand in meinem Zimmer ist, ob das ausreicht, um mich wach zu halten, oder daran, dass ich monatelang den Schlaf der Toten geschlafen habe und keinen Schlaf mehr nötig habe. Ich weiß nur, dass ich die Sonne vierzehnmal abends untergehen und morgens wieder aufgehen sah, seit sie da ist. Und ich schlafe nicht mehr.
Ich glaube, ich werde stärker.
Was das bedeutet, weiß ich allerdings auch nicht. Ich versuche, nicht zu hoffen, dass ich immer kräftiger werde, bis ich wieder zum Leben erwache. Die niederschmetternde Enttäuschung, mich geirrt zu haben, könnte ich nicht ertragen.
Aber kürzlich ist mir ein Gedanke gekommen. Vielleicht liege ich im Koma oder so was? Vielleicht komme ich ja wirklich wieder zurück? Vielleicht bin ich nicht richtig tot? Ich könnte mich sozusagen in einem Zwischenstadium befinden und muss darin verweilen, bis … ich weiß auch nicht, bis ich einen Test bestehe oder so, und dann finde ich zurück ins Leben.
Natürlich weiß ich, dass das unmöglich ist. Aber vor meinem Tod hätte ich auch gesagt, dass das, was jetzt passiert, unmöglich ist. Wer will also behaupten, dass ich falschliege?
Keiner.
Vor allem, weil keiner da ist, der etwas sagt. Denn keiner kann mich hören oder sehen.
Weil ich tot bin.
Ich weiß also, dass es ein Wunschtraum ist. Aber der ist alles, was ich habe; und die einzige Art, die Tage zu überstehen, ohne komplett durchzudrehen, ist, mir selbst Geschichten mit gutem Ausgang zu erzählen. Das ist wohl einer der Vorteile, wenn man niemanden zum Reden hat: Keiner sagt mir, ich soll nicht so viel denken, sondern anfangen zu leben.
Ha. Leben. Schön wär’s.
Ich habe jeden Sonnenaufgang gezählt, zwinge mich, mir die Zahlen zu merken, die jeden Tag zusammenkommen. Mein Gehirn gewöhnt sich langsam an diese Aufgabe. Jeden Morgen verscheuche ich den Nebel aus meinem Kopf, gehe alles durch, was ich weiß – was nicht viel ist –, und versuche, mindestens ein Detail hinzuzufügen.
Gewöhnlich sind das Kleinigkeiten wie: Heute ist Sonntag. Das habe ich gestern erfahren. Ihre Mutter stand in der Tür und sagte: »Erin, ich weiß, dass heute Sonntag ist, aber das heißt doch nicht, dass du den ganzen Tag im Bett bleiben musst.«
Den restlichen Tag verbrachte ich damit, mir ins Gedächtnis zu rufen, wie die anderen Tage heißen. Hab’s schließlich geschafft. Heute ist Montag. Wochenbeginn. Ich weiß noch, was das bedeutet. Es bedeutet Schule, es bedeutet Arbeit.
Es bedeutet, dass alle das Haus verlassen.
Es ist der erste Tag des neuen Schuljahrs und der erste Tag seit ihrer Ankunft, an dem ich ganz allein bin. Ich dachte, das wäre das, was ich wollte. Mein Zimmer wieder für mich zu haben. War aber nicht so.
Es war zu kalt im Zimmer ohne sie.
Jetzt ist sie da. Sitzt auf meinem Platz. Das macht mir nichts mehr aus. Es gefällt mir. Es gefällt mir, dass sie versteht, was für ein besonderer Platz das ist. Es gefällt mir, dass sie dort schreibt. Ich möchte ihr sagen, dass ich das auch so gemacht habe. Wenn ich nur könnte. Ich weiß, das geht nicht.
Aber ich kann ihr zusehen. Wie sie innehält und am Stift kaut. Ich erinnere mich, dass ich das auch gemacht habe.
Ich möchte sehen, was sie schreibt. Ich nähere mich ihr langsam.
Das sollte ich nicht. Es fühlt sich falsch an. Ich spioniere doch nicht. Ich bin nicht hinterhältig. Es ist ihre Privatsphäre. Ich kann mich an das Gefühl erinnern; ich darf da nicht eindringen.
Aber dann ändere ich meine Meinung, denn ich sehe etwas. Einen Tropfen, der aus ihrem Auge auf das Papier fällt. Sie weint. Das lässt mich dahinschmelzen.
Warum weint sie?
Ich möchte es wissen. Ich kämpfe ein paar Minuten mit mir. Am Ende gewinnt meine Neugier. Schließlich wird sie es ja nie erfahren, oder? Und ich kann es niemandem weitersagen.
Ich schleiche heran und werfe einen Blick auf die Seite.
Starre auf den grauen Teppich,
bis er verschwimmt,
nutzlos, ohne Gefühl
Ich löse den Blick von den Worten. Komme mir vor wie ein Dieb, ein Eindringling.
Wieder fällt ein Tropfen auf das Papier, und ich möchte sie so gerne berühren. Ihr übers Haar streichen, sie trösten. Sie würde es nicht spüren, deshalb weiß ich, dass ich ihr keinen Trost geben kann. Aber ihr Schmerz vermischt sich mit meinem; ihre Tränen sind wie eine Brücke zwischen uns, die ich überqueren will, mehr als alles, was ich bisher wollte.
Ehe ich mich daran hindern kann, strecke ich die Hand nach ihr aus, selbst wenn es nichts bringt.
Ich weiß, dass ich durchdrehe, wenn meine Hand einfach durch sie hindurchgleitet wie beim letzten Mal. Und ich weiß, dass sie nichts merken wird, dass ich nie in der Lage sein werde, Verbindung zu ihr aufzunehmen, sosehr ich mir das auch wünsche.
Und dann werde ich fast ohnmächtig, als ich ihr weiches Haar an meiner Handfläche spüre.
Nur, dass Tote nicht ohnmächtig werden können, soweit ich weiß.
4
Erin
»Iiieeeh!« Ich springe vom Fenstersitz auf, fahre mir mit den Fingern durchs Haar und reiße mir das Top vom Leib.
Mum kommt wie der Blitz die Treppe herauf und in mein Zimmer. »Was ist passiert?«, fragt sie. Ihr Gesicht ist gerötet und ihr Blick voller Sorge.
Ich beuge mich vornüber, schüttle die Haare wie ein verpeilter Headbanger und halte mein Top von mir weg. »Spinne«, sage ich. »Eine riesige, glaube ich.«
Mum seufzt erleichtert auf. »Ich dachte schon, es sei was Schlimmes passiert«, sagt sie.
»Es war etwas Schlimmes! Ich hab sie auf dem Haar gespürt, sie war so groß wie eine Hand, Mum. Schau mal nach.«
Mum inspiziert mein Haar, meinen Rücken, das Fenster, den Boden. »Nichts zu sehen«, sagt sie. »Wo bist du gewesen?«
»Auf dem Fenstersitz.«
Sie deutet auf die Gardine. »Wahrscheinlich hast du die gestreift«, sagt sie und schiebt sie beiseite. »Da ist keine Spinne, glaub mir.«
Mein Atem hat sich wieder beruhigt. »Na gut. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht erschrecken.« Ich komme mir etwas albern vor.