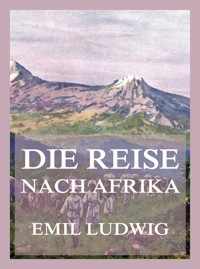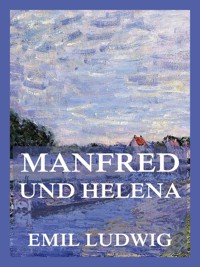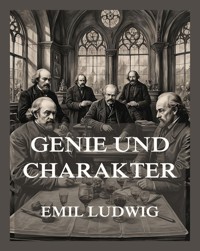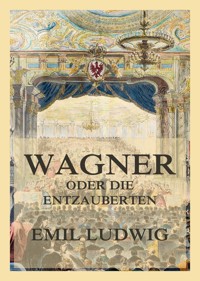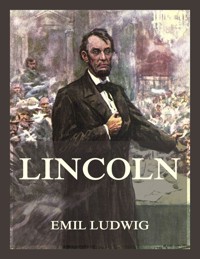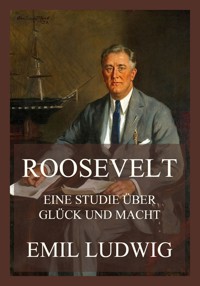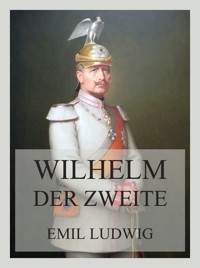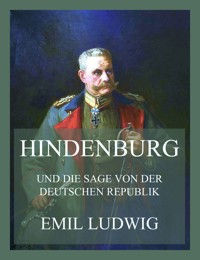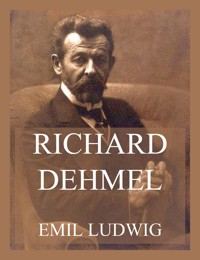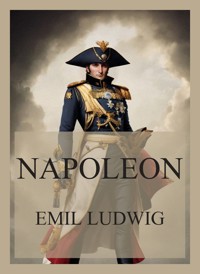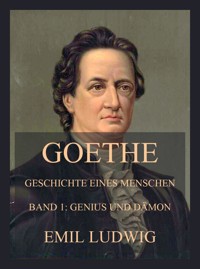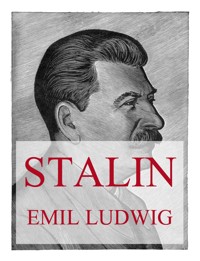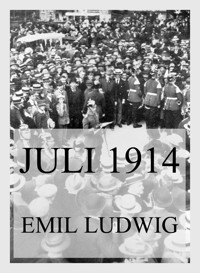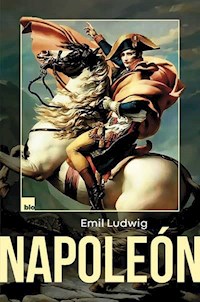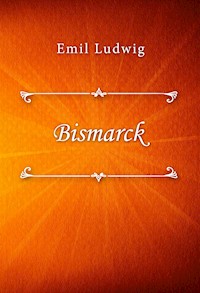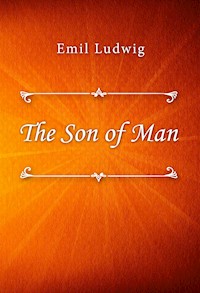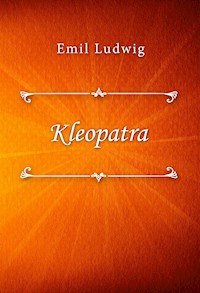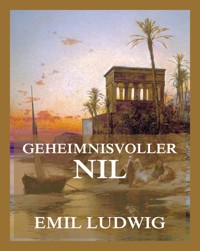
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Geheimnisvoller Nil" beschreibt Emil Ludwig, eigentlich bekannt für seine überaus detailreichen Biographien, seine Reise von den Quellen des mächtigen afrikanischen Stroms bis zu dessen Delta im weit entfernten Ägypten. Ludwig zeichnet dabei nicht nur Skizzen der Völker und deren Bräuche, sondern auch unnachahmliche landschaftliche Szenen, die den Leser Teil dieser langen Fahrt werden lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 858
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Geheimnisvoller Nil
Sechs Jahrtausende zwischen Mondgebirge und Mittelmeer
EMIL LUDWIG
Geheimnisvoller Nil, E. Ludwig
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849680600
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
VORWORT DES HERAUSGEBERS. 1
ERSTES BUCH. FREIHEIT UND ABENTEUER.. 2
ZWEITES BUCH. DER WILDERE BRUDER.. 71
DRITTES BUCH. DER KAMPF MIT DEM MENSCHEN.. 111
VIERTES BUCH. DER BEZWUNGENE STROM... 222
FÜNFTES BUCH. DAS GOLD AN DER MÜNDUNG.. 313
VORWORT DES HERAUSGEBERS
Lieber Leser,
in diesem, in den 1930er Jahren erstmals erschienenen Werk, benutzt der Autor in Zusammenhang mit den Einwohnern des Schwarzen Kontinents Worte und Beschreibungen, die heute nicht mehr zeitgemäß, geschweige denn akzeptabel sind. Wir weisen hier explizit darauf hin, dass Ludwig mitnichten Rassist war und selbst unter Hitlers Vorgehen und Literaturverständnis zu leiden hatte. Das Werk ist in diesem zeitgenössischen Zusammenhang zu verstehen.
Der Heruasgeber
ERSTES BUCH. FREIHEIT UND ABENTEUER
„Seht den Felsenquell,
freudehell,
wie ein Sternenblick;
über Wolken
nährten seine Jugend
gute Geister
zwischen Klippen im Gebüsch.
Jünglingfrisch
tanzt er aus der Wolke ...
und mit raschem Führertritt
reißt er seine Bruderquellen
mit sich fort.“
Goethe
I.
Brausend verkündet sich das Element. Mit Getöse stürzt sich um das Riff einer Felseninsel in zweigeteiltem Wasserfall ein glänzendes Riesenband, hellblau strahlend in seiner lebenden Spannung, bis sich’s im Strudel unten zu milchig grüner Gischt färbt, mit sich reißend den eigenen Schaum, ungestüm fort, dem unbekannten Schicksal zu. In solchem Dröhnen wird der Nil geboren.
Am Rande des gewaltigen Wasserfalls, in einer stilleren Bucht öffnet sich rosa ein Riesenmaul. Zwischen rosa gefütterten Ohren, gähnend, prustend und faul, speit das Nilpferd den Strahl aus dem Nasenloche, schnaubend und brummend hebt es den Kopf übers Wasser. Unterhalb, wo sich die Wasser beruhigen, dehnen sich auf einem Felsen unter dem Schaum ein paar bronze-grüne Drachen, mit schwarzen Flecken auf dem Schuppenpanzer, unten gelblich, und um sie vollends märchenhaft zu machen, blicken sie aus goldgeränderten Augen; jeder hat einen weißen Vogel auf dem Rücken, einem pickt er zwischen die Zähne, denn dieser Drache schläft mit offenem Maul. Das ist der Leviathan aus dem Buche Hiob, das Krokodil. Fremd scheint es aus einer Zeit herüberzuragen, als Farne und Schachtelwälder die Erde bedeckten und die Echsen die Welt regierten.
Über den vorweltlichen Ungeheuern aber kreist und wandelt, jagt und tummelt sich das gefiederte Wesen. Alles, was Nordafrika durchfliegt und vieles aus Europa, sammelt sich hier und überschreit das Rauschen. Auf der kleinen überbuschten Insel im Sturzbach, die nie ein Mensch betrat, an der Quelle des Nils liegt das Paradies der Vögel.
Jene weißen weichen Flecken, die wie Orangenblüten aus dem Dunkelgrün schimmern, verwandeln sich, wenn ein Geräusch sie aufschreckt, in weiße Reiher, die über die Fälle fliegen, die schwarzen Beine hinter ihnen her. Der mit dem komischen Löffel am Ende des Schnabels, nach dem er genannt wird, das weißeste Tier der Natur, scheint klein neben dem riesigen grauen, der seinen schweren Körper langsam, mit eingezogenen Schultern und kurz gemachtem Halse durch die Lüfte trägt. Plötzlich zischt es in das gewaltige Rauschen: ein großer, stumpf-schwarzer Vogel hat sich von den nassen Büschen der kleinen Insel ins Wasser fallen lassen, Kormoran, der berühmte Vielfraß, der nun Minuten lang untertaucht, an entfernter Stelle wieder heraufkommt und, den zappelnden Fisch im Schnabel, mit dem großen Flügelschlag eines Meervogels verschwindet. Missbilligend blickt solchem Spiel ein ernster schwarz-weißer Vogel nach, der beim Gehen den Kopf nach vorn fallen lässt und dann langsam, wie um die echte Würde zu beweisen, seine harmonisch gebogenen Flügel mit den gelben Streifen zu schönem Fluge öffnet: Ibis, der Heilige Vogel des Nils.
Stolz und silbern wie die Prinzen arabischer Legenden, stumm und unzugänglich stehen am Ufer die Kraniche. Der silbergraue mit dem herrlichen Blick, der auf zartem Halse den etwas zu schweren Kopf mit Eleganz zu tragen, die dunklen Schwanzfedern wie einen Strauß zu halten weiß, spreizt mit einem Mal ein paar Riesenflügel aus und zieht in langsam schleppendem Flug übers Wasser hin; aber sein schönerer Bruder, dessen Federn an Schwanz und Bauch bläulich schimmern, trägt einen goldenen Federbusch pfauenhaft auf dem Kopfe: der Königskranich, vornehm, farbenreich und dekadent wie die Königs-Bilder des van Dyck. Neben diesen Fürsten, etwas zurück wie sich’s gebührt, hässlich und komisch wie im Märchen, voll falscher Ruhe und Würde, rücksichtslos und vorsichtig, klug und gefräßig, so beteiligt sich der schwarz-weiße Marabu an jedem Geschäft, er nimmt alles mit, was sich bietet, von der Ratte bis zur Spinne.
Und zwischen den großen weben über der Quelle des Nils die tausend kleinen Vögel, schreiend, schwatzend, flötend: Sonnenvögel, aufglänzend in Wasser und Licht, türkisblau mit Orangefedern, rosafarben und rostrot, regenbogenhaft changierend, zwischen blauschimmernden Eisvögeln, von Glanzdrosseln überflogen. Bulbul, die orientalische Nachtigall, unsichtbar im Gebüsche, gluckst ihre Tonleitern hervor, aber dicht bei ihrem heimlichen Platze wehen in leise pfeifendem Flug die nordischen Schwalben vorüber, wie deutsche Dichter, die den Süden suchen und die orientalische Nachtigall. Und die rosa-grauen wilden Tauben gurren in tiefem Alt ihre Rufe, und kleine, blau-grün opalisierende Stare flöten in das Geschrei der großen Vögel, und die Mauerschwalbe benetzt im Sprühregen ihre braune Brust, und die Bachstelze, die, wie der Ibis, zum Nil gehört, der zierlichste von allen Vögeln, singt, wenn sie wippt. Alle umschwirren mit ihrem Konzert von Farben und Tönen die kleine, unerreichbare Insel inmitten der Wasserfälle, als fürchteten sie den Menschen mehr als das Nilpferd, mehr als das Krokodil und die großen Vögel. —
Wo sind wir?
Die Quelle des Nils, die Ripon-Fälle, dicht überm Äquator gelegen, 300 m breit, von den Eingeborenen „Die Steine“ genannt, stürzen nieder zwischen Urgestein, umgrünt heute nur von Wiesenblumen und Sträuchern, auf einer waldlosen Hochfläche, denn hier haben die Weißen den Wald wegen der tödlichen Fliegen niedergeschlagen. Es ist die Nordspitze des Victoria-Sees, bei Jinja, wo das gewaltige Rauschen ein großes Schauspiel anzeigt. Hinter grauen Felsen, die eine Art natürlichen Dammes bilden, jenseits der Bucht liegt mit großen und kleinen Inseln der See, der hier den Strom entsendet, den großen Boten Inner-Afrikas, um wunderbare Kunde an ein entferntes Meer zu tragen.
Niemand erriet seinen Ursprung, Jahrtausende lang suchten die Menschen diese Quelle und gingen in der Irre. Aus hohen Bergen, glaubten sie, müsste der seltsame Strom seine Kräfte ziehen, aus schmalen Bergbächen sollte auch dieser Strom sich bilden, wie andre auf Erden. Eines Tages, spät in der Zeit, es ist keine hundert Jahre her, fand sich’s, der Nil begann seine Bahn mit einem riesigen Wassersturze; als Kind des größten aller Seen Afrikas, im Schaum und Brausen seines ersten Tages zeigt er schon seine Kräfte.
Nur wenige Sturzwellen dieser ersten Lebensstunde werden ihr Ziel erreichen, Winde und Sonne, Felsen, Tiere und Pflanzen werden sie aufhalten oder verdampfen lassen; auch wird nicht alles, was spät im Mittelmeere nach einem Laufe von vielen Monaten endet, aus dieser Quelle stammen, denn der Nil hat drei Quellen und anfangs viele Zuflüsse. Aber es gibt Millionen von Wasser-Atomen, die den ganzen Lebensweg im Bett ihres Stromes zu Ende fließen, von diesem Quellsturz ab, bis sie zuletzt dem Salz des Meeres sich vermischen.
Hier oben, an der Quelle dunstet in Morgenschleiern der See, sein Ende kann niemand erkennen.
Mit steigendem Licht enthüllen sich Inseln, große und kleine, tiefe Schluchten, die ins Land einschneiden, Sandbänke weit hinaus, und draußen Hügelketten bis in die hellblaue Ferne. In weiten Wiesen streckt sich das erhöhte Ufer, schimmernd, von einzelnen mächtigen Bäumen bestimmt, Licht und Schatten in großen Komplexen verteilend, fruchtbar, idyllisch.
Doch auch wenn die Menge von Buchten und Inseln den Blick nicht bedrängte, könnte er niemals die fernen Ufer erreichen, denn dieser See ist ein Meer, viel größer als die Schweiz, mit eigenen Gesetzen, Formen und Gefahren, ein Element für sich mitten in diesem verzauberten Erdteil. Der Riesenspiegel ist er für die Sonne Afrikas, Grenze eines bukolischen Landes, das Uganda heißt. Man hat es dem Paradies verglichen, denn hier ist ewiger Sommer ohne tötende Tageshitze, ohne schwüle Nebelnächte, von 1100 Meter ab ansteigend, nachmittags durch Gewitter, abends durch Wind gekühlt, fast ohne Jahreszeiten, in täglichem Gleichmaß von Sonne und Regen, immer fruchtbar, immer schenkend.
Hinter dem Gürtel am See leben in Hügeln und Bergen verborgen die letzten Riesen der Vorwelt. Denn von den Ufern dieses seidenblauen Meeres erhebt sich in Terrassen das Land und steigt nordwestlich auf zu uralten Granitgipfeln und Vulkanen, zu den Quellen von Flüssen, die alle in den einen großen Strom einmünden sollen, bis zu den Schneegipfeln des Mondgebirges. Wie ein lockerer Panzer umgeben diese Gebirge den Park der begnadeten Menschen, die im Hochlande des Sees viel länger ernten als säen.
Ja, es ist ein Park am Ufer des Sees, geformt von der Natur und einer Menschenhand, die die Sonne gebräunt hat. Pastellgrün, doch durch ihre zarten Zweige das Licht lassend, so dass ihr Schatten nur grau auf die Wiesen fällt, stehen große Akazien einzeln da und breiten ihre Kronen wie geöffnete Fallschirme. Kurz über dem Boden verzweigt sich der dicke Hauptstamm in der Runde nach allen Seiten, trocken, knorrig, zartgrau, aber erst hoch oben beginnen überall die feingegliederten Blätter, und große lila Trauben hängen herunter. Über riesigen, breiten Wurzeln, die aus der Erde ragen, erhebt sich als eine Kuppel der Ficus-Baum, so schwer an Holz und Schatten, wie neben ihm die königliche Sykomore. In brennend roten Blüten wehen grazile Flamboyants gegen den See, aber das hell leuchtende Rot des Korallenbaumes sticht mit seinen Fingern steil in die Luft.
So stehen sie alle einzeln auf diesen wiesenhaften Hängen am See, fast unbewegt, Symbole einer Traumlandschaft.
II
Noch hat keine Menschenhand bauend oder bändigend sich an die Quelle des Nils gewagt, wenn sich auch mancher Wasser-Ingenieur an ihr verträumte. Aber bald unter der Quelle hat man ihn überbrückt: nur wenig abwärts, und eine graue Eisenbrücke trägt den Zug, der den Victoria-See mit dem Indischen Ozean verbindet, das kleine Meer mit dem großen. Erst 3000 Kilometer stromab, am Rande der Wüste, wird der gänzlich veränderte Nil eine zweite Brücke erleben. Auf dieser ganzen Strecke durch Länder und Völker — eine Naturbrücke ausgenommen kann niemand den Nil ohne Ruder überqueren; Menschen und Tiere haben’s versucht, sie liegen drin begraben. Auf unendlichen Strichen hat sich der unüberbrückte Strom als Scheide-Wasser zwischen einer Fauna und der andern erwiesen.
Den jungen Strom kümmert die Brücke nicht: in einer langen Folge von Fällen und Schnellen, sprühend und abgestoßen, von niemand zu bändigen, treibt er seine Kinderkräfte vor sich hin, im Schaum der Lebenslust. Ein zweiter Fall, der Owen-Fall, breit wie der erste, aber doppelt so tief, auch düsterer und wilder, steigert die Kette der Stromschnellen, und wenn man nach dem Lauf der Natur, nicht der Kultur rechnete, wären diese hier der Erste und Zweite Nil-Katarakt zu nennen. Ohne Atem zu holen, sprudelt der junge unschiffbare Strom in Windungen nach Norden weiter, aber jetzt ist er nicht mehr umgeben von Wiesen und geschnittenen Flächen. Da wegen der Schlafkrankheit niemand dies Gebiet bewohnen darf, ist der Strom hier mit dem Wald allein, so, wie sie beide aus der Hand des Schöpfers, aus Vegetation und Erosion der Jahrtausende hervorgegangen sind. Auf dieser Strecke seiner Bahn, nur auf dieser lernt der Nil den Urwald kennen.
Mit lebenden Wänden hängender Lianen schließt sich der Wald zu beiden Seiten des Stromes ab, verbirgt ihm die Kämpfe der großen Tiere in seinem Innern, wie man sie Kindern zu verbergen trachtet, und lässt tagsüber den Strom seine Spiele treiben. Was hinter jenen lebenden Wänden vorgeht, stammt aus Zeiten, da die Erde jünger, das Leben dichter, überschwänglicher war. In dieser Fülle unbekümmerten Wachstums, wo der Kampf der Individuen weniger nackt hervortritt als in den sparsamer bedachten Strichen des Nordens, hier wirken Tod und Leben unlösbar durcheinander; Pflanzen und Tiere, die nie eine Menschenhand berührt, bedingen einander im innersten Werden, auch wenn sich die Tiere bekämpfen. In der fließend grünen Dämmerung, die die Stimmung des Urwaldes bestimmt, krallen sich die Wurzeln ungeheurer Bäume um gefallene Vorgänger, während sich die Kronen, wie einsame und große Charaktere, aus dem Gedränge erheben, um oben mit andern die besonnte Gemeinschaft der Gipfel zu bilden. Was an ihnen wuchs, fällt ab, wird neue Fruchtbarkeit in dieser unverwüstlichen Lebenszone, denn die Früchte dieser Bäume erntet niemand. Dampfend, in brütender Liebeswärme, von jedem Zwecke genesen, liegt die Natur.
Immer höher steigt durch die Jahrhunderte der Boden des Urwaldes, ein feucht schwammiger Humus aus Blattwerk zeugt Wurzeln und Stängel aus den Zweigen schon fallender, noch lebender Baumriesen. Aus den zur Erde zurückgekehrten Stämmen, doch auch im Leib der lebenden Pflanzenkörper blühen neue aus saugenden Wurzeln empor, in furchtloser Freude des Wachsens, denn Frost und Hagel, die Feinde des Nordwaldes, und raue Winde von den nahen Schneebergen dringen nicht durch diese selbstgeschaffenen Mauern, aber die beiden großen Patrone der Pflanzen, Wärme und Wasser, herrschen im Überfluss. Der einzige Feind, der hier einzudringen wagt und stärker ist als die meisten, das vorweltliche Tier, das übrigblieb, als die andern kleiner wurden: der Elefant allein vermag mit seinen gewaltigen Organen niederzutreten und umzubrechen, was ihn stört. Ohne seinen mächtigen Schritt hätte der Mensch den Urwald nie betreten, denn er ist es, der dem Neger seine Pfade schlug, und eben diesen Pfaden folgt noch heute der Weiße mit seinen Straßen.
Und wie der Urwald von oben und unten zusammenwächst, wie Farne und Riesengräser vom Boden her den hängenden Lianen entgegenstreben, so entsteht das mauerartig Undurchdringliche, verhundertfacht im Laufe der Zeiten, weil der männliche Klang des baumfällenden Eisens diese summende Welt nie erschreckte.
Die Dichte des Waldes erzeugt seine Stille; nur aus der Ferne der Vogelrufe kann man auf seine Tiefe und nur auf einen Teil der Tiefe schließen. Das Murren der Affen, das Schwirren der Insekten, das Seufzen, Knarren und Ächzen der Riesenstämme, die nicht genug Luftraum um sich fühlen, das Gurgeln der Frösche aus dem Papyrus, der Ruf des Pirols, das Rascheln der großen Eidechsen, das seidene Gleiten der Schlangen und wieder das Locken und Knarren der Würger: lauter Töne, gedämpft wie das Licht dieses Waldes, zufällig und übertrieben wie Kinderstimmen, die in der Kirche laut werden; denn trotz aller Wildnis fühlt sich das Herz durch Dämmerung und Höhe an einen Dom gemahnt.
Unten, in dem enormen Stamme des Ficus, zwischen herabhängenden lila Orchideen, haben sich metertiefe Nischen gebildet wie an Dompfeilern, so dass ein Mensch drin stehen kann, während oben auf den überblühten Ästen alte Paviane sitzen, unbeweglich wie schwarze Statuen, gelangweilt von den Sprüngen des Kolobus-Affen, dessen weißer Schwanz und Rückenstrich aufglänzt, wenn er sich von einem Lianenstrang zum andern schwingt. Müde und unbewegt, wie alles Pflanzliche im Urwalde steht und hängt, undurchsichtig und schwül, wird er von Tieren nur auf eine unheimliche, verdeckte Art belebt, so dass die Farben der Blüten lauter wirken als Schritte und Töne der Tiere. Aus dem Gewirr von Schlingranken am Boden blinkt ein Stück von einer ruhenden Schlange hervor, ein Vogelschrei gewinnt erst durch den gleitenden Schatten des weißen Falken Bedeutung, und wenn auf dem Baobab, diesem Elefantenbaum mit seinen runzligen Lederfüßen, ein paar Papageien kreischen, so verhallt sogar dieser Ruf rasch in der Gewalt der Urwaldstille.
Aber der brennende Ruf der Korallenbäume dringt von den halb besonnten Enden feigenbaumartiger Zweige nieder, wie eine Art Riesenbohne, von den Fiederblättern der Akazien strahlen die handtellergroßen Rosenblüten, und die hellblauen Winden schlingen sich in Girlanden von den Ästen der Sykomore zum Flamboyant mit seinen dichtgedrängten, feuerroten Blüten.
In den Lichtungen, an halb entlaubten Teichen, dort, wo die Tropensonne durchbricht und die Fülle der Blumen sich verzehnfacht, haben ihre Farben weniger die Kraft des rufenden Tones; hier herrscht das Fier, denn alles findet sich am Wasser zusammen. Von den karminroten Winden, die die Mimosen einhüllen, dicht über das Wasser gehängt, blickt der türkisblaue Eisvogel unbeweglich spähend nieder, um den Fisch zu erhaschen. Schwankend schweben an den biegsamen Spitzen der Palmenwedel die Nester der Webervögel, die hier, an den luftigsten Enden, dem Griff der Affen und Schlangen zu entgehen wissen. Dort, wo die großen Farne halb faulend übers Wasser hängen, schwirren himmelblaue Segelfalter vorüber, andere weiße mit hellgrünem Flügelrande, blaue Eidechsen mit orangefarbenen Flecken sonnen sich zwischen Sumpf und Wasser.
Unter grotesken Bewegungen stößt der Nashornvogel seinen heiseren Ruf aus, als müsste er jeden Ton schmerzhaft in seinem Innern erzeugen, aber vom nächsten Baume flötet ein Blaustar vor sich hin, als wäre er allein in einer Idylle: der geborene Meister neben dem angestrengten Nachahmer. Beide werden vom Flötenvogel überstrahlt, der seinen verführerischen und zugleich höhnenden Oboen-Ton aus dem Gezweige sendet, als lebte er nur von Luft und Wasser, als forderte er die Wildheit des Urwaldes heraus und machte sich mit seinem schmelzenden Lockruf lustig über all den Lebensdurst und all die Schwere ringsumher, bis ihm eine Elster seine Harmonie zerschreit.
Doch fern von diesem spielenden Gewimmel leben und jagen, paaren und bekämpfen sich die großen Tiere des Urwaldes. Sie sind es, die abends an den Stromschnellen des Nils auftauchen, um sein frisches Wasser zu schlürfen. Da ist der Neger verschwunden, der am Tage in einer stillen Bucht badete und fischte. Den schweigenden Herren des Waldes lässt er abends den Vortritt, denn er fürchtet sie.
III
Erst 60 Kilometer unterhalb seiner Quelle beruhigt sich der junge Nil. Seine erste Umgebung hat er kennengelernt, 200 Meter ist er während der langen Stromschnellen und Wasserfälle gesunken, er hat auch schon ein paar bewaldete Inseln umflossen und nackte Menschen darauf gesehen, die sich kleine Hütten drauf bauten, um Fische zu fangen, zu trocknen und zu räuchern.
Doch dort, wo er aus den Stromschnellen tritt und einen breiten und ruhigen Lauf beginnt, überraschen die Menschen den Strom mit etwas Neuem, was ihn erschrecken muss: dort warten Boote und kleine Dampfer, und das junge Wesen muss sich’s zum ersten Mal gefallen lassen, dass einer auf seinem Rücken reitet. Erst schüttelt er ihn heftig, es gibt noch viele Steine und Felsen im Grunde, aber dann gibt er nach, denn der Mensch war schlau und hatte einen flachen Kiel gebaut. 200 Kilometer lang ist der Nil nun schiffbar. Wo die Schifffahrt nach Norden beginnt, auf dem 1. Grad n. Br. setzt die Bahn nach Südosten an, sie führt nach Kenia und zum Meer; den Nil berührt sie kaum. Erst am 13. Gr. n. Br., 2000 Kilometer von hier, wird eine Bahn ein zweites Mal an den Strom herantreten; so lang ziehen sich die Länder, und noch länger zieht sich der Stromlauf durch Gegenden, die sich dem Bahnbau widersetzen.
Kaum hat er den Dampfer auf seinen Rücken genommen, so erwartet den Nil ein neues Abenteuer: die Ufer, die ihm seinen Lauf begrenzen, entschwinden ihm, immer mehr fühlt er sich ausgeweitet. Wo ist der Wald, der ihn so fest begrenzte? Schon ist er 600 Meter breit, bald werden es viele tausend sein; das Wasser zerfließt ihm, seine Form ist hin: in einen Schwamm ist er geraten, drin scheint er sich zu verlieren. Je weiter, umso flacher wird er, 3 Meter tief, am Rande des Sumpfes noch weniger. Zugleich bedeckt er sich mit blühendem Kraut. Alles scheint um ihn her stille zu stehen, zu schlafen, sein junger Mut ist wie gelähmt, all seine Munterkeit ist hin. Was ist mit ihm geschehen?
Das ist der Kioga-See, ein weites schlammiges Wasser mit vier großen Armen, ein Sumpfsee, von Papyrus umsäumt. Und wie der Nil den See auf einer Länge von hundert Kilometern durchfließt, muss er auch dessen Pflanzenwelt ertragen. Eine Wasserlilie, die sich bei so flachen Wassern leicht einwurzeln kann, bedeckt jetzt meilenweit den im See fortfließenden Strom, aufregend schön, hellblau mit goldenem Schoß, aus dem zuweilen noch eine zweite Blüte wächst. "Wie Teppiche erscheinen die Lilien, kaum bewegt, ein gleichmäßiges Muster auf den See gebreitet, der den Strom verzehrt zu haben scheint.
Die ersten Nebenflüsse hüten sich, dem großen Schwamme zuzufließen; er würde sie verschlingen. Erst dort, wo der Nil den Kioga-See verlässt, an dessen westlicher Spitze mündet in ihn der Kafu, ein jüngerer Bruder, der sein kurzes Leben endet, indem er jenem sein Erbe übergibt. Wenn er nun auch wieder als ein Strom sich nordwärts wendet, so hat der Nil doch das Wesen des Sees angenommen, ist ein seichter, ein sumpfig schleichender Fluss geworden. Eine träumerisch träge Stimmung muss ihn überkommen.
Hier beginnt im Ablauf des Nils, was man den zyklischen Stimmungen gewisser Charaktere vergleichen könnte: in ungleichmäßigem Wechsel verändert er durch tausende von Meilen, durch viele Monate seiner Bahn immer wieder die Farbe seines Wesens; er wird stürmisch und abweisend, wild und müde. Nimmt er das Wesen seiner Umgebung, nimmt diese sein Wesen an? Für jetzt schleppt er sich mit geringem Gefälle im Rhythmus des Kioga-Sees nordwärts.
Doch plötzlich macht er eine scharfe Drehung, verlässt zum ersten Male seine nördliche Richtung, wendet sich nach Westen, verändert sich vollkommen. Der Felsenboden, den er endlich wieder fühlt, macht ihm neuen Mut, das Schiff wirft er von seinem Rücken ab, wieder wie in der ersten Kindheit wird er ein Bergstrom, den niemand befahren kann, sein Lauf verengt sich rasch, zugleich wird er schmaler und tiefer, als er je gewesen. Ein neues Abenteuer?
Der große Afrikanische Graben bricht hier mit einem aufgewölbten Rand durch. Die Gegend wird felsig, Granitmassen verengen sich, ein Canon drängt sich zusammen. Der Nil, dessen erste Wasserfälle nur vergrößerte Stromschnellen waren, steht plötzlich vor einem großen: zusammengedrückt auf nur 6 Meter, muss er über 40 Meter tief herunterstürzen. Der breite Ausfluss jenes Binnen-Meeres am Äquator wird hier in ein paar schäumende Sekunden zusammengedrückt: donnernd zerstäubt der aufgeregte Strom bei seinem Fall.
Diese Murchinson-Fälle, die ersten und letzten, die den Nil in solche Tiefen stürzen, bilden zum ersten Mal seinen Charakter. Hier erlebt er das Furchtbare, von einer Stufe Afrikas zur andern stürzt er nieder: diese Erfahrung der Jugend, stürmisch wie eine Leidenschaft, verändert ihn durchaus. Flier tummelt sich kein Nilpferd und kein Krokodil, sogar die Vögel sind rarer, denn hier wird kein Fisch den Sprung nach oben versuchen. Statt ihrer überschwebt die Felsenstelle die unsterbliche Brücke zwischen Sonne und Wasser, ein ewiger Regenbogen. Auf dem Felsen oben und unten bricht sich das Licht in tausend Glimmer-Kristallen, die dem gewaltigen Schauspiel einen glanzvollen Untergrund bereiten.
Noch eine Stunde unterhalb der Fälle gibt der Schaum auf dem wilden Wasser von der Erschütterung Kunde, die der Nil erlebt hat. Dann nähert er sich durch lichte Steppenwälder einem rasch verbreiterten Tale. Und hier zum ersten Male erblickt er das Wunder der Vorzeit. Unterhalb der Fälle tritt abends der Elefant an den Strom.
Ein Riese läuft er noch über eine Erde, deren Geschöpfe alle unter ihm bleiben. Der stärkste, dem kein Tier und kein Baum Stand hält, selbst der Dorn und die Schlangen können ihm nichts tun: so lässt er, wie große Charaktere, seine Wucht ungenützt, überlegen, im Bewusstsein einer Kraft, die niemand zu fürchten braucht, weder prahlerisch noch räuberisch, das generöseste und klügste unter allen Tieren. Voll Gemütsruhe und Humor, doch furchtbar in der Rache, auch um seine Brut vor dem Angriff tückischer Menschen zu schützen, begabt mit den kleinsten Augen im größten Gesicht, mit dem feinsten Gehör, das ein riesenhafter Lappen zudeckt, mit einem Organ halb Nase, halb Arm, mit Hauern, die alles zerreißen könnten, scheint er dennoch nur das Nötigste zu erbeuten, erschreckt und jagt selten Tiere, frisst keines, nährt sich wie ein Märchenungeheuer von zarten Gräsern, Rinden und Früchten, und wenn er mit den Riesenbeinen den Boden tritt, scheint er den kolossalen Leib nur eben leicht spazieren zu tragen. Nichts an diesem vorweltlichen Tier ist wild und plump, der Gang, der Zugriff, selbst der Blick ist heiter.
In früheren Epochen kannte ihn die Erde überall: nirgends hat man so viel von seinen Zähnen gefunden wie gegen die Behring-Straße zu. Er war in Rom und Irland, in Sibirien und Nordspanien; diese Reste, die stets den afrikanischen Elefanten erweisen, würden allein genügen, eine Landverbindung der beiden Erdteile zu beweisen. Aber auch noch in historischer Zeit war der Elefant ein Europäer: ein phönizischer Reisender beschrieb ihn in der Nähe von Gibraltar, und die Elefanten des Hannibal zeigen auf den Münzen die großen Ohren und den schrägen Rücken, die der indische nicht besitzt.
Wie da ein Rudel aus dem Walde tritt, kaum knackt es laut, so behutsam sind sie, und nur die Reiher, die immer über ihnen kreisen, verraten, wo sie sind, da sie von den Insekten ihrer Haut leben, wie die Philologen von den Dichtern. Dem Menschen misstrauen sie, er hat sie zu oft aus dem Hinterhalt betrogen; nun stehen sie still, minutenlang spürend, nichts als das Schlagen der Riesenohren wird laut. Da sie ein Junges in der Mitte haben, sind sie auf dem Qui vive; denn leise gehen sie fort, wenn sie unbemerkt sind, brechen aber hervor, wenn sie sich entdeckt fühlen; umgekehrt wie die weniger noblen Menschen. Nun treten sie aus den Büschen, sichtbar zu zwei Dritteln, denn das hohe Gras deckt sie noch bis zu den Knien. Das Junge tritt unter die Mutter, zwischen die Vorderbeine, wo die Brüste sitzen, aber zuerst schlägt es den Rüssel zurück, um mit dem Maul zu saugen. Die andern sind schon zum Wasser vorgedrungen, sie haben an einer kleinen Bucht alles niedergetreten, nicht aus Kampflust, nur weil sie so groß sind; prustend stehen sie alle im Nil, werfen mit den gelenkigen Rüsseln das Wasser auf ihren gebogenen Rücken, trinken dazwischen, nehmen eine Wiese voll hoher Gräser mit, und da man sie nicht eigentlich kauen sieht, da sie nie einen riesigen Rachen aufreißen wie etwa das Nilpferd, scheint alles im Unergründlichen zu verschwinden.
Wenn sie vom Nil zurückkehren, wirken sie ganz schwarz in der gelben Steppe, umso weißer die Stoßzähne, die hier auch die weiblichen Tiere tragen; der Bulle voran. Der weiße Reiher setzt sich wieder auf seinen Rücken, so wie die weißen Genien im Märchen, die die großen alten Sünder dirigieren, und der Riese, erfrischt, schlendert mit seinem schwingenden Gange dem Walde zu, nass und glücklich, befühlt so im Vorübergehen eine Akazie mit dem Rüssel, ob es wohl lohnt sie mit den Hauern abzuschälen, blickt halb zurück, ob Frau und Kind folgen. So zieht er sich vom Nil zurück, ins Dunkelgrün des Urwaldes, den er beherrscht, mit Menschenverstand, der voraussieht, kombiniert und sich erinnert; stärker als alle lebenden Wesen, heiter und überlegen: der letzte echte König der Natur.
Hier, wo der Strom sich immer mehr verbreitert, ist erst die wahre Heimat des Nilpferdes und des Krokodils, von denen man tausende unterhalb der Murchinson-Fälle sehen kann, hier ist es sonnig und flach, und die Nähe eines Riesenbades scheint diese Wasserwesen vor allen Gefahren zu schützen.
Denn nun sieht der Nil zum ersten Mal einen großen See mit offenem Wasser vor sich, uferlos wie der Victoria-See, den er selber nie gesehen hat, denn den ließ er im Rücken. Hinter der gelben, delta-artigen Steppe streckt sich das Nordende des Albert-Sees. Der Nil, 500 Kilometer von seiner Quelle, hört hier auf Victoria-Nil zu heißen und wird, von einer zweiten Quelle mächtig gestärkt, zum Albert-Nil werden, wenn er die Nordecke dieses Sees auf einer kurzen Strecke durchlaufen hat. Auf flachen Inseln, auf langen Landzungen, die wie im Wattenmeer vorgelagert sind, liegt hundertfach das Krokodil, im saftgrünen Wasser der kleinen Buchten schnellen sich silberne Fische empor, während der helle Strom sonst blau dahinfließt und keinen Sumpf zu dulden scheint. An den Ufern, wo Steppe und Wald wechseln und große Baumgruppen herantreten, schwärmt ein Trupp zierlicher Antilopen, die Riedböcke kommen langsam ans Wasser, dem Nil zu, der alle Tiere tränkt.
In diesem klaren See wird er nicht irre, wie im Kioga-Schwamm; eine große Strömung zieht ihn herum, der Weg ist vorgezeichnet. Drüben, in westlicher Ferne heben sich die violetten Schatten hoher Gebirge; dort fließt ein anderer großer Strom, der Kongo, er zieht nach Westen, und der Nil wird ihn nie kennenlernen. Sein eigener Lebenslauf geht nordwärts. Eh’ wir ihm folgen, suchen wir, woraus sich seine zweite Quelle, das gewaltige Wasserbecken des Albert-Sees ernährt.
IV
In den eigenwilligen Windungen der Ströme enthüllt sich ihre frühere Existenz: ungewiss in der Länge der Epoche, in den Einzelheiten ihres Laufes, und doch, wie beim Menschen, durch den Nebel der Erinnerung zu fühlen, unbeweisbar, unabweisbar. Ja, im Lande Uganda ist jene Vorgeschichte deutlicher abzulesen als die Geschichte, die prähistorische Welt tritt vor die historische. Denn was dem adamitischen Menschen hier geschah, ist in den Schoß der Zeiten zurückgesunken, weil er bis gestern ohne Schrift, fast ohne Überlieferung blieb, die Prähistorie aber hat ihre Runen und Zeichen in die Berge getragen. Wo der Ur-Nil lief, lässt sich mutmaßen.
Afrika, ein Kontinent aus Ebenen, der einzige, den man so nennen darf, der Erdteil ohne Gebirgszüge, hat am Plateau der großen Seen eine Ausnahme geschaffen oder erlitten. Sie entstand, als die Kruste des Erdteils durch einen Riss in zwei Teile barst, als sich der Graben bildete, der von Rhodesien her schräg durch Ost-Afrika bis zum Jordan-Tale läuft, so dass das Rote Meer einen Teil davon bildet. Aus dem Innern der Erde brach das tobende Feuer hervor, hob riesige Schollen zu Gebirgen, stülpte sie oben um und öffnete am Fuße der neuen Vulkane Flüssen und Seen das tiefer gelegene Land, um sich zu sammeln und abzufließen. Südlich vom Nilbassin teilte sich der Graben, der östliche Arm, der nach Kenia ging, bildete den Kilimandscharo, der westliche die drei Seen westlich vom Victoria-See; dieser selber stellt eine Senkung des Plateaus zwischen beiden dar.
So ungewiss die Zeiträume bleiben, es scheint doch sicher, dass alle sieben Seen Mittel-Afrikas jungen Datums sind; dass dort, wo jetzt der Victoria-See liegt, früher weite Ebenen lagen, von den Zuflüssen des heutigen Sees durchzogen. Später mögen sich diese großen Wasserbecken gebildet, dann vom ständigen Regen steigend erweitert und die umgebenden Bergwälle durchbrochen haben. Das Wasser vertiefte, verbreiterte den Durchbruch und bahnte sich den Weg in die Ebene; Stromschnellen und Katarakte sind die Zeugen dieser Entwicklung.
Über den großen Vulkanen und kleinen Kratern, die die erstarrte Lava, die Beben und heiße Quellen uns noch heut vor Aug’ und Ohren führen, erhob sich aus Urgestein ein königlicher Zeuge: der Ruwenzori, ein Schneegebirge, höher als der Montblanc. Hier liegt in Wahrheit das Herz von Afrika. Nach Westen und nach Osten verteilen sich die Wasser, um die größten Ströme des Erdteils zu speisen, Nil und Kongo.
Nicht der Ruwenzori selber bildet die Wasserscheide. Es ist eine Kette von Vulkanen, die 4500 Meter erreichen und etwa vom 2. Gr. s. Br. bis zum Äquator laufen; unter ihnen scheint ein bestimmtes Massiv, das Mufumbiro-Gebirge jetzt die genaue Wasserscheide zu bilden. Im Laufe jener Seelenwanderung der Ströme hat sie gewechselt, und noch heute bleibt sie geheimnisvoll ungewiss, die Linien schwanken, Geographen und Hydrographen messen immer aufs Neue. Die Namen zeigen es an: die vier Seen mit den englischen Königsnamen, die so befremdend nach Afrika importiert wurden, gehören zum Nil; die mit den afrikanischen Namen, der Kiwu- und Tanganjika-See gehören zum Kongo. In diesen Grenzen liegen die Quellen der beiden großen Ströme, die den alten, merkwürdig starren Kontinent beleben.
Nimmt nun der Nil all sein Wasser aus den Seen, woher nehmen es die Seen? Und wenn es weniger durch Flüsse als durch Regen in die Seen kommt: woher kommt dann der Regen? Umstritten. Gegenwärtig lässt man den Regen des Nilbassins vorwiegend aus der südlichen Atlantik stammen. Verdunstung und Verdichtung, entstehend aus der Spannung zwischen Meer und Land, bleibt sich im Allgemeinen gleich, nicht im Einzelnen. So erhebt sich über diesen Sammelbecken das Kampfspiel der Verdunstung, der Flussbildung und des Abflusses ins Meer. In diesem Kreislauf, in dem ein Drittel aller Niederschläge der Erde gefangen ist, wird die Tiefe der Bassins bedeutsam. Da der Victoria-See nur bis 90 Meter tief ist und deshalb mehr "Wasser verdampfen lässt, als er aufnimmt, stellt sich wir hören es am Ende dieses Bandes diese beständige Abnahme als bedeutendes Problem vor die Ingenieure des Nils. Nach seiner Struktur hat er als Quelle des Nils ein eigenes Klima, sogar ein eigenes Windsystem. Der "Wechsel von Land- und Seewind, die Menge der Gewittertage, die hohe Temperatur dieses warmen Meeres –– bis 26 Grad ––, der Wegfall trockener Monate, die Verdunstung der riesigen Fläche sind die Grundmotive seines Klimas.
Nicht die Zuflüsse. Zwar empfängt er solche von drei Seiten, während er nur an jener einzigen nördlichen Stelle bei Jinja, eben durch die Quelle des Nils Wasser abgibt; auch empfängt er viel Wasser mit starkem Gefälle von kurzen Flüssen, die von dem alleinstehenden, 4000 Meter übersteigenden Vulkan Elgon im Nordosten stammen. Bedeutend ist aber von allen 15 Zuflüssen nur einer, und eben diesen hat man deshalb früher Nil genannt, weil nach der Logik der Geographen der stärkste Zufluss eines Sees sich im stärksten Abfluss wiederfinden soll; nicht etwa bloß bei kleinen Seen, in denen man die Strömung messen, sogar mit Augen sehen kann, auch auf größte Entfernung. Wenn jener Zufluss aus "Westen der ursprüngliche Nil sein soll, so braucht er 250 Kilometer, um auf dem nächsten Wege durch den See seinen Abfluss im Norden zu erreichen. Das Einzige, was für diesen Gedanken spricht, denn es ist nur ein Gedanke, ist der Name, den ihm die Eingeborenen geben, nämlich „die Mutter des Flusses von Jinja“.
Dieser Zufluss des Victoria-Sees, der Kagera, ist ein mächtiger Fluss, auch ohne Nil zu heißen. 700 Kilometer lang, den größten Teil der westlichen Seenplatte entwässernd, ist er an seinen schwer zugänglichen Mündungen in den Victoria-See zuerst nur im Ruderboot zu befahren, denn diese ändern sich nach der Höhe der Pflanzen, die er aus den Bergen mitbringt. Nadi einem schiffbaren Stück, oft see-artig erweitert, tritt er dann stromaufwärts in steilere Klüfte, von Papyrus vielfach bedeckt und versumpft, und wird aufs Neue ein wilder Gebirgsfluss, wenn man sich seinen Quellarmen nähert.
Es sind drei, die sich wie jene sieben Städte um Homer, streiten, die Heimat des Nils zu sein, alle haben phantastische Namen, aber der mit dem dunkelgefärbten Namen Ruwuwu hat, nach unendlichen Messungen, heute die Autorität als Ursprung des Kagera. 2000 Meter hoch, in belgischen Gebieten, auf der östlichen Grabensenkung zwischen Tanganjika- und Edward-See, in dem Gewirr des hochgelegenen Urwaldes entspringt dieser Ruwuwu und, wem es gefällt, der mag in dessen südlichstem Zufluss den Urquell des Nils verehren.
V
Mit einer großen Umarmung umfängt der Ruwenzori das schöne Land an den westlichen Seen. Mondgebirge nannten es die Alten, denn da sie den Schnee auf seinem Haupte nicht zu deuten wussten, sagten die Neger, der Berg habe das Licht des Mondes auf sich herabgezogen. Und wirklich erscheint er in seiner Einsamkeit über dem Äquator aus einem nicht mehr irdischen Stoffe gemacht, dort oben, wo Pflanzen und Granit zu Ende sind und das ewige Eis seiner 5000 Meter hohen Kuppeln und Spitzen gegen den goldgelben Himmel des Abends erglänzt. Einsam, ein Philosoph, dem das Bewusstsein seiner Höhe genügt, hat dieser Berg sich lange der Neugier der Menschen entzogen, drei großen Forschern hat er durch Monate sein Haupt verhüllt, so dass sie an den Beteuerungen der Eingebornen zweifelten, und viele Reisende, die ihn heute nach der Karte an bestimmter Stelle suchen können, erblicken ihn nie. Reicher ist er als alle Berge Afrikas, denn wie die Regen sich an seinen Felsen brechen, so sendet er tausend Bäche nieder, die dann zu Flüssen werden, in Seen sich sammeln, um alle endlich die andere Hälfte des Nils zu bilden. König dieses Landes könnte das Mondgebirge heißen, aber es ist sein Vater.
In drei großartigen Gürteln baut sich dieses hundert Kilometer lange Gebirge empor; der erste, die Steppe auf etwa 1000 Meter Höhe, nimmt am meisten Raum ein.
Die Steppe ist licht. Ein offenes wellenförmiges Land, von breiten Wiesen durchschnitten, trägt die Akazie in vielen Formen: die blattlose, dornige, grünlichweiße, die weiße mit hellgrünen Blättern zwischen den Dornen, die schwarze blätterreiche mit dunklen Ästen, die höchste, deren Stamm rötlich schimmert, und wieder eine mit lavendel-blauen Riesentrauben, die als Blüten herabhängen. Dazwischen hebt sich dunkler, massiger, wie ein gegen den Himmel gestellter Protest die Euphorbie, die bis weit in die Höhe aushält. Alles an ihr scheint vorweltlich wie am Elefanten, zottig und stark, jeder einzelne Baum gleicht einer Familie mit einem Haupt an der Spitze, der enormen gelb und rosa Blüte. Aus dem gelb verbrannten Feld wachsen hohe lila Orchideen und karminrote Amaryllis lilienhaft hervor, dicht über der Erde steht auf dicken Stängeln zu Tausenden eine Blüte, die einer roten Puderquaste gleicht. Wo dunkles Grün sumpfig herüberleuchtet und sich die Vögel sammeln, dort, im Papyrus und dichteren Walde rauschen die Flüsse. Das starke Riesengras, vier Meter hoch und dick wie Bambus, in breite, nach oben stehende Blätter zugespitzt, heißt hier und überall am Nil das Elefantengras; es wird von der rötlichen, baumartigen Erika noch überragt, hoch und stachlig.
Zu den hochgelegenen Steppenflüssen dieser unteren Regionen drängen sich beinah furchtlos in Rudeln die Riedböcke. Graurote, behaarte Wasserböcke legen ihre schönen Hörner zurück, die Nüstern gegen den Wind, witternd, während das unförmige Warzenschwein, dumpf schlendernd, den Kopf zur Erde, weniger Mut und deshalb weniger Furcht verrät; Impala-Antilopen springen wie schwebend über ein Dorngestrüpp: alles angezogen von dem grünen Flecken, der Wasser verspricht. Dort, wo die Heuschrecken-Schwärme streifenartig vorüberziehen, kreisen oben, als ob sie Raubvögel wären, Massen von Marabus, unter ihnen ziehen über den grünen Papyrus-Sumpf Züge von Enten, unruhig über den scharfen Ruf eines Habichts.
In der zweiten, höheren Zone des Ruwenzori, im Walde zwischen Schluchten und Hochtälern, wo der Regen zunimmt und mit ihm das Moos, das ganze Wälder überdeckt, ist das gewaltige Gebirge von einem Gürtel umfangen, der sich von ferne deutlich unterscheiden lässt. Hier ragt ein schöner Nadelbaum in den Bambuswald, und noch höher starrt die Lobelie empor, eine riesige Blumenkerze, schaftförmig von unten bewachsen, von der wunderliche Traubendolden hängen. Wie Obelisken auf verfallenen Friedhöfen stehen diese großen Pflanzen im ewigen Regenwald.
Rosa und bläulich blühen in ihrer Nähe die Erika-Bäume, aber ihre dicken Stämme sind mit wolkigen Bärten behängt, Moos, das zugleich von unten heraufwächst, grün, goldorange, auch purpurn. Generationen ihrer toten Baum-Vorfahren, von weißem Moos bedeckt, liegen zwischen ihnen gehäuft, und der Bambus, halb gebrochen, knirscht überall in Regen und Wind. In dieser Landschaft liegen die Krater-Seen.
Es sind viele, die aus diesen Wäldern dunkeläugig aufblicken, tiefgelegen zwischen steilen Wänden, die die weiche Kraterform verraten. Die Stille und Dichte, das tiefe Gurren der Tauben, bebaute Stücke Waldes mit Bananen, wo ein paar Hütten den Menschen andeuten, dazwischen unberührte Alpenwiesen geben dem Ganzen Ton und Bild eines verwilderten Parkes, und nur das Wild erinnert plötzlich und erschreckend an die Gefahren, die darin wohnen. Elefanten und Büffel hat man bis 1800 Meter hinauf getroffen, den Löwen, um das Wildschwein zu verfolgen, bis 2400, noch höher einige Antilopenarten, Paviane, die großen Wildkatzen und den Hyrax, einen Springhasen; den Leoparden sogar hinauf bis zum Schnee. Bis zur höchsten Lobelia dringt unter den Vögeln nur ein metallgrüner Sonnenvogel, der noch am Rande des Schnees Honig sucht.
An diesem dritten, schmälsten Gürtel oben, wo ein fast nie weichender Regen- und Wolkenschleier sich in Schnee verwandelt, zieht sich eine Kette wie im Kaukasus, Schneegipfel, die über 50 Kilometer hinlaufen. Dort oben glänzen durch die Jahrtausende die letzten Zeichen der Eiszeit, wie Zeugen einer Sage über dem Äquator.
Zu Füßen dieser Berge, dort, wo sich westlich des Victoria-Sees, im Becken des Kagera, das Land von 1100 auf 3000 Meter erhebt, erreicht es den östlichen Rand jenes großen Grabens, der nun plötzlich auf 1500 Meter herunterstürzt. Der Abhang ist so wild und unberührt, dass außer dem Büffel und dem Elefanten das Wild vor überraschenden Grenzen steht, es kann nicht weiter. Dieser Graben, aufgeschüttelt und aufgebrochen von den noch immer nicht erloschenen Vulkanen, hat die Wasser auf seinem tiefen Grunde zur Kette der Seen aufgesammelt, und diese erzeugen teils, teils empfangen sie die Flüsse. Als kräftige Bäche sind sie herabgestürzt, im Graben aber stauen sie sich, werden träge Landflüsse, suchen gewaltsam einen Ausweg.
Der Edward-See, der Wasser von Süden und Norden empfängt, sendet alles nach Norden in den Nil; fast alles, was das Gebirge des Ruwenzori an Wassern herunterschickt, wird durch George- und Albert-See dem Nil zugeführt. Alles, was in Uganda herabfließt und herabregnet, Flüsse, Seen, Bergbäche strebt den beiden Quellen des Nils zu; sogar was ihm entfliehen möchte, ist an ihn verloren. Der Kafu-Fluss, der zuerst mit dem jungen Nil um die Wette lief, hat sich noch immer nicht entschieden. Er hat zwei Richtungen: läuft er dem schwammigen Kioga-See zu, so läuft er dem Victoria-Nil in die Arme; geht er nach Westen, so mündet sein Wasser im Albert-Nil. Auf jede Art verliert er sein kleines Leben an das Schicksal des gewaltigen Genossen.
VI
Nun haben sich die beiden Quellsysteme des Nils getroffen: in der Nordecke des Albert-Sees fließt alles zusammen, dem jungen Strome die Bahn von unbekannter Länge zu kräftigen. Viele Bogen und Umwege haben die Flüsse gemacht, denn über Land ist es von der Quelle bis zu diesem nördlichsten Abfluss des Stromes in Uganda nicht weit: 250 Kilometer, die sich durch ein Hügelland auf guter Straße rasch durchfahren lassen. Zwischen beiden Seen ist der Victoria-Nil von Südost nach Nordwest geflossen, und sonderbar: die drei großen Nebenflüsse, die dem Nil viel später von rechts in großen Abständen bevorstehen, werden alle dem Strom in der gleichen Richtung zufließen, die er selber von seiner ersten zu seiner zweiten Quelle beschrieben hat; wie Kinder die früheste Entwicklung eines großen Vaters nachahmen, ohne seinem kurvenreichen Leben später folgen zu können.
Der Albert-See, viel kleiner als der Victoria-See, doch immer noch achtmal so groß wie der Bodensee, ist der große Behälter für all die langen und kurzen Flüsse, die aus Schnee und Regen des Mondgebirges abströmen, um den Nil zu ernähren. Eigentlich füllt er den Graben vom 1. zum 2. Grade n. Br. ganz aus und ist deshalb auf beiden Längsseiten von Bergen eingerahmt. Bei seiner Lage und Größe ist dieser alpine See eine Tiergrenze, und weil hier die meisten Arten der Heuschrecken ihn nicht überqueren können, nennt die plastische Sprache der Neger ihn den „Luta-Nziga“, das heißt „die Helligkeit, die die Heuschrecken tötet“.
„Der Geist des Sees“, sagte ein Negerkönig zu einem Reisenden, „kann furchtbare Winde entfesseln und eure Barken alle umwerfen.“ Um ihn zu versöhnen, warfen sie vor dem Könige Hühner und Glasperlen in den See, in dem der Geist wohnte. Da es nur einen richtigen Hafen gibt und nur kleine Boote oder merkwürdige Flöße aus Papyrusstauden, ist jedes gefährdet, denn Stürme brechen plötzlich mit furchtbaren Gewittern los. Dafür hat aber der Geist des Sees seinen Anwohnern viele Fische beschert, die, von den Stürmen dem Ufer zugetrieben, von ihnen mit langen Leinen, auch in Körben gefangen werden, und die Legenden von ungeheuren Barschen, die die Väter fanden, kehren in jedem Gespräch wieder.
Meist gilt es dem Salz. Der große, meerähnliche Victoria-See schmeckt süß, der schmale Albert-See schmeckt salzig, und davon leben die meisten Neger dieser Gegend. Die hohen Gräser, aus denen sie ihre Hütten flechten, haben sie nicht so nah bei der Hand, wie drüben die Männer im Lande Uganda; sie müssen weit wandern, um sie zu kaufen, und sie erkaufen sie mit ihrem Salz, mit dem halb Uganda seine Speisen würzt, Millionen von Menschen, auch andere Völker bis tief in den Kongo-Staat, wo es mangelt. Dass dieses Salz im See zurückbleibt und dass der Nil, wenn er den See verlässt, fast salzlos schmeckt, soll Tausende von Kilometern fern von hier, weit unten in Ägypten bedeutsam werden. So tauchen die Folgen jugendlicher Erlebnisse im Alter aus der Tiefe des Schicksals plötzlich wieder empor. In einem Gebirge, dessen steile Wände meilenweit jeden Anbau von Korn verhindern, wird das unfruchtbare Salz den Menschen zur Lebensquelle, aber die Männer rühren keine Hand, es zu heben. Alles machen die Frauen.
Das ist eine rechte Hexenküche. Am Nordost-Ende des Sees, aus tiefen Schluchten, aus Blöcken und Trümmern, deren Hitze der weiße Mann durch den Schuh fühlt, gurgeln heiße Quellen, steigen schweflige Gase hervor, dampfend, luftlos, zum Ersticken. Aus diesen Höhlen sprudelt klares, heißes Wasser empor, vollkommen salzig. Aus Schlamm und Wasser haben die Frauen, nackt in solchen Dünsten arbeitend, kleine Mauern aufgebaut, unheimlich anzusehen, als wäre hier ein Dorf zerfallen, und sie haben in schmalen Kanälen die heiße, salzige Erde gestaut. Zwischen den kleinen Mauern, ein Arbeitsfeld vom andern getrennt, hocken Weiber und Kinder, kratzen mit rohen Eisen den Schlamm des aufgelaufenen Wassers ab, füllen kleine Tröge von Ton, teils zum Sammeln, teils zum Abtropfen. In der Mischung von Erde und Wasser liegt die Kunst. Hat der Regen den Boden abgekühlt, so quillt kein Salz; deshalb fürchten sie den Regen, den ihre Brüder ersehnen. Denn dieses Mineral, das sie dem Wasser entziehen, ist ihnen kostbar wie jenes, das andere aus anderen Flüssen waschen: das Salz ist ihr Gold.
Das graue, bitterschmeckende Produkt packen dann die Männer in Bananenblätter, legen diese in lange, schmale Futterale aus Bambusstängeln, die sie, wie Modelle von Nilbooten, auf der Schulter tragen, und nun wandern sie nackt, mit einer Schlafmatte und einem Kürbis voll Wasser versehen, tageweit bis zu den Märkten, wo ihre Brüder das Salz abwiegen und ihnen ihre Schätze dafür geben, Papyrus, Korn, Glasperlen, Speere, eine Tierhaut: alles, was sie zum Essen, Wohnen, Kleiden, Jagen, Schmücken brauchen, bekommen sie für das Salz, das ihre Frauen und Kinder in schwärenden Dämpfen aus der Erde ihrer Heimat kratzten. Diese erstaunliche Arbeit, geleistet von Menschen, die nie von einem Bergwerke Kunde erhielten, mitten in einem vor hundert Jahren von Weißen noch unbetretenen Lande, soll auf sehr alte Zeiten zurückgehen.
In der Nähe gibt es ein Volk, weit erstaunlicher und älter, in dieser Form und Herkunft einzig. Am Abhang des Mondgebirges wohnen die Zwerge. Hier lässt sich ein afrikanisches Volk an ein- und derselben Stelle von der antiken Zeit herleiten; denn Aristoteles betont, dies sei keine Fabel, die Zwerge lebten dort wirklich in Höhlen, und das einzige, was sich als Legende erwiesen hat, sind die kleinen Pferde, die er ihnen beigibt. Im Laufe der Jahrtausende scheinen sie aus der südafrikanischen Steppe heraufgewandert, und als der Neger begann das Feld zu bebauen, als die Schwächeren in die dichtesten Wälder getrieben worden zu sein; von dort, aus den Urwäldern des Kongo ergänzen sie sich noch immer, dringen immer wieder nach außen vor, werden immer wieder von den großgewachsenen Bantu-Negern zurückgedrängt. So überleben die Pygmäen, hier meistens Bakwa genannt, bekämpft und zähe, vorsichtig und unaustilgbar, die herrschenden Völker, mit denen sie sich nur selten vermischen. Körper und Schicksal haben auch hier den Charakter gebildet; in allem gleichen sie den Gnomen und Kobolden der nordischen Märchen, die sich ja auch aus wirklichen Zwergen entwickelten, denn aus der Steinzeit hat man ihre Knochen in Europa gefunden.
Schön sind die Zwerge nicht, aber nicht eigentlich grotesk. Ihre schwarzbraunen oder gelblichen, sehr behaarten Körper von etwa 1.30 Meter Größe, mit dicken Bäuchen und knopfartigem Nabel, tragen Köpfe, die alt wirken, klug und traurig. Viel Haar und bei den Männern lange Bärte, Schlitzaugen, große Münder mit dünnen Lippen unterscheiden sie sogleich von ihren Nachbarn, ihr Schweigen und Betrachten, der Mangel an negerhafter Neugier und Schwatzhaftigkeit, ein klügeres, dabei scheueres Gehaben, das an die großen Affen erinnert, sondert sie ab. Wenn sie nackt, die Frauen mit Tüchern aus gedehnter Baumrinde wenig bedeckt, auf dem Markte stehen, gleich misstrauisch gegen Neger und Weiße, die Frauen frecher, zugleich scheuer und wilder, so findet man bei ihnen die Züge der Kobolde wieder: Meister der Klugheit und Verstellung, grausam und hilfsbereit, gefühlvoll und rachsüchtig, ränkevoll und dankbar. Nur in den Alten tauchen Züge des Leidens auf: sie wissen, dass alles vergeblich war.
Konnten sie anders werden im Kampfe mit anderen Stämmen, die ihnen alle über die Köpfe sahen, die sie verachteten, wie der größere Naturmensch den kleineren verachtet, besonders mitten auf diesem dicht bevölkerten Stück Erde? Um sie her lebte alles mit dem Vieh und dem Acker, die Jagd war nur ein Fest wie der Krieg; sie allein in ihrer Kleinheit, Folge der Anpassung im Laufe der Zeiten, schlüpften in den Urwald, Kobolde zu den Tieren der Urzeit, dort wurden sie Jäger. So lebten sie durch die Jahrtausende nomadenhaft in rasch geflochtenen, winzigen Hütten, in Schlupfwinkeln, die keiner erreicht und die erst recht in seinem Aberglauben der Bantu-Neger als Heimat der Zwerge meidet. Dort hüten die Zwerge das Feuer, da sie es nicht anzünden können –– ihre Vettern westlich von Mount Elgon kennen es gar nicht ––, rösten darauf Fleisch und Bananen, formen sich kunstvolle Töpfe und Körbe. Sie essen nur, was sie erlegen, aber von allem mehr als andere Stämme, Eber und Gazellen, Ratten und Heuschrecken, Fische und Schlangen; weshalb sie die oberen Schneide- und Augenzähne bei Männern und Frauen spitz ausschneiden.
Erstaunlich einfach hausen die Zwerge in ihren Hütten, die selten zwei zusammen bewohnen und in die sie durch kleine Mauselöcher kriechen; zu Haus auch die Frauen immer nackt, ohne Schmuck und Tätowierung, ohne Halsbänder. So leben sie, nicht bloß ohne Glauben, wie die meisten ihrer Nachbarn, auch ohne Häuptling und Führer, anerkennen nur zeitweise den besten Jäger als bevorrechtigt, lehnen ab, was zu Staat und Gemeinschaft führen könnte; jeder lebt mit seinen wenigen Frauen für sich, familiär, in ausgesprochener Liebe zu den Kindern, die die Frauen nicht in der Hütte, sondern draußen im Walde allein zur Welt gebracht haben, wobei sie wie die Tiere die Nabelschnur mit den Zähnen durchbeißen.
Da sie weder Haustiere noch Gemüse noch Ackerbau von ihren Nachbarn übernommen haben, kommen sie mit ihnen nur bei einer Feier zusammen oder einem Jagdfest. Dann sind die Zwerge lustiger und musikalischer als alle andern Neger dieser Gegend, singen Chöre und Soli, lachen und erzählen Geschichten, trinken aber wenig in Gesellschaft und zeigen in allem überlegenen Anstand. Ihre einzige Leidenschaft ist Rauchen und Schnupfen.
Wie die nordischen Heinzelmännchen bewähren sich auch diese Kobolde als dankbare Diebe. Wenn sie sich nachts aus ihren Wäldern wagen, um Bananen zu stehlen, ihr Lieblingsessen, weil sie es nicht zu Hause haben, dann legen sie oft unter die beraubten Pflanzen ein Stück Fleisch von einem erlegten Tier, oder sie denken sich noch was Wunderlicheres aus, um auf eine krause Weise zu zahlen: sie schleichen, während der von ihnen bestohlene Neger schläft, herum, ziehen das Unkraut auf einem Stück seiner Pflanzung heraus, oder sie stellen eine Falle auf, in der sich ein Wild für ihn fangen möge, oder sie vertreiben ihm die Affen aus dem Bananenwalde. Zuweilen aber entführen diese schlauen Halbzigeuner und Halbaffen ein Negerkind in den Wald und legen dafür ein Zwergenkind dorthin, wo es nachher die schreiende Mutter findet.
Ihre große Gier gilt dem Elefanten. Das größte Tier erliegt dem kleinsten Menschen eben durch seine Kleinheit, wie einer ihrer Entdecker geschildert hat: mit ihren scharfen Lanzen schlüpft bei gemeinsamer Jagd einer unter das Tier, das kann ihn bisweilen bei seiner schwachen Sehkraft mit dem Rüssel nicht treffen und fällt am Ende von seinen tückischen Händen. Dort, an dem Leichnam hausen sie lange, bis alles verzehrt ist, mit dem Elfenbein aber kaufen sie, was ihnen fehlt. Auch dem Fisch lauern sie mit der Hinterlist des Kobolds auf, schließen durch Dämme kleine Wasserläufe, lassen durch Kanäle das Wasser ab und greifen die zappelnden Fische.
So sind die kleinen Jäger große Schmiede und Krieger geworden. Verachtet von ihren größeren Brüdern, die sie als „die Männer mit den spannlangen Bärten“ ausspotten, zwingen sie jene doch, ihre Speere zu erhandeln, die sie im Walde drinnen aus rohem Erz geschmiedet haben, ihre Speerspitzen, auch Eisenringe für die Frauen. Als Krieger benutzt sie ein herrschender Stamm gegen den andern, und wenn die Zwerge durch ihre Klugheit Berater eines Häuptlings wurden, ist ihre Dankbarkeit größer als ihre Tücke, und sie hängen, mit dem Konservativismus aller lange unterdrückten Völker denen an, die sie gut behandeln, um sie auszunützen.
Wer sind nun jene Bantustämme, mit denen die Zwerge in beständig unruhvollen Verhältnissen leben? Wer sind die Herren dieses Landes?
VII
Das Land Uganda ist reicher als alle seine Nachbarn, weil ein gesegnetes Klima die Früchte der Erde von selber wachsen lässt und weil ein glückliches Schicksal die Weißen bis vor 100 Jahren vollkommen fernhielt. Jahrtausendelang hausten hier ein paar Millionen schwarzer Menschen, ohne die Verführungen des Ostens und des Nordens kennenzulernen, und als Speke hier auftauchte, war er der erste, der von einem paradiesischen Volke sprach, das sich glücklich nannte. Fragt man einen Buganda am Victoria-See, so sagt er auch heute nur, er komme aus dem Lande, „wo der Mond aus den Spitzen der Schneeberge neue Kräfte schöpft und sein schönes weißes Licht“. Oder er weist in die Richtung der Nilquelle und sagt, dies sei das Land, das den großen Strom gebiert. Fragt man ihn aber nach dem Ablauf der Zeit, so rechnet er ein halbes Jahr gleich einem Jahr, da er zweimal erntet, und sagt: „Der erste Monat eines Jahres ist da zum Säen, die andern fünf Monate sind da zum Essen.“ Sie hatten alles, bevor man sie entdeckte, Bananen, Korn und Gemüse, Fische und Schafe, und haben sich erst in später Zeit durch lange Rassenkriege dezimiert.
Diese Rasse spricht man als Mischung von Bantu, Niloten und Hamiten an; da aber nie etwas aufgeschrieben wurde, ist alles ungewiss und nur das eine sicher, dass hier wie überall das Glück der Völker in der Mischung, ihr Unglück im Ehrgeiz der Rassen lag.
Die herrschenden Bantuneger, kräftige, gut gewachsene Leute mit Rundschädeln, dunkelbraun, von glänzender Haut und starken Knochen, das sind die Bauern; die Hirten-Völker neben ihnen, getrennt durch die uralte Eifersucht zwischen Nomaden und Ackerbauern, die Bahima, viel schöner und viel heller, mit graden Nasen, schmalen Lippen, erscheinen oft wie Kinder eines Weißen mit einer Mulattin.
Die Bahima waren früher –– niemand weiß das Jahrhundert –– als Eroberer vom Osten ins Land gedrungen, vielleicht aus Abessinien, hatten sich am Kioga-, dann auch am Victoria-See festgesetzt. Ihre Herrschaft haben sie zwar an die tüchtigeren Bantus wieder verloren; weil sie aber schöner und kunstreicher sind, verachten sie jene. Obwohl auch die größten Kenner aus dem Typus der beiden Rassen und aus den Überlieferungen schließend, ihren Schlüssen viele Fragezeichen zufügen, ist doch in jener frühen Einwanderung die einzige Erklärung für die erstaunlichen Sitten dieser abgeschlossenen Neger zu finden.
Denn wirklich scheint auf unglaubwürdigen Umwegen die große Kultur von der Mündung des Nils, es scheint Ägypten in hundertfacher Verdünnung bis auf diese fernen Neger an der Quelle des Stromes eingewirkt zu haben; so wie der Strahl eines erlauchten Geistes Menschen beleuchtet, die nie etwas von jenem Gestirn vernahmen. Da die Ägypter den Nil aufwärts niemals bis nach Uganda vorgedrungen sind: wie käme trotzdem das Rind mit seinem graden Rücken und seinen Riesenhörnern hierher und wandelt noch heute zwischen den Negern am Äquator, genau wie auf den altägyptischen Fresken? Wie kamen dieselben Harfen vor Auge und Ohr dieser schwarzen Häuptlinge, dieselben Trompeten aus Antilopenhorn, durch die ein Pharao seine Machtgefühle erregen ließ? Mit seiner Macht muss die Kultur Ägyptens über Somali-Land und Abessinien, wo sich die Denkmäler erhielten, sich jenen hamitisch-arabischen Stämmen eingeprägt haben; sie brachten sie dann, durch Kriege und Hungersnöte in immer neuen Schüben in das fruchtbare Land an den Nilquellen vordringend, zu schwarzen Menschen, denen keine Kunde, viel weniger die Erscheinung jener fremden, weißen Menschen begegnet war.
Das Volk, das nach Jahrtausenden, nämlich um 1860 die ersten Europäer hier vorfanden, kann seine überraschende Kultur nicht von den drei oder vier arabischen Händlern erhalten haben, die kurz vorher als erste von Sansibar aus ins Innere vordrangen, um den mächtigen schwarzen Königen Sklaven abzukaufen. Der erste Weiße, der sie so an dem großen See entdeckte, war kein Forscher und kein Missionar, sondern ein Soldat aus Sansibar gewesen, der vor seinen Gläubigern ins Innere fuhr. In diesen Mann verliebte sich der schwarze König, weil jener helle Haut hatte, schönes Haar und einen schönen Bart; er hat noch 1857 mit seinen 300 Frauen beim König gelebt. Durch diesen verschuldeten Soldaten haben Millionen in Zentral-Afrika zum ersten Male von der Existenz weißer Völker erfahren, nachdem sie ein paar tausend Jahre vorher schon einige Sitten und Sachen aus dem höchst kultivierten Lande am Mittelmeer erhalten hatten, ohne nur seinen Namen zu kennen. Diesem merkwürdigsten unter allen Kulturträgern folgten damals einige arabische Händler und Scheichs.
Und doch war nicht der König der erstaunteste Mensch in Uganda. Unruhig, zugleich geschmeichelt und verletzt waren jene Bahima, die, durch Mischung mit den Bantus immer schwärzer geworden, jetzt beim Auftreten jener ersten Araber schworen, sie seien ihre eigentlichen Verwandten, ihre eignen Vorfahren wären auch viel weißer gewesen und hätten auch langes Haar gehabt. Jetzt fürchteten sie, jene merkwürdigen Männer kämen, um ihnen das schöne Land wieder zu rauben, wie es einst ihre eignen Vorfahren getan hatten.
Als dicht nach jenen Arabern die ersten Engländer kamen und nun ein Volk trafen, das bis vor einem Jahrzehnt nie einen weißen Mann gesehen hatte: in welchem Zustand fanden sie diese Wilden vor?
Aus runden, meist kuppelförmigen Hütten, die sie aus hohem Gras und aus Bananenfasern kunstvoll gewirkt, aus einem Vorbau oder einem Rundgang traten ihnen Männer und Frauen entgegen, in Felle oder in Rinde gehüllt; sie hatten am Morgen zuerst den Erdwall neu gestampft, der ihre Wohnung gegen den täglichen Regen schützte. Durch sumpfige Strecken waren Dämme aus Palmenstangen gezogen, Wege, von Salvien eingehegt, führten sie von einem Dorf zum andern in dem dicht bevölkerten Lande, und bei Todesstrafe war ihnen von ihrem König verboten, nackt auf den Markt zu gehen; nur im Krieg und im Kanu legten die Männer ihre Felle ab, denn außer dem Hausbau machten sie nur den Krieg.
Alle Arbeit blieb den Frauen, sie säten und ernteten, rieben das Korn zwischen zwei Mahlsteinen, kauernd, hockend und singend, kochten Fleisch und Fisch, in Bananenblätter gewickelt, im Dampf auf Töpfen, die sie ohne Töpferscheibe aus Erde gemacht hatten. Aus den schmalen Blättern der Dattelpalmen machten sie Körbe für die roten Kaffeebohnen, die sie draußen vor dem Dorfe wachsen ließen, aber sie wussten auch Felle in der Sonne zu trocknen, in Rahmen zu spannen, mit öl zu glätten, mit Steinen zu reiben, aus Büffelhaut Sandalen zu schneiden. Die Sitten dieser Wilden waren so ausgebildet, dass sich alle vor Tische die Hände wuschen, und nochmals nachher, bevor sie ihren Kaffee tranken.
Allein von der Banane, die ihnen Gott geschenkt und die sie in einigen dreißig Arten pflanzten, hätten sie leben können. Die Früchte kochten sie zu Brei in Wasserdampf, andere ließen sie gären, setzten ihnen Essenzen zu und machten Wein daraus und eine Art süßlichen Bieres. Die Zweige brauchten sie zum Dach des Hauses, für ihre Betten, als Schutz für die Milch im Topf, die Stangen für Zäune, als Walze, um ein Kanu ans Land zu ziehen. Aus dem Mark, das sie herausholten, machten sie Schwämme, aus den Fasern Stricke und Hüte gegen die Sonne. Außer Fleisch und Eisen gab ihnen der eine Baum alles Nötige, ein rechter Lebensbaum.
Wenn die Männer nicht Krieg vorhatten, machten sie Eisenhaken für ihre Angelschnüre aus Fasern der Aloe; dem Elefanten gruben sie tiefe Fallen, um ihn dann mit Speeren zu erlegen, den Büffel fingen sie in Dorngezweigen, die kleinen Antilopen mit Netzen, auch Löwen und Leoparden in Fallen von schweren Stämmen: stets zu Hunderten unterwegs, wenn sie jagen. Ja, sie hatten eine Waffe erfunden, die man für ein Phantom von Münchhausen ansprechen würde, wenn sie nicht der größte Kenner Ugandas beschriebe: sie fingen junge giftige Schlangen im Urwalde, nagelten sie an einen Baum, dort, wo eine Wildfährte vorüberzieht, so dass das von Schmerz wütende Tier einen Leoparden oder ein anderes Wild im Vorüberstreichen erwischt und für den Neger tötet, der, an dieser Stelle versteckt, leichter die Beute macht. Sie flochten Körbe aus Baumrinde, hängten sie an die Gipfel hoher Bäume, in deren Nähe sie Bienen bemerkt hatten; diese, froh, eine Wohnung zu finden, legten dorthin ihren Honig, bis die Neger herbeiliefen, sie mit Rauch vertrieben und nicht bloß den Honig zum Essen, auch das Wachs sammelten, um daraus eine Art Kerze zu machen.
Frauen konnte der Mann haben, so viel er wollte, denn es gab dreimal so viel Weiber als Männer –– auch heute noch sind viel mehr Frauen da —, weil sie in ihren Kämpfen alle erwachsenen Männer nach dem Siege töteten, die Weiber aber raubten und mit sich führten, besonders die schönen der Bahima. Deshalb waren in Uganda die Frauen immer billiger als anderswo, sie kosteten nur drei Ochsen, später sechs Nähnadeln oder ein Paar Schuhe.
Kindersegen war selten, und ein Mann, der von derselben Frau schon das zweite Kind erhielt, durfte einen Monat lang vor der Hütte trommeln, um seine Freunde zum Freudentrunk einzuladen. In allem zeigten sie so viel Formsinn und Takt, dass Johnston schrieb: „Alle Bahima sind geborene Gentlemen.“ Dem Fremden schickten sie eine Erfrischung auf den Weg, ließen ihn dann im Zelte ausruhen, bevor sie ihn besuchten. Im Gespräch haben sie sich merkwürdige Formeln ausgedacht, sie sagen: „Ich danke dir, dass du dich gefreut hast. Ich danke dir, dass du mein Haus bewunderst. Ich danke dir, dass du meinen Sohn durchgeprügelt hast.“
Dies alles ward erfühlt und durchgeführt von einem Volke, das nie ein klarer Gottesglaube, nie eine Morallehre berührt hatte, nur aus einem tiefen, in der Brust des Menschen atmenden Takte. In diesem Zustande fand man um 1860 die angeblich Wilden auf. Der sie zu hüten hatte, war der König, rechtsprechend über Leben und Tod, umgeben von seinem Hofe, der ähnlich dem der Karolinger aus dem Minister, dem Mundschenk, dem Harfner, dem Flötisten, dem Torhüter, dem Pfeifenträger, aber auch aus Henker, Brauer und Koch bestand. Einer dieser Könige, der über 700 Kinder hatte, besaß außer seinen richtigen Frauen viele hundert Prostituierte, die er noch bis gegen 1900 auf den Markt schickte, um durch die Verleihung sinnlicher Freuden an seine Untertanen sich eine originelle Art von Steuer zu verschaffen. Als einziger Besitzer von Land und Herden gab er, wie der König des westlichen Mittelalters, seinen „Grafen“ Stücke des Landes zu Lehen, hielt sie durch Vorteile auf Kosten der Bauern in Laune, spielte ihre Eifersüchte gegeneinander aus: er, die Spitze der Staatspyramide, hoch über den besitzlosen Bauern als Basis, wie in Russland unter dem Zaren. Da der König jede Kuh besteuerte, war der Graf für jede verantwortlich, und wenn ein Löwe oder auch ein Nachbar einbrach, musste er Jagd oder Krieg veranstalten, um die Kühe zu retten oder zu ersetzen.
Der letzte dieser Könige, der letzte an Macht, jener, den die ersten Reisenden hier besuchten, Mutesa (1840-84), zeigte alle Eigenschaften seiner weißen Standesgenossen, nur dass er weiser war als manche von ihnen. In seinem Palast, einer Halle von 30 Metern Länge, empfing er mit der Würde des Sonnenkönigs die ersten Fremden zwischen Pauken, Fahnen und Lanzenträgern, behandelte die märchenhaften Männer, die da auf seinen Thron zutraten und ihm doch wie Götter erscheinen mussten, mit Huld ohne Neugier, gab ihnen Hilfe, statt sie zu erschlagen oder zurückzuhalten, und wenn er dort saß, in indische Seide gehüllt, ein Bein auf seinem Stuhle vorgestreckt wie die westlichen Könige auf alten Kupfern: wer hatte ihn gelehrt, dass Anmut und Würde den echten Herrn ausmachen? Die große Halle war aus Stroh, aber geräumig wie ein Marmorsaal in Rom. Wenn er aß, standen viele Frauen und Männer des Hofes umher, nur der Minister wartete an der Türe, um jeden bösen Blick von den bedeckten Schüsseln abzuhalten; denn er allein durfte die Reste aufessen. Die Höflinge aber riefen, wenn der König etwas sagte, nach jedem Satze aus: „Niyanzi-ge“, das heißt etwa: „Danke sehr, ausgezeichnet!“ Ganz wie an den Hoftafeln Europas.
Und wer hatte Mutesa verraten, dass man als König zunächst seinen Vater in eine phantastische Legende versetzen muss? „Mein Vater“, so erzählte er, „war krank im Alter, täglich ließ er, um die bösen Geister zu versöhnen, hundert junge Leute töten. Aber als er sich wieder besser fühlte und wieder, wie früher, auf seinem ersten Minister reitend ins Freie kam, brach er tot zusammen. Dann wurde er in eine Kuhhaut genäht, drei Tage lang auf dem See schwimmen gelassen, bis sich drei Maden aus ihm erhoben; da wurde er nach Hause gebracht, und dann verwandelte er sich in einen Löwen. Mein Großvater aber war so stark, er hätte ewig gelebt, hätte er sich nicht nach unendlicher Zeit selbst aus der Welt gezaubert, um seinem so lange wartenden Sohne Platz zu machen.“
Und was tat der Urvater deiner Väter? „Ich bin der Achtzehnte aus unserem Herrscherstamme“, sagte König Mutesa. „Der Gründer unseres Hauses kam aus der Ferne als ein berühmter Jäger hierher. Der war so stark und schön, dass sich die Königin in ihn verliebte, sogleich ihren Mann vergiftete und ihn zum König und zum Vater des nächsten Königs machte.“
Drei schöne Worte haben die Reisenden von Mutesa verzeichnet. Als er seine Kriegsbeute durch ein Land schleppen wollte, das ihm nicht freundlich war, schickte er dem schwarzen König hundert Pfeile und hundert Hacken. „Willst du Frieden“, so ließ er sagen, „so nimm die Hacken und bestelle damit deine Felder. Willst du Krieg, nimm die Pfeile, du wirst sie brauchen.“ Jener nahm die Hacken und heißt seither „König der hundert Hacken“. Als sich ein Engländer, der vor ihn trat, wegen fortgeschwommener Geschenke entschuldigte, sagte König Mutesa: „Die großen Flüsse verschlingen die kleinen. Seit ich dein Gesicht sehe, denke ich an nichts anderes mehr.“ Und als ihm Stanley anatomische Tafeln erklärte, wie das Handgelenk, die Fingermuskeln sich bewegen, sagte der König: „Wunderbar. So etwas könnte ich nicht machen. Und doch sollte ich auch nichts zerstören, was ich nicht machen kann.“ Kurz darauf ließ er einem, der ihm nicht gefiel, ein Ohr abschneiden.