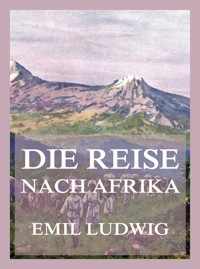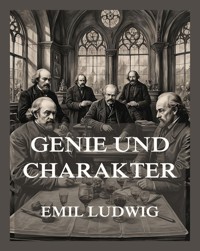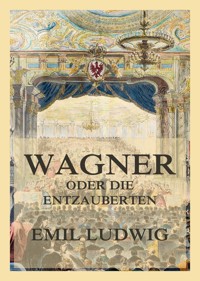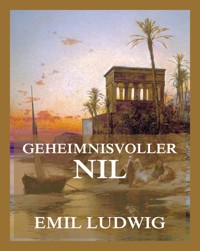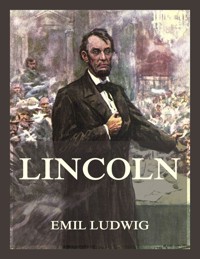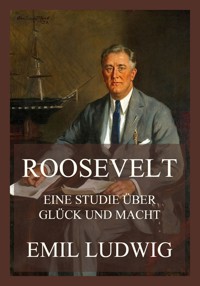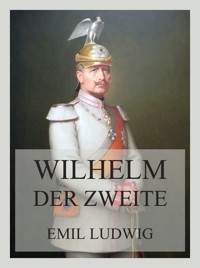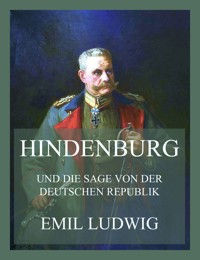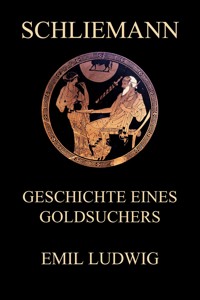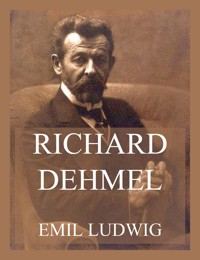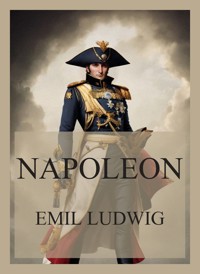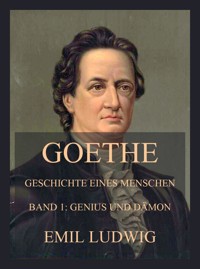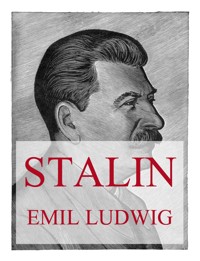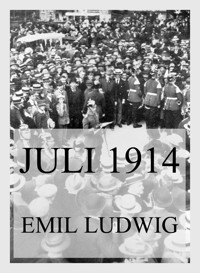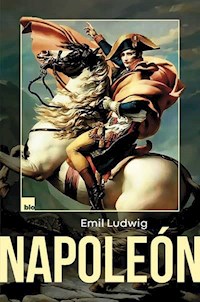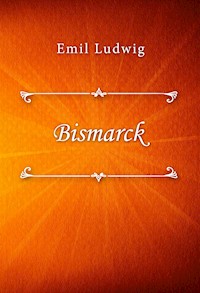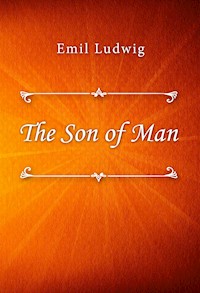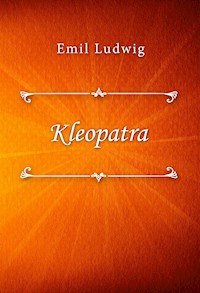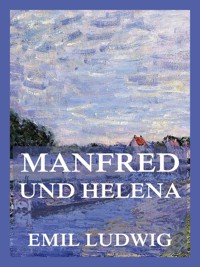
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Manfred ist ein Dichter, einer mit dunklem Haar und dunklen Augen. Nicht vom Geschlecht der Gottbegnadeten, an deren Spitze Goethe und Mozart stehen. Sein Ahnherr mag Tasso gewesen sein. Sein unglücklicher Vetter ist Grillparzer. Wie dieser ist er Dramatiker aus dem Zwiespalt zwischen Geist und Sinnlichkeit, wie dieser kämpft er gegen die quälende Herrschaft des Vaterlandes und sehnt sich, im unbewussten unterzugehen. Wie dieser ist er ein Greis und ein Knabe zugleich, indes man das mittlere von beiden sein sollte: ein Mann "; ist "zugleich Zuseher und Schauspieler." Er gehört der großen Familie der Zerrissenen an, deren einziger, unstillbarer Wunsch ist, sich selbst zu vergessen, einmal ganz und gar, mit allen Sinnen und restlos ins Leben hineinzuspringen, wieder ganz zum Tier zu werden. Manfred sagt: Die Gegenwart ist mir verstellt, immer tritt sie vor mich als Vergangenheit. Das macht ihn zum Dichter, zum Dramatiker. Aber das macht den Menschen Manfred unglücklich, er sehnt sich nach Ganzheit und schämt sich dieses Zwiespalts. Ihm ist die Kunst gegeben und er verlangt nach dem Leben. Manfred gegenüber steht das stahlblaue Auge, das lichte Haar. Dieser Gegner ist durchaus Mann, während in Manfred Mann und Weib wunderlich gemischt sind. So zieht es Manfred zu ihm und stößt ihn doch voll Hass ab und in diesem Widerstreit der Gefühle entsteht die erbittertste Feindschaft, nun gar als Helena sich dem anderen zuwendet. Helena, das ist eine Ganze, Starke, Gesunde; in ihr, der knabenhaft herben hat sich Hellas dem Norden vermählt wie weiland in Euphorion. In ihr hat Manfred sich ganz vergessen können, sie hat ihm das Glück gebracht. Unmöglich, ihren Charakter in logisch fassbare Worte zu zwingen. Sie, die aus sich so wunderbar gediehen " wird von dem Dichter selbst der Mona Lisa verglichen, sie ist es, vor der Heinrich Heine betete und die er Sphinx nannte. Kein Wunder, dass sie der Mensch der Realität, der Mathematiker, der Blonde, das Ewig Männliche anzieht. Aber auch hier bleibt schließlich Manfred Sieger, sein Genie, dem es nun gelingt, das Rätsel Helena ganz zu begreifen und so zu fassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Manfred und Helena
EMIL LUDWIG
Manfred und Helena, E. Ludwig
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849680655
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
ERSTES BUCH.. 1
Erstes Kapitel. Die Aussicht1
Zweites Kapitel. Der Fremde. 3
Drittes Kapitel. Der feurige Ring. 9
Viertes Kapitel. Das stahlblaue Auge. 14
Fünftes Kapitel. Realitäten. 22
Sechstes Kapitel. Die Erscheinung. 26
Siebtes Kapitel. Das Lachen. 30
Achtes Kapitel. Helena. 36
Neuntes Kapitel. Die Entführung. 41
ZWEITES BUCH.. 48
Zehntes Kapitel. Die Insel48
Elftes Kapitel. Der Tanz. 55
Zwölftes Kapitel. Masken. 62
Dreizehntes Kapitel. Nocturno. 67
Vierzehntes Kapitel. Wanderungen. 73
Fünfzehntes Kapitel. Einsiedler76
Sechzehntes Kapitel. Thanatos. 83
Siebzehntes Kapitel. Das stahlblaue Auge abermals. 88
DRITTES BUCH.. 95
Achtzehntes Kapitel. Der Eislauf95
Neunzehntes Kapitel. Der Reiter101
Zwischenspiel108
Zwanzigstes Kapitel. Helena spricht110
Einundzwanzigstes Kapitel. Sieg des feurigen Ringes. 115
Zweiundzwanzigstes Kapitel. Die Flucht122
Dreiundzwanzigstes Kapitel. Aus dem Tagebuch des Seefahrers126
Vierundzwanzigstes Kapitel. Gedanken des Reiters. 134
Fünfundzwanzigstes Kapitel. Tyche. 136
ERSTES BUCH
Erstes Kapitel. Die Aussicht
Die Sonne stieg. Manfred stand ihr abgewandt auf einem mäßigen Hügel und blickte über die Landschaft, als berge sie sein Geschick.
Dort draußen vor der Weltstadt hoben und senkten sich die bewaldeten Vorposten der großen Ebene und weite kalte Seen streckten sich zwischen ihnen. Aber in erblauender Ferne kündeten die Berge den Atem göttlicher Winde an, den von allen Menschen der Stadt und der Ebene nur die Erkorenen ertragen mochten.
— Bin ich der Liebling der Götter, bin der Erkorene, fühlte Manfred der Künstler, warum noch immer lasst ihr mich von den Hügeln auf eure Berge blicken? Welche Leiden fordert ihr noch? Stahl ich das Feuer? Liehet ihr mir es nicht? Warum entfachte eure Laune widrige Winde in mir, die die Flamme bekämpfen? Noch habt ihr ihnen nimmer Halt geboten, dass die Flamme das Bild der eigenen Seele mir beleuchte und Manfred im Anblick des vorausgeschaffenen Abbildes erkenne, wohin er die Kräfte der Schönheit senken soll, mit denen ihr ihn begabtet. Und ist das Opfer mit den unnennbar schönen Haaren, das ich euch gestern brachte, nicht groß genug?
Der Märzwind kam über die Ebene heran. Nun griff er den steilen Kiefern ins Haar, nun stürmte er den Hügel hinauf, nun hatte er den Mantel des Einsamen erfasst, nun wirbelte er ihm hart und feindlich in die schwarzen Locken.
Den dunklen und zugleich feurigen Blick gesenkt, mit fliegendem Haar, den weiten Mantel um Leib und Arme hüllend, stand er, das Abbild der erstrahlenden Nacht.
Aber Renate, der er gestern zum letzten Male Hand und Lippe gereicht, mit den unnennbar schönen Haaren gesponnen aus Goldfäden, - dem Tage hätte sie gleichen sollen und hatte ihm nicht geglichen. Eine Orangeröte, zu heftig für die weiße Haut, bildete Inseln auf den schmalen Wangen, ihr junger Busen hob sich zu weiblich, zu blühend schwoll die Lippe für solche Herbe, und das überreiche Gold ihres zarten Hauptes, stumpf statt strahlend, lastete über der Stirne wie die prangenden Kronen auf den Häuptern asiatischer Knaben, denen das Diadem riesiger Ahnen von rauen Händen aufs Haupt gepresst ward. Aber ihr Auge war der Verräter und Deuter dieser schmelzenden Disharmonien, denn es trug ohne deutliche Färbung in seiner Unruhe die tödlichen Zeichen der Unfruchtbarkeit.
Was hatte ihn, den immer Produktiven, so trotzig an die Seite des schönen und beklagenswerten Mädchens gezogen?
Er suchte vergeblich ihr Bildnis vor sich zu stellen, denn je häufiger er einem Mitmenschen begegnet, je gottloser er in ihn eingedrungen, desto unmöglicher wurde es ihm, seine Züge sich zu malen.
Er wusste nur noch, dass der schöne Leib jener unfruchtbaren Seele auf Fruchtbarkeit schließen ließ, wenn er sich den Kräften eines Mannes vermählte.
Noch hatte sie keinem angehört, doch umso heftiger vermochte Manfred, während des langen Jahres ihrer Gemeinschaft, in mancher Stunde das Begehren ihrer Sinne zu spüren, das krampfhaft war wie alle Äußerungen des Lebens, die diese Tote zeigte. Sie war klüger, schärfer gewesen als er, mit entsetzlichem Mute blickte dieses schöne Mädchen auf sich selber, mit reißender Gebärde für ihr Gefühl die Wahrheit schützend, an der allein sie mit der Inbrunst der Märtyrer sich aufrecht hielt.
Und wie diese alle Lust und Wollust der Welt, vor sie gebreitet, um sie zu verführen, mit der inbrünstigen Kühnheit monomaner Helden von sich stießen, um ekstatisch zu sterben, hatte Renate sich bis an die Zähne gewappnet und lange Monate gegen die Übergabe an dem schönen Verführer zum Leben gewehrt. Als sie seiner Hingabe endlich erlag, schrie noch einmal ihr Wille zur Wahrheit auf, und in der ersten Umarmung seiner schlanken Glieder, ihr angepasst wie zu schönem Gleichnis, war ihr Gebet zu den Göttern des Tartarus gedrungen in dem Rufe: ,,Manfred! ich fühle nichts!"
So ganz wie Sie der unfruchtbaren Wahrheit, war Er dem schönen Scheine hingegeben, den in unendlichen Bildern darzustellen sein Dämon ihn trieb.
Aber Renate kannte sich selbst und sah, mit jener frühen Vollendung unfruchtbarer Naturen, auf dies Geschöpf, das sie selbst darstellen musste, bis endlich einst der Leib zerfiele, schneidend und klar wie auf das bleiche Tuch der Winterwiesen in hohen Bergen. Manfred hingegen, unvollendet, hatte sich noch nicht erkannt, unvermählt lag Wille und Geschick in seiner Seele, wie Hammer und Marmor am Morgen in der Werkstatt des Bildners ruhen.
Zweites Kapitel. Der Fremde
Manfred war in einem Haus und Kreis erwachsen, freisinniger Naturforscher, deren breite Figuren ihm die Sterne ganz verstellten, die sie ihm hätten weisen sollen.
Ihn entzückte das Wesen seines Vaters, und er liebte die Gestalt seiner Mutter, ob auch Beide ihm das nicht reichten, was er suchte.
Sein Vater hatte ihm die Flüssigkeit des Geistes und die heitere Sinnlichkeit vererbt, die ihn unter allen Wirrnissen den Menschen liebenswert gemacht Er hatte das vollkommene Beispiel eines egozentrischen Menschen dargestellt, dessen Geist alles das an sich zog und mühelos verarbeitete, worin er selbst sich spiegeln konnte. Er war tätig, hell und gütig durchaus, dabei tyrannisch und selbstsüchtig mit solcher Frische, dass nur unterdrückte Seelen ihn missverstehen, nur dumpfe Naturen ihn hassen konnten. Als Arzt und als Gelehrter von weitem Ruf, in vielen Heilungen und Forschungen den rüstigen Fleiß der Tage und Nächte spiegelnd, hatte er dennoch seinem originellen und oftmals unbedachten Auftritt zuzuschreiben, dass er von den leitenden Stellungen ausgeschlossen blieb, und der große Kreis seiner Schüler folgte der begeisternden Persönlichkeit des Professors nur aus Neigung, ohne Verpflichtung, um aus diesen Händen praktische Lehre zu empfangen, die sich an Theoreme selten band.
Manfred war bald auf dem Punkte, die Grenzen seines Vaters zu erkennen. Aber mit der ganzen Hingabe des Knaben bewunderte er ihn, wenn er verstohlen seinen Operationen zuschauen durfte. Hier und nur hier sah sein Geist, von früher Jugend an auf die Dämonen lauernd, die die Menschen um ihn beherrschten, mit einer Art stummer Anbetung wie der weißbärtige Vater unter dem unentrinnbaren Druck des Dämons alles vergaß, was ihn sonst belebte, wie Laune und Tyrannei, Witz und Nervosität erstarrt und unbeweglich sich duckten, um allein Geist und Geschick, auf eine einzige kleine Wunde gerichtet, wirken zu lassen. An dieser Messerspitze hängt das Leben, dachte Manfred, aber er fühlte wohl, dass der dort Handelnde den eingeschläferten Kranken nicht anders denn als Kadaver sah, an dem nach den Gesetzen der großen Kunst dieser und kein anderer Schnitt zu tun war.
Da regte sich vor dem Auge des Knaben zum ersten Male die Gewalt der Besessenen, der Künstler. Ihn drängte es nicht, das Warum zu erfahren, das Wie zu lernen, nur aus der Ecke des Operationssaales blickte er auf den weißbärtigen Mann und ahnte mit Verwirrung, dass dieser, von vielen Händen umgeben, scheinbar ein König in diesen Räumen, ein Richter über Tod und Leben an diesem Leidenden, dennoch nichts als ein geniales Werkzeug war, das dem gestaltenden Triebe gehorchte.
Der Professor war niemals müde, immer wirkte er ostentativ, keck und vielfach. Er schrieb, lehrte, agitierte, beriet und operierte, und wenn er dann am Abend in den erleuchteten Räumen die Freunde und Fremden empfing, die unaufhörlich das gastliche Haus erfüllten, war Er es, der den Kreis beherrschte. Ohne tiefere Bildung, gründlich nur im Umkreis seiner speziellen Wissenschaft, hielt er doch den neubegierigen Sinn so lebhaft allen Erscheinungen lebendigen Wirkens zugewandt, sein schneller Verstand war so freundlich im Erfassen, sein Humor so rasch und springend, sein Temperament so reißend, dass Niemand mit ihm Schritt halten konnte. Er wusste nicht, dass man aus Menschen lernen könnte, weil er Menschen kaum unterschied, Vertrauen jedermann entgegenbrachte und sich immer gut unterhielt, weil er im Grunde immer allein sprach.
Er sah deshalb auch nicht die Enge jener Geister, die ihn täglich umgaben. Manfred hasste sie.
Gerade die Gestalt seines Vaters, der freier, unbefangener und klüger war als jene, und der dennoch mitzusprechen pflegte, was sie an Prinzipien verfochten, zeigte ihm die verdeckte Konstruktion dieser kleinen Geister. Sein Vater war die einzige Persönlichkeit, die Andern wandelten als Prinzip.
Dies Prinzip war der naturforschende Freisinn. Söhne jener Generation, die das Frankfurter Parlament als tapfere Männer mitgeschaffen, hatten sie ohne Schwierigkeit die Worte übernommen, die damals Leben bedeuteten: Aufklärung und Konstitution, exaktes Wissen und götterlose Naturverehrung sprühten unaufhörlich aus ihren unphilosophischen und ehrfurchtslosen Köpfen. Sie hatten weder Anmut noch Würde. Die drei Worte ihres Credos: die Pflicht, der Männerstolz und das Wissen, setzten den heranwachsenden Knaben erst in Verwirrung, dann in Wut. Ja! Sie alle, sie übten die Pflicht, eine Familie zu gründen, zu ernähren, zu erziehen, ihr Männerstolz war kerzengrade, wenn sie einen verhassten Mann von Einfluss nicht grüßten, ihr Wissen war unpersönlich, kalt, Stoff und Zahl. Nur ein einziges Wort war ihnen unbekannt, das Wort, das die Glocken rufen: Macht. Aber sie strebten Alle nach Geld.
Sie hatten keine Geheimnisse; ein großer Kreis teilte sich unaufhörlich mit, man kannte die Seele und die Sorgen des anderen, man besaß keinerlei Ehrfurcht vor sich selber. Bei jedem Mittagbrot wurde die Weltanschauung gesichtet. Man löste alle Fragen mit der heiteren Ruhe wissenschaftlich beschränkter Köpfe und schwor auf den Materialismus, als hätten die beiden großen Philosophen der letzten hundert Jahre nie gelebt.
Als Manfred erwuchs, verdross ihn die Eitelkeit der Vielwissenden, und er durchschaute ihre blendende Leere. Ihn kränkte das falsche Pathos, mit dem diese Männer der Wissenschaft, von freisinniger Wahl heimkehrend, sich in die schmale Brust warfen, einander zutranken und riefen: Ich kann nicht Fürstendiener sein! Ihn empörte jener Mangel an Generosität und Loyalität, mit dem diese bürgerlichen Kreise sich spreizten. Ihn entsetzte die Furcht vor Verantwortung, die diese optimistischen Männer bedrückte, die breite Lebensangst, die jammervolle Furcht vor dem Sterben, die sich hinter witzigen Bemerkungen über die Einfachheit der Auflösung von Kraft und Stoff recht kläglich verbarg.
Vor allem aber litt er unter der Vernachlässigung der Formen, die diese Geistesritter wie ein leider notwendiges Übel nur obenhin wahrten. Er wusste damals nicht, dass, wo eine vollkommene Geistigkeit herrscht, des Körpers nicht leicht vergessen werde, und sah nur, dass hier, wo das geistige Element mit Eitelkeit forciert wurde und ein breit gepriesener Wille zur Aufklärung die Stelle stummer Kenntnisse einnahm, das Körperliche geringgeachtet, verbannt, zumindest nicht gepflegt wurde.
Auch seinem Vater verdachte er mancherlei, aber die natürliche Elastizität dieses Temperamentes machte alle Unschönheiten biegsam, und die Raschheit seiner Bewegungen ließ wenig Zeit zur Kritik.
Doppelt zog den fünfzehnjährigen Sohn die Gestalt seiner Mutter an. Sie war kühl, schön, mit einem unbewussten Zug für alles Formale. In einem Kreis einseitig gebildeter, wortreicher Professoren fiel sie ohne geistige Prätention, mit vollkommenen Manieren und natürlichem Verstande beruhigend auf, und den durch die Ereignisse der Geschlechtsreife vollends verworrenen Sohn entzückte ihre absolute Verschlossenheit als Frau, während der Kreis ihrer Freundinnen in begeisterter Aufklärung sich oft unsäglich preisgab.
Obwohl sie von dem reifen Manne als halbes Kind heimgeführt und, wie seine Tochter erzogen, mit ihm vollkommen glücklich lebte, dachte Manfred, wenn er die schöne Frau von kaum vierzig Jahren in großer Toilette in den Wagen steigen sah: - Warum bist du nicht die Herrin eines großen Gutes, die Gemahlin eines Ministers? Bist du nicht schön, kühl und formvollendet wie jene Frauen, von denen ich gelesen? Magst du hier wirklich leben?
Um zu erkennen, warum die Ehe seiner beiden Eltern harmonisch erklang: weil der Eigenwillige sein Geschöpf, der Sinnliche die stets neu zu Erobernde zur Frau hatte, die Kühle und Kindliche den liebenswürdig Werbenden und Sicheren zum Manne, -um dies zu erkennen, hätte Manfred reifer oder er hätte so blind sein müssen, wie jene Welt von Naturforschern, die dort, am Tage in den Uferwassern ihrer Spezialitäten plätschernd, abends nichts forderten und gewohnt waren, als recht viel Weltanschauung und nachts das Bett, in dem sie ihre Kinder zeugten.
Eines Tages saß an der Mittagstafel ein Herr von mittleren Jahren, ein Aristokrat, ehemals Offizier, nun Forschungsreisender. Der Professor sprach viel, holte jeden Augenblick ein anderes Dokument der Wissenschaft oder der Kuriosität herbei, unterbrach das Gespräch seiner Gattin mit dem Gaste durch laute Mitteilung einer Zeitungsdepesche und strahlte wie immer ohne Ermüdung aus. Der Herr aber, verbindlich, fast ohne Farbe, zog Manfred leidenschaftlich an.
Dieser bewunderte an ihm zunächst nur negative Dinge: der Fremde äußerte keinerlei Weltanschauung und keine Prinzipien, obwohl man ihn in gewohnter Art dazu antrieb. Sein Wesen schien dem Knaben vornehm, seine Art zu essen, sich zu verneigen, zu antworten, entzückte ihn, die Mäßigkeit seiner Äußerungen und Erzählungen ließ ihn auf eine Fülle schließen, die jener verbergen mochte. Der Professor rief:
,,Wie? Sie waren auch in Indien, Verehrter? Nun erzählen Sie einmal!"
Der Fremde lächelte:
,,Was soll ich nun erzählen, Herr Professor? Soll ich von Tigern oder Tempeln erzählen, von der Pest, vom Militär, von Darjeeling oder Madras, von Kaschmir oder Ceylon, von Radjas oder Parias, von Dschungeln oder vom Ganges?“
,,Vom Ganges!" rief Manfred vom unteren Ende des Tisches, dass Alle sich umwandten.
,,Ruhe!" rief der Vater zurück. Aber der Fremde hatte die flehende Gebärde des Knaben noch erkannt, ehe er sich wieder hinter die gefüllte Vase zurückzog. Wollen sie mich in mein Hotel begleiten?" fragte ihn der Offizier, als er aufbrach.
,,Hör zu und lerne," ermahnte der Professor seinen Sohn. Denn es war ihm nicht bewusst, dass er selbst nicht zugehört und nichts von dem Fremden gelernt hatte.
,,Was wollen Sie werden," fragte dieser, als sie langsam die Straßen entlang schritten.
Manfred bewunderte den eleganten Mantel und Zylinder, die sich neben ihm bewegten. Er antwortete:
,,Ich weiß nicht. Alles!"
„Sie sind glücklich und jung."
,,Warum?"
Weil Sie Wünsche haben."
,,Wünsche? Ich wünsche nichts zu Haben, aber alles zu Sein. Ist auch das ein Zeichen des Glückes?" ,,Der höhergeartete Mensch," sagte der Fremde, indem er stehen blieb, um eine neue Zigarette zu entzünden, ,,pflegt die ordinären Wünsche zu Haben in Wünsche zu Sein umzuwandeln."
Manfred stutzte und dachte: Der höhergeartete Mensch....
„Reisen sie jung," unterbrach sein Begleiter mit Absicht seine Gedanken. ,,Dann werden Sie früh aufhören mit großer Sehnsucht diesseits der Berge zu seufzen."
Diesseits der Berge..., dachte Manfred und lauschte.
Der Fremde musterte seine Züge, Gestalt und Kleidung unbemerkt von der Seite, dann sagte er: ,,Streben Sie nach dem Abenteuer oder nach der Leidenschaft, junger Herr?"
Manfred blickte sich betroffen nach ihm um, errötete und stockte, sagte aber noch rasch: „Oh, nur nach Einer, Einer!"
,,Sie werden sich früh vermählen," schloss der Fremde, indem er sich die Asche sorgfältig vom Mantel putzte. „Das ist gefährlich. Ich will Ihnen ein Geheimnis sagen. Distanzen schaffen ist eine Lebenskunst. Jedes Mal, wenn Sie Ihrer Frau die Hand küssen, sich mit Haltung von ihr verabschieden oder sie begrüßen, werden Sie aufs Neue das Glück empfinden, sie mit einem Male wieder fern auftauchen zu sehen, und der Wunsch wird Sie beleben diese Fremde neu zu gewinnen."
Manfred sog diese Worte ein, ohne sie ganz zu begreifen. ,,Warum leben Sie nicht in unserer Mitte," sagte er leise und ohne Scheu.
Der Andere lächelte: ,,Wollen Sie mich ergründen? sagte er dann. ,,Meinen Sie, dass es lohnte? Sie irren sich, Ihr Herr Vater ist um vieles interessanter als ich, nur sind Sie zu jung, das einzusehen. Glauben Sie übrigens, dass Mitmenschen sich ergründen können?"
Manfred fühlte: Mitmenschen, die sich ergründen... ,,Was wissen wir vom andern," setzte jener ohne Seufzen hinzu. „Wir ahnen etwas von dem geliebten Wesen, in dessen Armen wir die Ekstasen des Lebens steigern, und im Augenblicke der Selbstvergessenheit spüren wir noch sein Selbstvergessen, ehe wir an der Wollust sterben. Wer vertraut uns aber die schauervollen Stunden der kostbarsten Gemeinschaft mit der angebetetsten Frau? Welcher Freund könnte sie vertrauen? Und wäre er ein Dichter und vermöchte es, –– wehe ihm, wenn er es täte! "
Manfred war ganz bleich geworden. Zwischen diesen Worten irrte seine Seele umher wie der Schritt eines Gefangenen, den die Laune des Fürsten schlafend in den Garten des Palastes hatte tragen lassen.
Der Fremde hatte die gewagten Worte in die Luft geworfen, damit sie der Knabe an seiner Seite auffange, denn rasch hatte er erkannt, was dieses Auge in dieser Unwelt vergeblich suchte. Er dachte: Wird dieser ein Künstler werden?
,,Es ist gleichgültig, was Sie werden," sagte er plötzlich, um sich wieder in jene Realität zu begeben, die den Schüler wohl noch lange blenden mochte. ,,Jeder Stand, jeder Mensch baut sich auf dem Grunde seines Optimismus aus seinen Schwächen ein System des Glückes. Leben Sie wohl. Denken Sie nicht zu viel."
Sie standen im Vestibül des Hotels. Freundlich reichte er ihm die Hand. Manfred blickte ihn mit Verwirrung an. Indem er etwas erwidern wollte, lenkte ihn die Beobachtung dieses Mundes ab, dessen blühende Lippen zwei lotrechte Falten begrenzten, die das Leben zu verachten schienen, das jene beglückte.
–– Bin Ich das nicht? Werde Ich das nicht sein, in zwanzig Jahren? –– dachte Manfred und bebte. ,,Leben Sie wohl," klang es noch einmal von diesen Lippen.
Manfred blickte dem Fremden, der nichts war als ein kluger Mann von Welt, wie einer Erscheinung nach. Als er im Lift verschwand und nach oben fuhr, versank das Hotel um den Knaben, und er glaubte einen Erzengel auffahren zu sehen.
Drittes Kapitel. Der feurige Ring
Es war nicht lange nach dieser Begegnung, da hatte Manfred ein Erlebnis, schrecklicher und schöner, tödlicher und fruchtbarer als alles, was ihn nachher traf.
Man hatte einen Streit bei Tische, es mochten sechs Personen sein. Man stritt über die Kandidaten für ein frei gewordenes Katheder, über ihre Befähigungen und Connaissancen. Wie immer wandte sich das Gespräch ins Allgemeine, und die für den berühmten Forscher eintraten, behaupteten, ein Professor sei zur Forschung da und seine Leistungen allein hätten zu entscheiden. Die anderen, die für einen jüngeren, wegen seiner Vortragskunst und Lehrfähigkeit bekannten Dozenten plädiert hatten, meinten, ein Professor sei in erster Linie Lehrer der Jugend, und große Leistungen als Gelehrter könnten Mangel an Lehrfähigkeit nicht wett machen.
Man sprach lebhaft, die Diskutierenden teilten sich in Gruppen, man hörte mehrere Stimmen zu gleicher Zeit. Manfred, am unteren Ende der Tafel, hörte mit Interesse zu und neigte bei sich zu den Vorkämpfern der geborenen Lehrer.
Da bemerkte er mit Schrecken, wie um das Bild der Sprechenden und Gestikulierenden ein unendlich schmaler, feuriger Ring sich schloss, der mit rasender Schnelle um das Bild zu rotieren begann. Er selbst aber stand außerhalb, er hörte zu denken auf, wie eine Maschine, die abgestellt worden, und blickte ins Innere der abgesperrten Scheibe, um die der Reifen feurig rotierte. Er fühlte ganz genau, dass und wie er hineinblickte, und glaubte sogar, wie auf unebenem Terrain, ein wenig über dem Bilde zu stehen. Dort drinnen sah er seinen Vater, laut und beweglich wie immer, seine Mutter an der Spitze des Tisches, bedacht auf die Bedienung, die Herren, welche aßen und stritten, seine ältere Schwester, die mit Unruhe nachzudenken schien, und endlich, zu seinem Entsetzen, sich selbst, verdoppelt, wie er am unteren Ende der Tafel saß, speiste und dachte, wie recht die Vorkämpfer der geborenen Lehrer hätten. Nach ein paar Augenblicken stummen Schauens fühlte er einen heftigen körperlichen Schmerz in der Gegend des Herzens.
Ausgestoßen! Verdoppelt! Ruchlos!, klang es in ihm und schrie es um ihn.
Er ging zu Bette, starrte ins Dunkel, begriff nichts und schlief endlich vor Erschöpfung ein.
Seine gute Natur ließ ihn die Erscheinung fast vergessen. Aber kurz darauf bemächtigte sie sich seiner aufs Neue, und er sah den Schulprofessor dozieren, die Mitschüler antworten, sich erheben und zur Tafel gehen. Er selbst saß ganz ruhig auf seinem Platze, gab oder verfehlte die Antwort, je nach Wissen.
Wieder fühlte er sich plötzlich ausgestoßen. Diesmal aber war ihm, als hätte sich um das wiederum abgesperrte Bild eine niedrige Mauer gebildet, über die er, aufgestützt, mit verschränkten Armen blickte, wie die Zaungäste, die er als Kind im Dorfzirkus beneidet. Dabei rotierte diese Mauer so rasch wie jener Ring. Er fürchtete sich und verließ mit einer Entschuldigung das Zimmer.
Nun sah und beobachtete er öfters dies Phänomen, auf der Straße, im Theater, im Wagen und hätte sich daran gewöhnt, hätte nicht einmal die Verwirrung so zugenommen, dass er dem Wahnsinn nahekam.
Mit vielen anderen lehnte er über eine Brücke des großen Flusses, um einen Fischzug zu betrachten, der dicht unter der Fläche mit dem Strome schwamm. Mit einem Male bemerkte er, wie der Ring zu kreisen begann, und wie er, Manfred, außerhalb des Kreises den Zuschauenden, innerhalb den Fischen zuschaute. Aber plötzlich stand er ein drittes Mal in seinem Rücken und betrachtete den Betrachter, der den Zuschauer der Fische betrachtete.
Sein Kopf begann zu wirbeln. Er erinnerte sich eines Irrgartens, in den er auf einem Jahrmarkt getreten und der durch geschickte Aufstellung weniger Spiegel das Bild der Besucher bis ins Unendliche wiederholte, machte man aber einen Schritt, so stieß man sogleich wider den Spiegel.
Manfred lief davon. Ausgestoßen lief er vor dem vervielfachten Ich davon, das ihn zur Tollheit treiben wollte. Zu niemand wagte er davon zu sprechen, aus Furcht in ein Tollhaus gesperrt zu werden. Er warf sich auf seine Schulaufgaben, und in vier Wochen lernte er mehr, als im ganzen letzten Jahre. Ort und Gesellschaft verließ er im Augenblick, da die Erscheinung kam. Von Schuld und Sühne hatte man ihm oft gefaselt. Was hatte er verbrochen!
Ausgeschlossen! Vervielfacht! Ruchlos!, schrie es in ihm.
Er ergriff die Werke der klassischen Literatur, las Dramen, die er seit der Kindheit instinktiv bevorzugt, und vertiefte sich in die Bilder jenes großen Saales, dessen Wände Shakespeare bemalt. Er war reif genug geworden, um den Unsinn, den die Schule bei solcher Lektüre lehrte, zu erkennen, und begann auf eigene Faust Charaktere und Antithesen zu studieren. Aber eines Tages fühlte er, wie er hinter sich selber stand und sah: Dort liest ein junger hübscher Mensch von 16 Jahren Shakespeare.
Auch in der Einsamkeit? Er war verloren. Wann anders als im Schlafe ließ ihn das Gespenst zufrieden? Schlafen, schlafen, dachte er.
Die leiblichen Erscheinungen jener Jahre schreckten ihn vollends. Schlafen, sterben, dachte er.
Da wurde ihm ein Ereignis in der Familie zur Deutung.
Die Schwester, welche er liebte, hatte sich insgeheim verlobt. Der Professor war außer sich, zumal da er wohl wusste, dass sein Eigenwille sich auf die Tochter vererbt hatte. Die Mutter hatte kühnere Pläne und war in ihrer Weise aufgebracht. Manfred, mit dem Tatendurste des Primaners, sprang der Schwester bei und erhielt die Feuertaufe. Es gab große und sehr laute Familienszenen. Der Vater fluchte der Tochter, sämtliche Freunde wurden zu Rate gezogen und pflichteten den Eltern bei. Die halbe Stadt sprach von der Sache.
An einem Abend, als man nach dem Theater heimkehrte, brach die gewaltige Erregung des Professors, der drei Stunden schweigend neben seiner Tochter hatte sitzen müssen, wieder aus.
Mit einem Male fühlte Manfred sich geteilt und sah dem Bilde innerhalb des rotierenden Feuerring es als zweiter Manfred gelassen zu. Ihm war diesmal, als blickte er durch ein umgekehrtes Opernglas, was er an diesem Abend einmal getan hatte, und in weiter Ferne bewegten sich die Personen.
„Warum soll gerade unsere Familie nicht aufsteigen?" sagte eine elegant gekleidete Dame, indem sie die Stehlampe höherschraubte.
„Ich bin der Herr im Hause, gegen meinen Willen gibt es keine Entschließungen der Kinder," rief ein weißbärtiger, untersetzter Herr und sprühte Hass und Feuer durch die Brillengläser.
,,Eine neue Zeit ist angebrochen, wir entscheiden selbst unser Geschick," rief aus der dunklen Ecke des Salons ein Knabe, der den Stimmbruch kaum überwunden.
,,Ich werde ihn heiraten, mit oder gegen euren Willen,“ klang die künstlich gedämpfte Stimme eines anmutigen und herben Mädchens. Sie lehnte sich in ihrer Schlankheit an einen Samtvorhang, dessen Muster, die französische Lilie, ihr blondes Haar wie Arabesken zierte.
Manfred, in dem die optische Illusion der Entfernung so stark war, dass er sogar die Stimmen wie aus der Ferne zu vernehmen meinte, dachte außerhalb des Ringes: An diesen vier Epigrammen könnte man die Charaktere fassen, wie am Schlusse eines Aktes. Da tritt unerwartet der Verlobte ein. Wie werden die Vier reagieren?
Er stellte sich, da er diesen Verlobten nicht kannte, den fremden Offizier vor, wie er nun einträte, zuerst der älteren Dame die Hand küsste, dann den Professor begrüßte, zu dritt erst und stumm seine Braut, der er die Hand nicht reichte.
Da verließ Manfred, der wirkliche, den Salon, eilte in sein Zimmer, verschloss es, ergriff ein paar Briefbogen und begann, ohne irgendwelche Absicht einer Darstellung seines Hauses, eine Szene zu entwerfen, dergestalt, wie er sie vor sich im kreisenden Feuerring gesehen und wie er sie weiter zu träumen begonnen. Er schrieb die halbe Nacht. Er bemerkte nicht, dass seine dramatischen Dialoge nicht Anfang noch Ende hatten, und musste er die Szene wechseln, so schrieb er nur: Verwandlung, dann fuhr er fort. Sein Vater und der Offizier, den er zu seinem Schwager erhoben, gerieten am besten; er verstand sie gegenüberzustellen. Seine Mutter, die auch in diesen Szenen weniger sprach als ihr Gatte, wurde weniger gut und auch die Schwester fand ihr bestes Spiegelbild nur in den Klammern, in denen es wiederholt hieß: Johanna (ans Fenster tretend) oder: Johanna (allein, das Gesicht mit den Händen bedeckend).
Am schlechtesten gelang ihm, wie er anderen Tages zu seinem Staunen sah, Manfred selber. Die Töne der Überzeugung, mit denen er der geliebten Schwester beistehen wollte, klangen unwahrer als im Leben. Manfred, ungewohnt, hatte schon im Schreiben jedes Mal eine Unruhe verspürt, wenn er Manfred sprechen lassen wollte, denn er konnte nicht fassen, dass solche objektive Betrachtung aufrichtiges Handeln nicht. auszuschließen brauchte.
Als er aber weiterhin über das Ereignis im Ganzen nachzudenken ruhig genug wurde, quälte ihn dieser Abfall von seiner Schwester, wie er es nannte, vollends, und er wusste sich keinen anderen Rat, als dieser sich zu eröffnen.
Johanna trug eine schöne Seele, doch fand sie nicht Gelegenheit noch Muße, diese Seele zu bilden. Sie hatte den Trotz und den Fleiß von ihrem Vater überkommen, aber sein hinreißendes Temperament und der formale Sinn der Mutter blieben ihr versagt. So konnte sie nicht wie der Bruder die Zersplitterungen, die ihrer Generation den Aufstieg erschwerten, durch eine gute und flüssige Natur paralysieren. Sie war hart mit sich selber, sehnsüchtig nach Beruf und Leistung und freiheitsdurstig in einem tieferen Sinne als die freisinnigen Naturforscher.
Das heimliche und selbständige Verlöbnis mit einem schweren Manne, dem sie sich auch in Tätigkeit zu verbinden gedachte, war ihr großer Wurf. Sie wagte alles gegen nichts. Stand ihr in dieser Lage der Jüngling bei, so musste eine Annäherung eintreten über die Grenzen geschwisterlicher Liebe hinaus.
Manfred liebte sie schon lange, weil sie das einzige junge Wesen seiner Umgebung war, das ihm durch Reine und Herbe gefiel, und vollends in kritischer Zeit war er in sie verliebt, eine schöne Seele in die schwesterliche.
Nun brach er mit der Flut seines im Hause sehr gebändigten Temperamentes und vollends mit einem Erlebnis auf sie ein, das sie verwirrte und entzückte. Dergleichen hatte sie für sich erträumt, wenn unklare Vorstellungen von Leistung, Ruhm, Genie sie umbrandeten. Der Bruder hatte heimlich etwas wie Widerspruch erwartet. Er fand Begeisterung, kritiklos, liebreich, anspornend.
Da Manfred schon in diesen Jahren ungewisse Gedanken über die Entwicklung begabter junger Menschen wälzte, gab er wohl acht, erkannte, dass hier kein Richter ihm gegenüberstand, und ließ sich von dem Entzücken der Schwester nicht mehr als anfeuern.
Die große Befreiung, die jene Nacht der ersten Produktion ihm geschenkt, konnte er bei sich nur jener vergleichen, da die aufspringende Männlichkeit ihm schlafend kund geworden. Seine Natur hatte den Weg gefunden den Druck der Verdoppelung zu heben. Es folgte eine Zeit dramatischer Produktionen ohne Wahl, in einer Sprache, die Manfred nicht gehörte. Er lernte, indem er schrieb, und vernichtete, was er geschrieben. Die lang gestauten Wasser inbrünstiger Kraft waren gelöst, brausend sprangen die Wasserfälle nieder. Bald war ihm die Umwelt, die er gesehen, zu klein. Er konnte sich nicht verhehlen, dass eine heimliche Verlobung kein Vorwurf für ein großes Drama sei, auch wenn sie noch so edel war und der Widerstand noch so heftig. Doch kränkte ihn eine Art bösen Gewissens, dass er die Lebensfrage seiner Schwester, der er sich so sehr verbunden fühlte, nicht würdig seiner werdenden Gestaltungskunst erfand.
Das aber überwand er, riss sich los, eilte großen Stoffen zu. Vor allem waren es Werke der bildenden Kunst, denen er Leben und Bewegung geben wollte, von der Darstellung von Ideen hielt er sich mit Scheu und instinktivem Misstrauen zurück. Bilder, tausend Bilder erstanden vor ihm, ob er nun las oder schaute, Bilder, die sich im Nu belebten und deren kleinsten Teil er nur festhalten konnte.
Was ihn früher erschreckt, das reizte ihn nun, und geduldig blickte er über die niedrige Mauer in den Ring, worin Mensch gegen Mensch sich bewegte.
So war Manfred, als in jene Vision, die ihn bisher nur geängstigt, zum ersten Mal ein Funken Phantasie fiel, als er das plastisch und bewegt Betrachtete zum ersten Male weiter träumte, mit sechzehn Jahren elementar und ohne Willen zum Bildner geworden.
Viertes Kapitel. Das stahlblaue Auge
Wäre ein Menschenkenner und Psycholog in jenem
Kreis gewesen und hätte von der beginnenden Künstlerschaft des Sohnes jenes merkwürdigen Elternpaares vernommen, er hätte solche Anlage wohl erklären können. Der formale Sinn der Mutter konnte sich wohl in der nächsten Generation in einen künstlerisch formalen umwandeln, und eine sonderbare Eigenschaft des Vaters nicht minder.
Der Professor besaß den Sinn für das Typische. Nichts oder wenig begegnete seinen impulsiven Trieben, das ihnen ermöglicht hätte, sich großen Stiles darzustellen, sich zu brechen oder zu siegen. Das Leben verlief ihm zu undramatisch. Er steigerte deshalb, sich selber völlig unbewusst, die gewöhnlichen Ereignisse des Lebens zu typischen, um von jenen Sensationen zu kosten, die eine bewegte Entwicklung seinem Temperament in Fülle zu verarbeiten hätte geben müssen. Sandte er den Sohn auf eine wenig Stunden entfernte Universität, so sagte er: Nun ist die Stunde da, wo ich, der Vater, meinen jungen Sohn in die Fremde schicken muss! Wurde er einmal des Nachts zu einem Operierten geholt, so seufzte er? Los des Arztes, der seinen Schlummer für das Leben der Kranken opfert! Dies gesteigerte Bewusstsein der typischen Lage, so verschroben seine Gründe waren, mochte sich in dem Sohne zum künstlerischen Bewusstsein der typischen Lage umwandeln.
Der Genius aber sollte ihm zu diesen ererbten Eigenschaften im Laufe der Entwickelung die Sprachkraft verleihen, die entscheidet.