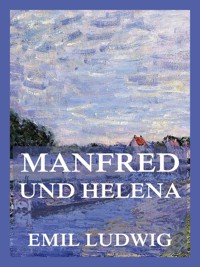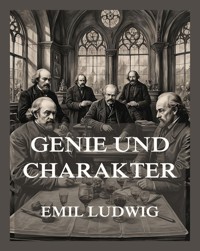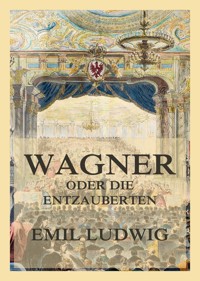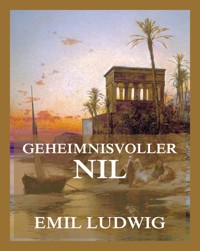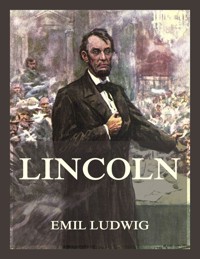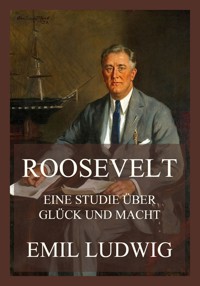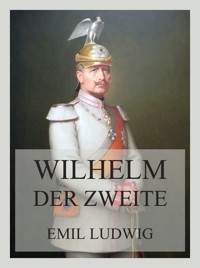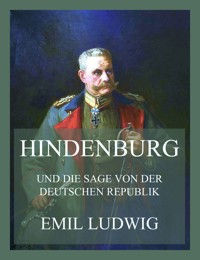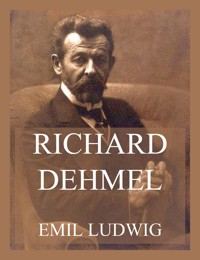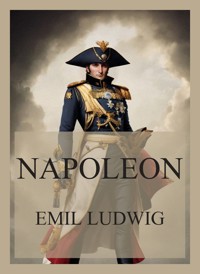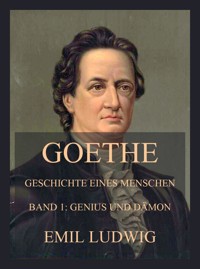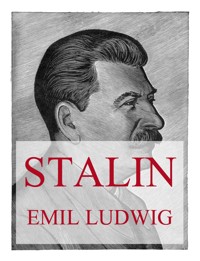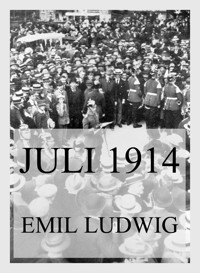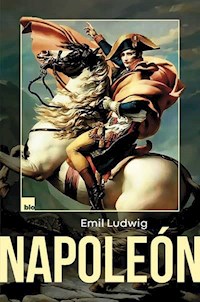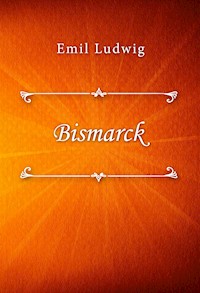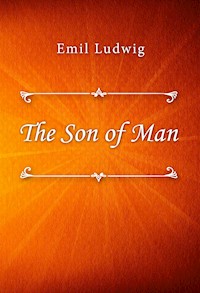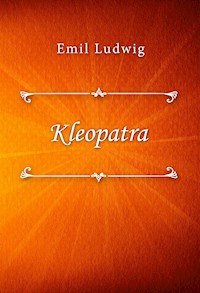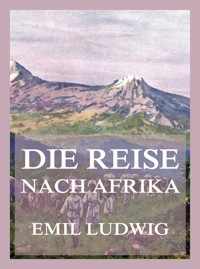
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im August 1913 unternahm der berühmte Schriftsteller Emil Ludwig im Auftrag der "Neuen Rundschau" eine mehrmonatige Reise nach Afrika, während der er Aden, Britisch- und Deutsch-Ostafrika, Sansibar, Sambesia und Südafrika besuchte. In seinem unnachahmlichen Stil berichtet er von Begegnungen an Bord des Schiffes und mit den eingeborenen Afrikanern, von Jagden, dem Afrikaforscher Lord Stanley und vielen interessanten Ereignissen mehr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die Reise nach Afrika
EMIL LUDWIG
Die Reise nach Afrika, E. Ludwig
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849680662
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
VORWORT DES HERAUSGEBERS. 1
ERSTE LANDUNG: DER KANAL. 2
ZWEITE LANDUNG: ADEN... 10
DRITTE LANDUNG: BRITISCH-OSTAFRIKA.. 21
VIERTE LANDUNG: DEUTSCH-OSTAFRIKA.. 59
FÜNFTE LANDUNG: SANSIBAR.. 90
SECHSTE LANDUNG: SAMBESIA.. 95
SIEBTE LANDUNG: SÜDAFRIKA.117
VORWORT DES HERAUSGEBERS
Lieber Leser,
in diesem, in den 1930er Jahren erstmals erschienenen Werk, benutzt der Autor in Zusammenhang mit den Einwohnern des Schwarzen Kontinents Worte und Beschreibungen, die heute nicht mehr zeitgemäß, geschweige denn akzeptabel sind. Wir weisen hier explizit darauf hin, dass Ludwig mitnichten Rassist war und selbst unter Hitlers Vorgehen und Literaturverständnis zu leiden hatte. Das Werk ist in diesem zeitgenössischen Zusammenhang zu verstehen.
Der Herausgeber
ERSTE LANDUNG: DER KANAL
La face d'arriver
Zwei Möwen flogen unserem Schiff voraus, als zeigten sie den Weg. Es wurde Abend. Westlich in drei Stufungen schattiert, noch einmal rauschte das Schauspiel des Lichtes hinab. Hoch, fast über unserem Scheitel bildeten stahlblaue Wolken geränderte Formen. Ihnen folgten, zum Horizont gesenkt, Inseln mit barocken Kratern, Landzungen, Halbinseln und Mittelmeere, hellgrün wie von chinesischer Tusche. Und erst am Horizont eröffnete sich rotgolden der Abendhimmel, mit weichen Rändern ausgeschnitten; wie man in Seide reißt.
Noch blieb die Küste unsichtbar, als ich im Rücken graublau die Nacht aufsteigen fühlte, wie ein geballtes Tuch, mit grausamer Schnelle. In wenig Augenblicken fraß sie das Licht. Verdunkelt und zerfließend bildete die mittlere Wolke eine Gestalt. Da rundete sie sich zu einer Insel, formte westlich eine tiefe Biegung, — und ich erkannte dort oben die Insel Afrika, umfeuert von den leidenschaftlichen Strahlen des hinabsinkenden Gestirns.
Wie von einem Zeichen überrascht wandte ich mich um: eine Reihe von Lichtern bedeutete die Küste. „... Und dort ist Abukir," sagte eine humanistische Stimme neben mir. Ich dachte: Napoleon auch hier, noch ehe wir landen? (Und noch zweimal erklang sein Name in diesem Erdteil.)
Von Westen sandte Djibouti seine Lichter, vor uns drehte das große Feuer von Port Said seinen dreifachen Lichtkegel. Ein großer Schatten stieg auf der Mole auf; weit hinaus gebaut ins Meer stand eine eherne Gestalt. Im letzten Lichte lässt sich erkennen, es ist auf hohem Postament ein Mann im Frack. Er trägt den Franzosenkopf der fünfziger Jahre. Dem Schiff entgegen blickt sein Auge nach Norden, aber die Rechte weist nach Süden. Darunter liest man das Motto: Aprire mare gentibus. Weit vor dem Hafen, auf umspülter Mole, am Eingang seines Werkes und des Erdteils steht Ferdinand de Lesseps.
Wohlbekannte Segel, goldbraun, blähen sich in der Einfahrt und sie sagen: Wir kommen mit gutem Wind von Chioggia her, von Venedig. Langsam gleitet unser Schiff in den Kanal, nun fallen die Anker. An der ersten Hausmauer steht in riesigen Lettern: White Star Whisky.
Dann fängt Afrika an.
Durch die Musik des Diners war ein Getöse gedrungen. Ich trat nach Tische auf das untere Deck. Zwischen einem Geräusch von stürzendem Gestein drang ein Gesang herauf, aus vier Tönen gebildet. Ich trat an die Brüstung.
Langsam dringt der Blick durch den Qualm von zerstäubender Schwärze. Auf der Fläche des Wassers bewegen sich Schatten: tappend, schwankend, gleitend, verschwindend. Wieder tauchen sie auf, selbst lautlos, körperlos, Schatten. Vier traurige Töne dringen unablässig aus ihrer Mitte empor. Nun unterscheide ich Menschen, die, grade unter mir, in langen Zügen zur Flanke des Schiffes sich bewegen und wieder von ihr. Lange Züge, wie von Abgeschiedenen, auf bloßen Füßen, braun von Rasse, schwarz von Kohle, steigen auf und nieder, unter dem Druck der Töne, die nicht menschlich dünken.
Drei riesige quadratische Leichter waren, während wir dinierten, herangerudert. Sie sind sehr tief. Bretter liegen über ihrem Abgrund, auf den wippenden Brücken schreiten die Züge, Körbe auf dem Rücken, Körbe mit Kohlen. In ihrem Kiel bewegt es sich, schwarz gegen schwarz. Sie füllen die Körbe, andere setzen sie andern auf die Köpfe, von denen schwarze Tücher niederhängen; wie Trauerschleier entrechteter Könige. Dann von Floß zu Floß über das Wasser weg schweben auf Brettern, steigen und sinken die Züge, endlos bis zur Flanke des Schiffes. Nun treten sie empor in den elektrischen Lichtkreis des Decks, ich sehe, wie sich die langen Schleier bewegen und wie die weiten Trichter die Kohle fressen wollen, habgierig vorgestreckt, sammelnd in den Bauch des Schiffes, das nun ruht.
Zwei Sekunden steht jede Gestalt im Lichtkreis, sie neigt den Kopf und schüttelt die Last darüber hinweg in den Trichter. Schon hat sie sich gewendet, schwankt über die Brücke in die Nacht zurück, kehrt in den Kiel, macht Platz für andere, ohne Anfang, endlos.
An den Ecken der Flöße glüht es, aus eisernen Körben leuchten ihnen Feuer zur Arbeit. Wie sie glühen. Zuweilen facht sie der Südwind an, dann flackert das Weiße in einem Augenpaar, mitten in aller Schwärze. Nun glüht es wieder, rötlich, still, und die Züge der Verdammten schwanken wieder durch das Dunkel her. Immer löst sich aus der Mitte der Gesang.
Staub wirbelt neben mir, ein Araber, der jene bewacht, erstaunt, wohin ich denn starre, tritt neben mich. Lachend zeigt er seine weißen Zähne. Er will nichts von mir, als dass ich sehe: er ist der Herr dieser Scharen. Plötzlich gurgelt es auf: ein Schatten fiel vom Brett ins Meer. Der Araber lacht, eine Frauenstimme schreit. Prustend schwingt sich der Schatten wieder empor, zwei Flüche sausen über ihn weg, dann reiht er sich ein.
Ich folge der Richtung des Schreies. Ein kleines elegantes Boot, ganz weiß, legt an. Noch ärgerlich, dass man sie so erschreckte, mit Vorsicht hebt die schöne Italienerin den weißen Schuh aus dem Boot aufs Fallreep. Und für eine Sekunde fiel der rötliche Schimmer vom Feuer des Infernos auf ihr lustvolles Angesicht.
Der Assessor sieht vom Skat auf, tritt, da er mich durch die Glastür bemerkt, heraus und fragt: ,,Was gibt's denn hier zu sehn? Nischt, sind das Arâber?" (Er betonte das Wort falsch.)
Ich trete zurück: ,,Nichts, Herr Assessor, Kohlen, nichts als Kohlen."
Die Sphinx
Nur ein paar Stunden waren uns gegeben, ein Zufall hielt das Schiff für einen Tag.
Kairo. Der Wagen raste durch die Stadt. Zehntausend Stimmen schrillten an die Ohren, Farben sprühten durcheinander, aus der Eleganz weißschimmernder Quartiere tauchten wir auf einmal in die Schatten riesiger Moscheen, deren Mauern wuchteten wie die Strozzifestung in Florenz. Es flogen die Kuppeln der Gräber vorüber, in denen die Mamelucken ruhen, die Steilheit gelber Minarette schoss empor. Durch das Gewimmel sausten wir über die Nil-Bridge, und schon erschienen die Zuckerhüte von Gizeh. Aber zum ersten Mal merkten wir, wie dieses Licht von Afrika Entfernungen zu unterschätzen schmeichelt. Noch eine halbe Stunde scharfen Trabes gings durch die Ebene. Plötzlich war alles nahe, die drei Kolosse standen da, mehr breit als hoch.
Mit Unlust hatten wir, Diana und ich, vor wenig Tagen Rom verlassen, das in zeitigem Frühling lag; ein dunkles Mittelmeer, noch kalt und unwirsch, gab ihr und mir nicht Hoffnung auf Ersatz. Heut aber sollten wir die Sphinx erblicken, und wussten doch voraus, wie von allen Werken der Welt nicht Eines sich der Nachbildung so ganz entzieht, wie dies. Beklemmung fiel uns an: nun war sie nahe.
Ich glaube, ich stehe auf einem Pass. Steigen wir nicht gegen die Spitzen von Gipfeln, deren Joch wir schon erreichten? Und dennoch hebt sich die Ebene nur gering. Wie jene Kuppeln, die am Jocheder Pässe zur Rechten und zur Linken stehen, steigen die Spitzen der Pyramiden ins Blau des subtropischen Nachmittags.
Wie Passwind weht es zwischen der Schärfe der schräg aufsteigenden Kanten und den Blöcken, die dort auf dem Gräberfelde von Gizeh lagern. Der Blick in das um weniges gesenkte Niltal erhöht die Illusion. Eine scharf geschnittene Wand von Sandstein ragt steil in der Nähe, wie von Papiermaché: hier wird alles zur Silhouette.
In der Weite schwimmen in südlichen Dünsten jene anderen Pyramiden von Sakkara, und es ist, als deuteten. sie an, dass diese Wüste ferner und ferner Grabmäler großer Könige und Kalifen berge, Meilensteine der Landschaft wie der Geschichte.
Was an Platten, Steinen, Blöcken umherliegt, zögere ich als Trümmer anzusprechen, vielmehr scheint alles zusammengehörig und einen Übergang zwischen der hügeligen Fläche und den Pyramiden darzustellen; wie die tektonischen Parks des Barock den Übergang vom Schloss zum Wald.
Scheu und bedacht umschweifen wir die mathematischen Ungetüme. Plötzlich erblicken wir von rückwärts die Sphinx.
Sie ruht am Abhang, wie zur Wache, genau in einer Linie mit dem entfernten Tor der Pyramide. Hinter dem Betrachter steht um diese Stunde die Sonne, dem Ziele nahe. So wird die Sphinx zuerst als riesiges Schattenbild deutlich; ruhend durchaus.
Furchtbar macht die scharfe Silhouette die Erscheinung inmitten unnennbarer Öde: noch sah ich nicht ihr Antlitz, kaum ihren Umriss, –– nur ihren Schatten. Zu dieser Stunde und von dieser Seite, –– im Rücken bleiben die drei pyramidalen Ruhepunkte des Auges: da droht aus gelber Unendlichkeit der einzige schwarze Schatten, das Haupt der Sphinx. Ihr Körper, aus den Sandmassen halb freigelegt, ruht doch zu tief, um Schatten zu werfen.
Mit sommerlichem Grausen schreiten wir an diesem halb im Sand hockenden Leibe vorbei, der nichts ist als ein abgeplatteter Riesenstein. Wir schreiten ihn ab wie einen sinnlosen Kolossus, nichts als seine Länge bestaunend. Dann stehen wir vor dem Haupte und wenden den Blick.
Ich forsche in dies Antlitz und fühle: Gelassenheit. Wachsam wie ein riesiger Diener im Vorgemach liegt dieses Geschöpf mit dem Löwenleibe, mit der gelassenen Kraft, die sich dem Herrn überlegen fühlt, und weiß, sie kann ihn erschlagen. Wie, –– wenn es nicht der tote, der mumifizierte Herr wäre, der dort in ihrem Rücken unter dem Totenbaldachin von Steinen ruht? Kam nicht zuweilen der Lebende, der Sohn, das große Grabmal des Vaters zu besuchen? Verweilte er nicht zuweilen in ihrem Rücken? Wagte er's, vor sie zu treten, die nicht gemacht war, noch gewillt, sich umzuwenden? ...
Wieder erwacht der umnachtete Intellekt, gedenkt der Zwecke jener Gräber von einst, da Könige, von hundert Sklaven gezogen, stets mächtiger als ihre Väter, zu deren Gräbern wallten. Doch wurde ich niemals des Gefühls Herr: dies Tier ist nur versteinert, einst hat es sich hier niedergelassen, dem Osten zugewandt, die Nacht im Rücken, wie leblos, doch lebendig.
Noch wirkt unverwandelt dieser versteinte Ausdruck. Er wird belebt durch die farbigen, dunkelvioletten dicken Streifen, die an den Seiten und über die Wangen laufen, über die Stirn, das Kinn. Ganz persönlich, bedeutend durchaus tritt darunter der sehr breite Mund hervor, dessen Unterlippe misanthropisch heruntergezogen. Es spielen die weit geöffneten Augen, ganz unpersönlich, dagegen ein mystisches Widerspiel, durch jenen breiten Raum voneinander getrennt, der mich an frühen griechischen Köpfen hingerissen, –– der breite Raum zwischen den Augen scheint ihnen eine Verständigung zu verbieten, die Schlauheit auszuschließen, deshalb wirkt er so blöde und erstaunt.
Ein ruhendes Kamel neben dem Betrachter beginnt zu klagen.
Ich bestaune die Kunst, mit der hier ein nur auf einen Steinhaufen gesetzter Kopf und eine ganz wenig skizzierte Körperfläche den Eindruck der ruhenden Löwin geben. Denn ganz und gar ist dies ein weiblicher Koloss. Ob auch die Archäologie das männliche Geschlecht des Sphinx erwiesen, ob auch nichts auf das weibliche schließen lässt, keine Spur einer Brust angedeutet, höchstens das grandios stilisierte Haar als weiblich anzusprechen ist, –– ich fühle: Ruhe, du Löwin...
Da stürzt die Nacht, von furchtbaren Tüchern umflattert. Rasch wird die Löwin Silhouette. Schatten beladener Kamele, heimkehrend, schwanken vorüber. Mit einem Male löst sich eines los, wankt, von dem schneeweiß umhüllten, überschlanken Beduinen getrieben, auf die Fremden zu, beugt vor uns die vorderen Knie.
Schon wächst die Dunkelheit an den bläulichen Rändern des Steinbildes, bald ist alles dunkelblaue Nacht. Ein Licht, aus einer Araberhütte aufleuchtend, scheint aus dem Inneren der Pyramide zu glimmen...
Wieder durchdonnert wild unser Wagen die Stadt.
Das gleitende Schiff
Ich blieb die Nacht auf Deck. In dreigeteilter, magischer Drehung wirft das Feuer von Port Said die bläulichen Lichtkegel um sich herum. In der breiten Mündung des Kanals vor uns und hinter uns viel Dampfer, große, kleine. Sie tauschen Lichtsignale: drei Sterne schweben plötzlich auf und bleiben in mäßiger Höhe stehen, wie auf einer unsichtbaren Rahe. Es ist, als wäre das Band des Orion in menschliche Sphäre gesunken.
Noch einmal blickte ich unter mich. Die letzten Ballen der Ladung werden gebunden, der große Kran zieht sie empor, der unermüdlich kreischend vom Deck zum Leichter und zurück gewandert. Lautlos schwebt ein Boot heran, schwer stampft eine Gestalt auf Deck, nunauf die Brücke. Es ist der Suez-Lotse, ein eleganter Herr mit grauem Haar. Die Anker rasseln auf.
Plötzlich fliegt ein glänzendes Licht über das Wasser, dicht vor die Spitze des Schiffes: die Suez-Lampe wirft ihren Trichter breit auf die Fläche. Für eine Nacht hat unser Schiff das Auge des Zyklopen. Der letzte Leichter weicht zurück. Schwarze Gestalten, deren Hände unseren Kran bedienten, stehen auf dem abschwimmenden Floß und blicken dem großen Schiffe nach, das sie bereichert haben. Es gleitet fort, von eigenem Licht beseelt, sie aber bleiben im Dunkeln.
Wir fahren, doch fühlt man die Schraube nicht. Niemand darf den Kanal mit mehr als 5 Knoten durchfahren, also mit Drittel- oder Viertelgeschwindigkeit. Das Schiff hat seinen Atem angehalten, aber der Dampf der kleinen Suezdampfer, die den Verkehr vermitteln, wirbelt in den Lichttrichter, und es ist, als atmete es durch die Nüstern wie ein Pferd im Winter. Von oben hallen Rufe durch die Nacht. Rasch wird der Kanal sehr eng.
Zu beiden Seiten beleuchtet das Zyklopenauge die Ränder der beiden Wüsten. Blendend rieselt das Licht durch die Feinheit des Sandes.
Mit einem Mal taucht aus der Wüste ein anderer Zyklop. Langsam nähert sich das rieselnd blaue Licht. Es rauscht heran. Dann beginnt das Rufen. Vom Licht des andern Schiffes geblendet vermögen wir nichts zu erkennen, auch als die Schiffe sich ganz nahe sind. Die Enge des Kanals (nicht über 80 Meter) zwingt immer eines von zwei Schiffen sich festzulegen, um auszuweichen. Ein Pfahl am Ufer wird erreicht, ein paar Matrosen booten hinüber, binden das riesige Schiff mit einem Tau ans Land, als wäre es ein Kahn. Vorn, rückwärts, auf der Brücke, alles ist in Bewegung, es ruft, antwortet, flucht, befiehlt. Die Maschine stoppt. Der Anker stürzt. Wir stehen.
Das Ganze hat nicht fünf Minuten gedauert. Und während wir uns knirschend ans Ufer drücken müssen, gleitet in ungestörter Fahrt haushoch ein Dampfer vorüber. Nachtflüche empfangen das Schiff, als hätte es etwas verbrochen. Nicht mehr als sechs Meter trennen die Flanken der beiden Kolosse. Jetzt erkennt man backbords den Union Jack. Jetzt ist es vorüber. Wir kuppeln ab, die Anker rasseln auf, die Maschine stampft, rasch ziehen die Matrosen ihr Boot am Tau heran, klettern die unteren Strickleitern hinauf. Wieder gleiten wir zwischen den Wüsten.
Als ich, im Rauchzimmer eingeschlafen, vom Licht erwache, sind wir in einem weiten See. Es ist einer der Bitterlaken, die, zwischen den Meeren gelegen, den Bau des Kanals erleichterten.
Nirgends in der Welt vermag man von Bord ein ähnliches Bild zu schauen. Fläche überall, Fläche in Weite und Breite. Um uns her die Fläche des Sees, ganz leicht gekräuselt. Dann aber die beiden Wüsten, bis ins Unendliche.
Nur an Sommermittagen, wenn alles Licht sich zerstäubt, und nur im Süden vermag das Meer das sinnliche Bild jener Unendlichkeit zu erwecken, deren Symbol es ist. Ist es neblig, so kann man des Eindrucks nicht entraten, dass man betrogen wird, dass hinter den Schleiern irgendwo ein Ende versteckt liegt. Ist es klar, so scheint die scharfe Linie des Horizontes vollends eine Grenze.
Aber die Wüste ist unendlich. Leichtes Gewölk, vom Widerschein des Sandes gelblich, macht alle Farbenspiele vielfach. Nicht ferne nimmt der grüne See die ersten violetten Streifen auf, dann türkisblaue, dann orangerote. Doch schon der nächste Streif, in hell oliv, ist sanft, ihm folgt ein gelber, grellbeleuchtet, dann wieder ein beschatteter. Sanft sind alle Formen, wie sie das Auge nirgends sonst gesehen, auch nicht auf Dünen, deren Umriss oft die Pflanze verdeckt. Das sind nicht gebaute, nicht gefestigte, es sind gewehte Formen, wandelbar mit dem Wind und keiner Karte standhaltend, so wenig es Karten gibt von den Wellen des Meeres. Wie im feinsten Kaleidoskop wechseln diese wandelbaren Formen ihre Farben, von violett zu Sepia, goldgelb, goldrot, rotlila, seegrün. Und durch die Mitte dieser schimmernd gewellten Fläche gleitet das Schiff, mit Viertel Kräften, selbst allein ein Ziel erstrebend, in zwecklos gelagerter Breite.
Da tauchen zwei Schornsteine auf, vorwärts bewegt. Am Beginn der nächsten Kanalenge legen sie an und warten, denn selbst der See ist nur in schmaler Grenze zu durchfahren. Die Regeln für das Ausweichen im Kanal sind mannigfach und richten sich nach Tonnenzahl, nach Heim- oder Ausfahrt, Post- oder Frachtdampfern. Diesmal sind wir die Herren und werden vorübergleiten.
Silhouetten wie von grotesken Statuen gleiten dicht vor uns querüber: das sind Kamele, auf einer Fähre übersetzend. Ein wenig weiter südlich schwimmt ein Mensch. Es ist ein Araber, er kommt aus Asien, durchwanderte die arabische Wüste. Nun band er sich sein Bündel um Kopf und Hals, nun schwimmt er hinüber. Nun taucht er auf, schüttelt sich triefend, nimmt das Bündel auf den Rücken, setzt die Wanderung fort, in der ägyptischen Wüste, im anderen Erdteil, in Afrika.
Wieder das Rufen, das Stoppen, das Halten. Ein riesiger Rumpf gleitet auf uns zu, er bringt 1200 deutsche Truppen aus Ostasien heim. Sie füllen das Deck in ihren weißen Anzügen, lehnen sich aufs Geländer, lachen herüber. Alle sind heiter. Auf beiden Schiffen spielen die Kapellen und zwischen den doppelten Siegerkranz dringen zahllose Rufe von Matrosen, die sich erkennen oder verkennen, grüßen, fragen, –– zwischen den Ozeanen, von Bord zu Bord, mitten in der Wüste.
Beim Lunch fliegt das Land an den runden Fenstern vorüber. Man glaubt sich im Speisewagen eines Schnellzuges, aber er gleitet, statt zu rütteln. Alle klagen. „Diese dreizehn Stunden sind immer furchtbar,“ sagt die Farmersfrau, die schon öfters den Kanal passierte, „die Ufer sind so trostlos." Der Leutnant sagt: „Es ist eine beklemmende Landschaft, nirgends ein Punkt, an dem man sich festhalten kann." Der Missionar, im Tone des Humanisten: ,,Unzweifelhaft ist der Anblick und das Klima der Wüste auf die Charaktere der sie bewohnenden Völker nicht ohne Einfluss geblieben."
Wir bekommen Vorläufer, Mitläufer. Nackte Knaben und Männer, Beduinen, Araber, laufen neben dem Dampfer am Ufer her. Sie rufen. Auf Deck amüsiert man sich, Semmeln hinüberzuwerfen, und lacht, wenn sie ins Wasser fallen. Aber wenn sie sie erhaschen, verteilen diese Bettelnden friedlich die Beute untereinander.
Ein zweiter See eröffnet sich. Von heimziehenden Störchen erreicht uns ein Flug, überholt uns. Die Farmersfrau seufzt und fasst sich in die Worte zusammen: ,,Wer mit euch wanderte, mit euch schiffte!" (Aber ihr Mann wartet am Kilimandscharo.) Auf einem Pfahl im See sitzt schwarz und unbeweglich Kormoran, der Vogel der Weisheit, groß wie ein hockender Adler, mit dem Ausdruck einer Eule. Über einer Bucht des Sees, die Fische bergen mag, kreisen zwei Weihe, in Spiralen, übereinander. Weiter rückwärts, in der Richtung des Nildeltas, schwimmt eine hell-lila Wolke dem Lichte vorbei. Das Fernglas löst sie auf: es sind Flamingos.
Neben mir weist ein Herr auf eine Oase und nennt den Namen des Kambyses. Es ist El Kantara, wo Alexander, wo Oktavian Ägypten angebohrt. Verwehte Spuren in gewehter Form.
Da wacht ein Wind auf: das neue Meer, das afrikanische schickt ihn von Süden. Kommt diese frische Brise aus dem berüchtigt heißen Roten Meer? Wir nähern uns der Bay von Suez.
Ein Bergzug, der von Kairo kommt, mündet auf uns zu. Tief glüht das Licht des Nachmittags. Einzeln steht und bewegt sich jedes Geschöpf in der Wüste. Man sieht: Eine Palme und die Wüste. Eine verschleierte Frau und die Wüste. Eine Gruppe wie versteinerter Kamele und die Wüste. Einzeln steht alles und schwarz auf dem goldgelben Sand gegen das Opal des Himmels.
Unmittelbar vor Suez liegt drüben in Arabien ein Lehmhüttendorf, und ich sehe deutlich: eine Frau schreitet dem Dorfe zu. (Dürer.)
Plötzlich wird eine schwarze Gruppe nahe sichtbar. Starr liegen zwanzig Kamele, starr liegen zwanzig Araber, nach vorn gebeugt. Sie beten. Es ist Sonnenuntergang. Wir sind in Suez und im Roten Meer. In der Klarheit dieses Wüstenlichtes scheinen ein paar Palmen nah zu stehen.
,,Die Moses-Quelle," sagte der erste Offizier und lächelt.,,Da hat Moses," fährt der Missionar fort, ,,als er Pharao entronnen, die Salzquelle durch Kräuter trinkbar gemacht. Noch heute machen das dort die Araber." (An der Art, wie er das vorbringt, erkenne ich, er ist ein Protestant.)
Ich trat zwei Schritte zurück und blickte noch einmal hinüber auf die süße Linie des abfallenden Gebirges. Gewehte Formen schimmerten im letzten Licht, wie Austernschalen. Dann stürzte die Nacht mit hinreißender Schnelle und bedeckte Land und Wasser.
ZWEITE LANDUNG: ADEN
Vier Tage durchs Rote Meer. Ich habe es nie so heiß gefunden als es verrufen ist, auch nicht, als ich's einmal Mitte Juni durchfuhr. Hat man freilich den Wind im Rücken, so hebt er den natürlichen Fahrtwind auf; dann mag die Stille drücken. An 40-50° muss sich jeder gewöhnen, der in die Tropen reist.
Übrigens lässt es sich auf den Dampfern der ,,Deutschen Ostafrikalinie" gut leben. Um ihrer Ordnung, Sauberkeit und Küche willen sind sie in der ganzen Welt berühmt, und selbst die Engländer geben ihnen sehr oft den Vorzug vor ihrer eigenen Linie. Ich habe Afrika rund umfahren, und die vier Dampfer, die ich dabei benutzte: ,,Adolph Wörmann", "General", „Windhuk“, „Rhenania" haben mir manche Vorzüge dieser Linie vor englischen und französischen Schiffen erwiesen, auf denen ich früher fuhr.
Bleiern und dumpf wie ein schwerflüssiges Zwischenspiel rollt das Rote Meer zwischen dem synkopischen Appassionato des Mittelmeeres und dem gelagerten Largo des Indischen Ozeans.
Zuweilen unterscheidet man die Röte der Felsen, die ihm den Namen gegeben. Es sind Korallenriffe, und sie tragen Leuchtfeuer. (Diesmal waren freilich viele erloschen, weil die Türken nicht den Italienern ihre Fahrt beleuchten wollten.) Auf diesen Riffen wohnen je zwei Männer, den Dienst zu versehen.
Die junge Engländerin sagte: „Always two? How human that is!" Der Offizier erwiderte: ,,Nein, aber wenn einer plötzlich stirbt, muss der andere das Feuer besorgen. Deshalb sind es zwei." Jede Woche kommt ein kleiner Dampfer und bringt ihnen, was sie brauchen. Er hält nur Augenblicke. Nichts erfahren diese Männer von den Ereignissen der Welt, deren Teile zu ihren Füßen sich unablässig Schiffe, Briefe, Kabel senden.
Am Südende liegt die steinige Insel Perim. Vor fünfzig Jahren –– erzählt der Kapitän, als wir sie sichten –– kurz vor Eröffnung des Kanals, kam ein französischer Kreuzer von Süden herauf, um diese Insel zu besetzen. In Aden gab ihm der englische Gouverneur ein Fest. Beim Weine plaudert der Franzose: ,,Morgen werden wir drüben die Trikolore hissen!" Nachts lässt der Engländer geheim ein Schiff hinübergehen, um ihm zuvorzukommen. Als Frankreich am Morgen vor Perim erscheint, flattert der Union Jack von der Spitze der Insel. Wütend muss der Franzose ums Kap nach Hause fahren.
Dicht hinter dieser Insel sichten wir das Feuer von Aden.
Überall, wo statt der Natur ein Gedanke Ursache einer Besiedlung wird, fehlt ihr für immer Notwendigkeit und Harmonie. Wer Aden hat, sperrt das Rote Meer, sperrt den Eingang nach Europa: dieser Gedanke allein konnte die entsetzliche Stelle in eine Stadt verwandeln. Von den Phöniziern über die Römer bis zu den Persern und Chinesen stritten alle Seevölker um diesen Punkt, und was einst porta romana hieß, heißt heute porta inglese.
Aden gilt für die heißeste Stadt der Welt. Zugleich ist es die grausigste. Auf pflanzenloser Felsenwüste ward eine Stadt gebaut. Bei der Anfahrt sieht man nur drohend gezackte, vulkanisch formierte Felsen, gelb, rot, flach, stumpf. Aber auf allen Felsen drohen zwischen den Zacken Forts und Kanonen. Eine winzige Insel, nichts als ein gelber Fels, bedeckt mit Wellblechbuden liegt vor. Hier weht die Quarantäneflagge, ihr Gelb ist krank und grünlich; davor trägt ein Dampfer dieselbe, er kommt von Bombay und hat Pest an Bord. „Heute sind dort vier Heizer krepiert," sagt neben mir der Matrose.
Drüben stehen ein paar Europäerhäuser. Nackte Araber rudern uns an Land. Dort warten die ersten Somali.
Beide, Somali und Araber, sind Herrenvölker. Doch hier, wo die beiden Erdteile zum letzten Mal zusammenstoßen, werden die Unterschiede dieser Grenzrassen deutlich. Nach Osten führt ein großes Crescendo der Kultur von diesen dämonisch gebundenen, gezwungen dienenden Arabern zu Persern und Indern, wo noch die letzte Paria um das Geheimnis ihrer Rasse weiß, bis schließlich im äußersten Osten das älteste Kulturvolk der Erde sich breitet. Nach Westen und Süden aber kommen hinter den Somalis nur Bantus und Kongoneger, Kaffern, Zulus, Hottentotten und Buschleute, und man fühlt, wie eine kaum unterbrochene Stumpfheit kreuz und quer durch Afrika der Unterjochung durch die Weißen harrt, die sich der Seele Asiens vergeblich zu bemächtigen suchten.
Afrika entbietet dem Landenden sogleich seinen schönsten und edelsten Stamm. Freilich sind die Somali keine Neger, sie sollen vor sechs Jahrtausenden aus Südarabien herübergekommen und reine Semiten gewesen sein. Heute bilden sie ein klassisches Beispiel für glückliche Rassenmischung. Matt glänzt ihre fast schwarze Farbe, hoch und mit unsäglich schmalen Hüften schreiten sie in stolzer Haltung auf kleinen Füßen, und kleine lange Hände halten eine weiße Toga. Diana, die in der Umgebung der untersten Araber eine Beklemmung nicht überwinden konnte, strahlte, als sie diese Männer sah.
Ein gertengleicher Somali, gefolgt von Sklaven, schritt an uns vorbei, der weiten Landzunge zu, nach Osten. Er sah hochmütig drein und schien zu sagen: ,,Seht her! Ich bin der Herr des Lebens!"
Ich fragte englisch: ,,Wohin gehst du?" —,,Hinüber nach Arabien." –– ,,Was suchst du da?" –– Da öffnete er das blendende Gebiss, zeigte das Weiße seiner Augen, durchstieß Diana mit einem Blick und rief: ,,Women!"
Der Schatten eines Kamels, das unserem Wagen folgte, ließ uns wenden: ein Junge, der Orangen trug, ritt vorüber, lachte kokett und begann seine Reitkunststücke zu produzieren. Er ritt voraus, er drehte gewandt das große Tier, ließ es niederknien. Mit seinen barocken. Buckeln wirkt das Wankende so lächerlich im Profil, als es von vorn erhaben wirken muss. Und völlig biblisch tauchte zwischen den Felsen ein anderes auf, mit einem Berg von Ästen beladen.
In Windungen fuhr der Wagen bergauf, eine gute Strecke, in brennender Hitze. Plötzlich durchfährt er ein Felsentor, zwei kolossale eiserne Torflügel stehen gesperrt, die schwarze Wache salutiert. Mit einem einzigen Schlüssel kann England zwischen den Felsen die ganze Stadt absperren.
Jetzt erst erblicken wir sie. Baumlos, buschlos, blätterlos liegen dort weite Quadrate von Hütten und Häusern, die, nach einer Feuersbrunst neu aufgebaut, in ihrer Regelmäßigkeit doppelt entsetzen. Zwischen ihnen führt der Weg in grauenhaftem Brande zu den Tanks.
Diese Felsgrotten, die schon zu antiker Zeit als Bassins dienten, sind durch Zementierung eingerichtet, Wasser aus den Bergen aufzufangen. Aber sie stehen strahlend trocken. ,,Diesen Januar hat es nicht geregnet," sagt der Wächter (es regnet hier höchstens im Januar). Wann hat es das letzte Mal geregnet?" –– ,,Vor drei Jahren.“
Über Treppen und Blöcke kletterten wir von einem Tank zum andern. Sie stehen wie leere Amphitheater. Auf ihrem Boden könnte man tanzen, so schreckhaft glatt, sauber wartend, zwecklos liegt er da. Kleine Vögel fliegen durch die Trockenheit, von einem zementenen Schlupfwinkel zum andern, durch die Krater, um Insekten zu fangen. Wovon wieder diese sich nähren, weiß man nicht.
Vier Araber stehen um ein Loch, ziehn an einer Kette, nach mehreren Minuten kommt eine kleine Haut voll Wasser heraus. Das ist ein Brunnen, aber er ist salzig, und sein Wasser trinken nur die Kamele; diese schweigend leidenden Diener, die weniger bedürfen als irgendein Tier. –– ,,Wer bringt euch Wasser?" — ,,Die Schiffe," sagte der Araber, ,,und dort drüben liegt die Oase."
Wir folgen der Richtung. Eine Stunde braucht der Wagen, die Landzunge zu durchqueren. Weiße Pyramiden, sonderbar schimmernd ziehn den Blick in die Ferne. Phantastische Gebilde stehen neben ihnen, mit Flügeln. In der Nähe sind es Salzhaufen und Salzmühlen. An wenigen Stellen der Erde hat man wie hier die Salzgewinnung aus dem Meer versucht. Ich sah sie in Sizilien.
Plötzlich halten wir vor einem wunderbaren Garten. Das ist eine gepflegte Oase, in der zwischen Palmenalleen der fast verbrannte Reisende in Kühlung wandeln darf. Oder sind dies Klosterhallen, spitzbogig, offen? Riesige Phönixe springen empor. Ihre Spitzen treffen einander, Luft rieselt dazwischen. Mitten drinnen steht ein Bungalow, in weißem Tropenanzug liegt der Gouverneurleutnant auf dem langen Bombay-Chair, die Daily-Mail studierend. Und hinter dem Hause: dort liegt die Quelle, die alles Wasser geben soll, für die Zehntausende.
Schrecklicher wälzt sich die entsetzliche Öde auf der Rückfahrt heran. Hat hier ein Strafgericht die Zeichen der Natur verbrannt?
Ehe wir in See gehen, sammeln sich viele Boote ringsum, und zwanzig Völker schreien ihre Ware aus. Die Somali schreien am meisten und bekommen wenig, Hindu und Singhalesen schreien wenig und bekommen viel, Araber und Juden schreien viel und bekommen am meisten. In seinem besten Englisch brüllt ein Neger: ,,I say! Hau mutsch ?!" und hebt und wirft ein Leopardenfell empor und fängt es wieder auf und zeigt den Dolch und ballt die Stickerei. Ich nenne die kleinste Summe, den vierten Teil von dem, was er gefordert: schon wirft er mir von unten eine Schlinge auf Deck, ein Korb wird hochgezogen, der Dolch liegt darin. Im selben Korbe geht das Geld herunter.
Die Schraube fängt zu stampfen an, langsam, wie unwillig im letzten Augenblick kauft der Assessor dreihundert Zigaretten. Er schickt einen Schilling herunter, denn das Schiff bewegt sich schon. Ein arabischer Wutblick trifft ihn von unten. Strahlend erzählt er überall seinen Kniff. Auf der untersten Stufe des Fallreeps steht der letzte Somalis, ein Knabe vom höchsten Ebenmaß des Körpers und der Züge. Schon fährt das Schiff, langsam wird die Treppe hochgezogen. Zitternd steht der schöne Knabe, wartend auf sein Geld, das der deutsche Tierarzt mit verruchter Langsamkeit hervorholt. Schon ist der Knabe mit der Treppe hochgewunden, jetzt hat er das Geld, lässt los und springt ins Meer. Ein Boot nimmt ihn auf, gleich rudert er mit.
Noch auf fünfzig Meter, als wir längst gedreht haben, hält der Neger seine Ambrakette hoch und lacht und schreit: ,,I say! Hau mutsch!?“
Soziologie an Bord
Es war ein Herrenschiff. Bei Tisch versuchten dreißig Herren drei sorgfältig verteilte Damen zu unterhalten. Die Farmersfrau (schon fast kanonisch) war sehr besorgt, nicht aufzufallen und achtete, dass ihr Junge in keinem Falle mit den reizenden Pastorskindern spielte, die zweiter Klasse fuhren. Denn sie fuhr selbst zum ersten Male erster. Sie war kräftig und hatte einmal vor dem Zelt einen Leoparden erschossen, während ihr Mann schlief.
Der lange, schwarze und gelehrte Missionar kam zum ersten Male aus Deutschland heraus, glaubte sich aber durch die Lektüre sämtlicher Werke über Ostafrika im Vorbesitze jeder Kenntnis. Schon beim Frühstück pflegte er zu belehren.
,,Die Dschagganeger haben noch den Frauenraub," sagte er und rückte seine Brille. „So?" sagte die Farmerin trocken, ,,wir wohnen zehn Jahre am Kilimandscharo, aber davon habe ich noch nichts gehört.“ — „Dann lesen Sie nur das Buch von G., so werden Sie finden...“
„Fisch gefällig?" fragte leise der Steward, der schon lange an seiner Linken gewartet. ,,Fisch! Was heißt Fisch auf Suaheli?" fragte der Missionar leutselig in die Runde. Er pflegte früh von 8-10 Uhr auf Deck Vokabeln sich zu erwandern. Der Steward resignierte. Er war ein Juwel aus Hamburg und wusste nach zwei Tagen, dass der Schotte dauernd Senf brauchte und der Schiffsarzt süße Speise zweimal nahm.
Der Schiffsarzt war melancholisch. Er heilte alle und versicherte mir am fünften Tage, ich als einziger hätte ihn noch nicht konsultiert. Er las die ,,Neue Rundschau" und hatte in seiner Kabine das Bild eines reizenden Mädchens. Übrigens hinterbrachte er uns alle Mokerien der Passagiere.
Diana beunruhigte den Missionar. Ihre Art, mit festen Schritten das Deck abzuschreiten, schokierte ihn ebenso wie ihr kurzes Haar und ihre gewisse Sicherheit der Antwort. (Aber einmal fing ich seinen Blick auf, als er, unter der steilen Treppe zum Bootsdeck liegend, Diana über sich herunterkommen sah.) Als wir eines Abends mit seinem großen Deckstuhl Fiaker spielten, sank sein Lächeln unter Null.
Dieser Deckstuhl war mit fahrendem Tintenfass und Schreibbrett versehen. Der Missionar, wenn er nicht lehrte, schrieb. Schon im Mittelmeer hielt er eines Vormittags dem Schiffsarzt neben sich einen Brief mit gestreckten Armen derart schräg zu, dass dieser lesen musste: ,,Geliebte Julia! Bessere Hälfte meiner unsterblichen Seele! Zum ersten Mal auf afrikanischem Boden .." (Diesen Brief steckte er bei der Landung in Afrika in den Kasten.) Auch empfahl er mir als praktische Erfindung eine mit Maschine geschriebene Liste von Namen, an deren Kopfe stand: ,,Grüße, von der Reise zu senden an 1 … bis 23."
Saß jemand plaudernd im Rauchzimmer und trank seinen Cocktail, so verdunkelte plötzlich der schwarze Kopf des Missionars das Fenster, und er nötigte herauszukommen und ,,die Beleuchtung" zu bewundern. Hiermit drückte er gleichzeitig sein Naturempfinden aus und seinen Abscheu vor dem Alkohol.
Die schöne Italienerin war ihm aus sprachlichen Gründen unzulänglich, aber ihre Üppigkeit erwärmte ihn. Sie spazierte ausschließlich mit ihrem 17jährigen Bruder, einem reizenden Elegant, der die Socken nach der Färbung des Meeres wechselte und mir vertraute, seit Aden legte er sich dreimal das Thermometer ein, um zu sehen, ob er noch nicht fieberte. Signorina reiste ihrem Bräutigam entgegen.
Der Leutnant sagte: ,,Wie kann man in die Tropen heiraten, wenn man so dick ist!" Er fuhr zur Schutztruppe zurück, hatte die besten Manieren an Bord und stritt sich zwei Wochen lang mit dem französischen Großfarmer über militärkoloniale Fragen.
Der Assessor, auf drei Seemeilen als solcher, nicht nur an seinen Schmissen zu erkennen, schien entschlossen, sogleich bei der ersten Ankunft unserer Kolonie mit ausgedehnten Reformen, ja mit einem völlig neuen Verwaltungsprogramm energisch aufzuhelfen. Er las Chamberlain. Wenn er sich zum Skat setzte, klopfte er dem Steward und rief: ,,Wenn der Geist sich regen soll, braucht der Körper Alkohol!" Als er eines Mittags neben mir Briefe schrieb, murmelte er: ,,Den 21. März. Frühlingsanfang..." In diesem Augenblicke rief das Signal zum Frühstück, er stand auf und fügte bei: ,,Na, wollen wir mal zu Frühlingsanfang was essen!" Er lachte den Engländern zu, weil sie diesen Witz nicht verstehen konnten. Als der erste Maschinist (der Offiziersrang hat) nach Tische sich empfahl, rief ihm der Assessor nach: ,,Na, werfen Sie mal noch ein paar Schaufeln Kohle rein!“ —
Diese Gemeinschaft: auf Deck eines Schiffes ist ohne Beispiel in ihrer soziologischen Struktur. Auf einem ganz beschränkten Raume wohnen unentrinnbar ein paar Dutzend Menschen zusammen, von denen keiner etwas zu tun hat, keiner und doch jeder den andern kennt; die alle, nur bemüht, die Fahrtzeit hinzubringen, zu gegenseitiger Beobachtung gedrängt, in Parteien gespalten, durch Zufälle zusammengeführt werden; die alle gemeinsam nur für die Zahl der Seemeilen sich interessieren, täglich durch ein Fähnchen auf der Karte bezeichnet; ahnungslos bei Tanz und Sekt, durch welche Gefahren ihr Schiff soeben gleitet. Und plötzlich eines Tages, man sieht keinen Grund, nach einer Woche völliger Steifheit, werden alle Gemüter elastisch, –– und dann gibt es sogar Deutsche, die miteinander reden, ohne sich vorzustellen.
,,Do you go to Nairobi ?" fragte an diesem Tage plötzlich der Engländer neben mir, und ich erfuhr nach achttägiger Tischnachbarschaft, dass er eine Stimme besaß. Er war Kabeldirektor, sah wild drein und sagte nie Guten Morgen.
„Ja, wenn man zum Vergnügen reist!" rief der Missionar über den Tisch und legte wohlwollende Nachsicht in den Ton. Und indem er sich pastoral zu dem Kreise der um ihn Sitzenden wandte, fuhr er fort: ,,Es kommt nämlich darauf an, ob man zum Vergnügen reist oder zur Forschung." Plötzlich sagte Diana laut: „Nein. Sondern ob man sucht oder ob man sieht. Suchen ist mühsam, aber sehen ist eine Gnade."
Der Kapitän lachte. Ich sagte: ,,Wir sind Dilettanten, Herr Missionar, und möchten diesen Erdteil nur an ein paar Stellen anbohren; zu sehen, welcher Wein fließt." Der Missionar sah mich übel an und stieß seine Hände energisch in die Waschbowle: ,,Hm. Werden Sie mit Zelten reisen ?" Ich stand auf und erwiderte: ,,Nein. Mit Cook!"
Wir stiegen hinab in den Bauch des Schiffes. Vom Bootsdeck, durch die geöffneten Kuppelfenster, wirken die vielen Parallelen, lotrecht geschnittene Eisenstangen, die untereinander Treppen bilden und Übergänge, wie das Gewirk einer Korkarbeit, die erst begonnen wurde. Alles hat jenen stumpfen Glanz, den beständige Ölung grauem Eisen verleiht. Eine Art nüchterner Harmonie steigt auf; die Durchsichtigkeit eines Planes, der sechs Stockwerke bis in die unterste Tiefe des schwimmenden Kolossus reicht. Oft hatte ich, vornübergebeugt, in diese Struktur geblickt, wie in ein System, das ein genialer Lehrer klargemacht, oder wie auf die Lösung eines Zaubers, den der geschwinde Hexenmeister dargetan, den aber nachzuahmen er uns dennoch außerstande ließ. Nun stiegen wir hinab.
Durch das Gestöhn der Maschine sucht die Stimme des Maschinisten zu dringen, der uns führt. Er nennt Zahlen, Namen und Übergänge. Aber dieser Schacht, ausgefüllt mit einer so großen Zahl sehr großer und sehr kleiner Maschinen, ist menschenleer. Taucht einmal ein Kopf auf, zwischen Stahl und Eisen, hinter Kolben, an Rädern, so ist es nur der eines Putzers. Keine Kraftquelle ist zu spüren. Das Ganze scheint perpetuum mobile. Plötzliche Luftzüge, senkrecht herabfahrend, durchschneiden die Hitze. Wieder staunte ich die Eleganz an und den Schein von Einfachheit, mit der moderne Maschinen wirken. Zwischen stampfenden Kolben, verschlossenen Trichtern, horizontal gedrehten Rädern beben unheimlich lebendig in kleinen Uhren die Manometer, nach vor- und rückwärts die rote Linie um ein geringes freigebend und wieder deckend. Es ist, als zitterten sie davor, ihr Maß zu überschreiten und könnten's doch nicht lassen.
Hinten wird die „Welle" sichtbar. Silbern glänzend, langsam um sich selbst rotierend, dreht sie draußen im Wasser die Schraube, die uns unablässig durch die Meere stößt. Scheint sie nicht der Wille des Schiffes, sehr körperlich, ein Ding, ganz unten wirkend, während ganz oben auf der Brücke der magische Herr des Schiffes ihr Geist und Richtung gibt, schwebend im doppelten Ring?
Plötzlich stößt der Führer gegen eine Eisenplatte, sie öffnet sich, Glut springt hervor. Noch eine Treppe, ganz tief in den Kiel, zu den Kesseln. Nun ist alles verwandelt. Die all das Glänzende treibt, was unermüdlich stampft, zuckt und rotiert: in einer letzten Tiefe wird die Kraft bereitet, in Schwärze, Glut und Staub. Halb nackt stehen die Araber, Henkern gleichend, und zugleich Verdammten. In schaukelnder Bewegung reißen sie mit bloßen Händen die Eisentüren auf, holen und werfen den Fraß, die Unholde zu speisen. Und jede neue Schaufel Kohle, die der Schwarze feindlich, mit wütendem Zwange hineinwirft, weckt aufs Neue die Wut des Kessels, und noch im Niederprasseln schlägt er dem Bändiger die Flamme zu. Der zuckt nicht mehr, aber mit Hass und mit Hast wirft er dem gefesselten Drachen die Eisenplatte vor, damit er sich selbst verzehre.
Dies also ist die Kraft, die uns durch Wochen über die Meere stößt? Kampf mit dem Element, das, während es sein Geschick erfüllt, dem Zweck des Menschen dient, den es verderben möchte; Schlacht im Kiele des Schiffes, tief unter dem Spiegel des Wassers, Tage und Nächte ...
Ich dachte: Nirgends in der Struktur unserer Gesellschaft findet sich eine Fläche, über der die große Pyramide so sinnfällig sich aufbaut, wie über dem Rumpf eines Ozeandampfers. Im Tartarus, hier kämpfen Araber mit