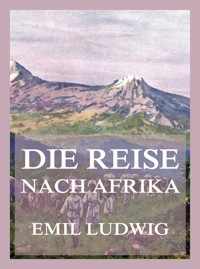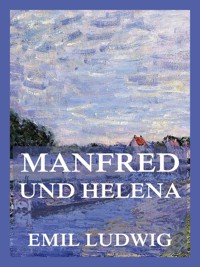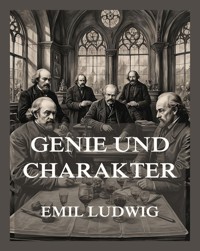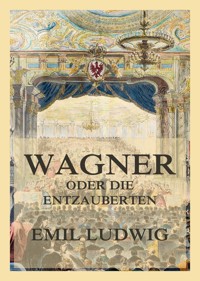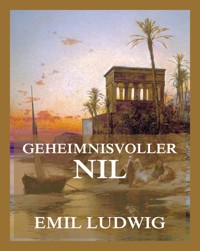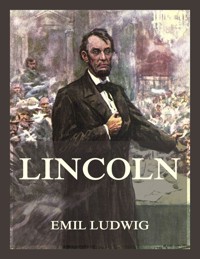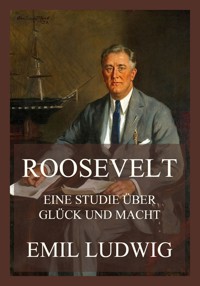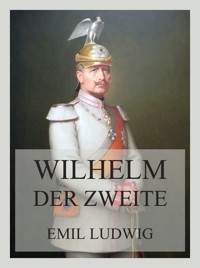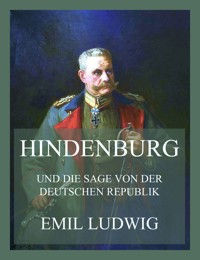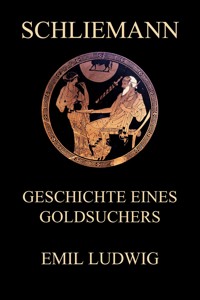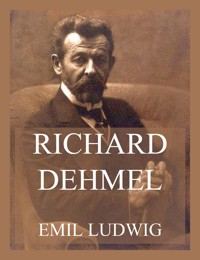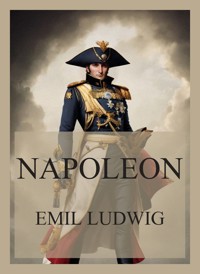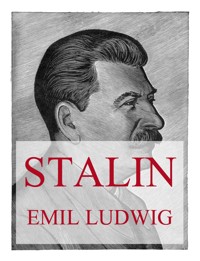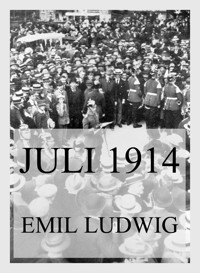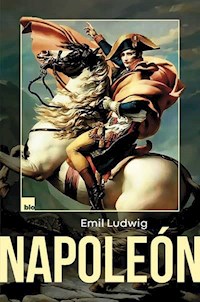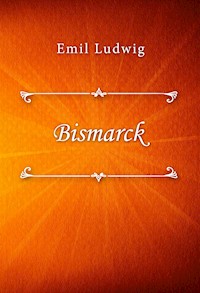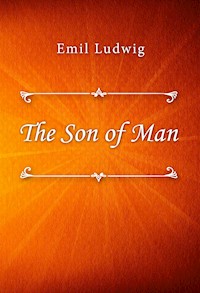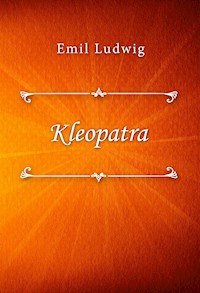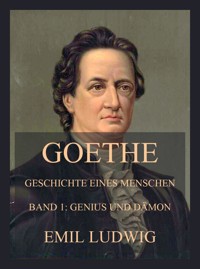
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als Reaktion auf die Masse an Goethe-Biographien, die trotz teilweise exzellenter Ansätze drohte, den Dichterfürsten in eine unendliche Anzahl von infinitesimalen Teilen zu zerlegen, haben verschiedenste Schriftsteller versucht, das Genie dieses unfassbaren Menschen zu rekonstruieren. Immer war das Ergebnis nur insoweit gut, als der Autor die Fähigkeit besaß, eine Synthese zu schaffen und gleichzeitig zu beweisen, dass er den Großteil der analytischen Forschung beherrschte. Emil Ludwig gibt sich bescheidener und gleichzeitig weniger penetrant. Er war Journalist und Schriftsteller von Beruf. Sein "Goethe - Geschichte eines Menschen" zeugt zudem von echter Schaffenskraft und sehr solider Wissenschaftlichkeit. Er stellt die Geschichte und Entwicklung des Dichters einfach und dennoch intim dar, erzählt sie von seiner Geburt an chronologisch. Ludwig stellt fest, dass sie sich in zwölf Perioden gliedert. Seine Querschnitte durch jede Periode widmet er einer bestimmten geistigen Kraft, die in ihr vorherrschte und die zum Titel eines Kapitels wurde. Diese Kapitel gruppiert er wiederum unter drei größer gefassten Themen: "Genius und Dämon" für den ersten Band, "Erdgeist" für den zweiten und "Tragischer Sieg" für den dritten. In regelmäßigen Abständen integriert er geschickt ein charakteristisches Porträt in die Geschichte . Jedes Kapitel wird zudem mit einem sehr schönen Stück Lokalkolorit eingeleitet, das den Rahmen für die darzustellende Zeit bildet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Goethe
Geschichte eines Menschen
Erster Band: Genius und Dämon
EMIL LUDWIG
Goethe – Geschichte eines Menschen 1, E. Ludwig
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849663995
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Vorrede. 1
Erstes Kapitel. Rokoko. 4
Zweites Kapitel. Prometheus. 30
Drittes Kapitel. Eros. 63
Viertes Kapitel. Dämon. 90
Fünftes Kapitel. Tatkraft131
Sechstes Kapitel. Pflicht187
VORREDE
"Was hat dich nur von uns entfernt?"
Hab' immer den Plutarch gelesen.
"Was hast du denn dabei gelernt?"
Sind eben alles Menschen gewesen.
Nur die Antike hat den historischen Menschen als Träger des Schicksals rein entwickelt; was nach ihr kam, verwirrte die naive Zeichnung großer Menschen durch Zeitschilderungen oder moralische Maßstäbe. Plutarch blieb in der Darstellung der Persönlichkeit unübertroffen, in großem Abstand folgten ihm Geister wie Carlyle und Taine, H. Grimm, Burckhardt und Brandes. Neben diesen Suchern der Wahrheit haben von jeher phantastische Köpfe, unter Opferung der Dokumente, jene gefährliche Mischform der historischen Romane geübt, "die die Moralität der Geschichte zerstören, ohne Dichtung zu werden".
Im Sinne Plutarchs, doch mit den Mitteln der modernen Psychologie wird für die Nerven unseres Jahrhunderts in diesem Buch eine neue Form versucht, den Menschen zu gestalten.
Aufgabe: die innere Welt eines Menschenlebens aus allen Symptomen zu erneuern. Mittel: alle von der Philologie anerkannten Quellen, vornehmlich autobiographische. Innerer Weg: von der Vision einer Gestalt zur Nachprüfung des Vorgefühlten im Studium der Akten. Äußerer Weg: von der Feststellung eingeborener Art über ihr Wachstum im Leben bis zur höchsten Auswirkung vor dem Tode. Ziel: die Landschaften der Seele, von der Jugend zum Alter, in langsamer Verschiebung aufgerollt. Ideal: historische Wahrheit eines Kalenders, psychologische Wahrheit einer Dichtung.
Die Geschichte von Goethes Seele ist bisher ebenso wenig wie die anderer historischer Menschen im Maßstabe einer Biographie geschrieben worden, obwohl sie durchforscht wurde wie keine. Wie ihr Werden immer aufwärtsführt, müsste auch ihre Darstellung von Jahr zu Jahr in 60 — 70 Kapiteln ansteigen; da dies technisch unmöglich und überdies ermüdend wäre, so muss man Epochen zusammenfassen: an die Stelle der idealen schiefen Ebene sind also zwölf große Stufen in das Urgestein dieses Lebens geschlagen worden, die die zwölf Lustren seines Aufstieges bedeuten.
Aus stillem Anschauen der Welt und dramatischen Verwirrungen, aus Versuchen, Erfolgen und Enttäuschungen, aus Liebe und Streit, Forschung und Gestaltung wird in jedem Kapitel die Stimmung der Seele abgeleitet; nur selten mussten Werk und Tätigkeit aus der Grundstimmung der Seele aufgebaut werden. Einmal in jedem Bande werden diese Skizzen inmitten der hinfließenden Erzählung inselhaft zu Analysen erweitert.
Als Schlüssel zu vielen Problemen in sich bezeichnet Goethe selbst "ein weit höheres Bedürfnis, ins innerste Wesen der Menschen und der Dinge einzudringen, als Gedanken poetisch auszusprechen . . als sprechend, überliefernd, lehrend oder handelnd sich zu äußern". Immer also bleibt Goethes Werk nicht der Zweck, um dessentwillen dies Leben gelebt wurde, sondern eines der Mittel, das es damals erhielt und das jetzt die Darstellung fördert. Als Verdienst seiner tätigen Geduld wird deshalb hier ein langsam naturhaftes Werden gestaltet, so dass die Grundzüge des 18jährigen noch im 80jährigen kenntlich bleiben.
Dabei schafft das Tempo seiner Jugend für die 20 Jugendjahre sechs Epochen, die folgenden 45 Jahre umfassen wieder sechs Epochen, so dass diese drei Bände mit dem 37., dem 57., dem 83. Lebensjahre schließen.
Zahlen und Daten jeder Art fallen fort, weil sie das innere Bild entfärben, ohne das äußere zu festigen, denn im Leben eines Dichters kann die Jahreszahl nicht selten genug, das Lebensalter nicht oft genug genannt werden; nur an den wenigen Stellen, wo er die Weltgeschichte kreuzt, sind Zahlen geboten. Zeittafeln am Schluss der Bände tragen das Nötigste nach.
Jeder Ausdruck des Goethischen Lebens wird zum Material: Briefe, Gespräche, Tagebücher, Bildnisse sind dieser Darstellung vom gleichen Wert wie Goethes sämtliche Werke, und auch unter diesen bedeutet Faust als Konfession grundsätzlich nicht mehr als die Farbenlehre; jede Form und Gattung wird nach Goethes eigener genetischer Denkweise nur insofern betrachtet, als er sie Lebensspuren nennen konnte, nicht als Objekte der Kritik.
Einziges Gesetz der Auswahl ist — neben eherner Echtheit — strengste Chronologie: waagerechte Schnitte durch ein Lebensjahr scheinen für die Erforschung der Seele aufschlussreicher als senkrechte Schnitte durch einzelne Gebiete des Wirkens. Ein Brief an seinen Diener, eine Kritik, ein Versuch über den Granit, sein Blick auf einem Bilde, der Gestus eines Abschiedes, die Form einer Unterschrift können reiner zur Deutung des Menschen führen als Claudine, Cellini oder die Achilleis.
Darum wird hier die Kenntnis der Hauptwerke fast so wenig vorausgesetzt als die Kenntnis der formellen Nebenwerke und der 13000 Briefe, die Goethes persönlichste Konfessionen enthalten und die er einmal eine Art von Selbstgespräch nennt. Dieses Buch gibt keinen Kommentar zu Goethes Werken, vielmehr dienen ihm diese Werke zum Kommentar; war' es gelungen, so müsste der Leser von nun an Goethes Gestalt und Werke persönlicher begreifen.
Die Kindheit, für die es an echten inneren Dokumenten fehlt und deren Einfluss weit schmaler war, als die Legende will, wird im Zusammenhange nicht erzählt. Auch alle Zeitumstände bleiben in schwachem Umriss, denn ihre entscheidende Wirkung auf Goethe war fast so gering wie Goethes Rückwirkung auf seine Zeit: Ahnen und Erben sind um Jahrhundertlänge von ihm getrennt. Gegenspieler werden, wenn sie ihn durch die Epochen begleiten, immer wieder, doch nur so weit geschildert, als sie seine Entwickelung fördern oder hemmen: er selbst forderte von seiner Biographie, sie solle das Leben nur darstellen, wie es an sich und um sein selbst willen da sei. — Das beste Bildnis leitet jede Epoche ein, denn es "bleibt immer das schönste Denkmal des Menschen; . . gibt mehr als irgendetwas anderes einen Begriff von dem, was er war". Bei beschränkter Auswahl musste manches wichtige Bildnis fehlen.
Jede literarische Parallele, ingleichen jede Polemik wird vermieden. An umstrittenen Punkten wird man den entscheidenden Nutzen spüren, den der Autor aus der großartigen Forschung der Philologen zog; der hingebenden Mitarbeit und Nachprüfung des Herrn Dr. Eduard von der Hellen verdankt er eine Exaktheit, zu der nur ein so vollkommener Kenner das Werk führen konnte.
Aus solchen Normen ist der Versuch eines neuen Goethe-Bildnisses entstanden, das freilich von den früheren abweicht. Nicht mit einem Genie beginnen wir und enden nicht mit einem Glücklichen: wir stellen den sechzigjährigen Kampf dar, den der Genius mit einer höchst gefährdeten Seele führt, um nach gewaltigen Opfern am Ende zu siegen. Was dämonische Naturen im Kampf mit sich aus sich zu machen vermögen, das erhebt sie zum Vorbilde jedes Strebenden; nicht indem man sie zu den Göttern erhebt, stellt man sie nachgeborenen Menschen zum Muster.
Wer erziehend wirken will, sollte vielmehr Goethes Gestalt durch die verschlungenen Kreise seines Menschenlebens, fort aus der Sphäre aller Vorurteile führen, die, um ihn ästhetisch, moralisch und national auf ihre Art klassisch zu machen, seine inneren Widersprüche verschleiern, statt sie zu beleuchten. Warnend hat Goethe selbst gegen Biographien geeifert, die die "sogenannten Tugenden und Fehler mit heuchlerischer Gerechtigkeit aufstutzen und dadurch, weit schlimmer als der Tod, eine Persönlichkeit zerstören, die nur in der lebendigen Vereinigung solcher entgegengesetzter Eigenschaften gedacht werden kann".
In diesem Goethischen Sinne wird man hier keinen jungen Apoll mehr finden und keinen alten Olympier, weder den glücklichen noch den harmonischen Goethe, sondern die größte Gestalt der neueren Geschichte als den Mann, der von sich sagte, er habe sich's sauer werden lassen, und der in der Lebensmitte an Schiller schrieb: "Es ist nicht in meinem Lebensgange, dass mir ein . . unerharrtes und unerrungnes Gute begegne."
Erstes Kapitel. Rokoko
In einem Leipziger Galanterieladen steht ein 16jähriger Student, um Puderquasten und Haarschleifen auszuwählen, und wie er sucht, fällt sein Blick in einen zierlich goldgerahmten Spiegel, in dem er lange wohlgefällig weilt. Kennerisch blicken ihn zwei dunkle Augen an, etwas zu groß wölbt sich die Nase, als müsste sie den Bau der hohen Stirne stützen, mokant und zweiflerisch lächelt ein hübsch geschürzter Mund, und dreht er sich leicht nach links, so kontrolliert er die gepuderte Ohrlocke, rückt am Jabot von Spitzen, poliert mit dem Handschuh einen von den Knöpfen; dann, wie er sich wieder zum Tische wendet, stützt er die Linke ein, spielt mit dem Degen wie mit einem Epigramm und ist mit sich zufrieden.
Als nun der junge Herr hinaustritt, einen Kameraden trifft und den Mund auftut, da kommen Sätze hervor, altklug und erfahren, mehr eitel als selbstbewusst, voll kecker Weisheit, die alles nivelliert, um ja nichts zu verehren, Gott, Welt und Kunst. Durch die alten Gassen streichen sie, in denen sich ein und das andere Haus bemüht, Versailler Glanz zu sprühen; dann ist der schwärmende oder verdorbene Blick jedes Mädchens, das sie grüßen, feil ihrem aufgeklärten Witz, und so sind es auch Miene, Gestalt und Lehre jedes ihrer Professoren, das Deutsche Reich und König Friedrich. Junger Zynismus, früh resignierte Bosheit, ein Witz um jeden Preis kräuselt sich auf jungen Lippen, als schlüge unter den neuen Spitzen ein altes Herz. Begehrlich ohne Feuer, lustvoll ohne Anbetung umspielt der geistreiche Student seine eigenen Wünsche, und bringt er sie in Verse, dann schraubt eine Schnürbrust seine Rhythmen ein, wie den Busen der Fräulein, denen sie gelten.
"Von unserem Goethe zu reden" schreibt ein Schulfreund. "Das ist noch immer der stolze Phantast . . Wenn du ihn nur sähest, du würdest entweder vor Zorn rasend werden oder vor Lachen bersten . . Er ist bei seinem Stolze auch ein Stutzer, und alle seine Kleider, so schön sie auch sind, sind von so einem närrischen goût, der ihn auf der ganzen Akademie auszeichnet . . Er macht sich in allen Gesellschaften mehr lächerlich als angenehm. Er hat sich . . solche porte-mains angewöhnt, bei welchen man unmöglich das Lachen enthalten kann. Einen Gang hat er angenommen, der ganz unerträglich ist . . Doch dieses ist ihm alles einerlei, man mag ihm seine Torheit vorhalten, so viel man will:
Man mag Amphion sein und Feld und Wald bezwingen, nur keinen Goethe nicht kann man zur Klugheit bringen!
Denn wir sind fertig, und was ist Erfahrung? Mit Fünfzehn haben wir den Epiktet studiert, vor unserem Geiste hegt das Bild der Welt, mit reifem Lächeln beschaut, noch ehe wir sie suchten: was kann uns noch erschüttern? Haben wir nicht eben, am sechzehnten Geburtstag alle Lebensweisheit ins Stammbuch des Freundes ergossen?
"Dieses ist das Bild der Welt,
die man für die beste hält:
fast wie eine Mördergrube,
fast wie eines Burschen Stube,
fast so wie ein Opernhaus,
fast wie ein Magisterschmaus,
fast wie Köpfe von Poeten,
fast wie schöne Raritäten,
fast wie abgehatztes Geld sieht sie aus, die beste Welt!"
Einiges freilich musste der junge Mann aus Frankfurt eilen in Leipzig nachzuholen, denn am Ende war man draußen im Reich hinter den eleganten Manieren doch zurückgeblieben, die der Glanz einer französischen Kolonie in das geistige Leipzig einführte. Wie da die Louisdors wegrollen, wenn man lauter neue Kleider braucht, nachdem ein sparsamer Vater die Garderobe im Hause zusammenschneidern Heß! War es nicht doch recht kleinbürgerlich daheim? Nur immer lernen, immer Wissen häufen, gar keine große Welt, lauter Sinn und so wenig Gebärde! Welch ein Beispiel wirkt nicht das glänzende Frankreich vor uns aus! Da geht der Geist nicht wie bei uns in alten Röcken umher, der große Voltaire hält einen Hof — erzählen's nicht alle, die sein weites Haus in Fernay betreten haben? Selbst Wieland, den die galanten Götter lieben, soll zwischen den Fürsten residieren. — Eine Professur? Vielleicht. Hintergrund und Titel gibt sie her, und steht man erst auf dem Katheder, so wird's ein wenig heiterer zugehen, gewandter fließt dann die Rede, und wir spielen zwischen ernster Wissenschaft und reizenden Formen uns recht literarisch hin.
Dort eilen die Leute zur Kirche. Gibt's wirklich noch so viele Toren? Schon in Frankfurt fühlte man sich "weder kalt noch warm" und fürchtete alle Gottesurteile des Mittelalters, seit man erfuhr: wer unwürdig den Leib des Herrn genießt, isst und trinkt sich selbst das Gericht. Das Sicherste ist fernzubleiben. Was tut man nur? Zum Reiten ist's zu spät, für Besuche zu früh. Versuchen wir's mit dem Collegium.
Mit mildem Lächeln tritt er ins deutsche Staatsrecht ein. Sitzen die Strümpfe stramm? Wo stehen wir denn? Vom Kammerrichter ist die Rede, von Präsident und Beisitzern. Wie endlos trägt er wieder vor, was doch im Buche steht! Der weiße Rand ist immer noch das Beste, darauf kann man die Herren zeichnen, von denen dieser ennuyante Vortrag handelt. Wenn die Uhr schlägt, dehnt man sich befreit und geht hinüber in die Physik — ob es wohl in dieser Fakultät anregender ist? Monaden, was für drollige kleine Geschöpfe! Und er schreibt der Schwester:
"Wir Gelehrten achten euch andere Mädchen so wie Monaden. Wahrlich, seit ich gelernt habe, dass man ein Sonnenstäubchen in einige tausend Teilchen teilen könne . . schäme ich mich, dass ich jemals einem Mädchen zu Gefallen gegangen bin, die vielleicht nicht gewusst hat, dass es Tierchen gibt, die auf einer Nadelspitze ein Menuett tanzen können. " Ewig Briefschulden an die alten Freunde! Und er schreibt:
"Ich bin unschlüssig! Soll ich bei euch bleiben, soll ich in die Komödie gehen? Ich weiß nicht! Geschwind, ich will würfeln. Ja, ich habe keine Würfel. Ich gehe, lebt wohl. Doch halt nein, ich will dableiben. Morgen kann ich wieder nicht, da muss ich ins Kolleg, und Besuche und abends zu Gaste . . Stellt euch ein Vöglein auf einem grünen Ästlein in allen seinen Freuden vor, so leb ich . . in Gesellschaft, Konzerten, Komödien, bei Gastereien, Abendessen, Spazierfahrten, so viel es um diese Zeit angeht. Hai Das geht köstlich, aber auch köstlich kostspielig!
Qui est ce precieux? fragen die Professorenfrauen. Neulich hat er in unserem Salon ein hypermodernes Gedicht rezitiert: es war unmöglich, wie sein gesticktes Gilet. Tritt er nicht auf wie ein prince du sang, und ist doch ein kleiner Ratssohn aus dem Reich, noch keine Siebzehn! Der Großvater soll ja Schneider gewesen sein. Ein guter Junge? Vielleicht, neulich spielte er gar freundlich mit den Kindern, doch zu Erwachsenen tut er stolzer, als seinem Alter ziemt. Er dichtet auch? Eh bien, er wielandet ein bisschen. Sollte lieber endlich Karten spielen lernen. Macht der kleinen Breitkopfin den Hof, auch der Oeser, immer älteren Demoisellen, das ist nicht anders bei solchen Buben. Und wer ist dieser närrische Mensch in Grau, mit dem man ihn immer stolzieren sieht?
Es dauert nicht lange, so laden ihn die Leipziger Familien nicht mehr ein, und er bestätigt ihr Urteil, wenn er schreibt: "Eine andere Ursache, warum man mich in der großen Welt nicht leiden kann: ich habe etwas mehr Geschmack und Kenntnis vom Schönen als unsere galanten Leute, und ich konnte nicht umhin, ihnen oft in großer Gesellschaft das Armselige von ihren Urteilen zu zeigen." Nein, er ist nicht gemacht, die Gesellschaft zu beleben, der sein Auftreten närrische Opfer bringt.
Doch ist's nicht erst die Leipziger Luft, die ihn so formte. Der erste Brief, der Goethes Namen nennt — Brief eines adligen Herrn, bei dem sich der Schüler mit Schwung und einer falschen Empfehlung um Aufnahme in einen Klub vergebens beworben — rühmt ihm "mehr ein gutes Plappermaul als Gründlichkeit" nach, und noch im Alter spricht er von seinem frühen Dünkel, als wären alle Blicke auf ihn gerichtet.
Mit solchem herrschsüchtigen Gebaren, lehrhaft, unwirsch, zerfahren, begegnet auch der Student seinen Kameraden. Seine Affären trägt er dem Einen auf einem Zweiten zu melden, dem Dritten schreibt er, er solle sich vom Vierten seine Meinung über ihn ausrichten lassen. Den Fünften, den er zur Lektüre bestellt hat, weist er von der Türe weg, um indessen dem Sechsten zu schreiben. Nie fragen seine Briefe: wie geht es dir? Versäumt aber der andere, ihn nach seiner Freundin zu fragen, so wird er getadelt.
Am ungebärdigsten schreibt er der Schwester nach Hause, die doch nur ein Jahr jünger ist und ebenso gescheit; verächtlich spielend, großmütig doktrinär: "Es ist heute dein Geburtstag, ich sollte dir poetisch Glück wünschen, aber ich habe keine Zeit mehr, auch keinen Platz mehr . . Schreibe deine Briefe auf ein gebrochenes Blatt, und ich will dir die Antwort und die Kritik daneben schreiben. Ferner verlange ich, dass du dich im Tanze perfektionierst, die gewöhnlichsten Kartenspiele lernst und den Putz mit Geschmack wohl verstehst . . Diese letzteren Forderungen werden dir von einem so strengen Moralisten, wie ich bin, äußerst seltsam vorkommen, zumal da mir alle dreie fehlen." Und als er den Brief gesiegelt hat, eilt der strenge Moralist zu seiner Geliebten, deren Putz er mit Geschmack wohl versteht. So zerbröckelt er die Zeit — und will der junge Dilettant sich denn für gar nichts sammeln?
Da ist eine Liebhaberei, die er ernster anfasst, weil sie ihn anfasst: Kunst, bildende und auch dichtende. Zuweilen geht er früh in die Akademie, um seine Knabenstudien fortzusetzen. Hier ist er naiver gestimmt, reiner, hier will er weder spotten noch lehren, nur lernen. Warum? Weil ihm natürliches Talent die Arbeit leicht macht, denn es macht ihm nichts Vergnügen, als was ihn anfliegt; auch weil der Mann, der ihn hier leitet, vom ersten Anblick ihm gefällt. So wird es ihm ein Leben lang ergehen, ihm und der Mitwelt: beinahe nur wer ihm gleich gefallt, wird später, wenn er mächtig ist, vor ihm bestehen.
Auch dies war schon im Knaben vorgebildet: "Ich war meist zu lebhaft oder zu still und schien entweder zudringlich oder stockig, je nachdem die Menschen mich anzogen oder abstießen . . Ich ward oft freundlich, oft auch spöttisch auf eine gewisse Würde berufen, die ich mir in meinem Äußeren herausnahm."
Jetzt gewinnt der Maler und Malprofessor, der zarte und vornehme Oeser mit den weichen Frauenzügen, den fahrigen jungen Herrn, indem er ihn anfeuert, statt ganz zu loben oder ganz zu tadeln. Er allein spürt unter dem skurrilen Wesen des Jünglings ein vergrabenes Streben, und, viel zu klug ihn zu meistern, lässt er ihn schweifen, gibt ihm beinahe nichts als sein Beispiel, drucklos, schweigend; bei einem Kupferstecher lässt er ihn in der Ätzung, bald auch im Holzschnitt dilettieren. Nicht als Zeichenlehrer fühlt er sich vor diesem Schüler, als Torwart der Kunst und lächelt, wenn jener Stiche und Bilder weiterdichtet, den Zustand der Figuren vor und nach dem Bilde durch kleine Lieder bezeichnet, ganz, wie er das Staatsrecht mit kleinen Bildern illustrierte. Zwar, sie ist weit entfernt von den Urquellen, diese literarische Manier des jungen Mannes, und wirklich trägt er sie so sehr ins Leben, dass er, aus der Galerie der Niederländer bei einem Schuster einkehrend, ein Bild von Ostade zu erblicken glaubt.
Mit heiterer Reife knüpft der Maler den Jüngling an sich, bald auch an sein Haus, fester als die Autokraten des Katheders oder das Leipziger Dichterpaar, Geliert und Gottsched, das sich nur in der Gala des Geistes den erschrockenen Schülern zeigt und von dem der Student nichts lernt als eine gute Handschrift. War es nicht dieser stille feine Oeser, der auch den großen Winckelmann auf seine Bahnen lenkte? Alles blickt nach Italien, und wie Oeser die Schüler auf die Antike des Südens als Vorbild des Nordens weist, so nimmt der junge Goethe zum ersten Male griechische Linien auf — doch lässt er sie in sich versinken, als fühlte er: es ist zu früh. Ja, es geschieht, dass er den Dresdner Pavillon der Antiken meidet, weil ihn sein Genius noch um jene Götter herumführt, die er später durch ihn erwecken will. Es ist zu früh: und was er jetzt von weitem verehren lernt, wird er in ein paar Jahren zerschlagen: denn nur auf großen Umwegen sollen die entscheidenden Erkenntnisse dieses langen Lebens fruchtbar werden.
Schon wird Goethe, ganz von der Persönlichkeit bestimmbar, bis dicht an Winckelmann herangeführt, nach Deutschland kehrt der Meister heim, die Leipziger Studenten rüsten sich zu einer Huldigung: da kommt die Nachricht, Winckelmann sei in Triest ermordet. So wird dem 18jährigen zum ersten Mal Italien entzogen: es wird ihm noch dreimal entzogen werden und erst nach zwanzig Jahren aufgetan.
Doch Lessing, dessen Lustspiel Goethe eben als Liebhaber agiert hat — kommt Lessing nicht einmal in dies Zentrum des Geistes? Wie, wenn er den Verworrenen in Zucht und Lehre nähme? Ja, Lessing kommt, doch "es beliebte uns, ihm nirgends zu Gefallen zu gehen, ja die Orte, wo er hinkam, zu vermeiden . . Diese augenblickliche Albernheit bestrafte sich": Goethe hat Lessing nie mit Augen gesehen, denn als er vierzehn Jahre später sich zu ihm aufmacht, ist Lessing eben gestorben. Hätte er jetzt an ihm gelernt? Muss er es später bedauern?
Dies Leben ist wie ein Baum gewachsen, und wer am Ende vor dem 80jährigen Stamme steht, fühlt, wie nach organischen Gesetzen Nahrung und Wasser, Wind und Gewitter ihn fast immer im rechten Augenblicke trafen. Auch für Lessing, der Shakespeare im Busen trug, ist Goethes Geist in Leipzig noch nicht reif. Als Oeser einen neuen Theatervorhang malt, auf dem er zwischen den Hermen antiker Dichter Shakespeare in den Tempel schreiten lässt, sitzt neben ihm auf einem Schemel der 18jährige Goethe und liest ihm Wielands neues Opus vor: Musarion!
Noch leuchtet Wieland als Polarstern vor. Gebannt steht jeder Anfänger vor diesen federleichten Versen, auch Goethe, dem Gelenkigkeit schon in den Knabenjahren eigen war, ahmt ihn nach: biegsam und mit leichten Sprüngen auf der Fläche eleganter Reime sich tummelnd, so dass gleich seine ersten Lieder in Musik gesetzt werden. Gefährlich leicht hat er die Maße zur Hand, wechselt Rhythmen in gereimten Briefen, auch Stil und Sprache von "Frauen und Schauspielern hat er als Knabe leicht nachgeahmt. Jetzt schreibt er einem Freunde ein englisches, dem andern ein französisches Gedicht, diesem überträgt er italienische Madrigale, jenem kopiert er eine zärtliche Götterfabel, zugleich verachtet er alle diese Etüden, warnt die Schwester, der er sie schickt, vor Abschriften, ironisiert seine Künstlichkeiten:
"Von kalten Weisen rings umgeben
sing ich, was heiße Liebe sei,
ich sing vom süßen Saft der Reben,
und Wasser trink ich oft dabei."
Also ist er kritisch gegen sich und wendet Spottlust gegen eigene Versuche? Nicht immer, und wehe, wenn es andere tun! Tadelt ihm der Professor ein Gedicht, so braucht Goethe ein halbes Jahr sich zu erholen; widmet er eines zu Neujahr dem Großvater, so fordert er peinlichen Bericht über die Gemütsbewegung der Hörer. Monate wendet er an sein Schäferspiel, er wird nicht müde, "Die Laune des Verliebten" umzuschreiben. Vergleicht ihm aber ein Freund dies Spiel mit einem berühmten Muster seiner Tage, gleich bricht er empfindlich aus, will alle Szenen verbrennen, wenn sie dem fremden Stücke ähnlich sind.
Freilich, es sind lauter Nippes von Porzellan, diese Lieder, diese Spiele, in feinen Öfen gebrannt und lackiert müssen sie unter den Glassturz kommen, dass sie kein Wind umblase. Aus Reflexion erzeugt handeln sie vom Vergangenen, Kunstformen ohne Veranlassung schließen sie meist mit einem Epigramm, und wenn er auch die Geliebte andichtet, es muss durchs Medium einer Chloe, einer Ziblis sein. Den besten Gemälden jener Zeit gleichen sie nicht, denn was dort, ob auch in Klammern der Mode, Freiheit der Liebe und der Linie bleibt, hier wirkt's nur zweideutig, nur schlüpfrig, wie nichts in der langen Reihe Goethischer Verse, die sie anführen. Ob seine Ironie die Kunst schildert eine Spröde zu fangen oder den Triumph der Tugend, immer glänzt in diesen Leipziger Liedern die Glätte eines Natur-Parkettes, bis zur letzten Grenze wagt sich das Mädchen, dann flieht sie, bittet und beschwört, und wird, nach Laune ihres pikanten Dichters, von ihrem Schäfer zuletzt in den Venustempel geführt oder um ihn herum. Denn Venus lebt nur in geschnittenen Gärten, und selbst die Welle des Baches wird von diesem Musensohne nur als Gleichnis wollüstiger Unbeständigkeit gefühlt,
"und buhlerisch drückt sie die sehnende Brust.
Dann trägt sie ihr Leichtsinn im Strome darnieder,
schon naht sich die zweite und streichelt mich wieder,
da fühl ich die Freuden der wechselnden Lust."
Braucht's dazu die Natur? Zuweilen geht man als Dichter ins Grüne "auf die Bilderjagd ", meist bleibt man in Stuben und Kellern, auch das Reiten wird aufgegeben, ein sitzendes und schleichendes Leben nennt er später die Jahre von Leipzig, und "bei der großen Beschränktheit meines Zustandes, bei der Gleichgültigkeit der Gesellen, dem Zurückhalten der Lehrer, der Abgesondertheit gebildeter Einwohner, bei ganz unbedeutenden Naturzuständen, war ich genötigt, alles in mir selbst zu suchen".
Was findet er?
Hüllt dieser intellektuelle Geist vielleicht den Ansturm dunkel brausender Gefühle ein? Suchen diese allzu klugen Blicke vielleicht ganz andere Dinge als den Beifall der Leipziger Gallier? Was birgt, was treibt dies eingeengte Herz, dass es in kurzem sich so groß entfalten kann? Wo ist die Spur des Dämons, der dies Leben in kurzem mit gefährlich wilder Flamme nähren wird? Soll er mit 22 Jahren das erste ungebärdige Bild der eingeborenen Riesenwelt gestalten: man müsste Wunder glauben, zeigte sich nirgends ein Vorspiel — und grade in diesem Leben geht es doch nie mit Wundern zu. Wir suchen Wetterzeichen.
Mitten aus den spielenden Wellen, die von den mutwillig kleinen Steinwürfen dieser drei Jugendjahre geweckt werden, ragen ein paar Blöcke, wie aus dem Urgestein einer kühnen Natur: drei Oden und ein Dutzend Briefe an einen Freund — und mit einem Schlage enthüllt sich die dämonisch geniale Art dieses Jünglings, die Auftreten, Geschmack und Geist sonst verhüllte. Denn während er in jenen Zeiten "an den Gegenständen der Kunst und der Natur nur hindämmert", erhebt sich in entlegener Provinz der Seele ein unbekannter Sturm, gestaltlos wühlend, in Urformen des Anrufes sich erschöpfend, keinem Liede, keinem Spiel, nur dem einzigen Freunde anvertraut.
In diesem fremden Brausen wirft er sich zuerst auf große Entwürfe, von denen er Akte durchschreibt, dann verbrennt. Nur von einem "Belsazar" ist ein Eckchen übriggeblieben. Alles bleibt Torso, er hat Witterung, dass es zu all dem zu früh ist; die runde Kunst erschöpft sich in der Schäferwelt.
Ungewisse Umrisse sieht er vor sich. Er besitze einige Eigenschaften des Poeten — schreibt er in aufgeregtem Tone plötzlich der Schwester — doch seien seine Verse schlecht. "Man lasse doch mich gehen! Habe ich Genie, so werde ich Poet werden, und wenn mich kein Mensch verbessert. Habe ich keins, so helfen alle Kritiken nichts. Mein Belsazar ist zu Ende, aber ich muss von ihm sagen, was ich von allen meinen Riesenarbeiten sagen muss, die ich als ein ohnmächtiger Zwerg unternommen habe. " Bald darauf: "So leb ich fast ohne Mädchen, fast ohne Freund, halb elend. Noch einen Schritt und ich bin's ganz."
Ja, er hat Freund und Mädchen.
Wer ist der Freund, an den jene seltsam dunklen Briefe, jene Oden strömen? Sucht der Empfindliche sich einen Bewunderer aus? Der herrisch Lehrhafte einen Jünger? Der Stolze einen Hochgeborenen? Es ist ein beinah 30jähriger armer Mensch, Hofmeister eines Grafensohnes, hager, mit großer Nase, kantigen Zügen, sorgsam grillenhaft gekleidet, stets mit Schuhen, Hut und Degen, einem alten Franzosen ähnlich. Das ist ein Mann, dessen größte Lust ist, sich ernsthaft in Possen zu vertiefen, verrückte Einfälle bis ins Unendliche zu verfolgen, dem grauen Anzug immer neue Schattierungen von Grau einzufügen, am Fenster die Vorübergehenden stundenlang zu karikieren, geistvoll barock, doch nicht im mindesten boshaft oder roh: trauriger Zyniker, skurriler Philosoph, verwunderlich rührender Narr. Dies ist Behrisch, der alle lebenden Autoren herunterreißt, doch Goethes Gedichte gelten lässt und,, unter kuriosen Glossen über Fraktur und Tinte, Papier und Heft, in vollendeter Schrift eine feierliche Kopie unternimmt, gegen das einzige Versprechen des Autors, nichts drucken zu lassen.
So ist der ältere Sonderling, mit dem der zehn Jahre jüngere Sonderling seine Zeit verbringt, nachdem er sich vollends von der Gesellschaft geschieden, mit dem er in Auerbachs Keller Nächte hindurch karikiert, spintisiert "wie in einer Burg . . um als misanthropische Philosophen über die Leipziger zu lachen". Als aber ruchbar wird, der junge Goethe habe in seinen Versen einen Kuchenbäcker zum Schaden eines Professors verherrlicht, da wird Behrisch um solchen Freundes willen als Hofmeister entlassen, er muss fort, in Dessau findet er besseren Dienst beim Fürsten. Dort lebt er dann lange Jahre still auf dem Schloss, schreibt eine romantische Oper und ein Wörterbuch der Jägersprache, zieht Georginen an den Fenstern und begrüßt nach Jahrzehnten den Jugendfreund im alten Ton. Goethes Werk und Ruhm lassen ihn kalt; er liebt ihn nur. Als er stirbt, legt man ihm nach seinem letzten Willen die Abschrift jener Leipziger Gedichte in den Sarg, darunter die drei Oden.
Ist es wirklich dieselbe Hand, die diese Oden und jene Lieder schrieb? Heut schrieb sie dieses:
"Ich sah, wie Doris bei Damoeten stand,
er nahm sie zärtlich bei der Hand;
lang sahen sie einander an
und sahn sich um, ob nicht die Eltern wachen,
und da sie niemand sahn, geschwind — -
genug, sie machten's, wie wir's machen!"
Und morgen, als der Freund die Stadt verlässt, schreibt dieselbe Hand:
"Du gehst! Ich murre.
Geh! Lass mich murren.
Ehrlicher Mann,
fliehe dieses Land.
Tote Sümpfe,
dampfende Oktobernebel
verweben ihre Ausflüsse
hier unzertrennlich . .
Fliehe sanfte Nachtgänge
in der Mondendämmerung,
dort halten zuckende Kröten
Zusammenkünfte auf Kreuzwegen.
Schaden sie nicht,
werden sie schrecken.
Ehrlicher Mann,
fliehe dieses Land! "
Oder aus der dritten Ode:
"Sei gefühllos!
Ein leichtbewegtes Herz
ist ein elend Gut
auf der wankenden Erde.
Behrisch, des Frühlings Lächeln
erheitre deine Stirne nie;
nie trübt sie dann mit Verdruss
des Winters stürmischer Ernst . .
Zerreiß sie! Ich klage nicht.
Kein edler Freund
hält den Mitgefangenen,
der fliehen kann, zurück . .
Du gehst, ich bleibe.
Aber schon drehen
des letzten Jahrs Flügelspeichen
sich um die rauchende Achse.
Ich zähle die Schläge
des donnernden Rads,
segne den letzten —
da springen die Riegel,
frei bin ich wie du."
Wo ist nur all die Versfreude, wo ist der Reimglanz hin, wo eleganter Witz, pfeilsichere Ironie und wo der Zauber halb enthüllter Wollust? Dies klingt mit einem Male nach erlebtem Herbst, nach wühlendem Schmerz eines bitter Zurückgebliebenen, mit einem Male brandet Chaos, Trieb nach Freiheit durchdringt freirollende Rhythmen, ein dunkles Streben will sich den Armen früher Resignation entreißen, fern dämmert eine Küste auf. In Briefen, oft tagebuchartig geweitet, strömt nun gegen den abwesenden Freund Klage, Empfindlichkeit, strömt nun zum ersten Male aufgestaute Leidenschaft eines früher schlafenden Herzens. Denn Goethe liebt.
Schon einmal hat er "gerast": als man ihm in tragikomischer Lage seine erste Neigung, ein Frankfurter Gretchen genommen hat; aber da ist es Knabentrotz, es ist wie die Verwundung eines Schlummernden gewesen, denn jene Neigung war ideal geblieben, in den Jahren der Dämmerung. In Leipzig aber liegen in seiner Liebschaft Fußangeln verborgen, in denen er sich schmerzhaft fängt. Wie sieht das Wesen aus, um das er kämpft? Vielleicht ist's eine leidenschaftlich weltliche Frau von dreißig Jahren, die den sinnlich Weltsüchtigen, vielleicht eine Künstlerin und Muse, die den Literaten, oder eine glänzende Kokotte, die den unerfahrenen Jungen verführt?
Es ist Käthchen Schönkopf, Weinhändlers-Tochter, 20jährig, "wohlgewachsen, obgleich nicht sehr groß, ein rundes, freundliches, obgleich nicht außerordentlich schönes Gesicht, eine offene, sanft einnehmende Miene, viel Freimütigkeit ohne Koketterie, ein sehr artiger Verstand ohne, die größte Erziehung". Ihr werden andere Frauen in Goethes Jugend ähneln, denn seine Neigung gilt, in allen Epochen, selten der Schönheit, nie dem Verstand, immer einer sanfteren Natur. So müssen, nach dem Gesetze der Polarität, die Quietive sein, die dieses ungeheure Temperament sich sucht.
Immerhin, sie ist eine Wirtstochter, und der Ratssohn muss sich erst durchkämpfen zwischen Stolz und Neigung. Draußen schmückt er sich übers Maß, macht fremden Fräuleins den Hof, um Neugierige von der Weinstube abzulenken: noch gilt sein Selbstbewusstsein dem Stande, Erziehung wirkt noch immer stärker als Natur, nur langsam lernt er vor seinem Empfinden frei bestehen: "Was hat meine Liebe für eine scheltenswürdige Seite? . . Was ist der Stand? Eine eitle Farbe, die die Menschen erfunden haben, um Leute, die es nicht verdienen, mit anzustreichen. Und Geld ist ein ebenso elender Vorzug in den Augen eines Menschen, der denkt. Ich liebe ein Mädchen ohne Stand und ohne Vermögen, und jetzo fühle ich zum allerersten Male das Glück, das eine wahre Liebe macht. Ich habe die Gewogenheit meines Mädchens nicht denen elenden kleinen Trakasserien des Liebhabers zu danken, nur durch meinen Charakter, nur durch mein Herz habe ich sie erlangt."
Bald wird er fordernder, alles, was an sinnlicher Kraft in ihm atmet, bricht zu dem lebensvollen Mädchen vor, erzwingt sich jene halbe Hingabe, mit der sich grade damals die Mädchen Genüsse ohne Gefahren zu schaffen wussten. Rokoko -Verse, die er Annetten, ihrem anderen Namen, widmet, tragen die Farben sinnlich voller Stunden, die nicht geträumt sind.
Er wirbt, er dient. Denn wird auch diese Seele erst allmählich zur Ehrfurcht aufblühen, die heut noch ein früher Zynismus überwächst, so ist ihr vor den Frauen das Dienen doch eingeboren, und so wird er in allen Wirrnissen der Liebe immer zum stärker leidenden Teil. Nie ist Goethe der schöne Verführer geworden, nie auf Eroberungen stolz, nie Don Juan, immer der Bittende, immer der Dankende — und viel öfter ein vergeblich als ein glücklich Werbender! Nur von diesem Punkte grenzenloser Hingabe, von der Erkenntnis seines unlöschlichen Liebeswillens, der sich in Wesen und Dinge senkt, eröffnet sich klar die Legende seiner Leidenschaften, die Kosmogonie seines Werkes, die Geschichte seiner Seele.
Schon jetzt verblasst sein Skeptizismus vor dem Anblick des Mädchens:
"Welch ein Verstand, der sie beseelet,
mit immer neuem Reiz umgibt!
Sie ist vollkommen, und sie fehlet
darin allein, dass sie mich liebt.
Die Ehrfurcht wirft mich ihr zu Füßen,
die Wollust mich an ihre Brust . ."
Doch hinter solcher Dankbarkeit des Beschenkten steigt, zwischen Hingabe und Pathos, schon in diesem 17jährigen faustischer Zweifel auf, und gespielte Ironie wird zur zitternden Erfahrung:
"Das reinste Glück, das wir empfunden,
die Wollust mancher reichen Stunden
floh wie die Zeit mit dem Genuss.
Was hilft es mir, dass ich genieße?
Wie Träume flieh'n die wärmsten Küsse,
und alle Freude wie ein Kuss!"
Hier ist zum ersten Male das tragische Grundproblem dieses Lebens angerührt. In allen Epochen wird er aufs neue sich fragen und noch im 82. Jahre unerbittlich den 100jährigen Faust resümieren lassen: Was hilft es mir, dass ich genieße? Goethes Flucht vor der Gegenwart, vor dem Augenblicke, dem er zugleich doch immer nachjagt, beginnt mit 18 Jahren.
Heut ist es noch zu früh! Teuer kommt es ihm und den Seinen zu stehen, dass Goethe dies Zufrüh gefühlt hat; zwischen innerer Erkenntnis und äußerer Erfahrung sich zurechtzufinden vermag die brausende Seele noch nicht und richtet Unheil an.
In der Kunst hat ihn der Genius besser geleitet, hat ihn die großen Entwürfe liegen, jene Rhythmen an den Freund nicht fortbilden, sich lieber der Verfeinerung leichter Spiele hingeben lassen, um ihn indessen zu beschäftigen. Im Leben weiß er zwischen allgemeinen dunklen Urworten und speziellem Misstrauen gegen dieses Käthchen nicht zu unterscheiden. Als Dichter, mit einer Seele geboren, die jede Erfahrung ins Allgemeine umzudeuten begnadet und verurteilt ist, verwirrt sich ihm der Rückweg von solcher Erkenntnis ins Leben; führerlos vollends, seit der Freund entfernt ist, nervös und empfindlich, begehrlich in seiner Passion, zerstört er sich selbst die Stille seiner ersten Neigung, raubt den befangenen Sinnen ihr natürliches Vertrauen; bald wird er sich mit der Geliebten überwerfen — und so, zum ersten Male, unbewusst die Freiheit seiner Sendung retten.
Denn eine Ehe mit Käthchen ist sein bestimmter Plan. Ihre Mutter Frankfurterin, auch der Vater ist ihm gewogen, und er, mit sinnlichen Blicken Haus und Hof, Schenkzimmer und Spieltisch, die ganze Atmosphäre der Geliebten mit umfangend, träumt sich, mit eingeborener Neigung zu Ordnung und gesicherten Bezirken, als ihr Gatte. Doch nun, als er sie schon länger als ein Jahr liebt, fängt er an, sie zu quälen: sein Mangel an Gefasstheit rächt sich auch dort, wo sich das Herz gefassßt hat. "Die böse Laune . . glaubte ich an ihr auslassen zu dürfen . . Durch unbegründete und abgeschmackte Eifersüchteleien verdarb ich mir und ihr die schönsten Tage. Sie ertrug es eine Zeitlang mit unglaublicher Geduld, die ich grausam genug war aufs Äußerste zu treiben. Allein zu meiner Beschämung und Verzweiflung musste ich endlich bemerken, dass sich ihr Gemüt von mir entfernt habe . . Es gab schreckliche Szenen unter uns, bei welchen ich nichts gewann, und nun fühlte ich erst, dass ich sie wirklich liebte und dass ich sie nicht entbehren könne."
In diesen unbarmherzigen Sätzen des greisen Rückblickes sind dennoch alle Leidenschaften verschwiegen, die seine Briefe an den entfernten Freund in einem Maß enthüllen, wie man sie nur noch einmal in Goethes Leben wiederfinden wird. Wildheit und Skepsis, sinnliches und seelisches Chaos, Moralität und Zynismus, Faust und Mephisto: schon aus diesen Briefen des 18jährigen werden die großen Gegenkräfte seines Herzens kund. Von ruhelosen Sinnen emporgeschaufelt tritt das Doppelwesen dieser Seele zum ersten Male an den Tag.
"Noch so eine Nacht wie diese, Behrisch, und ich komme für alle meine Sünden nicht in die Hölle! . . Ein eifersüchtiger Liebhaber, der eben so viel Champagner getrunken hatte, als er brauchte, um seine . . Einbildungskraft aufs äußerste zu entzünden! Erst könnt' ich nicht schlafen, wälzte mich im Bette, sprang auf, raste, und dann ward ich müde und schlief ein. Aber wie lange, da hatt' ich dumme Träume . . Darüber wachte ich auf und gab alles zum Teufel. Darnach hatte ich eine ruhige Stunde, hübsche Träume: die gewöhnlichen Mienen, die Winke an der Türe, die Küsse im Vorbeifliegen, und dann auf einmal — da hatte sie mich in einen Sack gesteckt . . Ich philosophierte im Sacke und jammerte ein Dutzend Allegorien im Geschmack von Shakespeare, wenn er reimt . . Da kam mir's auf einmal ein, dass ich dich nicht wiedersehen würde, und das fühlte ich . . in einem Fieber-Paroxismus, da mir der Kopf taumelicht war. Ich riss mein Bett durcheinander, verzehrte ein Stückchen Schnupftuch und schlief bis acht auf den Trümmern meines Bettpalastes."
Erotische Kämpfe mit Käthchen mögen diesen Zustand erzeugt, dann verschlimmert haben. "Diese Hand, die jetzt das Papier berührt . . drückte sie an meine Brust. O, Behrisch, es ist Gift in denen Küssen I Warum müssen sie so süße sein! . . Ich sage mir oft: wenn sie nun deine wäre und niemand mehr als der Tod . . dir ihre Umarmung verwehren könnte? Sage dir, was ich da fühle, was ich da alles herumdenke — und wenn ich am Ende bin, so bitte ich Gott, sie mir nicht zu geben . . Sieh, wie ernsthaft ich geworden bin. Das arriviert mir oft." Je heftiger er sich mit ihr herumbeißt, umso eher geht's dann zu den "Mädchen, die besser waren als ihr Ruf".
"Ich bin bei Fritzchen gewesen, die ganz eingezogen geworden ist. So sittsam, so tugendhaft . . Kein nackend Hälschen mehr, nicht mehr ohne Schnürbrust . . Könnte ich's aber nur ungestraft tun und stünden (bei Käthchen) nicht einige Nägel und Stricke parat, wenn man so etwas erführe, so würde ich die Affäre des Teufels übernehmen und das gute Werk zunichtemachen. Kennst du mich in diesem Tone, Behrisch? Es ist der Ton eines siegenden jungen Herrn. Und der Ton und ich zusammen! Es ist komisch! Aber ohne zu schwören, ich unterstehe mich schon ein Mädchen zu verf —, wie Teufel soll ich's nennen. Genug, Monsieur."
Doch ein paar Tage später bricht es plötzlich wieder aus. "Ha, Behrisch, da ist einer von den Augenblicken! Du bist weg, und das Papier ist nur eine kalte Zuflucht gegen deine Arme. O Gott, Gott! lass mich nur erst wieder zu mir kommen. Behrisch, verflucht sei die Liebe! O sähst du mich, sähst du den Elenden, wie er rast, der nicht weiß, gegen wen er rasen soll: du würdest jammern. Freund, Freund! Warum hab' ich nur einen!" Nun schildert er in einem Tagebuch-Briefe, der über vier Tage reicht und den acht Druckseiten nicht fassen, in gehetztem Tempo zuerst, wie sie ihn durch ihre Kälte in ein Fieber geworfen. "Nun! Oh Behrisch, verlange nicht, dass ich es mit kaltem Blut erzähle! Gott! Diesen Abend schicke ich hinunter . . Meine Magd . . bringt mir die Nachricht, dass sie mit ihrer Mutter in der Komödie sei. Eben hatte das Fieber mich mit seinem Froste geschüttelt, und bei dieser Nachricht wird mein ganzes Blut zu Feuer! Ha! In der Komödie! Zu der Zeit, da sie weiß, dass ihr Geliebter krank ist! Gott! . . Wie? Sollte sie mit Denen in der Komödie sein, mit Denen? Das schüttelte mich! Ich musste es wissen. Ich kleide mich an und renne wie ein Toller nach der Komödie . .
"Nun aber! Hinter ihrem Stuhl Herr Ryden, in einer sehr zärtlichen Stellung. Ha! Denke mich! Auf der Galerie! Mit einem Fernglas — das sehend! Verflucht! O Behrisch, ich dachte, mein Kopf spränge mir für Wut . . Er lehnte sich bald hervor . . bald trat er zurück, bald lehnte er sich über den Stuhl und sagte ihr was, ich knirschte die Zähne und sah zu. Es kamen mir Tränen in die Augen, aber sie waren vom scharfen Sehen, ich habe diesen ganzen Abend noch nicht weinen können . . Auf einmal fasste mich das Fieber mit seiner ganzen Stärke, und ich dachte in dem Augenblicke zu sterben . . Kennst du einen unglücklicheren Menschen, bei solchem Vermögen, bei solchen Aussichten, bei solchen Vorzügen, als mich . . Wieder eine neue Feder. Wieder einige Augenblicke Ruhe . . Aber ich liebe sie. Ich glaube, ich tränke Gift von ihrer Hand . . Was werde ich morgen tun? . . Seh ich sie etwa, da . . werde ich denken: Gott verzeih' dir, wie ich dir verzeihe, und schenke dir alle die Jahre, die du meinem Leben raubst . . Ha! Alles Vergnügen liegt in uns! Wir sind unsre eigne Teufel, wir vertreiben uns aus unserm Paradiese . ."
Bis zum nächsten Abend ist alles geschehen, was er gewünscht, ihre Unschuld erwiesen. Versöhnung. Trotzdem führt er den Brief zu Ende und "würde ihn zerreißen, wenn ich mich schämen dürfte, vor dir in meiner eigentlichen Gestalt zu erscheinen. Dieses heftige Begehren und dieses ebenso heftige Verabscheuen, dieses Rasen und diese Wollust werden dir den Jüngling kenntlich machen . . Gestern machte das mir die Welt zur Hölle, was sie mir heute zum Himmel macht. . Die Erinnerung überstandener Schmerzen ist Vergnügen. Und so ersetzt! Mein ganzes Glück in meinen Armen!"
Dies ist der früheste Goethe. Leidenschaft, die andere Charaktere oft verdunkelt, hat alle Züge dieser Seele transparent gemacht. Wollüstig und betrachtsam, toll und weltklug, dämonisch und naiv, selbstbewusst und unterworfen: in gleicher Stärke schrillt ein Chaos von Gefühlen durcheinander, unbeherrscht, führerlos.
In solchen Kurven von Eifersucht und Versöhnung zu neuer Eifersucht schleift er sich durch den Herbst; läuft die Kurve tief, so findet sich sein Geist im Vorwurf schwankend gegen sich und sie. Aus kühler Zergliederung der eigenen Stimmung bauen sich Antriebe des Künstlers auf, doch zugleich schwebt der fruchtbare Teil seines Wesens empor, die instinktive, freiwaltende Natur in ihm lässt ihn schon damals Selbstbetrachtung verdammen oder verlachen. Glänzend reizt ihn eine Libelle, ihre Farben in der Sonne zu analysieren, er findet sich enttäuscht, und wie er das kleine Erlebnis in Verse bringt, endet er, lehrhaft gegen sich selbst gewandt:
"Und nun betracht' ich sie genau
und seh' ein traurig dunkles Blau:
so geht es dir, Zerglied'rer deiner Freuden!"
In diesem letzten Leipziger Winter mag er das Mädchen nach zwei Jahren des Werbens ganz erobert haben. Seine Geständnisse an den Freund werden dunkler, auch seltener, der Verkehr der Liebenden scheint geregelter, seine Nerven beruhigter, er spielt Theater, zeichnet, geht in einige Familien, bis er im März dem Freunde dieses Merkwürdige vertraut:
"Höre, Behrisch, ich kann, ich will das Mädchen nie verlassen, und doch muss ich fort, doch will ich fort; aber sie soll nicht unglücklich sein. Wenn sie meiner wert bleibt, wie sie's jetzt ist! Sie soll glücklich sein. Und doch wird' ich so grausam sein und ihr alle Hoffnung benehmen . . Kann sie einen rechtschaffenen Mann kriegen, kann sie ohne mich glücklich leben, wie fröhlich will ich sein. Ich weiß, was ich ihr schuldig bin, meine Hand und mein Vermögen gehört ihr, sie soll alles haben, was ich ihr geben kann! Fluch sei auf dem, der sich versorgt, eh das Mädchen versorgt ist, das er elend gemacht hat! Sie soll nie die Schmerzen fühlen, mich in den Armen einer Andern zu sehen, bis ich die Schmerzen gefühlt habe, sie in den Armen eines Andern zu sehen . . Es ist sehr verworren, was ich geschrieben habe, aber du magst dich herausdenken. Du kennst mich."
Ein neuer — wohl der eindeutige Ton des besitzenden jungen Mannes, der, nach Genuss und Ernüchterung, sich irgendwie als Schuldner fühlt, aber den Willen zur Freiheit mit moralischen Redensarten drapiert. Das Mädchen, feinfühlig, stolz, zugleich von bürgerlicher Klugheit, scheint es ihm leicht zu machen, denn ein paar Wochen später klingt sein Ton befreit: sie haben sich getrennt, er liebt sie nun noch mehr, "denn stärker ist eine Leidenschaft, wenn sie ruhiger ist, und so ist meine. Oh Behrisch, ich habe angefangen zu leben! Dass ich dir alles erzählen könnte! Ich kann nicht, es würde mich zu viel kosten. Genug sei dir's, wir haben uns getrennt, wir sind glücklich. Es war Arbeit, aber nun sitz ich wie Herkules, der alles getan hat, und betrachte die glorreiche Beute umher. Es war ein schrecklicher Zeitpunkt bis zur Erklärung . . Nun kenn ich erst das Leben! Sie ist das beste, liebenswürdigste Mädchen, nun kann ich dir schwören, dass ich nie aufhören werde, das für sie zu fühlen, was das Glück meines Lebens macht . . Keine Vertraulichkeit mehr, nicht ein Wort von Liebe mehr, und so vergnügt, so glücklich, sie ist ein Engel . . Wir haben mit der Liebe angefangen und hören mit der Freundschaft auf. Doch nicht ich! Ich liebe sie noch, so sehr, Gott so sehr! O dass du hier wärest, dass du mich trösten, dass du mich lieben könntest!"
Voller Hintergründe, psychologischer Verstecke, voll Unaufrichtigkeit, mehr noch sich selbst betrügend als den Freund, zeigt dieser Brief ein immer heftiger aufgelockertes Wesen, gespenstisch vor seiner Neigung schwankend, die enden sollte und doch nicht endet, zeigt unwahre Zufriedenheit über einen künstlichen Ausgang, viel Mitleid mit sich selbst, wenig mit ihr, Verwirrung der Sinne und des Herzens. So vergisst er, dass nun auch das Mädchen, älter als er, ohne Stand und Vermögen in weit größerem Wagnis begriffen, an sich denken wird —: und fährt plötzlich mit furchtbarem Schreck empor, als sie in ihrer erneuten Freiheit das tut, was er doch vorgibt ihr zu wünschen: sie gibt einem Andern ihr Versprechen.
Da schlagen Leidenschaft und Eifersucht aufs Neue aus Goethes Herzen hervor. "Meine Leidenschaft wuchs," — schreibt er später in seinen Erinnerungen — "allein es war zu spät, ich hatte sie wirklich verloren, und die Tollheit, mit der ich meinen Fehler an mir selbst rächte, indem ich auf mancherlei unsinnige Weise in meine physische Natur stürmte, um der sittlichen etwas zuleide zu tun, hat sehr viel zu den körperlichen Übeln beigetragen, unter denen ich einige der besten Jahre meines Lebens verlor . . Ich verhetzte meinen glücklichen Organismus dergestalt, dass die darin enthaltenen besonderen Systeme zuletzt in eine Verschwörung und Revolution ausbrechen mussten, um das Ganze zu retten."
Deutet er auf erotische Exzesse? Ausschweifend ist sein Leben im letzten Leipziger Jahr gewiss. Folgte das nicht aus der gesamten inneren Lage dieses Temperamentes, man müsste es doch aus ein paar Worten an den Freund schließen: "Ich gehe nun täglich mehr bergunter. Drei Monate, Behrisch, und darnach ist's aus. Gute Nacht, ich mag davon nichts wissen." Ergreifend kurzer Epilog vor dem Fallen des Vorhanges: denn hier endet der Briefwechsel mit dem Freunde.
Schneller, als jene apokalyptische Anzeige die Selbstzerstörung berechnet hat, bricht er zusammen. Zwei Monate nach diesem Brief, im Juli erwacht er eines Nachts von einem Blutsturz, hat noch Besinnung, den Stubennachbar zu wecken, dann liegt er wochenlang fest, und erst nach einem halben Jahre endet eine Krise, wie sie ihn körperlich nur noch einmal erschüttert hat, ein Menschenalter später. Er nennt die Krankheit hier Lungensucht, später Hals-, dann Darmleiden. Die Forschung hat alle denkbaren Diagnosen gestellt. Wichtig ist nur: in diese für seine innere Entwicklung entscheidende Krankheit hat ihn ein wildes Leben gestürzt, in das ihn wieder innere Unruhe trieb. So schließt sich die Kette von psychischen Ursachen zu psychischen Wirkungen.
Auf dem Krankenbette, wo er mit einem halbblinden Theologen nachdenkliche Gespräche führt, tröstet ihn eine Freundin, wie sie noch oft, Pylades gleich, an seine Seite treten werden, wenn orestische Krisen ihn bedrohen. Diesmal ist's die Tochter seines Lehrers, die reife, unschöne Friederike Oeser, der er schon vorher manches vertraut hat und der er nachher schreibt:
"Ich kam zu dir ein Toter aus dem Grabe,
den bald ein zweiter Tod zum zweiten Mal begräbt,
und wem er nur einmal recht nah ums Haupt geschwebt,
der bebt
bei der Erinnerung gewiss, so lang er lebt . .
Ich weiß, wie ich gezittert habe . . "
Mit vorsichtigem Schritte nähert sich der Halbgeheilte wieder dem Weinhaus, begegnet mit äußerer Ruhe der Geliebten, spürt aber umher, ob sie indessen viel mit ihrem neuen Freunde war. Freilich, er hatte sie ja freigegeben, und der neue Verehrer, älter und ruhiger, wird sie zu behandeln wissen. Aber zu sehr ergreift der Anblick den Leidenden: ohne Abschied flieht er vor einem Mädchen, die längst nicht mehr die Seine ist.
Dies ist Goethes erste Flucht vor einer Frau, die er liebt. Sie wird sich wiederholen und weist auf einen Instinkt, der sich allmählich zur Erfahrung entfaltet: wieviel er seinem Herzen zutrauen darf und was er ihm in den Katastrophen ersparen muss, die diese Jugend erschüttern. Hier ist der Beginn von Goethes Hygiene der Seele, mit der er sich von einer Verwickelung zur andern rettet.
Den letzten Tag bringt er vor dem Tore zu, bei Oesers auf dem Lande, nachdenklich, resigniert. An seinem neunzehnten Geburtstage verlässt er Leipzig, in dem er drei Jahre lang wenig gelernt, manches erfahren hat. Auf der Heimfahrt in der Post fragt ihn ein fremder Offizier: "Sie haben die Miene, nicht unbekannt mit dem schönen Geschlechte zu sein . . Aber Sie sind krank, ich wette zehn gegen eins: kein Mädchen hat Sie beim Ärmel gehalten", und er bietet zehn Taler, wenn er sich irrt. Der blasse junge Mann lächelt: "Topp, Herr Kapitän, Sie behalten ihre zehn Taler: Sie sind ein Kenner und werfen Ihr Geld nicht weg!"
Das ist ein düsteres Haus, das der leidende Sohn nach drei Jahren wieder betritt. Ein verbitterter Vater, der früh gescheiterte Hoffnungen auf Rang und Einfluss nun ganz auf seine Kinder werfen wollte, der dann vier Kinder nacheinander verliert, nur zwei aufwachsen sieht, sein ganzes Streben in den einzigen Sohn bohrt, hat vor drei Jahren einen begabten Jungen in die Welt entlassen, den er mit Sorgfalt selbst herangebildet.
War dieser Vater zur Menschenfeindschaft geboren? Ein stolzes Streben ist sein Grundzug, zurückgesetzter Ehrgeiz ist sein Leiden, Rang seines Sohns ist nun sein Ziel. Goethes Vater — Sohn eines Damenschneiders — der sich vor dreißig Jahren die heiß erstrebte Stellung im Rate seiner Vaterstadt durch wunderlich stolze Bedingungen selbst verschlossen hat und nun ein Menschenalter ohne Beruf von den ererbten Zinsen lebt, hatte selbst von einem weitblickenden Vater schwer erworbene Mittel empfangen, um auf breiter Fläche Weltwissen und Erkenntnis zu sammeln, er durfte schon im Beginn des Jahrhunderts auf großen Reisen nach Süden und Norden seine Bildung pflegen.
Ganz so hat er später selbst in erstaunlicher Fülle den Sohn in Wissen und Fertigkeiten aufgezogen, dass er ein großer Dilettant werden konnte oder ein Universal-Genie. Drei lebende Sprachen, drei tote hatte der Knabe vom Vater und dessen Beauftragten gelernt, Klavier und Cello, Zeichnen und Malen, Geschichte der Welt und der Künste, Reisen und Karten, Reiten, Fechten und Tanzen, Dinge der Stadt und des Staates hat er in der Nähe gesehen, Maler und Diamantschleifer bei der Arbeit, die Bühne vor und hinter den Kulissen, selbst zum Versemachen hat ihn zuerst der Vater angeleitet.
Doch nun verdüstern sich dessen vertikale Züge, wie er da an der Treppe des breiten Flures steht und sieht als Objekt seiner Sorgfalt einen bleichen, siechen, verbummelten Studenten heraufkommen, ohne Streben, ohne Lebenswillen.
Hier freilich herrscht keine Harmonie, die der Heimkehrende stören könnte; sein Anblick wird nur den Missklang eines freudlosen Hauses vermehren. Die dort neben dem grämlichen alten Herrn steht, diese erst 38jährige Mutter hat immer auf seine Rückkehr gehofft, damit des Hauses Dumpfheit sich hebe. Aus einer bitteren Ehe stammt der Sohn. Dieser Vater, der so viel Gutes für den Sohn gewollt, hat seiner heiteren Frau wenig Gutes gegeben, Geiz und Misstrauen umdüstern den beschäftigungslosen, enttäuschten Mann, pathologische Züge weisen mit zunehmendem Alter auf innere Unruhen zurück.
Als damals der reife einsame Mann um die halb so alte Schultheiß-Tochter warb, konnte ihn nur die ersehnte Verbindung mit der Stadtverwaltung, konnte den Schwiegervater Textor, Erben einer alten Gelehrtenfamilie, nur das Geld des Schneidersohnes locken. Je weniger es in der Folge dem Ehrgeizigen gelang, seinen erkauften Ratstitel zu tätigem Wert zu bringen, umso rascher schloss er sich von der jungen Gattin ab, deren eingeboren stete Heiterkeit ihm ohnehin verdrießlich war. Bald stand er auch mit dem' Schwiegervater schlecht, und schließlich ist es dahin gekommen, dass er ihm vorwarf, er habe die Stadt an die Franzosen verraten. Wie solche Debatte zwischen Goethes Vater und Goethes Großvater ablief, schildert ein alter Zeuge, wenn er kühl hinzufügt: "Textor warf ein Messer nach ihm, Goethe zog den Degen."
Es ist das Äußerste, was Goethe selbst im Alter darüber der Welt enthüllen kann, — und was verhüllt er nicht noch alles, wenn er den Vater einen ernsten Mann nennt, der, "weil er innerlich ein sehr zartes Gemüt hegte, äußerlich mit unglaublicher Konsequenz eine eherne Strenge vorbildete . . Dagegen eine Mutter, fast noch Kind, ja erst mit und in ihren beiden Ältesten zum Bewusstsein heranwachsend, lebensfähig und nach gegenwärtigem Genuss verlangend. Ein solcher in der Familie schwebender Widerstreit vermehrte sich mit den Jahren, der Vater verfolgte seine Absichten unerschüttert und ununterbrochen; Mutter und Kinder konnten ihre Gefühle, ihre Anforderungen, ihre Wünsche nicht aufgeben."
Deutlicher gibt er einem Freunde im Alter dies Missverhältnis kund, in dem ein Gran Bewusstsein vieles erspart hätte, und vollends aus Notizen zu "Dichtung und Wahrheit" blitzt es erschreckend auf: "Jeder tätige Widerstand ist ein Verbrechen, Entbehrungen und Strafen lehren das Kind schnell auf sich zurückgehen, und da seine Wünsche sehr nahe liegen, wird es sehr bald klug und verstellt. Damals wenigstens war es so . . "
Goethe, der im höchsten Alter in einem wohlgelaunten Verschen die Erbschaft seiner Eigenschaften von den Eltern stilisiert, hat alles, was in ihm Leidenschaft, Skepsis, Streben ist, vom Vater, die Korrektive dieser drei Elemente aber: Heiterkeit, Weltlust und in gewissem Sinn auch Phantasie von der Mutter. Helle und Dunkelheit seines Temperamentes, deren seltsame Mischung sein Glück und Leiden bestimmte, mag man auf diese Erbschaft von so verschiedenen Eltern zurückführen; der Genius ist niemals aus menschlichen Säften aufgestiegen, "der Geist ist immer Autochthone": so schließt er im Alter.
Zählt man aber das Maß von Bildungskeimen hinzu, die nur der Vater in ihn senkte, so bleibt schon für diese Epoche das väterliche Verdienst entscheidend und wird in den nächsten sieben Jahren durch dessen richtiges Gefühl für die Bahn des Sohnes, durch seine tätige Hilfe noch erweitert. Liebenswert und natürlich, wirkt die Mutter daneben auf den Jüngling wie eine ältere Schwester, der er sich unmittelbarer verbunden fühlt. Doch hat er von ihr weder gelernt noch erfahren. Tiefe Wirkungen — für die Kinderzeit durch die Märchen der Bettina von Arnim später zur Legende geformt — werden in den entscheidenden Jahren, die er von nun an meist zu Hause verbringt, weder in Goethes Berichten noch in denen seiner Freunde der Mutter zugeschrieben, und tritt sie gegen den Vater auf des Sohnes Seite, so ist's für die kleinen Zwecke des Tages, ohne ihm Vertraute, Halt oder Trost in Krisen zu werden. Noch in seinen Erinnerungen, aus denen Dankbarkeit gegen den ungeliebten Vater immer wieder sprüht, urteilt er nur einmal über die Mutter, als "eine gute, innerlich niemals unbeschäftigte Frau", die ihr nächstes Interesse in der Religion fand.
Jetzt, da er heimkehrt, steht sie da und hofft auf den Sohn wie auf einen Erlöser aus Streit und Langerweile. Heftiger noch, weil ein schwereres Herz sie bedrängt, hofft auf ihn die Schwester, die diese drei Jahre lang viel ausgestanden hat. Sein Erziehungsfieber hat der Vater, seinen Hochmut der entfernte Bruder an ihr ausgelassen, die Mutter aber mit ihrem Willen zum Genuss ist ihrem Wesen ganz fremd. Vielleicht ist sie schon jetzt ein gemütsleidendes Wesen.
Diese Geschwister ähneln einander stark in den Elementen ihrer Charaktere, sie bleiben einander fremd in der Mischung dieser Elemente — doch grade diese Mischung entscheidet ihr Los. Nennt Goethe die Schwester später ein indefinibles Gemisch von Strenge und Weichheit, so könnte er dies von sich selber sagen, ohne doch das Entscheidende vorzukehren. Dieselben Depressionen, wie sie Goethe zu allen Zeiten, besonders oft als Jüngling befallen, werden in ihm immer wieder durch männlich getroste Elemente der Seele bis ins neunte Jahrzehnt des Lebens bemeistert. In Cornelia bleiben sie ohne Korrektiv, so dass Goethe sie ein Wesen ohne Glaube, Liebe und Hoffnung nennen darf. Wie die nämlichen Kräfte ihre unharmonische Natur schnell zerstören, die er in riesenhafter Lebensarbeit zum Ganzen schließt, das ist in Beider Zügen vorgebildet. Denn bei körperlicher Ähnlichkeit solchen Grades, dass man sie zuweilen als Zwillinge anspricht, wirkt eben das, was den Bruder anziehend, zuweilen schön macht, bei ihr abstoßend männlich; dazu ist ihre Haltung schlecht, ihr Teint ist unrein. Ein Strom von Sinnlichkeit hat Goethes gefährdetes Wesen durch Hingabe an Menschen und Werke erhalten; krankhafte Unsinnlichkeit hat seiner Schwester Liebe, Ehe und das Leben zerstört.
Nie waren sich diese Geschwister ähnlicher als in diesem Augenblicke, da der leidende 19jährige eine enttäuschte 18jährige begrüßt, die keinen Verehrer hat wie die Freundinnen und die auf eine fürchterliche Weise ihre Härte gegen den Vater" wendet. In solche Gewitterluft, die das freundliche Naturell der Mutter zu durchstrahlen selten stark genug ist, kehrt der Schiffbrüchige zurück. Es gibt eine leidenschaftliche Szene bei der Begrüßung. "Ich mochte übler aussehen, als ich selbst wusste. "
Dann richtet man sich leidlich ein, die drei Jüngeren im Hause atmen heimlich auf, lassen den Alten murren. Von Leipzig muss der Studiosus den Frauen erzählen, sein Geist ist in Leipzig, das seiner problematischen Natur jetzt das Ziel aller Wünsche scheint, nachdem er darauf gebrannt hat es zu verlassen. Dabei schmilzt rasch der briefliche Verkehr, nur die Oesers bleiben nach drei Studienjahren dem eleganten Studenten als Freunde zurück. In Frankfurt will ihm nichts gefallen, auch nicht Corneliens Kreis. Er sammelt seine Leipziger Gedichte, gibt sie anonym heraus, obwohl er sie verachtet, entwirft ein einaktiges Stückchen, das er "Lustspiel in Leipzig" nennen will und später "Die Mitschuldigen" nennt.
Das ist ein sonderbar dunkles Lustspiel, dicht am Tragischen vorüberstreichend. Da ist ein zynisch-dämonisch bewegter Mensch auf die Lustspielseite geworfen, und was dieser Söller an Menschenfeindschaft umfasst, lässt umso entschiedener auf seinen Autor schließen, als er die interessanteste Gestalt im Stücke bleibt. Denn weder hier noch in den späteren Stücken darf man Goethes Wesen nur aus dem Helden lesen, das gleiche Licht strahlt seine Doppelseele auf den Gegenspieler des Helden, weshalb in Goethes gesamtem Werke der Bösewicht fehlt. Vom Zynismus dieser Jahre legt er so viel in Söller, wie er Alceste, dem Gegenspieler, von seinem ungeduldigen Begehren gibt. Wenn jener diesen umso leichter bestiehlt, weil dieser ihm sein Weib verführt, und er am Schluss gesteht:
"Das ist sehr einerlei: Gelüst nach Fleisch, nach Gold.
Seid erst nicht hängenswert, wenn ihr uns hängen wollt . .
In Summa nehmen Sie's nur nicht so gar genau:
ich stahl dem Herrn sein Geld, und er mir meine Frau — "
da spukt Mephisto schon in seinem Herzen vor. Sicherheit der Effekte, exakte Regie, Anspielungen auf den neusten Tag deuten übrigens an, wie sehr dem Autor an schnellem Erfolg liegt.
Die Krankheit ist nicht vorüber, sie schleicht, nun ist der Hals wund, mit verbundenem Kopfe, im Schlafrock sitzt er in einem Sessel seiner Dachstube, oben im Elternhaus. Erliest. Was ist das für ein alter Foliant? Paracelsus? Wie kam der Spötter an das Werk des Alchimisten?
Leidend an Herz und Gliedern ist der junge Mann geeignet, den Herrnhutischen Geist anzuziehen, und wie nun die Klettenberg, ein altes adliges Fräulein, Vertraute der Mutter in manchen Nöten ihrer Ehe, den Zweifler in ihre Kreise zieht, ihn zu bekehren, folgt er willig als wohlerzogener Sohn, hört eine Weile ruhig zu, verbirgt sein Lächeln: denn er glaubt damals mit seinem Gott "ganz gut zu stehen, ja ich bildete mir nach mancherlei Erfahrungen wohl ein, dass er gegen mich sogar im Rest stehen könne, und ich war kühn genug zu glauben, dass ich ihm einiges zu verzeihen hätte".
Da ist es denn vergebens, dass die zarte und heitere Dame, eine Seele mehr rein als tief, ihr Netz wirft nach diesem Schüler Voltaires. Doch von der Reinlichkeit ihres Daseins wird Goethe angezogen — wie er es später nennt: von dieser liebevollen Harmonie — und so hört er auch zu, als ihr Arzt und Freund in solchen übersinnlichen Gesprächen ihn auf gewisse okkulte Bücher lenkt, auf alchemische Mittel und durchblicken lässt, wie er sich ihrer ärztlichen Wirkung bediene. Hat man mit Neunzehn schon so viel gelesen: warum nicht auch einmal ein mystisches Buch? Und ohne die Bedeutung dieses Schrittes zu ahnen, tastet der nachdenkliche Patient, mehr um des Wissens als der Seele willen, zum ersten Male nach einem Zugang zu jener Welt, nachdem er sich den andern, die Bibel seiner Kindheit, mit aufgeklärter Geste selbst verschlossen.
Da sitzt er nun, liest alte Mystiker, sogar Swedenborgs Name tritt ihm zum ersten Male aus dem Dunkel der Legende. Nicht, dass er nach Glauben trachtete. Vielmehr, anstatt die Dunkelheiten dieser Bücher schweigend zu verehren, sucht er störrisch die Noten genau anzumerken, in denen der Verfasser von einer Stelle auf die andere deutet und so, was er verbirgt, zu enthüllen verspricht, und mit Seitenzahlen am Rande folgt er trotzig der mystischen Spur.
So nahe hat ihn der bildende Genius an die Quellen gelockt. Da der Schüler noch immer verstockt bleibt, wird er mit härteren Griffen gefasst. Aufs Neue wird er im Dezember in schwere Krankheit geworfen, so drohend, dass er unter großen Beängstigungen das Leben zu verlieren glaubt und kein Mittel mehr hilft. Da, wie es um Alles geht, in höchster Angst fordern die Eltern von jenem mystischen Arzte sein Universal- und Zaubermittel. Des Doktors Widerstand erhöht die Spannung, schließlich läuft er nachts nach Hause, bringt ein Gläschen kristallisierten Salzes, das gibt er dem Kranken ein: sogleich zeigt sich Erleichterung, die Krankheit nimmt eine Wendung, Besserung folgt. "Ich darf nicht sagen, wie sehr dieses den Glauben an unsern Arzt erhöhte."
Die große Krisis, die fünf Monate zuvor in Leipzig begonnen, steht auf dem Höhepunkt. Nennen wir dergleichen heut Wachsuggestion, es ist immer nur ein Wort. Entscheidend bleibt, dass genau auf diesem physischen Wendepunkt die erste Wendung in Goethes Seelenleben liegt.
Denn als er nach schweren Wochen aus den Fiebern ersteht, ist in ihm etwas aufgewacht, was seinem fahrigen Wesen zum ersten Mal kristallenen Halt verleiht. Nennt man es Glauben, so ist es nicht der Glaube, in dem er erzogen war: es ist nur Gläubigkeit. Dass diese sich zuerst an jenem Heilmittel aufrichtet, durch das der Körper sich gerettet glaubt, wird nun dem suchenden Geiste zum Schicksal. Dass er einen Halt findet, ist das Entscheidende.
Solche psychische Wendung, nicht als Mirakel, nur als Folge mannigfacher Vorgänge begriffen, kann nicht über Nacht Wunder tun. So wie am Körper ist auch hier am Geiste eine allgemeine Erleichterung, ist stufenweise Klärung zu bemerken. Das Ereignis als Ganzes: Körperkrisis und Seelen-Lösung, macht die Bedeutung. Durch diese Krankheit — so schreibt er im Alter — ist er ein anderer Mensch geworden. Denn ich hatte eine große Heiterkeit des Geistes gewonnen . . Ich war froh, meine innere Freiheit zu fühlen, wenn mich gleich äußerlich ein langwieriges Leiden bedrohte. " Gleich nach der Krise schreibt er der Freundin: "Ich habe viel in der Krankheit gelernt, das ich nirgends in meinem Leben hätte lernen können . . Ein närrisch Ding um uns Menschen. Wie ich in munt'rer Gesellschaft war, war ich verdrießlich; jetzt bin ich von aller Welt verlassen und bin lustig . . Übrigens zeichne ich sehr viel, schreibe Märchen und bin mit mir selbst zufrieden."
Wann schrieb Goethe je solche Worte? Fängt er nun an, bescheiden an sich zu glauben, sich stiller hinzugeben?