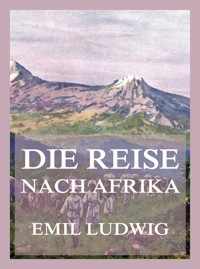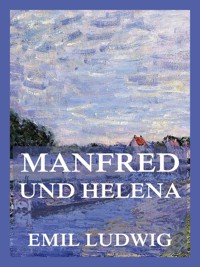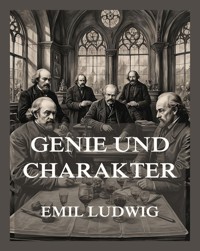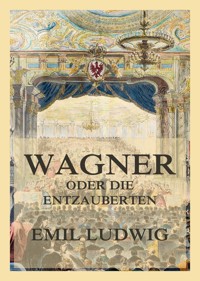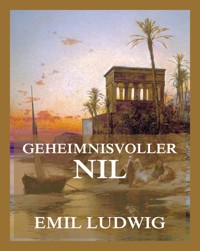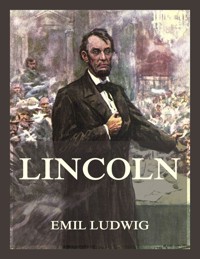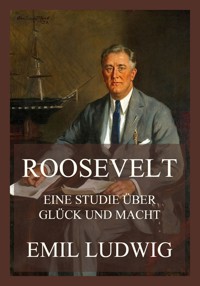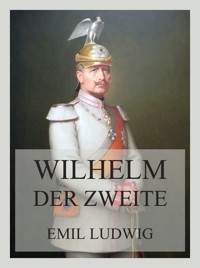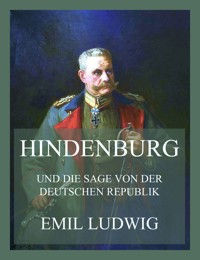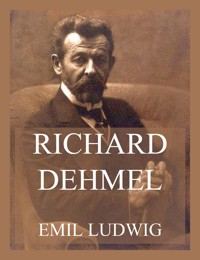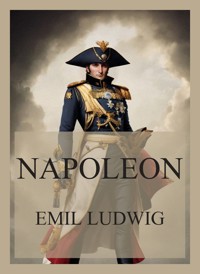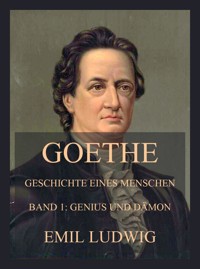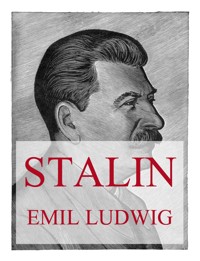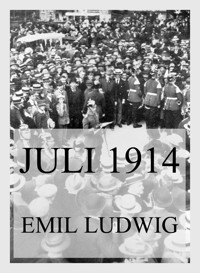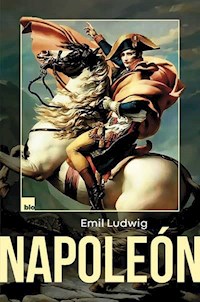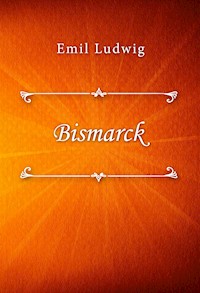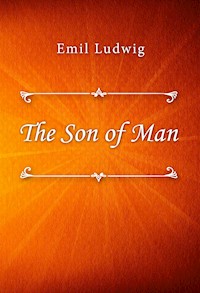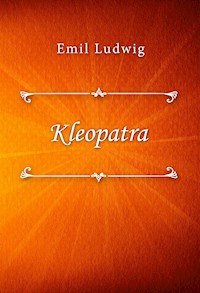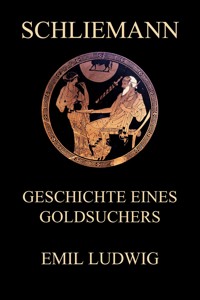
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Keiner der Hauptakteure auf dem Welttheater, deren Bilder von Emil Ludwig so glänzend gezeichnet worden sind, kann sich an jähem Wechsel des Lebens oder an weltweiter Erfahrung mit dem Helden des vorliegenden Buches messen. So weitreichend die politischen und ökonomischen Wirkungen ihrer Handlungen auch gewesen sein mögen, so kann weder Napoleon noch Bismarck noch Wilhelm II. beanspruchen, wie Heinrich Schliemann neue Grundlagen für die schönsten Überlieferungen des Menschengeschlechtes geliefert zu haben. Sein tiefer Glaube hat die historischen Tatsachen, die der "Geschichte vom göttlichen Troja", den Schätzen und Tragödien von Agamemnons Herrschersitz zugrunde liegen und für viele nur dichterische Fiktionen waren, wahr und wirklich gemacht. Es ist eine seltsame Geschichte, und Ludwig tat gut daran, den glänzenden Faden, der sie durchzieht, nämlich den eingeborenen Drang zum Gold, aufzuzeigen, der sich zuerst praktisch, dann historisch manifestierte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Schliemann
Geschichte eines Goldsuchers
EMIL LUDWIG
Schliemann, Emil Ludwig
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849680174
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
EINLEITUNG.. 1
VORWORT.. 8
ERSTES KAPITEL. DUNKLE JUGEND... 13
ZWEITES KAPITEL. GOLD ÜBER DER ERDE.. 35
DRITTES KAPITEL. GOLD UNTER DER ERDE.. 87
VIERTES KAPITEL. DER NEID AUF DAS GOLD... 131
FÜNFTES KAPITEL. DAS GOLD VERBLASST.. 176
EINLEITUNG
Keiner der Hauptakteure auf dem Welttheater, deren Bilder von Emil Ludwig in letzter Zeit so glänzend gezeichnet worden sind, kann sich an jähem Wechsel des Lebens oder an weltweiter Erfahrung mit dem Helden des vorliegenden Buches messen. So weitreichend die politischen und ökonomischen Wirkungen ihrer Handlungen auch gewesen sein mögen, so kann weder Napoleon noch Bismarck noch Wilhelm II. beanspruchen, wie Heinrich Schliemann neue Grundlagen für die schönsten Überlieferungen des Menschengeschlechtes geliefert zu haben. Sein tiefer Glaube hat die historischen Tatsachen, die der "Geschichte vom göttlichen Troja", den Schätzen und Tragödien von Agamemnons Herrschersitz zugrunde liegen und für viele nur dichterische Fiktionen waren, wahr und wirklich gemacht. Es ist eine seltsame Geschichte, und Ludwig, der, um sie zu berichten, die ungeheure Masse der Schliemannschen Papiere mehr als 20000 durchforschen musste, tat gut daran, den glänzenden Faden, der sie durchzieht, nämlich den eingeborenen Drang zum Golde, aufzuzeigen, der sich zuerst praktisch, dann historisch manifestierte.
Es ist ganz unmöglich, Schliemanns epochemachenden Entdeckungen zu beiden Seiten des Ägäischen Meeres hier gerecht zu werden, die mit Ithaka begannen und Troja, Mykenä, Tiryns und Orchomenos einschlossen. Seine Grabungen waren das Ergebnis seines Buchstabenglaubens an die Berichte Homers und anderer alter Autoren. Es war ein Glaube "wie an die Bibel", und es ist etwas Erschütterndes um diese einfache Hingabe. So sehen wir ihn zu Beginn seiner Laufbahn als Ausgräber den Berg Aetos auf Ithaka hinaufklettern, um die Nordostecke des Gipfels aufzugraben, wo, "nach meiner Vermutung, sich der herrliche Ölbaum befunden haben musste, aus welchem Odysseus sein Hochzeitsbett verfertigte und um dessen Standort er sein Schlafzimmer baute. Dies ist vielleicht die Stelle, wo Odysseus Tränen vergoss, als er seinen Lieblingshund Argos wiedersah, der vor Freude starb". Schliemann fand dort fünf kleine Urnen, "und es ist wohl möglich, dass ich in meinen fünf kleinen Urnen die Asche des Odysseus und der Penelope oder ihrer Nachkommen bewahre".
Ludwigs Bericht von Schliemanns langen Kampagnen in Troja gibt einen guten, kritischen Überblick über deren Ergebnisse. Schliemann hat nicht als erster die Bedeutung der Hochebene von Hissarlik erkannt, aber die Sicherheit, die ihm aus seinem intensiven Glauben an Homer erwuchs, veranlasste ihn, einen großen Teil seines Vermögens und die Energie seiner späteren Jahre dem Versuch dieser Ausgrabung zu widmen. Als große prähistorische Ansiedlung war Troja schon Knotenpunkt gewesen, hatte den Zugang zu den Dardanellen beherrscht und den frühen Verkehr zwischen dem Ägäischen und Schwarzen Meer kontrolliert; es hatte ferner den Abschluss der Straßen in das Innere Anatoliens gebildet. So war es in der Tat der eigentliche Vorläufer von Byzanz und Konstantinopel. Allein von diesem Gesichtspunkt aus war die schichtweise Aufdeckung seiner früheren Existenz ein sehr wichtiger Beitrag zur Ursprungsgeschichte der europäischen Zivilisation, ganz abgesehen von der Frage, welche Ansiedlung das Ilion des Priamos wirklich darstellte. Wir wissen heute, dass der in der Zweiten Stadt gefundene "Schatz" nicht die persönlichen Beziehungen hatte, die sein Entdecker ihm beimaß, und dass erst die VI. Schicht mit ihren spät-minoischen und mykenischen Resten chronologisch der Ilias entspricht; aber dieses Wissen beruht auf der langen Reihe früherer Niederlassungen, die uns der Spaten des Forschers aufdeckte.
Was Mykenä betrifft, so ist zum Verständnis des von Schliemann so drastisch behandelten Problems notwendig, die Aufmerksamkeit auf einige neue, durch die Grabungen auf Knossos festgestellte Tatsachen zu lenken, die jene archäologische Schule noch nicht berücksichtigt, die die Frage nur vom kontinentalen Gesichtspunkt zu erfassen sucht.
Die Entdeckungen auf dem Boden Kretas, insbesondere in Knossos, haben als Grundtatsache erwiesen, dass Mykenä in jedem höheren Betracht von dem "Mittelmeerland" abhängt, das selbst etwas abseits vom homerischen Gesichtskreis lag. Aus der ersten Zeit der Ausbreitung der minoischen Macht auf dem festländischen Griechenland es war eine richtige Eroberung sind noch einige Spuren anderer Rassen-Elemente erkennbar, die entweder mit den minoischen zusammenwirkten oder von ihnen noch nicht assimiliert worden waren. Es kommen transägäische und kykladische Reste vor und Gefäße, die von den verschwundenen Eingeborenen, "Helladiern" oder "Minyern", stammen. Aber von diesen Ausnahmen abgesehen, sind die Waffen und Werkzeuge, die kunstvollen Goldarbeiten und der Schmuck, die gemalten Vasen, die Fresken an den Wänden, die Architektur mit ihrer typischen Verzierung, die Darstellungen von Sport und Zeitvertreib, die Schreine und Altäre, die herrschende Gottheit selbst mit ihren heiligen Symbolen entweder importiert oder von der minoischen Kultur befruchtet. Von dem großen mykenischen Zeitalter sind auf Morea tatsächlich weit weniger Spuren einer Eingeborenenkultur geblieben als keltische, selbst nach der Eroberung durch Claudius, in Britannien.
Als umstürzendes Ergebnis fordern Vergleiche mit Kreta, wie ich es anderwärts schon im Einzelnen darstellte,- den endgültigen Verzicht auf eine allen Büchern noch gemeinsame Auffassung, als ob die Schachtgräber innerhalb der angebauten Rundung der alten Akropolismauern, die eigens dafür erweitert wurden, früheren Datums seien, als die großen Kuppelgräber außerhalb. Der Inhalt der prächtigsten dieser Gewölbebauten, die die Namen des Atreus und der Klytämnestra tragen, deckt sich mit den frühesten Dingen, die sich in den Schachtgräbern fanden. Diese gehören zur dritten Mittelminoischen Periode, die mindestens bis ans Ende des 17. Jahrhunderts v. Chr. zurückreicht und deren wesentlichste Belege in dem sogenannten "Mittleren Palast von Knossos" vorkamen. Die herrlichen architektonischen Muster, die die Fassaden jener beiden Kuppelgräber zierten, geben andererseits in kaum geringerem Stil die charakteristischen Motive wieder, die "Triglyphen" und "Metopen" mit ihren Halbrosetten und Spiralen, die, von den Portalen des "Mittleren Palastes" abgefallen, gefunden wurden. Mehr als dies, es kamen in den Gewölben oder in den Vorhallen der Vorratskammern die gleichen für die Dritte Mittelminoische Zeit charakteristischen, eingelegten Steingefäße von Knossos vor, die ihrerseits Weichstein-Imitationen der "Medaillon"-Vorratskrüge des königlichen Magazins von Knossos darstellen. Um die Übereinstimmungen zu vervollkommnen, ist das Relief einer Gipsplatte, selbst kretisch, das Lord Elgin von der Vorhalle des Atreusgrabes heimbrachte und das den Kopf eines rennenden Stieres und den Teil eines Olivenbaumes darstellt, eine deutliche Widerspiegelung des angreifenden Stieres — in bemaltem gesso duro — des Meisterwerkes minoischer Kunst, das einen Teil des Schmucks am nördlichen Eingang des Palastes von Minos ausmachte. Es ist im gleichen zeitgenössischen "Mittelminoischen" Stil gehalten.
Die Evidenz einer unmittelbaren Abhängigkeit von dem "Mittleren Palast" der Knossischen Priesterkönige ist überwältigend, und die tatsächliche Gleichzeitigkeit desselben mit den Kuppelgräbern von Mykenä muss als unumstößliche Tatsache anerkannt werden. Die noch weitverbreitete Meinung, dass diese Gewölbe von späterer Konstruktion seien als die Schachtgräber und dass sie einer gewissen Sorte spätmykenischer Töpfereien — bestimmt nicht früher als im 13. Jahrhundert — gleichzusetzen sind, kann nur im wahrsten Sinne des Wortes als verkehrt und pervers bezeichnet werden. Aber was dann? Es herrscht eine allgemeine Übereinstimmung darüber, dass es absurd wäre, die gleichzeitige Existenz voneinander unabhängiger Dynastien in Mykenä anzunehmen, die ihre Toten fast nebeneinander begruben. Es bleibt nur eine sinnvolle Erklärung, die vor einigen Jahren von Professor Percy Gardner auf Grund des Durcheinanders der Begräbnisse selbst aufgestellt und jetzt durch die neuen Erkenntnisse bei den Funden von Knossos gestützt wurde: die Beisetzungen der Könige fanden zuerst in den großen Kuppelgräbern statt, dann wurden sie in Zeiten drohender Gefahr in Gräber überführt, die für sie auf dem alten Gräberplatz neben der Akropolismauer gegraben wurden und nun von dieser eingeschlossen sind.
Schliemann, für den in dieser Frage Pausanias als einwandfreie Quelle galt, nahm dessen Bericht gläubig auf, dass Atreus, Agamemnon und die anderen — mit Ausnahme des schuldbeladenen Ägisthos — und der Klytämnestra innerhalb der Mauern begraben sind, obwohl tatsächlich die Behauptungen des Pausanias ungenau und wohl auf verschiedene Überlieferungen basiert sind. Die meisten Kenner haben angenommen, dass die Kuppelgräber und sogenannten "Schatzkammern" die Begräbnisplätze darstellten. Die oben gegebene Erklärung versöhnt beide Überlieferungen. Aber da ist ein Punkt, dem nicht genügend Beachtung geschenkt wurde. Die Meinung, dass zu Pausanias' Tagen die Grabsteine noch an ihren Plätzen über den Gräbern in dem Plattenring standen, kann weder einem erfahrenen Ausgräber noch einem Laien auch nur einen Augenblick lang einleuchten. Die Plünderung alter Gräber, wo dieselben auch sein mochten, ist leider überall üblich gewesen; und das Beispiel Ägyptens zeigt, welches Maß an Arbeit und Findigkeit solche Grabräuber bei ihrer Tätigkeit entfalteten. Dass die Stelen während der Herrschaft der regierenden Dynastie in Mykenä unberührt blieben, ist begreiflich genug, obwohl sogar hier eines der Begräbnisse in Grab III heimlich ausgeraubt wurde. Man kann aber unmöglich annehmen, dass unter Herrschern einer anderen Dynastie die Goldschätze Agamemnons und seiner Genossen, die doch stets in der Überlieferung gefeiert wurden, unberührt geblieben wären, wenn ihre Lage auch nur annähernd bekannt gewesen wäre.
Wir müssen annehmen, dass in einer dunklen Periode zeitweiliger Verwahrlosung Naturereignisse, wie zum Beispiel von den Steilhängen der Akropolis herabstürzende Trümmer und vielleicht noch ernstere Naturkatastrophen, die sogenannten Gedenksteine der darunterliegenden Gräber verschüttet haben. Einige Überreste des Gräberkultes der toten Heroen scheinen vermutlich durch die neuen Besitzer dieses Platzes — wohl von achäischer Abstammung — tatsächlich erhalten geblieben zu sein. Denn die umfangreichen Funde von kleinen Ton-Idolen und Kühen, sowie die Masse von Tierknochen, die Schliemann auf dem darüberliegenden Hang ausgegraben hat, deuten zweifellos auf einen Kult, der in der allerletzten mykenischen Zeit hier stattfand. Die Tore der großen Bauwerke aber waren deutlich auf dem gegenüberliegenden Hügel zu sehen und mögen dazu beigetragen haben, Plünderer von der Suche nach den reichen Gräbern abzulenken, die tief unter der Erde innerhalb der Mauern ruhten.
Hier bewies Schliemann wieder seine ungewöhnlich glückliche Hand. Archäologen wissen aus Erfahrung, dass die beste Aussicht, an vielen Stellen sogar die einzige, ein ungeplündertes Grab zu finden, darin beruht, dass man eine natürliche Erhöhung aufgräbt, die sich durch Erdmassen und durch heruntergewaschene oder heruntergefallene Reste am Fuß eines Hügels gebildet hat. Die Stelle, auf der die Schachtgräber angelegt waren, entsprach all diesen Bedingungen. Sie befand sich direkt unter der aufsteigenden Rampe der Akropolis und deren innerer Mauer und war von dem Hügel darüber beherrscht. Und so hat Schliemann, geleitet von der glücklichen Version der alten Überlieferung, mit so dramatischen Ergebnissen dort gegraben.
Von all seinen Entdeckungen war die der Königsgräber von Mykenä bei weitem die wichtigste; der "Schatz des Priamos" verblasst daneben. Hier waren in der Tat die ersten Beweise einer hohen, tausend Jahre älteren Kultur als die der Griechen auf hellenischem Boden. Die volle Bedeutung der Entdeckung aber wurde damals nicht verstanden, es wurden sonderbare Theorien aufgestellt, wie dass die Schätze die Beute plündernder Gallier oder Goten darstellten, dass die Gegenstände phönizischer oder "kolonial-griechischer" Herkunft wären, ja, die goldene Totenmaske des Agamemnon wurde für einen byzantinischen Christuskopf gehalten! Nur nach und nach hat man dank der Funde auf kretischem Boden erkannt, dass wenigstens neun Zehntel der kostbaren, zutage geförderten Gegenstände von jener künstlerisch begabten Rasse stammte, deren frühere Werke einige tausend Jahre weiter zurück in die überseeischen minoischen Zentren verfolgt werden können. Als Ergebnis jahrelanger Reinigungs- und Rekonstruktionsarbeiten hat man nach und nach den Charakter einiger der herrlichsten Reste ganz herausgefunden, wie bei den eingelegten Dolchen mit ihren unvergleichlichen, "in Metall gemalten" Mustern. Die Ergebnisse sind allgemein bekannt geworden, und erst jetzt — nach 55 Jahren— ist eine vollwertige Veröffentlichung der Schätze erfolgt in dem großen Werk von Professor Karo "Die Schachtgräber von Mykenai."
Es war leicht, den Entdecker zu kritisieren. In einer seiner früheren Aufzeichnungen, als er noch im geschäftlichen Leben stand, bemerkte Schliemann ein wenig pathetisch: ",Ein Gelehrter kann ich niemals werden", und er ist auch im wahrsten Sinne des Wortes nie ein "Archäologe" gewesen. Dazu fehlte es ihm vor allem an künstlerischem Urteil, und je barbarischer einige seiner Funde gearbeitet waren, umso besser schienen sie ihm zu gefallen. Hera-Idole und Tonkühe aus der dekadentesten Zeit begeisterten ihn. Es fehlte ihm der Sinn für kleine Gegenstände wie Gemmen, und er veröffentlichte zum Beispiel die Zeichnung eines Karneolsiegels von Mykenä, dessen Sinn und Einzelheiten, zwei minoische kämpfende Krieger, an sich völlig klar sind; er aber verwandelte es in etwas wie einen turbangeschmückten Türken, der eine Dame grüßt, und ihr Kopfschmuck erinnerte ihn wieder an die Mode aus Königin Philippas Zeiten. Er klammerte sich so abergläubisch an das geschriebene Wort, dass er in Mykenä nach dem 5. Grabe seine Grabungen einstellte, weil Pausanias diese Zahl genannthatte. Aber er glaubte, er grub, er fand; und es ist kein geringes Verdienst, dass er eigenhändig mit Hilfe seiner hochbegabten Frau so viele zerbrechliche Gegenstände unversehrt ans Tageslicht brachte. Seine große kaufmännische Begabung zeigte sich auch in der Leitung der Hilfskräfte und in der Wahl von Ratgebern wie Burnouf und Virchow. So hat man nicht ganz mit Unrecht gesagt, Dörpfeld sei Schliemanns "größte Entdeckung" gewesen. Seine altbewährte, starke Fähigkeit der Selbstverleugnung bewies er auch in seinen späteren Kampagnen in Troja, wo er sich trotz starker innerer Widerstände zuletzt der "wissenschaftlichen Methode" unterwarf.
Niemand kann bedauern, dass Schliemanns Ehrgeiz, auch Olympia auszugraben, nicht befriedigt wurde. Bei prähistorischen Aufgaben wie Troja, Mykenä oder Tiryns, wo die alten Anlagen erst wieder entdeckt werden mussten, waren empirische Methoden bis zu einem gewissen Grad unvermeidlich; bei klassischen Gebäuden aber, wo die Entdeckung einer einzigen Ecke oft den Schlüssel zu einem ganzen Plan liefert, war großes, wohlfundiertes Wissen nötig. Auch kann ich nicht bedauern, dass er in Knossos, das er in derselben Absicht aufsuchte, dann doch nicht gegraben hat. Die Aufgabe in dem großen Palast war kompliziert, sie eignete sich wenig für seine summarische Methode, und tatsächlich wäre ein großer Teil des Bauwerkes mit seinen Resten von mehreren oberen Stockwerken, wobei Stützungs- und Rekonstruktionsarbeiten immer wieder notwendig wurden, pari passu mit der Arbeit des Spatens zu einem unentwirrbaren Trümmerhaufen geworden. Dass Schliemann durch türkischen Widerstand, mit dem ich selbst sechs Jahre lang zu kämpfen hatte, gehindert wurde, ist verständlich genug; aber eine seltsame Unsicherheit herrscht über die Stelle, an der er mit seinen Grabungen beginnen wollte. In einem an Professor Sayce gerichteten Brief, der jetzt vor mir liegt, spricht er von den Schwierigkeiten, die ihm das Vorhandensein erst zu enteignender Bauernhöfe und wertvoller Olivenhaine bereiten, sowie von dem Sumpfboden, der die Grabungen erschweren würde. Nun ist zwar die Stelle des "breiten Knossos" ausgedehnt genug, aber der Hügel von Kephala, wo die Hausreste des Minos liegen, der damals mehreren moslemischen Besitzern gehörte, war weder von Bauernhöfen noch von Olivenbäumen bedeckt und war außerdem infolge seiner hohen Lage entschieden trocken.
Ich bin alt genug, mich der ersten authentischen Schliemannschen Berichte über seine Entdeckungen in Mykenä in der "Times" zu erinnern, und ich entsinne mich auch, welch großes Interesse sie erweckten. Später hatte ich das Glück, seine persönliche Bekanntschaft am Ort seines Ruhms zu machen, und ich höre noch den Widerhall, den seine Besuche in England, seine größten Triumphe, hervorriefen. "Ich wurde aufgenommen," schrieb er selbst, "als ob ich einen neuen Weltteil für England erobert hätte." Gladstone wurde sein Prophet. Über dreißig Gesellschaften bewarben sich um seine Anwesenheit, er und Frau Schliemann wurden durch besondere Ehrendiplome ausgezeichnet. Gemessen an der kühlen, ja sogar feindlichen Aufnahme, die er in seinem Vaterlande fand und die schließlich erst durch Virchows mächtigen Einfluss besiegt wurde, war seine Popularität bei den Gebildeten Englands außerordentlich. Schliemanns sichtlicher Mangel an archäologischer Vorbildung war den systematischen Deutschen ein Ärgernis. Hingegen fand sein Vertrauen in die Glaubwürdigkeit homerischer Gesänge in England ein Echo, soweit die Resultate die aufgewandten Mittel rechtfertigten. Es kann kaum geleugnetwerden, dass die schlichte Geschichte der trojanischen Helden dem englischen Gefühl zu allen Zeiten besonders naheging.
In seinem ersten Buch über die Grabungen von Mykenä —in englischer Sprache verfasst, was einen Tribut an unser nationales Interesse bedeutete —bediente sich Schliemann einer großen sprachlichen Naivität, die ihn seinen Lesern sehr nahebrachte. Bezwingend in ihrer Einfachheit waren auch die Schilderungen aus seinem Leben, so die bekannte Szene von Hissarlik, wo er beim ersten Anblick des Schatzes des Priamos alle Arbeiter wegschickte, nach seiner geliebten Sophia rief und nun Stück für Stück des kostbaren Fundes selbst aushob, um sie in ihr großes rotes Umschlagtuch zu legen.
Er war "Doktor", und eine gewisse mysteriöse Gelehrsamkeit umgab seinen Titel, dessen Wirkung vielleicht bedeutsamer gewesen wäre, wenn man gewusst hätte, dass er ihn an seiner heimatlichen Universität Rostock nicht zuletzt für seinen in klassischem Griechisch abgefassten Lebenslauf erhalten hatte. Etwas vom Roman seiner früheren Jahre schien noch an seiner Persönlichkeit zu haften, und ich habe selbst noch eine beinah unheimliche Erinnerung an den mageren, leichtgebauten, blassen Mann in dunklen Kleidern, mit seiner fremdartigen Brille, mit der er, so schien es mir, tief in die Erde hineingeblickt hatte.
Athen, 26. März 1931
ARTHUR EVANS
VORWORT
Als Kind, noch ehe ich lesen lernte, reichte ich ihm anmeines Vaters Tische die Hand; zehn Jahre später stand ich vor den langen Glaskästen des Berliner Museums und sah das Gold aus Troja. So lernte ich die ersten Gedanken über Größe und Ruhm, über Sage, Dichtung und Forschung an jenen Namen knüpfen. Alles um ihn her war romantisch: die Könige, deren Schätze er ausgrub, andere, die ihn mit Schätzen begnadeten, und doch blieb meine Erinnerung an den guten, blauen Augen haften.
Als ich 1915 an den Dardanellen war, ritt ich auf die Ebene von Troja, nach jenem Hissarlik, von dem Schliemanns Bücher stärkere Kunde zu uns getragen hatten als von Troja; es war ein Tag vor der Seeschlacht des 18. März. Dort grub ich mit meinem Stock und mit Hilfe eines türkischen Seitengewehrs, das mir ein Leutnant lieh, aus der Mauer einen Stein, um einen Zeugen jenes Ortes in meinem Hause zu haben. Erst viel später erkannten wir, indem wir zu Hause den ungefügen Stein umdrehten, dass es der Rest eines Löwen- oder Pferdekopfes war, ich weiß nicht, aus welcher Epoche. Damals, im Kriege, trat mir in Athen aus ihrem herrlichen Palast eine schöne, hohe Frau von etwa 60 Jahren entgegen, halb Königin, halb Niobe, ganz in Schwarz mit einer Perlenkette. Es war Sophia Schliemann, die Heldin dieser erstaunlichen Geschichte.
Wieder ein Jahrzehnt später, als meine biographischen Arbeiten sich im Auslande verbreiteten, trat die Familie, Frau Schliemann, Tochter und Sohn, Erben des Ruhmes und der Dokumente, an mich mit dem Ersuchen heran, ich möge Schliemanns Leben schreiben. Die Erinnerungen der frühesten Kindheit vereinigten sich mit den wunderlichen Anekdoten, die ihren Mann und Vater in neuem, vielfältigem Lichte erstehen ließen, die Suggestion der Materie und der mir bekannten Landschaft trat hinzu, ich ging nach Athen und fand — fast sage ich: zu meinem Schrecken — zwei große Schränke voll von Bänden, die alle von Schliemanns Hand gefüllt, geschrieben oder geordnet waren. Als ich zu zählen aufhörte, waren es 150 Bände.
Ordnung und Sammelwut haben hier das beispiellose Faktum erzeugt, dass eines Mannes Leben in seinen Papieren völlig vorliegt: vom Stammbaum und von der Weltgeschichte an, die ihn im achten Jahr begeisterte, bis zum Beileidstelegramm Wilhelms des Zweiten, das die Witwe nach seinem Tode nur hinzuzufügen brauchte, um eine wahrhaft unheimliche Übersicht über dies Schicksal zu geben. All dies stand vierzig Jahre lang unberührt: Schliemanns Biographie, die er mit so übertriebener Sorgfalt vorbereitete, wurde noch nicht geschrieben. Diese Papiere schätze ich auf 20.000 Stücke.
Da ist zuerst die lange Reihe der Tage- und Notizbücher, die er vom 20. bis zum letzten, dem 69. Lebensjahre beinahe ununterbrochen weiterführte. Dann die Geschäfts- und Kontobücher, die Familienbriefe, die Urkunden, Pässe und Ehrungen, Riesenbände seiner Sprachstudien, bis ins Detail dieser Fingerübungen, wie er die russischen oder arabischen Schriftzeichen übte. Es folgen Zeitungsausschnitte aus allen möglichen Gebieten, Listen mit historischen Zahlen, selbstgemachte Wörterbücher in einem Dutzend Sprachen. Da er alles aufhob, findet sich neben den aufschlussreichsten Notizen auch die Aufforderung, zum Konzert einer armen Witwe zu kommen; alles von seiner Hand mit Daten versehen.
Da er sein Leben lang alle Briefe eigenhändig schrieb und selbst in der Presse kopierte, so ist, man kann fast sagen, jede Zeile von seiner Hand in diesem Archiv erhalten, also jeder Briefwechsel von beiden Seiten zu verfolgen. Nur an ganz wenigen Stellen hat er Stücke aus Briefen herausgeschnitten oder etwa einen Brief seines Bruders vernichtet, der den Vater beschimpfte. Dagegen boten Schliemanns Werke nur äußerst wenig Material, denn er war durchaus Mann der Tat und nicht Schriftsteller.
Aus jenem Chaos von Papier galt es möglichst wenig, nicht möglichst viel zu kopieren; denn der modernen Unsitte, über jeden bedeutenden Kopf gleich nach seinem Tode 700 Seiten zu schreiben, wollte ich ein Maß gegenüberstellen, das die Distanz von über hundert Jahren seit der Geburt des Mannes, von vierzig Jahren seit seinem Tode, das vor allem der ziemlich abgeschlossene Kampf um seine Leistung ermöglicht und gebietet.
Und doch hätte ich meinen Grundsatz, nie zu forschen, nur zu gestalten, auch diesmal nicht durchbrochen, wenn nicht der Charakter dieses Mannes seine geniale Anlage an Interessantheit überböte. Denn erst aus diesem völlig originalen Wesen ist Absicht, Verdienst und Schicksal Heinrich Schliemanns zu begreifen. Hier wird man einen Mann finden, der in jedem Zuge, fast bei jeder Handlung originell, selbständig und vorurteilslos entscheidet: eine monomane, vielleicht auch mythomane Natur, die die Grenzen des Normalen hinter sich lässt; eine Mischung von Phantastik und Realismus, die nur durch unermüdliche Energie und Kontrolle sich ihre großartigen Leistungen abringen, ja ihr Leben erhalten konnte.
Was einen Mann darstellungswert macht: die Kunst, wie er mit seinem Pfund wuchert, der Wille, der die angeborenen Gaben entwickelt, das tritt hier an einem Beispiel zutage, klassisch im doppelten Sinne. Das Vorbild, das aus jeder Biographie fortwirken sollte, entwickelt sich hier ergreifend aus den Einwirkungen einer dunklen Jugend; die Konsequenz, mit der ein Pastorssohn und Krämerjunge, dann ein Bankmann und Importeur die Welt durchreist, bevor er sich in ein Loch in der Erde vergräbt, um dort zu finden, was er geträumt hat; diese Energie eines vorwiegend handelnden Menschen, der naive Egoismus dieser Erscheinung, der seine Leistung erst ermöglicht, die völlige Internationalität eines Mannes, der achtzehn Sprachen spricht und eine tote zu seiner Mannessprache macht, das Tempo, in dem er vorwärts stürmt und darum drei Lebensleistungen hinter sich bringt, dieser phantastische Drang eines unerschrockenen Realisten, diese berechnende Klugheit eines Visionärs schienen mir ein Beispiel. Ich wünschte, die Jugend lernte hier, was alles sie im Leben erreichen kann, wenn ein mecklenburgischer Pfarrerssohn, unter den ungünstigsten Umständen aufgewachsen, es so weit bringen konnte. Dies ist ein großer menschlicher Roman, und man würde ihn für unglaubwürdig halten, wäre nicht jede Seite mit Dokumenten bestreut. Zurecht begreifen kann man dies Leben nur, wenn man nicht den geringsten Versuch macht, es typisch oder von seiner Epoche abhängig zu sehen; dass hier vielmehr das völlig originale und zeitlose Abenteuer eines Sonderlings sich auftat, erhöhte die Kraft seiner Anziehung auf einen Porträtisten, wie ich's bin.
Auch dass der Fachmann nicht immer der glücklichste Finder ist, könnte man aus diesem Beispiele lernen, und ich leugne nicht, dass die Probleme Historie und Dichtung oder Dilettanten und Professoren, die hier im späteren Verlaufe auftauchen, mir persönlich nicht eben fremd erschienen sind.
Aber nur bei völliger Wahrheit, indem man das Dunkel hinter dem Lichte malt, war auch hier das Bild eines echten Menschen mit seinen Widersprüchen zu gewinnen, und es ist eine Seltenheit, wie in diesem Falle die Familie, erzogen in echt Schliemannschem Geiste, diese helldunkle Darstellung unterstützt hat, anstatt sie, wie ich das in berühmteren Fällen erfuhr, zu bekämpfen. Denn während wir uns um Sichtung und Übersetzung jener Papiere bemühten — sie sind in mehr als zwölf Sprachen verfasst, denn Schliemann schrieb auf jeder Reise sein Tagebuch in der Sprache des eben durchreisten Landes — , illustrierten mir Schliemanns Frau und Tochter aus lebhaften Erinnerungen die Ereignisse, soweit sie sie miterlebt hatten. Dagegen ist Schliemanns mit 60 Jahren geschriebene Autobiographie (in "Ilios", 1881) nur stellenweise verwendbar; die kritische Analyse dieser Schrift, kontrolliert an den, von nun an wohl zugänglichen Dokumenten, überlasse ich den Herren Philologen.
Indessen muss ich den Groll der Philologen auf mich ziehen, indem ich mich auch diesmal, wo mir ein bisher völlig unbekanntes Material vorliegt (u. a. über hundert Briefe Virchows), auf keine Quellenangaben einlassen kann, die die Frische jeder Darstellung zerstören. Genügen möge, dass alles, was hier zitiert, aus jenem Archiv geschöpft wurde, ohne dass ich behaupte, es sei erschöpft; dies macht neun Zehntel meiner Quellen aus. Was an kleinen Einzelheiten dazu erzählt wurde, stammt größtenteils von Sophia Schliemann, die fast alles, was er schuf, mit ihm geschaffen, vieles, was er schrieb, mit ihm geschrieben hat, und die nicht umsonst mit goldenen Medaillen geschmückt wurde. Bei der Übersetzung aus dem Griechischen und Russischen hat uns Schliemanns Tochter geholfen. In der Durchforschung und Ordnung jener Quellen hat mir in Athen und später meine Mitarbeiterin, Dr. N. G. Katzenstein in Zürich, hervorragende und produktive Dienste geleistet. Sir Arthur Evans in London, Emil Waldmann in Bremen, Wilhelm Weber in Halle haben mich durch Ratschläge und Korrekturen bei Durchsicht des Manuskriptes sehr verpflichtet.
Der Glaube an die Realität der homerischen Gedichte wurde zu Schliemanns Zeiten nur von wenigen geteilt. Wie er am Ende damit recht behalten, nachdem er ausgelacht worden, das zeigt der neu ausgebrochene Kampf um Ithaka, das heute wieder drei Nationen an drei verschiedenen Stellen suchen. Auf Grund dieses Glaubens allein konnte Schliemann Troja finden, die mykenischen Schätze heben, den Palast von Tiryns bloßlegen und mit alledem das vorhomerische Dunkel und das homerische Halbdunkel aufhellen.
Indessen, er fand an diesen Orten im Einzelnen anderes, als was er suchte, und wollte doch lange Zeit daran nicht glauben. Sein homerisches Troja war ein prähomerisches Troja. Jahrelang beschrieb er von seinen sieben Schichten— heute zählt man neun — die III. von unten als die "Verbrannte Stadt" und fand dort Türme und Tore zwar klein, aber doch, wie Homer sie besungen, bis Dörpfeld ihn zuletzt zur II. Schicht bekehrte. Erst kurz vor dem Tode begann Schliemann zu erkennen, dass die Burg des Priamos groß und mächtig sich in der VI. Schicht verbarg. Heute weiß man, dass alles in den untersten Tiefen Trojas Gefundene: Mauerreste, Waffen, auch das Gold rund tausend Jahre älter war als die gesuchte homerische Welt.
In Mykenä hat Schliemann die Königsgräber gesucht, ungeheure Goldschätze gefunden und so den Schlüssel zur mykenischen Kultur. Aber auch hier stieß er nicht auf die Atriden, sondern auf ein älteres Herrschergeschlecht. Die Schachtgräber werden heute ins XVI., Burg und Löwentor ins XIV. Jahrhundert v. Chr. gesetzt. Hier wie in Troja hat sein Spaten zu schnell gearbeitet. So ließ er hinter dem Löwentor bis auf das Niveau des Plattenringes graben und vernichtete dabei den Anfang der Rampe und den auf ihr ruhenden Fahrweg zur Burg; auch ließ er die Grabreliefplatten ausheben und fortschaffen, ohne ihre Stelle und Beziehung zu den einzelnen Gräbern festzustellen.
In Tiryns machte Schliemann nur bei der Versuchsgrabung von 1876 Fehler, indem er im inneren Vorhof einen Ostwestgraben aushob, der von einem kurzen Nordsüdgraben gekreuzt wurde, dazu noch zwanzig Schächte. Dabei glaubte er "die Zeit der fränkischen Herrschaft . . . in dem Kalkpflaster einer Villa und ihrer Nebengebäude zu erkennen"; es waren aber Reste durch Brand beschädigter Marmorplatten des Palastes, die an den Grabungsstellen zerstört wurden. Acht Jahre später, bei der großen Grabung, gelang es Schliemann zusammen mit Dörpfeld durch Bloßlegung der Burgreste den ersten Grundriss eines festländischen Herrschersitzes mykenischer Zeit zu schaffen.
Je näher man Schliemann zeitlich stand, umso schärfer war die Kritik der damals unproduktiven Legitimen an dem genialen Dilettanten. So wagte noch vor etwa zwanzig Jahren Professor Michaelis zu behaupten, dass Schliemann "jeder wissenschaftlichen Betrachtungs- und Behandlungsweise völlig fremd gegenüberstand, ohne eine Ahnung, dass es eine Methode und feste Technik dafür gebe". Der damals berühmte Fachmann verschwieg dabei, dass die erste wirklich wissenschaftliche Ausgrabung auf Samothrake nicht vor 1873 stattfand und die Erforschung von Olympia erst 1876 begann, also nach Schliemanns Anfängen, wobei sich die Archäologie erst im Terrain selber zur streng wissenschaftlichen Disziplin zu entwickeln begann. Heute finden die Fachleute viel gerechtere Worte.
Schliemann ist ein großes Beispiel für unsere heute wieder umstrittene These, dass der erleuchtete Liebhaber den gründlichen Fachmann besiegt. Deshalb war es auch ein erleuchteter Liebhaber, der ihn am frühesten erkannte. Wundervoll begriff und schilderte ihn der 80jährige Gladstone in einem Briefe, geschrieben nach Schliemanns Tode an dessen Frau:
"In dem Werk, dem er sich hingab, erneuerte seine Begeisterung den alten Geist der Ritterlichkeit in ganz reiner und gewaltloser Form. In den früheren Epochen seiner Arbeit trafen ihn Feindseligkeit und Schweigen; beide mussten zerfließen wie Nebel vor der Sonne, als Wucht und Wert seiner Entdeckungen sich erhoben. Die Geschichte seiner Kindheit und Jugend scheint nicht weniger seltsam als die seines späteren Lebens; sie gehören zusammen, sie verband Ein Ziel. Solche Generosität ohne solche Energie, aber auch diese ohne jene hätte zu seinem Ruhme genügt; in ihrer Verbindung grenzen sie ans Wunderbare."
EMIL LUDWIG
Dr. h. c.
ERSTES KAPITEL. DUNKLE JUGEND
I
Mecklenburg ist berühmt als das Land der dicksten Kartoffeln, fetten Viehs, schöner Buchenwälder, zurückgebliebenen Adels; da es aber im deutschen Geistesleben beinahe unbekannt bleibt, da jede Art selbständigen Denkens hier länger als in irgendeinem anderen deutschen Lande unterdrückt, das Volk dumpf und schwer erhalten und durchs ganze 19. Jahrhundert, ja bis zum Ende des Weltkrieges mit mittelalterlicher Verfassung und Vorherrschaft des Adels, also von oben regiert wurde, so knüpften gebildetere Deutsche gern einigen Spott an dieses Land, und wenn man einen groben, stumpfen Menschen sah, so sagte man, er mache das mecklenburgische Wappen, denn das enthält oben einen großen Ochsenkopf.
Indessen hat es unter Geistlichen und Lehrern auch hier, wie überall in deutschen Landen, eine humanistische Kultur gegeben, die in der lange Zeit freien, auch später noch privilegierten Universität Rostock Ursprung oder doch Anregung fand. Während die Leibeigenschaft in diesem Lande erst 1820 abgeschafft, dann aber durch die Macht der Gutsherren faktisch fortgesetzt wurde, während selbst das Bürgertum sich nur unter Druck und Widerständen zu entwickeln suchte, pflegten in ihren Kreisen die von Staat und weiterem Wirken ausgeschlossenen Bürger umso eher Studien und platonische Liebhabereien und führten eine Tradition des Lernens und Sammelns fort, die sich aus der Reformation herschreiben mochte.
Zu diesen engen Zirkeln mögen die Schliemanns gehört haben, denn drei Generationen waren hintereinander Pastoren, etwa von 1730-1830, und zwar auf der kleinen Insel Poel, in Gresse und Neu-Buckow; der Vater dieser Pastorendynastie war "Bürger und Worthalter", dessen Väter aber waren durch vier Generationen Kaufleute, und zwar im 16. Jahrhundert in Lübeck, wo sich der Handelsgeist weiter entfalten konnte, denn dort war die Freiheit und dort war das Meer.
Der eine, der den unbekannten Namen aus der Enge jener Städtchen und Dörfer in die Welt tragen sollte, schien auch von anderen Vorfahren theologisch mitbestimmt, denn seine Großmutter war eine Pastorstochter und seiner Mutter Bruder war wieder ein Pastor. Und doch ging nichts von all dieser Tradition auf einen Geist über, den seine inneren Gesichte durch Wahl oder Schicksal in die unchristliche Welt par excellence führen sollten. Dagegen muss sich das alte Kaufmannsblut nach einer Schonzeit von einem Jahrhundert in ihm wieder geregt haben, und zwar in Form jenes alten Hansageistes, der vielleicht die Lübecker Schliemanns schon übers Meer geführt hat.
In seiner Jugend muss Heinrich Schliemanns Vater ein strebender, gelehrter Kopf gewesen sein; zuerst vier Jahre lang Lehrer in Altona, ging er mit etwa 26 in der Theologie weiter. Frömmigkeit war es nicht, die ihn dazu trieb, das zeigt sein späteres Leben; sicher aber hat er diese zweite Wissenschaft mit Eifer studiert, denn ein Zeugnis spricht über den 31 Jährigen aus, dass er ",in der Grundsprache des Neuen Testamentes mit allem Fleiß von mir geprüft und zu meinem wahren Vergnügen so befunden wurde, dass seine mir vorgelegten Zeugnisse ihm bloße Gerechtigkeit widerfahren lassen"; und bald darauf spricht ein anderer Examinator von den "schönsten Beweisen seiner gründlichen theologischen Kenntnisse . . Gott leite diesen mir sehr werten Mann".
Und doch war es durchaus nicht das deutsche Pfarrhaus, wie es im Buche steht, in dem Heinrich Schliemann aufwuchs. Zwar, die Mutter, eine gebildete, auch musikalische Frau, Tochter des Bürgermeisters einer kleinen Stadt Mecklenburgs, gab den Kindern das beste Vorbild. Auf ihre Züge können wir nur unsicher aus einer späten Photographie ihres Bruders schließen, eines Hans Bürger, der mit seinen freien Blicken, dem vornehmen geschlossenen Munde, der klaren Stirn ein Sinnbild von Selbstgefühl und Bescheidenheit erscheint. 13 Jahre jünger als ihr Mann, ist sie schon vor dem 40. Jahre gestorben, während er sie um nahezu vierzig Jahre überlebt hat. Auch vom Vater hat Schliemann manches Gute gelernt, denn er war für die Ausgrabungen von Pompeji begeistert, erzählte Geschichten aus dem Altertum, schenkte den Kindern ein Tierbuch mit vielen schönen Stichen, ein Lehrbuch der französischen Sprache, und dann eine Weltgeschichte für Kinder, in der den 8jährigen Knaben nichts so ergriff wie jener Stich, auf dem Aeneas aus dem brennenden Troja flieht, seinen Vater auf dem Rücken, den Knaben an der Hand führend. Fünfzig Jahre später hat Schliemann etwas romantisch erzählt, er habe sich schon damals vorgenommen, jene verbrannte Stadt auszugraben.
Sicher war seine Phantasie früh aufgewacht. Was er in jenem späten Selbstbildnis beschreibt, hat er vorher den Seinigen oft berichtet, und dem, der ihn später beobachtet, ist es nur natürlich, dass "die in meiner Natur begründete Neigung für alles Geheimnisvolle und Wunderbare durch die Wunder, welche jener Ort enthielt, zu einer wahren Leidenschaft entflammt" wurde. In dem Dorf Ankershagen, in dem er vom 2. bis 10. Jahre aufwuchs, sollte nämlich der Geist eines früheren Pfarrers umgehen, ein Hünengrab das Kind eines Richters in seiner goldenen Wiege enthalten, märchenhafte Schätze sollten bei den Ruinen eines runden alten Turmes liegen und einem legendären Raubritter, dessen Untaten im Volke weiterlebten, sollte ein Bein immer wieder aus dem Grabe herauswachsen, was Küster und Totengräber beschworen, selber gesehen zu haben, bis das Bein leider aufhörte nachzuwachsen. "Natürlich glaubte ich auch all dies in kindlicher Einfalt, ja ich bat sogar oft genug meinen Vater, dass er das Grab selber öffnen oder auch mir nur erlauben möge, das zu tun, um endlich sehen zu können, warum das Bein nicht mehr herauswachsen wolle."
Hier ist der erste Zug, in dem sich jene merkwürdige Mischung von Gläubigkeit und Gründlichkeit, von mythischem Glauben und realistischer Neugier zeigt, die die Schicksale dieses Charakters später entscheiden sollten. Dass Kinder solche Märchen nicht glauben, hat man wohl gehört; tun sie es aber, so fürchten sie nichts in der Welt so sehr, als die Entschleierung, das heißt die Öffnung des Grabes. Hier aber ist ein achtjähriger Junge, der von allerlei Gespenstergeschichten glüht und doch den Vater auffordert nachzugraben, um endlich hinter die Wirklichkeit zu kommen: zu sehen, warum denn das fatale Bein des Bösewichts, an das er glaubt, nicht mehr nachwachsen wollte. Wie hier das Kind seinen eigenen angeborenen Mystizismus kontrollieren will, genau so wird der Mann einst den Glauben an Homer und seine Wirklichkeit sich und der Welt mit demselben Spaten beweisen wollen, den er heute dem Vater in die Hand drücken möchte.
Aber der Vater war ein Spötter und scheint an allem in der Welt gezweifelt zu haben, es sei denn am Genuss. Wie er auf dem hier folgenden Bilde vor uns sitzt, von dem die Unterschrift der Tochter besagt, so habe er noch zuletzt oft ausgesehen, das heißt mit 90 Jahren, bietet er den Anblick einer riesigen Vitalität, und die aus den Papieren bekannteGeschichte seiner letzten vierzig Lebensjahre entspricht dem Bilde dieses Mannes, der die Frauen verbraucht, verjagt, wieder aufgenommen, mit 67 noch ein Kind gezeugt und immer wieder in Unternehmungen, Schulden, in einem beständigen Trubel von Willensakten gelebt und sich dennoch nicht verzehrt hat. Alles, was sein Sohn an erstaunlicher Lebensfülle und Leidenschaft später bewiesen hat, dies ruhelos tätige, egoistische, beständig neu entzündete Temperament, das eben noch segnete und gleich darauf flucht, hat er von seinem Vater geerbt, dem nur der moralische Halt fehlte, um in einem mecklenburgischen Neste im kleinen auszuführen, was später der Sohn in den weltweiten Radius seiner Untersuchungen spannte. Eine nie verminderte Anhänglichkeit des Sohnes inmitten aller Herausforderungen Seiten dieses Vaters findet nur in dem instinktiven Gefühl einer inneren Verwandtschaft ihre Erklärung.
II
"Die meisten Weiber sind Gemälde außer dem Hause, Glucken in ihren Zimmern, wilde Katzen in ihrer Küche, Heilige wenn sie beleidigen, Teufel wenn sie beleidigt werden, Komödiantinnen in ihrer Wirtschaft und Hausweiber nirgends als in ihrem Bett. Das weibliche Geschlecht gab die erste Idee der Lotterie, wo tausend Nieten auf einen Treffer kommen." Solche und verwandte Aphorismen sind von der Hand des 29jährigen Pfarrers Ernst Schliemann erhalten, der in diesem Jahre noch kaum verheiratet war, er müsste denn eine 16 Jährige soeben zur Frau genommen haben. Sind dies vielleicht nicht seine eigenen Gedanken, so sind sie ihm doch treffend genug erschienen, um sie in seine kleinen Hefte aufzunehmen, wo historische Tabellen sorgsam notiert oder prosaische und poetische Aufsätze nach der Sitte jener Zeit aufgeschrieben werden.
Hier parodiert er Mignons Lied und schließt: "Dahin möcht ich mit dir, o meine Agnes, ziehn"; daneben notiert er sich ein vierzehn Strophen langes Gedicht "Empfindungen in den Tagen des Kummers" oder überträgt "God save the King" ins Deutsche und ins Hebräische. Der Wille zur Bildung wird hier von wilden Leidenschaften durchkreuzt, und ein Skeptizismus, der nirgends Halt macht, von keiner Hingabe besänftigt.
Die zarte, traurige Frau, die am Fuße dieses Vulkans vergebens zu blühen suchte und verbrannt wurde, hat dem Manne vier Töchter und drei Söhne geboren, den letzten, als Heinrich 9 Jahre alt wurde. In dieser letzten Zeit ihres Lebens, vielleicht schon vorher, hatte ihr Mann eine langjährige Beziehung zu einer Magd im Hause, die nach dem Tode der Leidenden gern Frau Pastorin werden wollte. Auch Frau Luise Schliemann schrieb sich Verse heraus, die sie in einem Buch oder im Wochenblatte fand; auch diese sind skeptisch, aber zugleich leidend:
"Es gab geheime Wissenschaft
und Sympathie und Zauberkraft
für Fieber, Krampf und Gicht;
man brauchte Luft und Goldtinktur,
die Wasser- und die Hungerkur:
doch älter ward man nicht.
Und seit der Sintflut ist gefehlt,
ist klar und deutlich uns erzählt,
die Weltgeschichte spricht,
doch schöner wird es nicht."
Diese Frau, deren Wesen man mangels Bild sich aus ihrer wahrhaft bedeutenden Handschrift, aus der allgemeinen Liebe ihrer Kinder und Geschwister, aus der lebenslänglichen Verehrung ihres großen Sohnes zusammensetzen mag, hat ihm ersichtlich alles vererbt, was an ihm tief, besinnlich, philosophisch war. Dass sie Klavier spielte und Spitzenmanschetten trug, nahm man freilich in Ankershagen übel; als aber die Affäre der Magd zum Skandal wurde, wandte sich alle Sympathie der Pastorin zu und vom Pastor weg.
Zwei Monate vor ihrer letzten Entbindung dankte sie ihrer 18 jährigen Ältesten "für die liebevollen Empfindungen, die Du, gutes Kind, jetzt zu mir zu haben scheinst, und womit Du Deine verlassene Mutter so sehr erfreut und belebt hast . . . Die Tage, die dann kommen, kannst Du jeden Augenblick denken, dass ich im Kampfe zwischen Leben oder Tode bin. Solltest Du von letzterem benachrichtigt werden, so gräme Dich nicht viel, sondern freue Dich vielmehr, dass ich ausgelitten habe auf dieser für mich so undankbaren Welt, wo alles Dulden, Bitten und Beten zu Gott im Stillen um Änderung meines harten Schicksals doch nichts hilft. Wenn Gott mir sollte mein Schmerzensjahr glücklich überstehen helfen und mein Leben vielleicht nachher noch einmal wieder so werden, dass ich mit Lust und Vergnügen unter Menschen bin, so verspreche ich Dir, die schöne Haube auch recht fleißig zu tragen. Ich muss schließen, weil ich beim Schlachten der Schweine bin und es mir so, so sauer wird."
Die Bitterkeit dieser Frau, die betrogen und zugleich zur Mutter gemacht wird, die Tiefe ihres Leidens begreift man ganz erst bei der Lektüre viel späterer Briefe Schliemanns, die sich der Wiedergabe geradezu entziehen.
Drei Monate nach jenem Briefe, ein paar Wochen nach der Geburt ihres letzten Sohnes, war Luise Schliemann tot. Sie hinterließ nichts als den Ruf eines Engels und einen genialen Sohn.
Aber wie Kinder rasch verwinden, was sie doch nicht begreifen, so verliebt sich der verschlossene und phantastische Knabe um jene Zeit in der Tanzstunde in die gleichaltrige Tochter eines Gutspächters — und noch fünfzig Jahre später hatte er Minna Meincke nicht vergessen. Die ältere Schwester hatte diese erste Leidenschaft bemerkt, als eines Tages das Mädchen mit Mutter und Schwester im Wagen vom Gute herüberkam, man Heinrich sucht, nicht findet, bis er schließlich auffallend wohl gewaschen und herrlich hergerichtet erscheint, mit fein gesträhltem Haar, während die Tropfen noch auf sein rotgeriebenes Gesicht fielen. Freilich, tanzen lernten sie beide nicht, aber sie beschlossen sich zu heiraten und hinter die Geheimnisse von Ankershagen zu kommen; denn Minna und auch ihre Schwester waren die einzigen, die den Knaben mit seinen wunderlichen Plänen und Gedanken nicht auslachten. Da musste oft der Dorfschneider im echten Plattdeutsch erstaunliche Dinge von eingefangenen und wiederkehrenden Störchen erzählen, und eine 80jährige Pastorstochter musste vor den Porträts ihrer Vorfahren von alten Zeiten hier in der Runde berichten. Vergangenheit in aufregenden Mythen konzentriert und eine Zukunft in Glück und Wonne verschmolzen für die beiden Kinder, die sich liebten.
Plötzlich war alles aus, die Meinckes, wie alle anderen, wandten dem skandalösen Pfarrhause den Rücken, und "das war mir tausendmal schmerzlicher als meiner Mutter Tod, den ich dann auch bald in dem überwältigenden Kummer um Minnas Verlust vergaß. Nie wieder hat mir ein schweres Geschickauch nur den tausendsten Teil jenes tiefen Schmerzes verursacht, den ich im zarten Alter von neun Jahren bei der Trennung von meiner kleinen Braut empfunden habe. Mein Vater, dem meine tiefe Niedergeschlagenheit nicht entging, schickte mich nun auf zwei Jahre zu seinem Bruder", einem Pfarrer in Kalkhorst in Mecklenburg.
Dem Vater war es offenbar lieb, ein paar Augen weniger im Hause, und auch die älteren Töchter scheinen längere Zeit bei Verwandten verbracht zu haben. Fiekchen aber, jene Magd, scheint erst einige Jahre später und unter großem Lärm weggejagt worden zu sein. In Altona erzählte später eine Verwandte dem zugereisten Heinrich Schliemann, sie habe, weggeschickt "bedeutendes Kostgeld . . immer die kostbarsten Geschenke sowohl an Geld als an Luxusartikeln vom Vater bekommen und immer vorgerechnet, wie lange es noch dauern würde, bis sie Frau Pastor sein würde. Kleider vom schwersten Atlas, Umschlagetücher von Samt und Seide seien ihre tägliche Tracht gewesen".
So war es kein Wunder, dass in demselben Jahre der Verdacht aufkam, der Pfarrer Schliemann habe die Kirchenkasse beraubt. Gewiss ist, dass fünf Jahre nach dem Tode seiner Frau der Vater in der Rostocker Zeitung seinen "zahlreichen Freunden und Gönnern im In- und Auslande" mitteilt, er sei nunmehr freigesprochen, der früher erteilte Verweis zurückgezogen, er werde vom Amte nicht suspendiert. Trotzdem dauerte die Amtsenthebung noch ein Jahr später an, und erst nach einem weiteren Jahre kann der offenbar zu Unrecht Angeschuldigte öffentlich anzeigen, "dass ich aus eigner freier Entschließung meine Pfarre gegen bare Ausbezahlung der von mir begehrten Abfindungssumme rein abgetreten habe". Die Behörde bestätigt, dass seine Rechnungen von damals richtig waren, und zahlt ihm statt einer Pension 8000 preußische Taler aus. Mit diesem Gelde geht der 58jährige Pfarrer in einen anderen Ort und fängt mit der Wucht eines schlauen Bauern, doch wieder ohne Selbstbeherrschung und darum ohne Erfolg, ein zweites Leben als Krämer an.
III
Was musste im Herzen eines empfindsamen Knaben vorgehen, der in den entscheidenden Jahren zwischen 10 und 16 teils zu Hause, zum Teil aus naher Ferne, ohne Mutter und meist auch den Geschwistern fern, dies schwere Gewitter über sein Vaterhaus kommen, sich entladen und nur teilweise wieder weichen sah! Welche Gedanken eines frühreifen Kindes, das, in den engen und durchsichtigen Umständen eines Dorfes, denselben Mann segnen und fluchen, Gott vertreten und seine Frau totkränken sah, und dieser Mann war sein Vater und jene Frau seine Mutter! Hätte er noch, im Hause des Onkels geborgen, inzwischen seinen stillen Weg fortschreiten können! Aber sein eigenes junges Schicksal wurde von dem wüsten Leben des Vaters zerrüttet. Das Mädchen, das sich mit dem ganzen Ernst der Kinder ihm versprochen, hatte sich abgewandt, die Freunde kommen nicht mehr ins Haus, und was auf die Dauer das schlimmste ist das Studium wird abgebrochen, und er, der von den frühesten Tagen her seine Phantasie mit den Geschichten und Bildern der Antike erfüllte, wird von dem Buch, das alles enthüllen soll, vom Griechischen in dem Augenblicke weggerissen, wo er es aufschlagen soll.
Denn in jenem anderen Pfarrhaus, beim Onkel in Kalkhorst, lernt der Junge an der Hand eines trefflichen Philologen so rasch Latein, dass er im elften Jahre seinem Vater einen lateinischen ",wenn auch nicht korrekten Aufsatz über die Ereignisse des trojanischen Krieges, über die Abenteuer des Odysseus und Agamemnon" zu Weihnachten schicken konnte. Jetzt sollte das Gymnasium in der Stadt ihm die Tore der Weisheit aufschließen, und der Elfjährige kam in die Tertia von Neu-Strelitz. Aber da kam der Zusammenbruch des Hauses, Amtsenthebung, Untersuchung, völliger Umschlag, der Vater will den Sohn von der Tasche, die Lehrer wollen ihn wohl nicht gern unter den Patriziersöhnen sitzen haben, und so muss er nach drei Monaten in die Bürgerschule, um dort hastig und unvollkommen eine sogenannte Reife zu erlangen. So wurde ein hochbegabter, humanistischen Gedanken zugewandter Knabe durch die Abenteuer seines Vaters aus allen Himmeln gerissen und mit 14 Jahren als Lehrling in den Krämerladen eines nahe. gelegenen Nestes, nach Fürstenberg in Mecklenburg geschickt.
Ein paar Tage vor seiner Abreise dorthin traf er im Hause eines Hofmusikus zufällig seine Minna wieder, die er fünf Jahre lang nicht gesehen. "Sie war jetzt 14 Jahre alt und. sehr gewachsen — so schreibt er mit 50. — Sie war einfach schwarz gekleidet, und gerade diese Einfachheit ihrer Kleidung schien ihre bestrickende Schönheit noch zu erhöhen. Als wir einander in die Augen sahen, brachen wir beide in einen Strom von Tränen aus und fielen, keines Wortes mächtig, einander in die Arme. Mehrmals versuchten wir zu sprechen, aber unsere Aufregung war zu groß. Bald traten Minnas Eltern in das Zimmer, und so mussten wir uns trennen. Jetzt war ich sicher, dass Minna mich noch liebte, und dieser Gedanke feuerte meinen Ehrgeiz an: von jenem Augenblicke an fühlte ich eine grenzenlose Energie und das feste Vertrauen in mir, dass ich durch unermüdlichen Eifer in der Welt vorwärtskommen und mich Minnas würdig zeigen werde. Das Einzige, was ich damals von Gott erflehte, war, dass sie nicht heiraten möchte, bevor ich mir eine unabhängige Stellung erworben haben würde."
Da sitzt er nun, von einer neuen Hoffnung angefeuert, auf der Heringskiste, ordnet, packt, verkauft um Pfennige Milch, Salz, Kaffee, Zucker, auch den Kartoffelbranntwein, der in Mecklenburg zu Hause ist, mahlt die Kartoffeln für die Brennerei, fegt den Laden, und so ist er "von 5 Uhr morgens bis 11 Uhr abends beschäftigt, und mir blieb kein freier Augenblick, zu studieren. Überdies vergaß ich das wenige, was ich in meiner Kindheit gelernt hatte, nur zu schnell". Welch ein Ereignis, als zwischen Öl- und Talglichtern in der kleinen Bude einmal die Sonne der Antike aufging! "So wird mir, solange ich lebe, jener Abend unvergesslich bleiben, an dem ein betrunkener Müller in unseren Laden kam." Auch dieser ein Mecklenburgischer Predigerssohn, der wegen schlechten Betragens das Gymnasium kurz vor der Prüfung verlassen musste, vagabundierte, trank, seinen Homer aber doch nicht vergessen hatte. "Denn an dem obenerwähnten Abend rezitierte er uns nicht weniger als hundert Verse dieses Dichters und skandierte sie mit vollem Pathos. Obgleich ich kein Wort davon verstand, machte doch die melodische Sprache den tiefsten Eindruck auf mich, und heiße Tränen entlockte sie mir über mein unglückliches Geschick. Dreimal musste er mir die göttlichen Verse wiederholen, und ich bezahlte ihn dafür mit drei Gläsern Branntwein, für die ich die wenigen Pfennige, die grade mein ganzes Vermögen ausmachten, gern hingab. Von jenem Augenblicke an hörte ich nicht auf, Gott zu bitten, dass er in seiner Gnade mir das Glück gewähren möge, einmal Griechisch lernen zu dürfen."
In diesen fünf Jahren, zwischen 14 und 19, hat einer der fleißigsten und ehrgeizigsten Menschen keine Möglichkeit gesehen, dem Gefängnis seines Krämerdaseins zu entfliehen, und doch auch kein Mittel gefunden, weder Lehrer noch Bücher, um in einer imaginären Welt, auch keine Freunde, um in der Hingabe an einen anderen seine Spannungen zu lösen. Und doch muss er grade in diesem leersten Lustrum seines Lebens, in irgendeinem grundlosen Vertrauen auf das Schicksal, Grundgedanken in sich herangebildet haben, die nur ein absonderliches Schicksal aus seinem besonderen Wesen entwickeln konnte. Denn während schwache Naturen einem schlechten Beispiel in der Jugend erliegen, kräftigen sich starke an solcher Warnung. Schliemann war eine starke Natur.
Was war — so mochte der Junge denken — die Ursache all dieses Unglückes? Begierden. Was komplizierte die Krisis? Seines Vaters Armut. Was also brauchte man, um im Leben zu siegen? Mäßigkeit, Ehrlichkeit und Geld. Die Gesellschaft, ob es ein kleiner Pächter war oder der Großvater Bürgermeister, von dem die Mutter erzählt hatte, hielt sich an ein paar Grundsätze und entzog dem unschuldigen Sohn eines dunklen Ehrenmannes das schuldlose Mädchen, das er liebte. Hatte man aber Geld, so kam man über Vorurteile leichter hinweg. Wenn er einmal genug besaß, um ein Haus zu gründen, wer würde ihm dann seine Minna noch streitig machen? Und Bücher und Bilder der alten Welt, Griechisch und den Homer, alles konnte man kaufen und lernen mit diesem Gelde, um das der Vater nun jahrelang mit der Kirchenbehörde verhandelte, zugleich mit seiner Ehre. Was also galt es zu gewinnen? Ehre und Gold. Dann wurde man Herr der Welt.
IV
Doch wie aus diesem engen Bretterhaus entfliehen, von Hering, Schnaps und Butter? In Amerika, da ist das Leben neu und anders. Da war ein Amtmann auf Türkshof, mit dem hatte der Achtzehnjährige schon "kontrahiert, um die Reise nach New York in Nordamerika anzutreten". Aber da mischte sich der Vater ein, der sich um diese Zeit mit jenen 8000 Talern wieder stark fühlte, und verweigerte, so wie die meisten Abenteurer gegen ihre Kinder handeln, kurzerhand das Geld für solche abenteuerliche Fahrt. Und doch trat jetzt wenigstens eine Ortsveränderung ein. Sei es, wie er es in seinen Memoiren erzählt, dass Schliemann damals durch Aufheben eines zu schweren Fasses sich die Brust ruinierte und arbeitsunfähig wurde, oder dass er wegen jenes Projektes andere Stellungen ausgeschlagen hatte— so schilderte er es damals: gewiss ist dies, er war stellungslos und ging nach Rostock, um dort die doppelte Buchführung zu erlernen. "Den schönen Sommer musste ich auf eine jämmerliche Weise hinbringen; da ich zu Hause nicht sein konnte, wenn ich mich nicht hätte totärgern wollen, so mietete ich mir ein Kämmerchen bei einem Freunde meines früheren Prinzipals. Mit dem regsten Eifer begann ich das ungeheure Werk der Schwanbeckschen Buchführung, arbeitete vom frühen Morgen bis zum späten Abend und sah mich zum Erstaunen der Lehrer und Mitschüler, obgleich ich sämtliche neun Bücher selbst linierte, schon am 10. September am Ende meines Werkes, woran andere ein bis anderthalb Jahre arbeiten."
Schon hier und dann später in diesem etwa zwanzig Seiten langen Briefe, in dem der Zwanzigjährige seinen Schwestern von seinen letzten Schicksalen berichtet, werden Grundlagen seines Wesens kund, die sich später in allen Briefen und Büchern wiederholen und verstärken; seine Leistung stellt er gern ins Licht, betont den Beifall der Kenner, verschwendet den Superlativ und warnt deshalb den aufmerksamen Leser, Errungenschaften oder Anschuldigungen allzu wörtlich zu nehmen. Dies stammt aus jener Leidenschaft, die auch die Briefe seines Vaters überschwemmt, die aber im Sohne sich nie auf Genuss, immer auf Gold und Ehre wirft, aus denen ein nie gesättigtes Streben die Resultate seines Lebens ziehen wird. In ein paar Monaten errafft sich dieser arme, herumgestoßene, lungenschwache Junge ein erstes Instrument auf der Jagd nach dem Erfolg, und wenn es auch nur die Kunst ist, Zahlen zu buchen, die anderen zugutekommen.