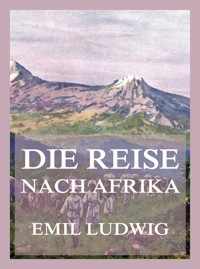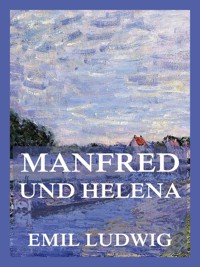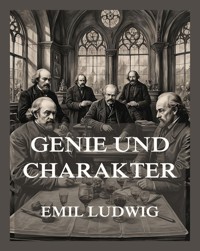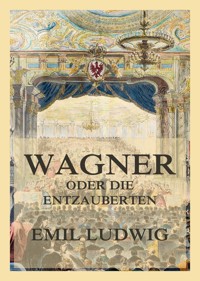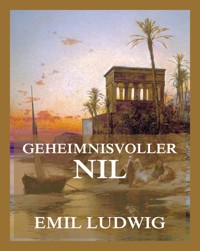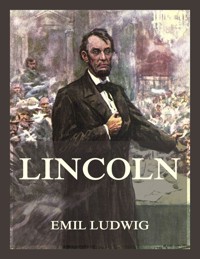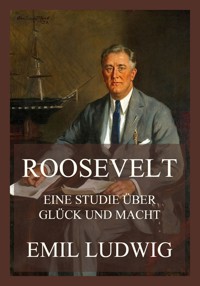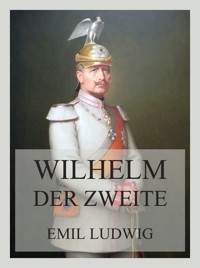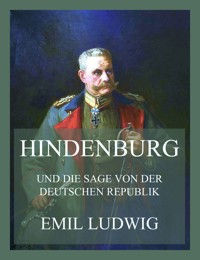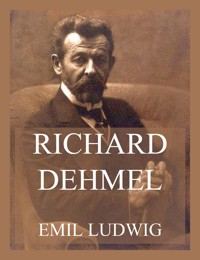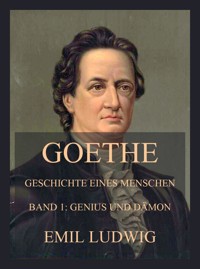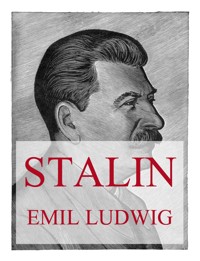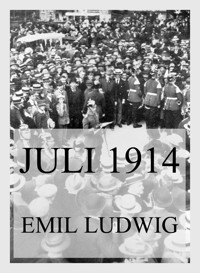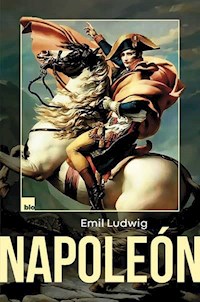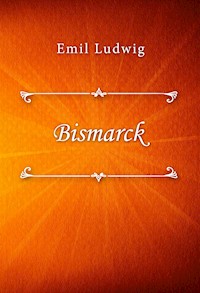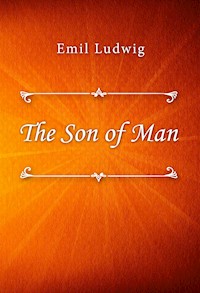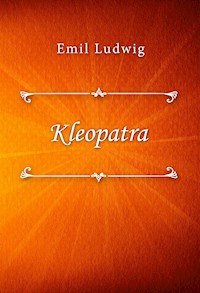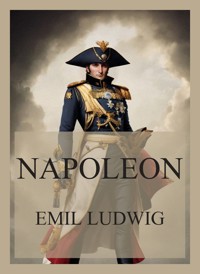
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die vielleicht brillanteste Darstellung der napoleonischen Legende ist seit ihrem ersten Erscheinen im Jahr 1924 ein zu Recht bemerkenswertes und populäres Werk. Ein solcher Versuch, Geschichte neu zu beleben, ist äußerst lobenswert, und zwei Faktoren haben zu seinem Erfolg beigetragen. Der erste ist der Stil des Autors, der vielleicht das beste Beispiel dafür ist, wie die historische Gegenwart betrachtet werden sollte und wie nicht, denn sie ist das Medium des gesamten Werkes. Der zweite ist die ausgiebige Verwendung der Aussagen von Napoleon selbst (oft frei erfunden) und seiner Zeitgenossen. Das Ergebnis ist eine äußerst lebendige Schilderung seiner Reaktionen auf seine Umgebung und insbesondere seiner Beziehungen zu Josephine und seiner Familie. Hierin liegt vielleicht der Hauptwert des Buches. Dem Autor ist es in der Tat in besonderem Maße gelungen, die nicht greifbare Qualität "Atmosphäre" zu erzeugen. Jeder, der sich für Napoleon interessiert, und jeder, der Freude an modernen psychologischen Biographien hat, wird dieses Buch lesen wollen. Es ist von der ersten bis zur letzten Seite fesselnd, aber es möchte keine fundierten Meinungen ändern. Es wird jedoch viele, die noch nicht fundiert sind, entscheidend formen –– und genau darin liegt sein Wert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 877
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Napoleon
EMIL LUDWIG
Napoleon, Emil Ludwig
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849680051
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
ERSTES BUCH. DIE INSEL.. 2
I2
II3
III4
IV.. 6
V.. 9
VI11
VII13
VIII15
IX.. 17
X.. 19
XI21
XII23
XIII26
XIV.. 29
ZWEITES BUCH. DER STURZBACH.. 35
I35
II38
III40
IV.. 45
V.. 47
VI51
VII54
VIII59
IX.. 65
X.. 67
XI69
XII72
XIII76
XIV.. 78
XV.. 82
XVI84
XVII89
XVIII92
XIX.. 97
XX.. 100
DRITTES BUCH. DER STROM... 106
I.106
II114
III119
IV.. 124
V.. 126
VI131
VII135
VIII139
IX.. 145
X.. 148
XI154
XII159
XIII162
XIV.. 169
XV.. 175
XVI179
XVII186
XVIII189
XIX.. 199
XX.. 207
XXI213
XXII224
VIERTES BUCH. DAS MEER.. 232
I232
II240
III244
IV.. 248
V.. 258
VI262
VII266
VIII271
IX.. 275
X.. 279
XI287
XII292
XIII296
XIV.. 301
XV.. 312
XVI322
XVII329
XVIII336
XIX.. 341
XX.. 350
FÜNFTES BUCH. DER FELSEN... 353
I353
II355
III361
IV.. 367
V.. 373
VI377
VII384
VIII385
IX.. 388
X.. 393
XI398
XII402
XIII409
XIV.. 414
XV.. 417
XVI421
XVII425
XVIII429
XIX.. 435
XX.. 439
NACHWORT.. 442
JAHRESZAHLEN... 445
„Napoleon hat die Tugend gesucht und,
als sie nicht zu finden war, die Macht bekommen.“
GOETHE
ERSTES BUCH. DIE INSEL
„Napoleons Märchen kommt mir grade so vor wie die Offenbarung Johannis: es fühlt ein jeder, dass noch etwas drinsteckt, er weiß nur nicht was.“
GOETHE
I
Im Biwak sitzt ein junges Weib, in Decken gehüllt nährt sie das Kind, fern hört sie Rollen und Rauschen. Wird noch nach Sonnenuntergang geschossen? Sind es Gewitter, die der Herbst in diesem rauen Felsgebirge Echo um Echo weiterträgt, oder ist es nur der Urwald von Steineichen und Kiefern ringsum, in denen Fuchs und Wildschwein hausen? Eine Zigeunerin scheint sie, wie sie dasitzt, das Tuch nur halb um die weiße Brust geschlagen, zwischen Rauch und Dunst vor sich brütend, in Ungewissheit, was heute draußen sich entschieden haben mag. Wie sie aufhorcht, da Hufschlag sich dem Zelt nähert! Ist er’s? Er versprach zu kommen, doch von der Schützenlinie ist es weit, und die Nebel brauen.
Da wird die Zeltluke aufgeschlagen, mit frischem Luftzug tritt der Mann herein, ein Offizier in Farben und mit Federn, schlank, mit gewandter Bewegung, ein junger Adliger von Mitte Zwanzig, der sie heftig begrüßt. Nun ist sie aufgesprungen, hat den Säugling der Magd übergeben, Wein wird hervorgeholt, und wie sie das Kopftuch abnimmt und vor ihm steht, kastanienbraune Locken über einer reinen Stirn sich kräuseln, der feine Mund die rasche Frage spricht, dazu das lange Kinn, Sitz jeder Tatkraft, die Adlernase sich vom Feuerscheine heben, und von der Hüfte blitzt der Dolch, den sie in diesen Bergen niemals ablegt: mit einem Male zeigt die schöne Amazone, dass sie von alten Geschlechtern stammt, von Männern der Tat und des Entschlusses, und wirklich waren ihre Ahnen gleich den seinen schon vor Jahrhunderten drüben in Italien und dann hier auf dieser Bergesinsel Führer und Kämpfer.
Nur jetzt, da sich alles zusammengerottet hat, um den verhassten Feind, um Frankreich zu vertreiben, hier im wildesten Teil des Gebirges, wohin die tapfere Neunzehnjährige dem Mann im Kampfe ums Vaterland gefolgt ist, jetzt möchte freilich keiner in ihr die glänzende Patrizierin sehen, auf die beim Kirchgang alle blicken; nur Stolz und Mut erweisen hier den Adel.
Er aber, lebensvoll und stets beweglich, schüttet den Korb von Neuigkeiten vor ihr aus: der Feind ist geschlagen, gegen die Küste, jetzt weiß er keinen Ausweg mehr, heut hat er zu Paoli seinen Unterhändler geschickt, morgen haben wir Waffenstillstand. Laetitia! Wir siegen! Und Korsika wird frei!
In jedem Korsen lebt der Wunsch nach vielen Kindern. Denn hier wird noch Beleidigung auf der Stelle gerächt, rasch wird zugestochen, dann aber Urfehde geschworen von einer Sippe zur andern: die dauert jahrzehntelang und ein Jahrhundert. Drum will auch dieser wie die andern viele Kinder, um sein Geschlecht zu sichern; sie aber lernte von Mutter und Ahnin, dass Kinder Ehre bedeuten. Mit Fünfzehn hat sie das Erste geboren, doch erst dies Jahr hat sie den ersten Knaben behalten.
Wie sich das Bild der Freiheit belebt, denn der Offizier ist Paolis Adjutant, des Volksführers. Ja, unsre Kinder werden nicht mehr Frankreichs Sklaven sein!
II
Doch mit dem Frühling sinkt allen das Herz. Neue Truppen hat der Feind gelandet, noch einmal waffnen sich die Söhne der Insel, wieder ist das junge Weib mit ihrem Manne, ein Kind unterm Herzen, das sie in jenen Herbststürmen empfing. „Oft schlich ich mich um Nachrichten aus unserm Bergverstecke bis ans Schlachtfeld, ich hörte wohl die Kugeln pfeifen, doch ich vertraute der Madonna.“ So erzählte sie’s später.
Im Mai verlieren sie die Schlacht: furchtbarer Rückzug durch das Dickicht der Wälder, durch die Schroffen des Gebirges. Zwischen den vielen Männern und den wenigen Frauen reitet Laetitia, schwanger, das Einjährige im Arm, auf dem Maulesel zur Küste. Im Juni muss der geschlagene Paoli mit ein paar hundert Getreuen fliehen, hinüber nach Italien, im Juli steht der Offizier, sein Adjutant, mit einer Gruppe Abgesandter vor dem Eroberer und kapituliert. Der Inselstolz ist gebrochen. Doch im August bringt seine Frau den Rächer zur Welt.
Sie nennt ihn Napolione.
Das ist eine kluge, sparsame Hausfrau, hier an der Küste, in dem großen Haus, nahe dem Strande, sie, die im Felde nur mutig und männlich schien. Und muss sie’s nicht, da der junge Gatte, immer phantastisch, mehr von Plänen lebt als von Einkunft, durch Jahre den großen Prozess um das ererbte Gut gewinnen will und als Student in Pisa sich zwar Graf Bonaparte genannt, gut gelebt, doch wenig studiert, und erst jetzt, nach des zweiten Sohnes Geburt, das Studium rasch beendet hat. Wovon also leben? In schweren Zeiten nimmt man die Welt, so wie sie ist, verträgt sich mit dem Eroberer, zumal der Franzose die adligen Eingebornen begünstigt, um Fuß zu fassen.
Rasch wird man Assessor am neuen Gericht, Aufseher einer Baumschule, in der der König von Frankreich auf seiner neuen Insel Maulbeeren ziehen will, und wenn der vornehme Marschall zu Gaste kommt, wird man die Kosten nicht bereuen. Man hat auch noch Schafherden in den Bergen, Weingärten am Meer, der Bruder, Erzpriester an der Kathedrale, ist begütert, und auch der Stiefbruder der Frau, Priester wie jener, ist nicht umsonst eines Kaufmanns Sohn, geschickt in Weltgeschäften.
Später aber, als die schöne, stolze Frau im dreißigsten Jahre steht, drängen sich fünf Knaben und drei Mädchen um sie her: so will es der Familiensinn des Insulaners, dem Wettkampf und Vendetta höchste Tugenden sind. Acht kleine Wesen aufzuziehen ist schwer und teuer, da hören die Kinder im Hause täglich von Gelde reden. Doch am Ende weiß sich der Vater zu helfen und mit dem zehn- und elfjährigen Knaben setzt er sich eines Tages auf den Segler nach Frankreich und reist von Toulon nach Versailles.
Der Marschall auf Korsika hat ihn empfohlen, nun wird vom Heroldsamt der italienische Adelsbrief Derer von Bonaparte bestätigt, und König Ludwig lässt diesem Beamten, der ein Jahrzehnt loyal gewesen, 2000 Francs geben und für zwei Söhne und eine Tochter Freistellen in den Adelsschulen: einer soll Geistlicher werden, der andre Offizier.
III
In seiner Gartenecke sitzt ein schweigsamer Knabe, klein, menschenscheu und einsam, und er liest. Um das Stückchen Garten, das ihm hier auf der Schule von Brienne angewiesen ist, hat er einen Zaun gelegt. Zwar, eigentlich gehört ihm nur ein Drittel, denn er hat die Teile seiner beiden Nachbarn gleich mit umzäunt, die lässt er auch herein, doch wehe sonst jedem, der ihn stört! Wütend stürzt er dann vor, und selbst neulich, beim Feuerwerk, wo sich ein paar Kameraden an der Flamme verletzten und grade in seine Ecke geflüchtet hatten, vertrieb er sie mit der Hacke.
Da hilft keine Strafe, kopfschüttelnd lassen ihn die Lehrer gewähren: „Der Junge ist von Granit, urteilt ein Lehrer, drinnen aber hat er einen Vulkan“. Ja, dies kleine Reich, das ihm gehört, obwohl zum Teil usurpiert, darf niemand antasten: so groß ist sein Gefühl für seine eigene Freiheit, und bald schreibt er dem Vater: „Lieber will ich der Erste sein unter den Arbeitern einer Fabrik, als der letzte Künstler auf der Akademie.“ Hat er das schon bei Plutarch gelesen? Der ist es, der ihn begeistert! Dort steht das Leben großer Männer aufgezeichnet, vor allem der römischen Helden: darüber lässt sich träumen. Niemand berichtet, dass er den Knaben je lachen sah.
Wie ein halber Wilder, zumindest als ein wunderlicher Fremder ist er den Kameraden erschienen. Französisch kannte der Italiener kaum und scheint auch nicht geneigt, sich vor der Sprache seiner Feinde zu beugen. Was für ein Knirps er ist! Was für einen komischen Namen er trägt! Sein Rock ist ihm zu lang, Taschengeld hat er nicht und kann sich nichts kaufen, und da behauptet er gar von Adel zu sein! Die jungen Grafensöhne lachen: Korsischer Adel, was sind das für Leute! Und wenn ihr denn so tapfer seid, warum habt ihr euch von unseren nie geschlagenen Truppen besiegen lassen?
„Wir waren Eins gegen Zehn“, ruft in bösem Zorn der Junge zurück. „Wartet nur, bis ich groß bin: ich will euch Franzosen alles Böse antun!“
„Dein Vater ist nichts als ein kleiner Sergeant!“
Wutausbruch des Knaben, er fordert den Rufer, Hausarrest, hilferufender Brief an den Vater: „Ich bin es müde, meine Armut zu erklären, den Spott von fremden Jungen anzuhören, die mir nur durch Geld überlegen sind, an edlen Gefühlen tief unter mir stehen. Muss ich mich wirklich diesen Kerlen beugen, die auf ihren Luxus pochen?“ Doch von der Insel kommt es zurück, wir haben kein Geld, du musst bleiben.
Er bleibt fünf Jahre, und wie mit jeder Zurücksetzung das revolutionierende Gefühl in ihm steigt, so wächst mit der Menschenverachtung das Selbstgefühl. Zwar, mit den Lehrern, die Mönche sind, steht er nicht schlecht, doch leistet er nur viel in Mathematik, Geschichte, Länderkunde: solchen Dingen, die den exakten Geist, das forschende Auge und die zudem den Groll eines Unterworfenen fesseln.
Denn immer bleibt sein Blick der Insel zugewandt. Dem Vater wirft er’s heimlich vor, dass er sich mit den Franzosen eingelassen, und ist schon heute entschlossen, vom König, als dessen Gast er studiert, alles anzunehmen, um einst alles gegen ihn zu brauchen. Dunkel strömt in ihm das Vorgefühl, seine Insel zu befreien. Machtlos aber, wie er heut noch ist, lässt sich der Vierzehnjährige Bücher und Denkschriften über die Heimat schicken: man muss die Geschichte erst studieren, will man sie fortsetzen. Zugleich verschlingt er, was Voltaire, Rousseau, auch was der große Preußenkönig noch eben vor seinem Tode für Korsikas Befreiung schrieb.
Was wird ein so vereinsamter, in stolzen Plänen grollender, rebellisch brütender, misstrauisch prüfender Knabe zuerst? Ein Menschenkenner, frühreif, überlegen. Als Joseph, der Ältere, von der geistlichen zur Offiziersbahn wechseln will, schreibt über ihn der Jüngere: „1. fehlt es ihm an Kühnheit, um den Gefahren einer Schlacht zu trotzen . . Er wird ein guter Garnisonoffizier: schön gewachsen, von leichtem Witz, daher geneigt zu frivolen Komplimenten, wird er sich stets gut in die Gesellschaft fügen. Aber in der Schlacht? 2. ist es zum Umsatteln zu spät, er hätte eine reiche Pfründe bekommen; welcher Vorteil für die Familie! 3. In welches Korps? In die Marine? a) keine Kenntnis der Mathematik, b) keine Ausdauer für diesen Dienst. Auch die konsequente Arbeit bei der Artillerie erträgt seine leichte Art nicht.“ Erwägungen eines 15-jährigen Menschenkenners, der sich selbst genau das zuschreibt, das er jenem abspricht; zugleich vollkommene Beschreibung des älteren Bruders, der dem Vater glich.
Er selbst, Napoleon, erbte von diesem Phantasie und Gewandtheit, von der Mutter Stolz, Mut und Exaktheit; Gefühl der Sippe von beiden.
IV
Nur die Koppel gehört Frankreich, seine Schärfe gehört mir! denkt er, als er zum ersten Mal den Degen umschnallt. Denn mit 16 ist man Seconde-Lieutenant, und er wird im Leben die Uniform nur noch ein paarmal abtun. Erworben hat er sie auf der Pariser Kadettenschule, in der er sein Jahr verbrachte, als wäre er noch in Brienne: grenzenlos lesend. Diesem Spartaner ist das Dekorum hier erst recht unbequem, wo Frankreichs Hochadel ihn zurückstößt. Doch da er sich von Natur immer als Zentrum der Welt fühlt, nur entschiedener als es die andern tun, macht er sogleich aus seiner Notlage ein Gesetz und erörtert in einer Denkschrift, dies reiche Leben zieme nicht künftigen Soldaten. Schuldenmachen mag er nicht, er kennt zuhause die Misere, und als nun auch der Vater stirbt, wirft sich das Familiengefühl dieses Italieners gewaltig auf die Seinen. Jetzt fängt er an, ein halber Knabe, für die Mutter zu sparen.
Das Examen, schlecht und recht bestanden, bringt ihm dies Zeugnis ein: „Zurückhaltend und fleißig, zieht er Studien jeder Art der Unterhaltung vor und erwärmt sich an guten Schriftstellern . . Er ist schweigsam, liebt die Einsamkeit, ist launisch, hochmütig und sehr egoistisch. Ohne viel zu reden, ist er in seinen Antworten entschieden, schlagfertig und überlegt in der Debatte. Viel Eigenliebe und ein Ehrgeiz, der nach allem strebt.“
Der kleine Leutnant, der in der neuen Uniform zu seinem Regiment nach Valence reist, den halben Weg zu Fuß, denn er ist arm, fühlt drei Antriebe im Jünglingsherzen: Menschen, meist hohl und hochmütig, verachten und benutzen; Misere überwinden; viel lernen, um andre zu beherrschen. Mittel und Ziel dieses Wegs ist das nämliche: im Kampf auf der Insel Führer sein und dann ihr Herr.
Wie langweilig ist diese Garnison! Man sollte tanzen lernen, in lustige Gesellschaft gehen, und er versucht’s, gibt es bald wieder auf, denn ein so großer Stolz will seine Armut verbergen. Geht man aber mit Bürgern um, mit Advokaten, Kaufleuten, da kann man erstaunliche Dinge hören, die scheinen die jungen Vicomtes in Paris gar nicht zu ahnen. Es ist also wahr? Aus Voltaires, Montesquieus, aus Raynals Schriften stieg wirklich der Geist schon bis zu den kleinen Bürgern in die Provinz herunter? Stehen wir im Ernst vor der Bewegung, die diese Propheten beschworen: stehen wir vor der Revolution?
Die Bücher rufen es in die Welt. Lesen ist umsonst, wie Atmen, und hat man die Leihbibliothek verschlungen, so kann man sich doch zuweilen für zwei abgesparte Francs ein neues Buch erstehen. Zwar, das Billard im Nebenzimmer, denn er wohnt im Café, ist lästig, Umziehen aber ist noch lästiger; in Gewohnheiten ist er konservativ.
In den Gefühlen? Lasst sehn, denn ihn wie jeden jungen Mann seiner Epoche regt nichts heftiger auf als Staat und Gesellschaft. Da sitzt er neben dem Billardzimmer, bleich, einsam, in glühender Dumpfheit, und während seine Kameraden nach kurzen Dienststunden das Weite suchen, Spiel oder Weiber, hockt der arme Leutnant und studiert mit unbeirrbarem Instinkt das und nur das, was er einst brauchen wird: Grundsätze und Geschichte der Artillerie, Regeln der Belagerung, Platons Staat, Verfassung der Perser, Athener, Spartaner, Englands Geschichte, Friedrichs Feldzüge, Frankreichs Finanzen, Länder und Sitten der Tartaren und Türken, Geschichte Ägyptens und Karthagos, Beschreibung Indiens, englische Berichte über das gegenwärtige Frankreich, Mirabeau, Buffon und Machiavelli, Geschichte und Verfassung der Schweiz, Geschichte und Verfassung Chinas, Indiens, der Inkas, Geschichte des Adels, Verbrechen des Adels, Astronomie, Geographie, Wetterkunde, Gesetze der Fortpflanzung, Statistik der Sterblichkeit.
Dass er dies und vieles daneben nicht durchfliegt, sondern durchdringt, bezeugen die Reihen von Heften, in denen er, mit einer fast unleserlichen Handschrift, sich die genausten Auszüge macht; der Abdruck der Hefte füllt allein 400 Seiten. Da steht in Handschrift der ganze Plan der sieben sächsischen Reiche in England und deren Könige durch drei Jahrhunderte zu lesen, die Formen des Wettlaufs im antiken Kreta, Listen altgriechischer Befestigungen in Kleinasien, die Daten von 27 Kalifen mit der Zahl ihrer Reiter und den Untaten ihrer Frauen.
Am reichsten sind die Auszüge über Ägypten und Indien, die bis zu den Maßen der Großen Pyramide und zu den einzelnen Sekten der Brahminen reichen. Da liest er eine Stelle bei Raynal: „Im Anblick Ägyptens, das zwischen zwei Meeren liegt, in Wahrheit zwischen Orient und Okzident, fasste Alexander der Große den Plan, den Hauptsitz seines Weltreiches dorthin zu legen und Ägypten zum Mittelpunkt des Welthandels zu machen. Dieser aufgeklärteste aller Eroberer begriff: gäbe es ein Mittel, alle seine Eroberungen in einem Staatswesen zusammenzuschließen, so kann dies nur Ägypten sein, geschaffen Afrika und Asien mit Europa zu verbinden.“ Dreißig Jahre später hat er die Worte noch im Gedächtnis. So oft hatte er sie gelesen.
Zugleich beginnt er selbst zu schreiben, mehr als ein Dutzend Schriften und Entwürfe in diesen Jahren: über Aufstellung von Kanonen, über Selbstmord, über Königsgewalt, über Ungleichheit der Menschen, vor allem über Korsika. Vor seiner entschiedenen Sachlichkeit, vor diesem Realistenblick zerschmilzt der populärste Autor jener Jahre, Rousseau; die Auszüge über Rousseaus Ursprung des menschlichen Geschlechtes werden dauernd von den resolut wiederholten Worten unterbrochen: „Von all dem glaube ich kein Wort.“ Dann lässt er auf ein paar Seiten seine Gegenansicht folgen: nicht einsam, nicht nomadenhaft haben die Menschen gelebt, sie waren nur glücklich und separiert, weil sie nicht zahlreich und nah beieinander lebten. Als sie sich vermehrten, „da ist die Phantasie aus ihrer Höhle getreten, wo sie lange eingesperrt war: Selbstgefühl, Leidenschaft, Stolz erhoben sich, und es kamen Ehrgeizige mit bleichen Zügen, die sich der Geschäfte bemächtigten und der jungen Gecken mit ihren blühenden Farben, dieser Weiberhelden und Schürzenjäger.“
Hört man ihn schon an seinen Ketten rasseln, in der dunklen Höhle, in der er mit seiner ungeheuren Phantasie verschlossen lebt? Sieht man ihn hier, mit seinen bleichen Zügen, mit seinem Hass gegen die blühenden Schürzenjäger im Regiment?
Fort von diesen Menschen, es sind Franzosen! Auf die Insel bleibt sein Blick gerichtet, schon dreht er auch die neue Staatsanschauung auf dies Ziel, er schreibt: „Wie absurd, als Gottes Gebot aufzustellen, man dürfe das Joch des Usurpators nicht abschütteln! Da wäre jeder Fürstenmörder, der sich den leeren Thron erringt, sofort durch Gott geschützt, während er doch beim Misslingen den Kopf verlor. Um wieviel eher darf ein Volk den eingedrungenen Fürsten absetzen. Spricht das nicht für die Korsen? . . So können wir Frankreichs Joch abschütteln, wie Genuas. Amen.“
Indes, der junge Geist will sich fühlen, und so entwirft er einen Roman auf Korsika, auch Novellen, alles vom Hass gegen Frankreich gespeist, doch nichts beendet. Zugleich lernt er immer sein Handwerk, gespornt durch Armut, Leidenschaft und das Gefühl: Phantasie regiert die Welt, aber Kanonen verwirklichen die Phantasie. „Ich habe keine Zuflucht als meine Arbeit. Ich ziehe mich nur alle acht Tage einmal um. Seit ich krank lag, schlafe ich nur wenig . . Ich esse nur einmal täglich.“
Er studiert Geschütze und Munition, immer in Zahlen denkend, bis alle sagen, er ist für die Mathematik geschaffen. Nun zeichnet er, neben jene phantastischen Entwürfe, genau die Punkte auf der Insel ein, wo er Kanonen aufstellen, Schanzen aufwerfen, Truppen stationieren würde, — hätte er nur die Macht! Unter das Netz dichterischer Gedanken, das er der Insel übergeworfen, spannt er auf seinen Karten das zweite Netz, in dem Kreuze Kanonen bedeuten. Karten, Karten! Und er studiert in seinem Zimmer neben dem lärmenden Café aufs Neue alles, was sich berechnen lässt, kopiert ganze Reden aus dem Londoner Parlament und skizziert die fernsten Teile der Erde. Am Schluss des letzten Heftes, die letzte seiner Notizen lautet: „St. Helena, kleine Insel im atlantischen Ocean. Englische Kolonie.“
Da kommt aus der Heimat ein Brief der Mutter: ihr mächtiger Patron, der Marschall ist tot, nun fehlt es dem Hause an Beistand, auch die Baumschule hat man der Mutter gekündigt, Joseph ist ohne Stellung, jetzt ruft sie den Zweiten zu Hilfe. Bald segelt er mit Urlaub heim. Ist es ein heimlicher Sieger, der nach der Insel seiner Pläne und Träume zurückkehrt? Aus dem Tagebuch:
„Immer allein, auch unter den Menschen, komme ich nach Hause, um mich meinen einsamen Träumen und den Wellen meiner Schwermut hinzugeben. Wohin neigt sie sich heute? Dem Tode zu. Und doch stehe ich an der Schwelle des Lebens und darf hoffen, lange zu atmen. Seit 6 Jahren oder 7 bin ich dem Vaterlande fern. Welche Freude . . die Meinen wiederzusehen! . . Welcher Dämon treibt mich also, mich selbst zu zerstören? . . Da ich immer Unglück habe und mir nichts Freude macht, warum ein Leben ertragen, in dem mir alles misslingt! . . Welches Schauspiel zu Hause! Meine Landsleute in Ketten küssen die Hand, die sie schlägt . . Stolz, erfüllt vom eigenen Wert, so lebte einst glücklich der Korse, den Tag für den Staat, die Nacht in den Armen der liebenden Gattin, — Natur und Zärtlichkeit machten sie ihm zur Götternacht. Mit der Freiheit sind diese glücklichen Zeiten wie Träume verschwunden. Franzosen! Ihr raubt uns nicht nur das höchste Gut, nun verderbt ihr noch unsere Sitten! Solch ein Blick auf mein Vaterland, dazu volle Ohnmacht, zu helfen: Gründe genug, um eine Welt zu fliehen, in der ich Die rühmen muss, die ich hasse. . Hätte ich nur einen Einzigen umzubringen, um uns zu befreien, gleich machte ich mich auf. . Das Leben ist mir zur Last, ich habe keinen Genuss, alles wird Schmerz, . . und weil ich nicht auf meine Art leben darf, wird mir alles zuwider.“
V
Und hoffnungslos, nach einem dumpfen Jahre, das er zwischen Geld- und Familiensorgen auf der Insel verbrachte, muss er zurück in die Garnison, diesmal heißt sie Auxonne, was hilft der Wechsel.
Da! Einmal lässt man ihn endlich vor: dem 19-Jährigen befiehlt der neue General, der sein Wissen erkannt hat, einige Werke auf dem Übungsplätze zu errichten, „die schwierige Berechnungen erfordern, und so bin ich seit zehn Tagen ununterbrochen, vom Morgen bis zum Abend an der Spitze von 200 Mann tätig. Diese ungewöhnliche Bevorzugung hat die Hauptleute gegen mich aufgebracht, die schimpfen, dass ein Leutnant ihnen für so wichtige Dinge vorgezogen wird.“
Wieder wird er zurückgedrängt. So wird man sich mühsam weiterschleppen, um dann als Hauptmann pensioniert, mit der Franzosenrente zu Hause verachtet, schließlich in der mütterlichen Erde verscharrt zu. werden, — das Einzige, was sie uns nicht rauben können! Also waren es doch nur Schäume, die Träume von Freiheit, die jene Bücher verkündeten? Wenn sich das mächtige Frankreich selber nicht befreit vom Drucke seines Adels, von Bestechung und Vetterschaft, wie soll das kleine Korsika von Frankreich sich befreien!
Mit neuen Entwürfen füllt der junge Autor sein Tagebuch. Wehe, wenn das schmale Heft dem Vorgesetzten in die Hände fiele, er läse: „Entwurf zu einer Denkschrift über die Königsgewalt. Die Einzelheiten der usurpierten Macht darzustellen, die die Könige in den 12 Monarchien Europas heute genießen. Nur wenige sind unter ihnen, die nicht verdienten, abgesetzt zu werden.“ So knirscht er ins verschwiegene Tagebuch, während er draußen am Namenstag jedes Prinzen in Gala rufen muss: Es lebe der König!
Noch einmal geht ein Jugendjahr in dumpfem Dienst dahin, schweigend, wartend, zwischen Dichtung und Mathematik.
Da bricht das Jahr des Schicksals herein, bis in die Nester der verschlafenen Provinz dringt das Vorgefühl von Trommeln, die noch nicht wirbeln: wir schreiben Juni 1789. Da fühlt der melancholische Leutnant die Epoche der Vergeltung nahen! Soll sich der Hochmut Jener selbst vernichten, die ihn so lange kränkten? Ist dieser Ruf der Tausende nicht auch sein Schlachtruf für die Insel? Und er nimmt seine Korsischen Briefe, schickt sie dem bewunderten Vorbild, Paoli, in die Verbannung, und schreibt:
„General! Ich kam zur Welt, als mein Vaterland unterging. Das Röcheln Sterbender, die Tränen Verzweifelnder umrauschten meine Wiege . . Mit ihnen entschwand alle Hoffnung. Knechtschaft war der Preis unserer Unterwerfung. Um sich zu rechtfertigen, haben die Verräter Verleumdungen gegen Sie gehäuft . . Als ich dies las, geriet mein Blut in Wallung, und ich beschloss, die Nebel zu verscheuchen. Nun werde ich Alle, die die gemeinsame Sache verrieten, mit dem Pinsel der Schmach anschwärzen, . . die Regierenden öffentlich anklagen, alle Skandale aufdecken . . Lebte ich in der Hauptstadt, ich fände andere Mittel . . Bei meiner Jugend ist dies Unternehmen vielleicht verwegen, doch Liebe zur Wahrheit, zum Vaterlande, Begeisterung soll mir helfen. Wenn Sie, General, in dieser Arbeit einen jungen Mann ermutigen wollen, den Sie zur Welt kommen sahen, dann fasse ich Zuversicht . . Meine Mutter, Madame Laetitia, hat mir aufgetragen, Sie an die in Corte verlebten Tage zu erinnern.“
Ein neuer Ton, Symphonie von neuen Tönen: das schwingende Pathos der Epoche, die Geste des Tyrannenmörders, der ganze Aufwand glänzender Worte, nicht etwa gefühlt wie die Seiten des Tagebuches, alles auf Wirkung gesprochen. Nur eins ist neu, das ist erschreckend neu, das gehört ihm allein: das entscheidende Ich an der Spitze des Briefes, dies Ich als große These, in Front zur Welt gestellt. Zum ersten Mal bricht maßloses Selbstgefühl sich seine Bahn, weil jetzt die ersten Trommelschläge einer neuen Zeit ertönen, die nicht Geburt krönt, sondern Leistung, und so das einzige Hindernis wegwirbeln, das unüberwindlich war. Ein beispielloser Anspruch tritt hervor, er wird von heut ab nicht ruhen; am Schluss des Schreibens aber wird er mit einer fast galanten Wendung ins Familiäre zurückgebogen, aus dem sich Protektion errechnen lässt. Welche Gewandtheit, welche Courtoisie in allen Briefen des Halbwüchsigen, der persönlich rau und dunkel bleibt!
Paoli, aus einer anderen Zeit, verdrießt solcher Hochmut, er erwidert höflich, junge Leute sollten nicht Geschichte schreiben.
Vier Wochen nach dem Briefe beginnen junge Leute Geschichte zu machen, zum ersten Mal seit hundert Jahren: sie stürmen die Bastille in Paris, das große Signal ist gegeben, Frankreich eilt zu den Waffen, auch in der Garnison des jungen Leutnants plündert die Menge, bis sich die Besitzenden mit den Truppen vereinen, und neben der Kanone auf der Straße steht auch der Leutnant und schießt ins Volk. Dies ist Bonapartes erster scharfer Schuss, auf Befehl des königlichen Offiziers, doch sicher auch von ganzem Herzen in die Menge gefeuert, denn er verachtet sie nicht minder als den Adel.
In der Tiefe seiner Seele aber ist ihm all das fremd: was gehen ihn die Franzosen an, die gegen Franzosen wüten! Nur ein Gedanke verzehrt sein Hirn: Jetzt Korsika! Jetzt diese Wut oder ist es Begeisterung, jetzt dieses Ideal oder ist es nur ein Stichwort, auf unsre Insel tragen! Jetzt Urlaub und im Wirrwarr der neuen Bewegung zu Haus der Erste sein!
VI
Wie ein Prophet, der seine neue Lehre an fremde Küste trägt, so landet der Leutnant Bonaparte auf seiner Insel: denn als der erste bringt er die rote Kokarde, die Freiheit verheißt, Gleichheit und Brüderlichkeit. Lag nicht hier ein freies Bergvolk, das sich einst selbst regierte, seit zwanzig Jahren unter dem Druck des Eroberers, der Adel und Kirche benutzte und das Volk nicht begriff?
Was kümmert es den jungen Jakobiner, dass er bis gestern vom Adel seiner Ahnen gelebt, durch ihn allein zur Erziehung auf Kosten des Königs zugelassen war! Was kümmert ihn der König! Hieß es nicht endlich, die Völker sind frei, sich selber zu regieren? Spricht so das neue Frankreich, das eben erwachte, so muss sich auch die Insel für frei erklären, die das alte in Ketten schlug. Mitbürger! Die Zeit ist erfüllt! Bewaffnet euch! Jeder trage die Kokarde der neuen Epoche, man bilde eine Nationalgarde wie in Paris! Lasst uns die Mittel der Macht den Truppen des Königs entreißen! Ich weiß mit Kanonen umzugehen, ich will euch führen!
20-jährig, bleich, mit blaugrau kalten Augen, doch den Mund von glühenden Worten voll: so hastet der junge Bonaparte, den jeder im kleinen Ajaccio kennt, durch die Straßen, gefolgt von einer wachsenden Menge, die teils die Freiheit, teils Veränderung wünscht, so tritt er auf dem Platze vor die Schar, ein leidenschaftlich Hoffender, ganz ein Tribun. Ja, in diesem halborientalischen Volke, so sagt er später, zwischen diesen streitsüchtigen Familien „lernt man früh das menschliche Herz studieren“.
Rückschlag: aus dem Berglande bleibt der Zuzug aus, und als die legitimen Truppen kommen, treiben sie die Revolutionäre zu Paaren, alles wird in ein paar Stunden entwaffnet, doch aus Klugheit nicht verhaftet. Neue Enttäuschung: nicht einmal Märtyrer, nur ein geschlagener Volksführer zu sein, ist nah am Lächerlichen. Doch brennt das Fieber in den Adern, greift man nach jedem Mittel, es zu kühlen. Klageschrift an die Nationalversammlung in Paris: zuerst, im strömenden Stil der Zeit, eine Ode auf die neue Freiheit, dann ein Wirbel von Anklagen und Beschwörungen: — An den Galgen mit den Beamten des Königs! Bewaffnet die Bürger der Insel! Und rasch unterzeichnet mit ihm ein Komitee das Papier.
Wochen des Wartens: was wird Paris erwidern? Endlich landet der Kurier: die Insel ist mit allen gleichen Rechten französische Provinz, Paoli wird auf Mirabeaus Antrag mit allen Freiheitskämpfern heimgerufen. Der Leutnant stutzt: — Provinz? So wird man also trotz der neuen Ideen und grade durch diese Franzose? Sonderbare Form der Freiheit! Doch da drängt sich schon der Zug zur Kirche, an der Spitze die Behörden, um das Pariser Dekret einsegnen zu lassen. Rasch fasst man das Seil, das alle fassen, schreibt feurige Manifeste an seine Mitbürger, sucht Anhang im neuen Club, bringt den älteren Bruder in den Gemeinderat. Dazwischen schreibt er weiter an seiner Korsischen Geschichte und liest der Mutter Stücke daraus vor.
Ist dies der große Paoli? fragt sich Bonaparte, als er den Helden seiner Phantasie nach 20 Jahren der Verbannung unter Jubel heimkehren sieht. Wie maßvoll er redet und blickt, wie politisch, wie unsoldatisch! Doch man muss sich mit ihm stellen, da er nun auch die Nationalgarde kommandieren wird. In den Bergen verbringt er einige Zeit in der Nähe des Mannes, der seines Vaters Chef gewesen, gerade bevor er selber zur Welt kam.
Und wie sie miteinander sitzen und reiten, der erprobte alte, der dunkel strebende junge Korse, und er entwickelt ihm mit Feuer seine bewaffneten Pläne, um mit Gewalt die Insel auch von dem neuen Frankreich loszureißen: da sieht der Alte ihn mit einem Blick an, zwischen Stolz und Schrecken: nun fühlt er, der Autor jener Korsischen Briefe hat wirklich einen Anspruch auf sein Ich: er hat ja den Teufel im Leibe, noch schlimmer, im Hirn, denn darin glänzt allein das Bild des Schwertes, und er sagt kopfschüttelnd: „Du hast nichts Modernes an dir, Napolione, Du kommst aus dem Zeitalter des Plutarch!“
Zum ersten Male fühlt sich der junge Mann erkannt: Plutarchs Helden allein, diese Römer genügen seinem Streben. Paoli als erster hat in Bonaparte den Römer erkannt.
Da hat er endlich ein Wort, an dem sein Selbstgefühl sich aufzuranken weiß, und als er jetzt auf dem Lande in Paolis Auftrag ein Manifest schreibt, da datiert die Feder dieses Fiebernden: „23. Januar des 2. Jahres, in meinem Kabinett zu Midilli.“ Ist es grotesk oder erhaben? Auf jeden Fall muss der junge Mann am Tage nach dieser diktatorischen Unterschrift in seine Garnison zurückeilen, denn der immer verlängerte Urlaub ist abgelaufen. Und soll man diesen letzten Rückhalt opfern? Wofür? Was soll er jetzt auf der Insel? Der erste Platz ist besetzt.
VII
„Ich sitze in einer armen Hütte und schreibe dir, nachdem ich mich mit den Insassen lange unterhalten . . Es ist abends vier, die Witterung frisch, es hat mir Spaß gemacht zu Fuß zu reisen, Schnee fällt nicht, doch ist er nicht fern . . Überall habe ich die Bauern fest gefunden, sämtlich bereit, für die neue Verfassung zu sterben. . Nur die Frauen sind überall royalistisch: kein Wunder, denn die Freiheit ist ein Weib, das sie alle durch ihre Schönheit aussticht. Die Priester der Dauphine haben alle den Zivileid geleistet, man lacht über die Bischöfe . . Was man die gute Gesellschaft nennt, dreiviertel Aristokraten, spielt Anhänger der englischen Verfassung. Teretti (ein Korse) hat Mirabeau wahrhaftig mit dem Messer bedroht, das macht uns wenig Ehre. Unser Club müsste Mirabeau unsre Nationaltracht zum Geschenk machen, also Barett, Weste, Hose, Patronentasche, Stilett, Pistole und Büchse; davon verspreche ich mir einen guten Effekt.“
Alles in diesem Brief an den geistlichen Onkel zu Hause zeugt von Beobachtung und von Berechnung, den Elementen des Politikers: so sind Wetter und Staat, eine Fußreise und die Beschwichtigung eines Mächtigen, die Motive der Menschen bedacht. Eitelkeit und Habgier, das sind die Schwächen, an denen man sie fasst, und tief in seine eigne Seele blickt man, wenn man ihn in einem offenen Brief aus diesen Wochen den Gegner anklagen hört: „Als wahrer Menschenkenner wussten Sie, wieviel die Begeisterung jedes Einzelnen kostet: ein paar Goldstücke mehr oder weniger bezeichneten Ihnen den Unterschied der Charaktere!“
Goldstücke! Wer sie hätte! Jetzt hat er Louis, den dreizehnjährigen Bruder mit sich genommen, und wie er nun als Premierlieutenant wieder nach Valence kommt, haben sie 85 Francs zusammen, zum Leben, Kleiden und zum Unterricht des Knaben. Da bürstet man selber die Kleider.
Geld! Nicht um zu genießen er verachtet die Genießenden doch nm sich aufzuschwingen! Hat nicht die Akademie von Lyon eine Preisaufgabe gestellt: 1200 Francs! Damit könnte man die halbe Insel bewaffnen! „Welche Wahrheiten und Empfindungen sind vor allem geeignet, die Menschen glücklich zu machen?“ Der Leutnant lächelt: damit kann ich dienen. Erst gibt er seine Karte ab bei den Akademikern, diesen Schülern Rousseaus, die die Aufgabe stellten, preist die Freude an Natur, Freundschaft, schwärmerischem Müßiggang, drei Dingen, die er weder kennt noch schätzt. Plötzlich wird alles politisch gewendet, gegen die Könige, für freien Genuss Aller an Besitz und Recht. Doch dann kommt, mit unheimlichem Tone, als sähe er sich in dem Spiegel, wieder der bleiche Mann wie vor ein paar Jahren: „Der Ehrgeizige mit bleichem Gesicht, mit sardonischem Lachen, spielt mit dem Verbrechen, sein Werkzeug wird die Kabale . . Gelangt er endlich ans Ruder der Macht, dann ermüdet ihn bald die Huldigung der Menge . . Die großen Ehrgeizigen haben das Glück gesucht und den Ruhm gefunden.“
Erhabene Vorgefühle, eines plutarchischen Charakters wert! Doch gleich wird es noch deutlicher werden: das Ideal ist Sparta, Mut und Kraft sind die großen Tugenden. „Des Spartaners Regung war die eines Mannes in der Fülle der Kraft. Weil er seinem Wesen gemäß lebte, darum war er glücklich. Nur das Starke ist gut, das Schwache ist böse.“ Und nochmals glüht Vorgefühl auf in den Sätzen: „Die wahrhaft großen Männer sind wie Meteore: sie glänzen und verzehren sich, um die Erde zu beleuchten.“
Das war zu viel für die Akademie, sie fand die Arbeit „nicht der Beachtung wert“. Neue Enttäuschung: kein Geld, kein Ruhm. Doch unverdrossen schreibt er weiter am Roman auf Korsika und einen Dialog über die Liebe.
Wie? Strahlt auch dies Wort in solche dunkle Jugend? Werden wir einen Erguss im Tone Rousseaus hören? So urteilt der 22jährige Oberleutnant: „Auch ich war einmal verliebt und weiß genug davon, um Definitionen zu verachten, die die Sachen nur verwirren. Ich leugne ihre Berechtigung, ja mehr, ich halte sie für schädlich für die Gesellschaft wie für das Glück des Einzelnen. Ein Segen des Himmels wäre es, die Menschen davon zu befreien.“
Fanfaren unterbrechen solche Erwägungen des politischen Dichters, Fanfaren aus Paris! Der König ist gefangen, das Volk triumphiert, die Revolution verschärft sich. Am zweiten Gedenktage der Bastille bringt der rote Leutnant einen Trinkspruch den Patrioten. Da brausen von der Insel selber die Rufe der Verwirrung zu ihm herüber, die Synkopen der Anarchie; denn immer schlagen in jenen Jahren die wild geschleuderten Steine des aufgewühlten Meeres von Paris ihre Kreise bis an ferne Küsten. Auch Korsika steht vor dem Bürgerkrieg. Hinüber, um es ein zweites Mal zu wagen!
VIII
Nun wird der Leutnant zum Coriolanus: Stimmen fangen, Menschen fangen! denn seit das Volk entscheidet, braucht man Volkstümlichkeit. Gut, dass grade jetzt der Erbonkel starb: so geht es der Familie besser. In den Club versteht man den andern Geistlichen zu bringen, Mutters Bruder Fesch. Joseph kann im Gemeinderat Stimmung machen. Ist denn sonst einer auf der Insel, der gelernt hat, eine Batterie zu richten? Die Nationalgarde führen: das wäre die reale Macht. Doch wenn man nicht gewählt wird?
Diesmal läuft der Urlaub schon Neujahr ab: Vorsicht! Er schreibt seinem Chef: „Zwingende Umstände haben mich genötigt, länger auf Korsika zu bleiben, als meine Pflicht erlaubt, doch habe ich mir nichts vorzuwerfen: heiligere Pflichten, teurere, sprechen für mich.“ Man möge ihn ja nicht streichen! Keine Antwort? Man muss es dennoch wagen.
Jetzt kommt der Wahlkampf um die Kommandostelle. Verwandte überall, doch das ist nicht genug. Gedeckt steht immer der Tisch bei der Mutter für die Parteifreunde, auch nachts logieren dort Leute, die aus den Bergen kamen; so macht man Stimmung. „Er war damals, schreibt ein Kamerad, einmal schweigsam und nachdenklich, dann wieder freundlich, schmeichelnd zu aller Welt, unterhielt sich mit jedem, besuchte, die ihm nützen konnten, und suchte jeden zu gewinnen.“ Als dann die Kommissare kommen, lässt er den einen gewaltsam in seinem Hause festhalten, Anhänger seiner Konkurrenten lässt er verprügeln; das ist korsischer Wahltag. Aber am Abend nach diesem herzklopfenden Tage hat er es endlich erreicht: er ist Zweiter Kommandant geworden, Oberstleutnant.
Nimmt er nun seine Entlassung in Frankreich, dieser Italiener? Vorsicht! Nie sich den Rückzug versperren, hat er aus den Büchern der Feldherrn gelernt. „In dieser schwierigen Lage, schreibt er jetzt nach Valence, ist der Ehrenposten eines guten Korsen in seinem Vaterlande. Das ist der Grund, warum die Meinigen mich zurückhielten. Da ich aber mit meiner Pflicht nicht zu feilschen verstehe, so hatte ich vor, meine Entlassung zu geben.“ Er gibt sie keineswegs, fordert vielmehr den rückständigen Gehalt und nennt in diesem Schreiben Frankreich „eure Nation“. Da streicht Frankreich den Offizier aus den Listen.
So ist er rascher als er wollte zum Glücksritter geworden. Ohne Rückhalt, ohne andre als die revolutionären Rechte einer Nationalgarde, die jeder Rückschlag auflösen kann: Hic Rhodus! Diesen latenten Bürgerkrieg zwischen Bürgern und Garde muss man benutzen, die Flamme anblasen, um dann, in der allgemeinen Verwirrung Retter zu sein! Droht dort nicht hoch die Zitadelle mit den regulären Truppen des Königs? Hat nicht Friedrich, nicht Cäsar immer zuerst die Zitadelle gestürmt? Den Kommandeur muss man fangen, diesen adligen Tölpel vertreiben und so mit einem Schlag die Insel von Frankreich befreien, das jetzt, in Kriege verwickelt, sie nicht zurückerobern kann. So wird man Herr der Insel. Der alte Paoli wird Legende.
Am Ostertag kommt es zum Kampf. War die Garde provokant, waren die Bürger verschworen? Wer hat angefangen? Ewig ironische Frage! Der Bataillonsführer Bonaparte, das Eine ist gewiss, suchte sich der Festung zu bemächtigen. Aber dort lässt man sich nicht einschüchtern, richtet die Kanonen, zwingt ihn zum Abzug, klagt ihn in Paris an wegen Aufruhrs: ein Hochverratsprozess steht ihm bevor. Die Phrasen seiner Verteidigungsschrift imponieren niemand. Selbst Paoli, von Anfang an diesem wilden Landsmann misstrauend, eilt, sich loyal zu zeigen, und setzt den Sohn seines Freundes ab.
Willst du nicht mit mir, Paoli, denkt Bonaparte, so will ich gegen dich! Gib acht! Ich eile nach Paris! dort ist nicht umsonst Revolution! -
Durch die Straßen der sommerlichen Weltstadt flaniert der Abenteurer, dem alles misslingt, ohne Geld, ohne Stellung. In Frankreich ein mehr oder weniger desertierter Leutnant, in Korsika ein abgesetzter Oberstleutnant, den peinlichsten Verfahren ausgesetzt, abgerissen, morgen dem Hunger preisgegeben. Seine einzige Hoffnung sind die Radikalen, Robespierre schließt er sich an, denn nur, wenn die Dynastie endlich fällt, nur am vollen Wechsel kann er genesen.
Glühende Sommertage, und das Pflaster von Paris ist teuer. Einmal versetzt er seine Uhr, einmal macht er, der es bis in dies 23ste Jahr immer vermieden, Schulden: 15 Francs bei einem Weinhändler. Dann schlägt er Bourienne, seinem Freunde vor, gemeinsam Häusermakler zu werden. Beneidet er die Herrschenden? Er verachtet sie nur. „Man muss gestehen, wenn man dies alles aus der Nähe sieht, die Völker sind es kaum wert, dass einer sich um ihre Gunst bemüht. Hier sind die Menschen vielleicht noch elender und verleumderischer . . Begeisterung ist eben nur Begeisterung, und das französische Volk ist gealtert. Jeder sucht nur seinen Vorteil und will emporkommen . . Alle untergräbt der Ehrgeiz. Ruhig dahinleben, für sich und die Familie, das ist die einzige Rolle, mit 4-5000 Francs Rente, d. h. wenn eine beruhigte Phantasie einen nicht mehr plagt.“
Doch wehe, wen sie plagt! Welches Ungeheure ist im Chaos dieser Epoche, ist im Kessel von Paris nicht möglich! Weil er ein Fremder ist, vermag dieser Italiener reinen Blutes die Schicksale dieser Franzosen mit der vollen Kälte des Abenteurers zu erleben, zu nutzen. Schon rücken die Jakobiner vor.
Als dann die radikalisierte Menge die Tuilerien stürmt, und Bonaparte ist unter den Zuschauern: was sagt die bedrängte Existenz? Gottlob, man wird jetzt wieder frei! Was aber sagt der Offizier? „Ich sah Soldaten von Zivilisten bedroht, das schockierte mich . . Hätte sich der König zu Pferde gezeigt, so blieb ihm der Sieg; das war die Stimmung am Morgen.“ Und ein paar Tage vorher, als sich der König mit der roten Mütze zeigte: „So ein Esel! Er hätte ein paar Hundert von diesem Gesindel niederkartätschen sollen, dann liefen die Anderen!“
Und doch, er fühlt sich befreit, seine Gegner sind entmachtet, am nächsten Tage schreibt er dem Onkel: „Keine Sorge um Ihre Neffen, sie werden sich Platz zu machen wissen.“ Ist nicht die neue Regierung brav? Sie nimmt ihn nicht bloß auf, den Deserteur, sie befördert ihn gleich zum Kapitän. Doch nun soll er eilig sein Regiment auf dem östlichen Schauplatz suchen? Was geht ihn der Preußenkönig an der Mosel, was gehen ihn Frankreichs Kriege an! Ein Korse bleibe ich! Lebt wohl, und nach der Insel!
IX
Ist’s möglich? Hat der immer frische Wind des Meeres, hat selbst die reine Luft der Berge nicht den Parteigeist aufgelöst, in den der Kampf der Ideen überall verdampft? Verleumdung, Korruption und Anarchie, das sind die Formen, in denen sie sich auf der Insel darstellen! Der Mann, den Korsika in den Pariser Konvent gesandt hat, Saliceti, ist der Todfeind Paolis, darum den Bonapartes zugetan, die Paolis Gegner geworden. Im Club ist man gespalten, doch die Mehrheit scheint radikal und schilt Paoli, den einzig integren Mann auf der Insel, einen Verräter, weil er gemäßigt handelt.
Wer hat die Macht? Alle und keiner. Jeder misstraut dem andern, denn in Paris hat man das Fallbeil erfunden, den König enthauptet, niemand weiß, wer morgen dort regiert. Alles trägt Waffen, nicht nur in den Bergen, machtlos brechen sich die Befehle der Küste an den Felsen des Innern, jeder ist hier sein König, jeder sein Rächer. Gibt es ein besseres Feld für diesen Abenteurer, der nichts mehr zu verlieren hat? Ein drittes Mal versucht er’s, Herr der Insel zu werden.
Um das Haus Bonaparte sammelt sich die Fronde, die Brüder Joseph und Lucien, der geistliche Onkel haben ihre Leute. Doch erst Napoleon fasst die Kräfte zusammen: er bringt das Vertrauen des Deputierten mit, der hier einen tüchtigen Artilleristen braucht, um sich beim nächsten Putsch zu behaupten. Dasselbe Vorgefühl bringt ihm der Club entgegen. Wie, wenn man Paoli, der nicht umsonst durch 20 Jahre englische Gastfreundschaft genossen, des Hochverrats an Frankreich bezichtigte? Steht er nicht im Begriff, uns an England zu verkaufen? Geht Lucien nach Marseille und sagt es dort den Kommissaren ins Ohr, so wird es Saliceti bald dem Konvent zuschreien. Eine Hochschule für Intrigen ist solch eine kleine Insel: weil sich das öffentliche Leben durch ein paar Familien entscheidet, verschwindet alles Familienleben im öffentlichen.
Bald schickt der Konvent Vertreter, setzt auf Korsika Offiziere ab und ein, ohne Paoli zu fragen, und so wird rasch der in Frankreich wieder eingesetzte Kapitän Bonaparte auch auf der Insel wieder Bataillonschef, denn durch Geschicklichkeit und Sympathie seiner Soldaten hat er die Führung wieder usurpiert, man braucht ihn nur noch zu bestätigen. Seine Chancen steigen.
Da kommt aus Paris der furchtbare Befehl: Paoli ist zu verhaften. Nun aber, da die Gegner zu viel erreichten, fliegt noch einmal das Herz der Insulaner ihrem greisen Helden zu: alles schart sich um ihn, und er trotzt dem Befehl.
Der junge Bonaparte stutzt. Immer hat er das Ohr ans Herz der Menge gelegt, nicht wie ein Liebender, nur wie ein Arzt und Forscher. Nun sucht er Zeit zu gewinnen, schwenkt in den Mittelweg, erklärt sich öffentlich für den verkannten Paoli, — doch auch für den weisen Konvent. Zwar, der misstraut ihm und will nun auch ihn verhaften, doch Paoli misstraut dem Doppelspiel nicht minder, und so heißt es in einem Aufruf der Seinen: „Weil die Brüder Bonaparte die Verleumdung gestützt und sich der Kommission angeschlossen, so ist es unter der Würde des korsischen Volkes, sich mit ihnen zu befassen: der Reue und dem öffentlichen Schimpf sind sie anheimgegeben.“
Jetzt stürzen sich die Feinde der Familie auf ihr Haus, plündern darin und hätten sie getötet, wenn sie nicht bei der Kommission Schutz suchten und fanden.
War das vielleicht seine Absicht? Jetzt kann er den Machthabern aus Paris mit Fingern zeigen, was für ein unbeugsamer Revolutionär er sei, ja, jetzt vertraut man ihm wieder. Er, der vor einem Jahr Führer der korsischen Freischar gegen die Artillerie der Regierung gewesen, wird nun von dieser zum Kommandanten der Artillerie gegen die korsische Freischar ernannt. Kanonen! Zwar, die besten Punkte haben die andern, doch endlich hat man einige Macht, hat Vollmacht und sogar Befehl, die Küste zu sichern. Nun, Paoli, zum letzten Zweikampf!
Aber der alte Mann ist durch die Volksgunst auch als Soldat im Vorteil: er hat die Zitadelle, und als der junge Mann, nun als Franzose, diese zum zweiten Mal stürmen will, misslingt es ihm wieder. Ein letzter Versuch, draußen von den Inseln her die Festung anzugreifen: vergebens!
Er und die Seinen sind auf der Insel verloren. Ein Volksrat spricht die Verbannung aus über sie, erklärt die Familie Bonaparte in die Acht. Die Mutter, so stolz auf ihr Geschlecht, zwei Söhne, zwei Töchter und ihr Bruder: alles ist durch des Leutnants misslungenen Putsch obdachlos geworden, alles muss in ein paar Stunden fliehen. Durch die verschwiegenen Wälder, deren Wildnis sie vor 24 Jahren vor den Franzosen deckte, muss nun diese Frau im Schutze der Franzosen zur Küste flüchten, nichts als das Kleid am Leibe gehört ihr mehr, das Eigentum bleibt den Feinden.
Auf dem Segler, der sie nach Toulon entführt, steht der 23jährige Leutnant, er sieht im späten Abendschein des Junitages die Insel sich entfernen, jede Kuppe, jeder Grat ist ihm vertraut. Dreimal hat er sie erobern wollen, als Befreier. Nun wird er als Franzose von den Seinen verjagt. Hass und der Durst nach Rache drängen in ihm: Frankreichs Siege werden ihn stärken, und so wird er dennoch einst ihr Herr!
Doch wie er sich nach Westen wendet und sieht die Küste Frankreichs näher kommen, da fühlt der Abenteurer die Freiheit, überall zu Haus zu sein: Glück und Schicksal des Vaterlandslosen.
X
Wie verschlissen die Kleider sind! denkt Laetitia Bonaparte, wenn sie die beiden halbwüchsigen Mädchen von ihrem dürftigen Einkauf heimkommen sieht. Im vierten Stock eines beschlagnahmten Hauses zu Marseille, der adlige Eigentümer ist hingerichtet, sitzt die stolze Frau von Anfang Vierzig mit ihren Kindern, drei verdienen ihr Brot, die beiden jüngsten blieben bei Verwandten auf der Insel. Als „verfolgte Patrioten“ beziehen sie vom Kommandanten einen Teil des Essens. Doch sie klagte nie. Sie ist stolz.
Bald glückt es Napoleon auf seinen Reisen, durch Beziehungen dem Bruder Kriegslieferungen zuzuschieben, der geistliche Onkel legt die Kutte ab und macht Geschäfte, man kommt in die Seidenbranche. Da gewinnt der elegante Joseph, der äußerlich dem Vater gleicht und sich als Ältester wie einst Jener Graf von Bona Parte nennt, eine von den Erbinnen eines Marseiller Seidenhauses, man kommt zu Gelde, und nun denkt Napoleon daran, die andre, Desiree, die Schwägerin, heimzuführen.
Geschäftig fährt er in diesen Sommermonaten hin und her, nun ist er in Nizza bei seinem Regiment, nun wieder an der Rhone, nun in Toulon. Doch immer verzehrt sein Offiziersblick, notiert sein Artilleristenhirn die natürliche Lage, wie die Verschanzung jedes Punktes in diesen Küstenstrichen: bald wird er es brauchen. Dazwischen schreibt er politische Dialoge, einen sieht er sogar als Flugschrift auf Staatskosten gedruckt.
Der Fabrikant in dieser Unterhaltung ist ein allzu verbreiteter Typ, und da in Toulon die reichen Leute Angst haben, gleich ihren Freunden in Marseille von Robespierres Gewalten geköpft oder gar enteignet zu werden, fühlen sie ihr Herz aus Angst für ihr gutes Geld immer inniger dem armen vertriebenen Königshause verbunden und rufen, um ihr Kapital zu retten, des Vaterlandes Feinde herbei: den Rest der Flotte liefern sie den Engländern aus, die dafür Schutz versprechen.
Furchtbarer Schlag für das junge Frankreich, das eben nach allen Seiten gegen die andrängende Reaktion kämpft, Belgien verloren hat, die Spanier über die Berge dringen, in der Vendée das Bourbonentum erstarken sieht! Ja, nun verkauft die Börse von Toulon ihre Angst um den Preis der Flotte an ihren alten Gegner! Da macht man den letzten Mann mobil, stellt die Frauen ein, verwandelt Frankreich in ein Feldlager. Jeder, der das Handwerk versteht, ist doppelt willkommen.
Vor Toulon rüstet man sich, den Engländer zu vertreiben; das Wie überlässt der Konvent einem Maler, bei dem die revolutionäre Gesinnung alle Kenntnisse ersetzen soll.
Da geschieht’s, dass der junge Kapitän Bonaparte, der aus Avignon Schießpulver holen sollte, auf dem Rückwege seinen Landsmann Saliceti besucht, der bringt ihn zum Maler-General. Nach Tische treten die Dilettanten an einen 24-Pfünder, der bald eine Meile vom Meer steht, und erhitzen sich in prahlenden Plänen. Der Fachmann bestreitet jede Wirkung, beweist mit vier Schüssen, dass sie das Meer nie erreichen. Man stutzt, hält ihn zurück, lässt ihn arbeiten.
— Endlich! Ein Ende des Seiles! Fassen und nicht lassen! denkt der einsame Mann des Willens, und mit verblüffender Tatkraft sieht man den Kapitän von entfernten Plätzen der Küste Kanonen herbeischleppen; nach sechs Wochen sind über 100 schwere Geschütze versammelt.
Nun aber will der junge Mann uns auch noch seine Feldherrnkünste zeigen? Was hat er vor? Die Landzunge, die die Bucht in einen Doppelhafen teilt, mit Batterien bestellen und so die feindliche Flotte absperren: dann wird sich der englische General hüten, im Mauseloch ohne Hinterland die Kugeln aufzufangen, er wird das Arsenal verbrennen und abziehen. — Phantastisch! spotten die Dilettanten. Bonaparte aber, der im Konvent auch seine Freunde hat, erhebt dort Klage über seinen Chef und schickt nach Paris seinen Plan der Beschießung von Toulon, bogenlang, mit Ratschlägen auch allgemeiner Art: „Man muss sein Feuer stets vereinigen. Ist erst Bresche geschossen, dann wankt drüben das Gleichgewicht, aller Widerstand wird fruchtlos, der Platz ist gewonnen. Man muss sich teilen, um zu leben, sich vereinen, um zu schlagen. Ohne Einheit des Kommandos kein Sieg. Die Zeit ist alles.“ So schreibt der Zentrale ein 24jähriger Hauptmann.
Mit Paris verbindet ihn ein mächtiger Freund, der jüngere Robespierre, der sogar in die dünne Luft des allmächtigen Bruders den Namen eines jungen Talentes rufen darf: Brauchst du einmal, hatte er dem Älteren gesagt, gegen die Straße einen eisernen Soldaten, dann muss es ein junger, ein neuer Mann, dann sollte es dieser Bonaparte sein. Ja, man hatte ihm schon angetragen, die Garde der Schreckensmänner zu übernehmen, doch Vorsicht hielt ihn zurück. Jetzt wird sein Plan genehmigt, der Maler-General abberufen. Wen wird man senden?
Er knirscht mit den Zähnen: wieder ein Dilettant! Der neue General ist Arzt, riecht überall Verschwörung adliger Leute, während indessen der Feind die kostbare Landzunge selber besetzt. In goldenen Hofkutschen kommt zugleich von Paris ein Schock begeisterter Männer im Lager an, entschlossen, in ihren schönen Uniformen Toulon kurzerhand endlich zu nehmen. Bonaparte führt sie an eine ungedeckte Batterie, und als der Feind schießt und sie nach Deckung rufen, sagt er ernst: „Das ist abgeschafft, dafür haben wir heute den Patriotismus.“ Dieser junge Mann mit den graublauen Augen liebt die Sache, nicht die Gesinnung. Neue Klagen, neuer Wechsel, dann kommt ein Haudegen an die Spitze, der macht ihn sofort zum Bataillonschef und unternimmt’s, genau nach Bonapartes Plan den Feind von der Landzunge zu vertreiben.
Als es endlich, immer nach seinen Plänen, zum Sturm kommt, wird ihm das Pferd unterm Leibe zerschossen, ein englischer Lanzenstich trifft ihn in die Wade: Napoleons erste und beinah die letzte Wunde. Dies ist sein erster Sieg, wenn auch nicht als amtlicher Führer; es ist ein Sieg über England. Der Feind rettet sich auf die Schiffe, verbrennt das Arsenal, zieht ab, alles in selbiger Nacht, wie es Jener vorausgesagt.
Brand und Tod, Schlacht und die Schrecken eines Hafens, in den sich Tausende von schuldbewussten Bürgern retten wollen: in dieser feuersbrünstigen Dezembernacht, durch Qualm und Schreie, über den Leichenhaufen, zwischen den Fluchen ertrinkender Bürger und dem Johlen plündernder Soldaten steigt zum ersten Mal ein neuer Stern empor: Napoleons Ruhm.
XI
Denn das Volksfest, das Paris für Toulons Befreiung, doch auch für neue Siege an der Nord- und Ostfront feiert, trägt Bonapartes Namen in die Menge. Er wird Brigadegeneral, und indem sein Chef ihn in seinem Bericht als Erfinder des Schlachtplanes rühmt, fügt er, zwischen Bewunderung und Furcht, den erstaunlichen Satz hinzu: „Wenn man ihn im Konvent zurücksetzen sollte, so wird er sich dennoch seinen Weg erzwingen.“ Doch mit ihm werden fünf andre junge Namen berühmt, und als er nun im „Moniteur“ zum ersten Mal den seinen liest, stört ihn gewiss solche Nachbarschaft. Wie schwer ist der Aufstieg!
Schon aber gibt es ein paar junge Leute, die haben in jener Nacht seinen Stern erblickt: Marmont, Junot, junge, unbekannte Offiziere verschreiben sich seinem Glücke, er nimmt sie und gleich auch Louis, den sechzehnjährigen Bruder, zu Adjutanten. Nun hat er schon eine Gruppe.
Kanonen! Und der Konvent gibt ihm den Auftrag, die ganze Küste von Toulon bis Nizza zu befestigen. Liegt dort nicht Genua, Korsikas alter Feind? Man müsste Genua nehmen, dann hat man auch die Insel. Steckt nicht in Genua alles voll Diplomaten und Agenten? Hier wird das Wetter der Neutralen gemacht, hier kann man scharfen Auges und gespitzten Ohres viel aufnehmen und alles verschweigen. Er verschafft sich den Auftrag eines Volkskommissars, er wird den Häuptern Genuas vorgestellt, vorgeblich um einiger Grenzfragen willen.
In Wahrheit ist dies der erste Schritt des Diplomaten Bonaparte: mit Agenten aller Art spinnt er an, gibt zugleich acht, ob Frankreichs Vertreter dort wirklich radikal sind oder nur so tun, zugleich erspäht er, wo denn eigentlich die Kanonen stehen. Als er nach Nizza zurückkehrt, um seinen Bericht zu schreiben, wird er plötzlich verhaftet.
Denn inzwischen ist Robespierre gestürzt und geköpft worden. Sofort rückt alles ab, jeder will nur gezwungen mit dem Tyrannen verkehrt haben und sucht, um rein zu erscheinen, nach Opfern. Wer nicht da ist, um die andern niederzudonnern, passt dazu am besten. Eilt euch, sonst sagen jene aus, dass wir dazu gehörten! Da ist dieser General Bonaparte! Der war noch eben in geheimer Mission im feindlichen Genua: setzt den Verräter fest! Mit Robespierre hat er es darauf angelegt, unsere Südarmee zu vernichten! Schleppt ihn zum Verhör nach Paris!
Da sitzt er im Fort Carree bei Nizza, alle Papiere sind ihm abgenommen, heut ist sein Geburtstag. Heut bin ich 25, denkt er, und blickt durch die Stäbe aufs Meer. Könnte man sich hinauslehnen, so sähe man wohl noch Korsikas Küste. Wie oft versucht und immer abgeschlagen! Hat sich jemals die Jugend eines Strebenden aus solcher Reihe von Katastrophen aufgebaut? Was erzählt Plutarch? Abgesetzt, verbannt, in Acht auf unsrer Insel, und nun, mit allen Plänen ein Gefangener Frankreichs, in acht Tagen vielleicht im Kasernenhof, zwanzig Kugeln gegenüber. Was ist zu tun?
Die Getreuen raten zur Flucht. Er erwidert in einem Ton von Rührung, wie er sich in den Sechzig Tausend Briefen Napoleons nur sehr selten findet: Dank für die Freundschaft, aber „die Menschen können gegen mich ungerecht sein, wenn ich nur unschuldig bin, das genügt. Mein Gewissen ist das Tribunal, vor das ich mein Benehmen zitiere, und das ist ruhig. Tue also nichts, du würdest mich nur kompromittieren.“ Echt ist in diesem larmoyanten Märtyrerbrief nichts als das letzte Wort. Dem Schwärmer Junot gibt er Motive an, die Jener begreift. In Wahrheit will er, da keine Verbindung mit Robespierre erweisbar ist, sich nur nicht kompromittieren, und Flucht wäre Geständnis.
„Ich bin, schreibt er einem gewichtigen Diplomaten aus dem Kerker, von der Katastrophe des jüngeren Robespierre etwas betroffen, den ich bebte und für rein hielt, und doch, wäre es mein Vater, ich hätte ihn erdolcht, wenn er sich zum Tyrannen machen wollte.“ Heißt das nicht wie ein Römer gesprochen? Noch klüger an den Konvent: „Obwohl unschuldig verleumdet, werde ich doch nie Klagen gegen den Ausschuss führen, was immer er beschließen mag . . Nun aber hört mich! Zerreißt meine Ketten, gebt mir die Achtung der Patrioten wieder! Eine Stunde darauf will ich, wenn die Bösen meinen Kadaver fordern, bereit sein. Ich achte das Leben gering, zu oft habe ich es in die Schanze geschlagen. Nur der Gedanke, dem Vaterlande zu dienen, lässt mich getrost seine Last ertragen.“
Nach acht Tagen ist er frei. Saliceti, sein Landsmann im Konvent, war es, der ihn zuerst verleumdet hatte; nun, nach dem ersten Schrecken, als er sich selber sicher fühlt, verbürgt er Bonapartes Unschuld, an den Schluss aber setzt der intrigante Korse ein Wort, in dem er unbewusst Bonapartes Triumphe vorwegnimmt: „Übrigens braucht man ihn bei der Armee.“
XII
Wie man ihn meidet! Wie mächtige Freunde, denen er lange und wiederholte Briefe schreibt, nicht antworten; wie er kleine Dinge erbitten muss, „einen guten Messapparat für die Armee,“ um einen gewichtigen Kameraden zur Antwort zu nötigen!
Da kommt noch einmal das Signal von der Insel. Der alte Paoli hat die Engländer zu Hilfe gerufen, jetzt heißt es, Korsika für Frankreich retten! Nach Paris, um das Feuer zu schüren! Wirklich, der Feldzug wird beschlossen, er zittert nach dem Kommando, doch die Flotte kehrt schon nach zwei Wochen geschlagen nach Toulon zurück. Neue Enttäuschung! Hätte man ihn nur operieren lassen! Hatte er nicht Toulon erobert, die Küste bewaffnet, den Feldzug gegen Korsika im Kopfe?
Aber die Reaktion ist im Anmarsch, man misstraut ihm und sucht ihn mit hohem Kommando in der Vendée von seinen Leuten zu trennen; zugleich wird er, als ein „Überzähliger“, zur Infanterie versetzt: Degradation im Gefühl eines durchgebildeten Artilleristen.
Der bleiche junge Mann wird bleicher. Nein! Und als er den Volkskommissar für Krieg zur Rede stellt, und dieser sagt: Zu jung, da fasst er ihn, der kaum im Felde war, ins Auge: „Man altert schnell auf dem Schlachtfeld, und von dort komme ich.“ Gehorsam verweigert, den Umsturz erwartend: ganz wie vor drei Jahren.
Was tun? Sich krankmelden, Urlaub nehmen? denkt der beschäftigungslose General. Lieber hierbleiben, Paris ist der Nabel der Welt. Zwar, Marmont und Junot, ohne Urlaub um ihn herum, haben auch kein Geld. Was tut denn Bourienne?
Er spekuliert? Das kann man auch probieren, aber die Assignaten stürzen. Wie schlecht habt ihr den neusten Putsch inszeniert! Wollt ihr Staatsstreiche ohne Kanonen machen? Aber an Saliceti, der nun seinerseits vor schwerer Anklage steht und im Versteck bei einer befreundeten Corsin hockt, schreibt er: „Siehst du, den Schaden, den du mir getan, hätte ich dir vergelten können . . Welches ist die schönere Rolle, deine oder meine? Ja, ich hätte mich rächen können und habe es nicht getan . . Geh, such in Frieden eine Zuflucht, wo du besser über dein Vaterland denken lernst. Mein Mund wird ewig über dich schweigen. Geh in dich, würdige meine Motive, ich verdiene es, sie sind edel und großmütig.“
Welche Schliche hinter diesen selbstgefälligen Zeilen, welche Schatten über diesem Edelmute, um einen tatenlosen Tag mit dem Gefühl falscher Großmut zu beleben!
Denn dunkel rauscht, schwer schlägt die Flut des Lebens an seine Küste in diesen Sommerwochen. Das Buch schwerblütiger Leidenschaft, Ossian ergreift ihn, auch das tragische Ende der Dramen, die er sich nie durch die nachher gespielte Farce verderben lässt, und er eilt deshalb rasch aus dem Theater. „Unsinnig, Paul et Virginie in einer neuen Oper durch ihre Errettung ins Heitere umzubiegen!“ — Und was ist Glück? fragt ihn die Dame, die diese Dinge von seinen Lippen hörte.
„Glück?“ sagt Bonaparte. „Die höchste Entwicklung meiner Fähigkeiten.“
Die eben Hegen brach, das kann er nicht verwinden. Wachsende Schwermut liegt über ihm und stummer Groll. In der Komödie, so erzählt die Frau eines Freundes, lacht alles, nur Bonaparte sitzt mit eisiger Miene; zuweilen verschwindet er dann und taucht am andern Ende des Parkettes finster auf. Manchmal schwebt auf seinen Lippen ein falsches und unangebrachtes Lächeln. Anekdoten aus dem Felde weiß er unwiderstehlich zu erzählen, aber sein Lachen
darauf ist roh. Oft sieht man ihn mit seinen kurzen Beinen durch die Straßen irren, mager, gelb, kränklich, nervös, „linkisch und unsicher, mit einem alten runden Hut, unter dem zwei schlecht gepuderte Hundeohren herauskommen, Schuppen auf dem Kragen, Hände lang, mager und dunkel ohne Handschuh, mit schlechtsitzenden Stiefeln.“
Jetzt fängt er einen Bücherhandel nach dem Ausland an, aber gleich der erste Versuch mit einer Kiste nach Basel misslingt.
Zuweilen geht er in die Salons, denn „hierzulande, schreibt er dem Bruder, ist alles darauf aus, sich zu zerstreuen . . Die Frauen sind überall, im Theater, im Park, auf der Bibliothek. In der Studierstube des Gelehrten trifft man die hübschesten Kinder. Ja, hier verdienen sie zu regieren, die Männer sind vernarrt, leben nur durch und für sie.“
Wenn Bonaparte in den Salon des Tribunen Barras tritt, der Glanz, Verschwendung, Frauen nie genug haben kann, damit Paris darüber klatsche, und er steht dort zwischen den schönsten: der Tallien und der Recamier, so kann er, klein, finster, eckig, nur durch Geist, durch Laune wirken, und auch dann bleibt er der Sonderling.
Immer einsam, gibt er sich in langen Briefen nur den Brüdern hin. Louis erzieht er: „Er ist ein guter Soldat. Was mir besonders gefällt, ist, dass er alles vereint: Feuer, Geist, Gesundheit, Talent, Zuverlässigkeit, Herzensgüte . . Er wird sicher der beste von uns Vieren. Freilich hat auch keiner von uns eine so gute Erziehung genossen.“ Auch Jerome, den Jüngsten, denkt er jetzt in Paris unterzubringen. Mit Lucien steht er gespannt: dieser genialische Bruder eifert ihm nach, will ihm den Rang ablaufen; ein Menschenkenner wie er selbst, ist Lucien der erste, der Napoleon ganz begreift, und zwar begriff er mit 17 schon den 23jährigen: „Ich habe, schrieb er damals dem Ältesten, in Napoleon einen Ehrgeiz entdeckt, nicht grade egoistisch, aber größer als seine Liebe für das öffentliche Wohl. In einem freien Staat wäre er wohl ein gefährlicher Mensch. Er scheint mir sehr zum Tyrannen geneigt, ich glaube auch, er würde es werden, wenn er König wäre. Zumindest würde sein Name für die Nachwelt und für empfindsame Patrioten ein Schrecken sein.“ Und solche großartige Voraussicht ist in Luciens Munde nicht bloß Gedankenspiel: sein eigener Ehrgeiz ist so brennend, dass er in diesen Zeiten, diesem Lande solche Heraufkunft des Bruders für möglich hält und sich im Voraus kränkt, wenn jener ihn überrennen sollte.
Der ist vorerst gedämpft. Er beneidet schon Joseph, den Geld und Heiterkeit unabhängig machten. Ihm bietet er jede Unterstützung an Empfehlungen und Papieren an, rät ihm, mit entwertetem Gelde billig ein Gut zu kaufen. Freilich heißt es auch schon an diesen Älteren: ,,Dein (politischer)Brief war zu trocken, du musst noch lernen, anders zu schreiben.“
Ein Heim! er will ein eigenes Heim besitzen, gleich jenem. Heftiger dringt er nun mit jedem Briefe in ihn, ihm die hübsche reiche Schwägerin zu sichern, von der er nun schon Jahr und Tag zärtliche Briefe bekam. Als sie sich aber gar nicht entschließt, fordert er Klarheit. Seinen Bruder, einen Freund sieht er in guter Ehe, Kameraden von gleicher Jugend als Führer an weithin sichtbarer Stelle. Nur er selbst, mit seinen wühlenden Gedanken, seinen phantastischen Projekten, bleibt tatenlos und allein.
„Reisest du für längere Zeit, schreibt er Joseph, so schicke mir doch dein Porträt. Wir haben so lange eng verbunden gelebt, dass unsere Herzen vereint sind: Du weißt am besten, wie ganz dir das meine gehört. Indem ich diese Zeilen schreibe, bin ich bewegt wie nie, ich fühle, wir werden uns so bald nicht wiedersehen, und kann nicht weiterschreiben. Lebe wohl, mein Freund.“
Seine Seele ist weich gestimmt, zuweilen scheint er ganz degoutiert: „Von Stufe zu Stufe emporzuklimmen, das ähnelt ein wenig dem Abenteurer und dem Manne, der sein Glück zu machen sucht.“ Und schließlich heißt es: „Das Leben ist ein leichter Traum, der zerrinnt.“
XIII
Plötzlich kommt alles in Fluss.
Der Kriegsminister wechselt, der neue will an der italienischen Front rasch Wandel schaffen. Weiß jemand einen neuen Mann, der dort kommandieren könnte? Ein Zweiter, ein Dritter trägt die Frage weiter, der Vierte empfiehlt Bonaparte. Man ruft ihn ins Ministerium. Er, dessen Kopf und Auge seit Jahren an dieser Küste, dieser Grenze zu Hause war, legt auf der Stelle das vollkommene Projekt eines Feldzugs in Oberitalien dar, gegen Sardinien und Österreich, gestützt auf jede Kenntnis der Alpenübergänge, von Wetter und Schnee, von Saat, Frucht, Verwaltung, Stimmung, Charakter der Länder und der Leute. Nach Eroberung der Lombardei, zwischen Februar und Juli muss man das mächtige Mantua den Österreichern nehmen, sich dann nach Norden wenden, die Schwesterarmee, die am Rheine steht, in Tirol treffen, Wien bedrohen und so den Kaiser zu einem Frieden zwingen, der alles erfüllt, was Frankreichs Phantasie seit Jahren sich versprochen.
Starr, vor den Katarakten dieses Hirns, steht der Minister: „Ihre Gedanken, General, sind ebenso glänzend als kühn, man muss sie prüfen. Machen Sie einen Bericht für den Ausschuss, nehmen Sie sich Zeit.“
„Mein Plan ist fertig. In einer halben Stunde kann ich ihn niederschreiben.“
,,Bedeutend, sagen die Herren nach der Lektüre, wenn auch nicht durchzuführen.“ Auf jeden Fall muss solch ein Kopf in die Operations-Abteilung. Ein paar Tage später sitzt er dort, wo alles beschlossen wird.
Dies ist der große Augenblick, der entscheidende Tag seiner Jugend. Jetzt endlich steht er auf der Schwelle seiner Bahn: plötzlich gerufen, wie alles in dieser eruptiven Epoche plötzlich kommt. Von heut, er ist knapp 26, wird er die Kette des Denkens und Handelns mit nie unterbrochener Gewalt zum selben Ziele hinter sich herziehen, 20 Jahre lang. Plötzlich, heut in 20 Jahren reißt sie ab.
Napoleons Arbeit beginnt. Mit brennender Tatkraft, um das Kleinste besorgt, weil er das Größte will, betreibt er von heut ab „die Geschäfte“, der Schleier hebt sich, von allen Armeen der Republik findet er hier die geheimsten Berichte. Zugleich erzwingt ein täglicher Verkehr bei den zivilen Machthabern ihm Autorität. Die Suggestion seiner Persönlichkeit setzt ein.