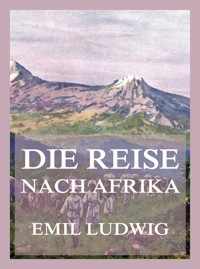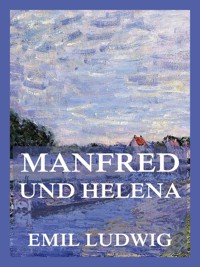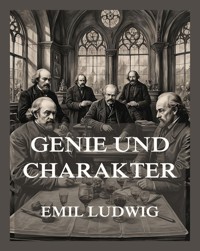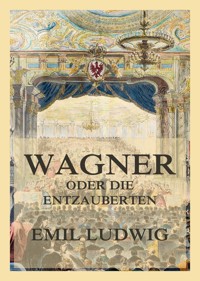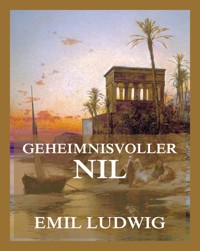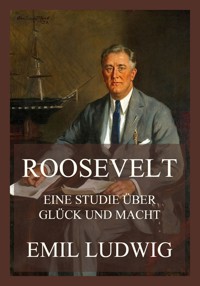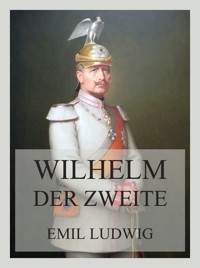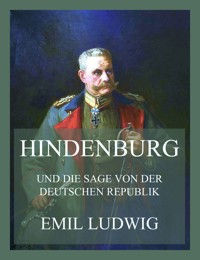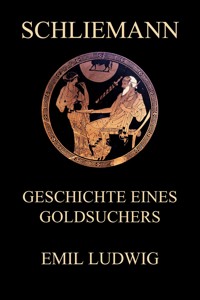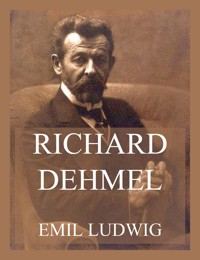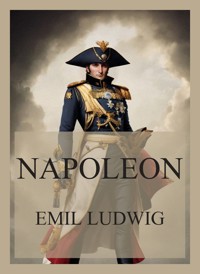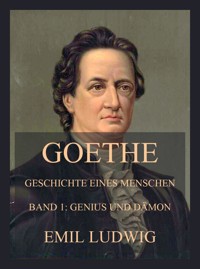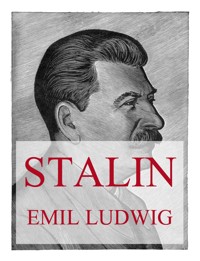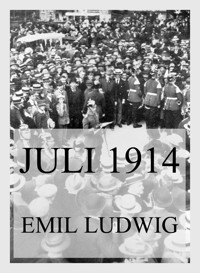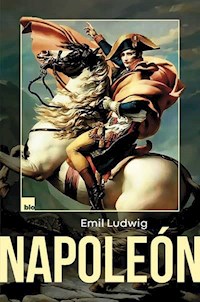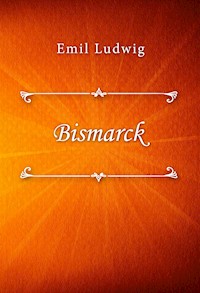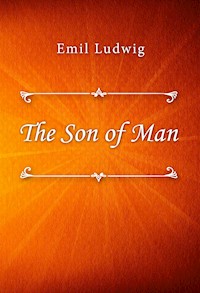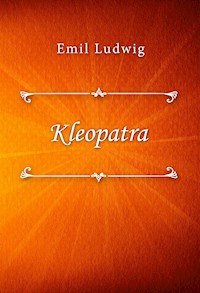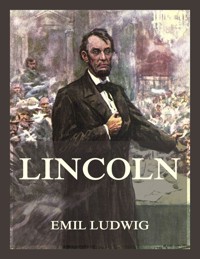
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Emil Ludwig erzählt in seinem Buch die Lebensgeschichte Abraham Lincolns, des großen Präsidenten der amerikanischen Sklavenbefreiung. Mit besonderer Liebe schildert er die primitive Jugend des Farmersohns, der als Holzfäller und Flößer am Rande der Prärie heranwuchs, alles in allem kaum ein Jahr die Schule besuchte, um schließlich doch die vielleicht größte humanitäre Intelligenz seines Jahrhunderts zu werden. "Lincoln" ist nicht nur ein künsterlisch geschlossenes Geschichtsdrama, sondern auch ein unvergeßliches Buch von großem Charme, groß, mitreißend, klug, leutselig, angenehm, fließend, unterhaltend, interessant und von einer Farbigkeit und Lebendigkeit ohnegleichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 736
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Lincoln
EMIL LUDWIG
Lincoln, E. Ludwig
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849680617
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
ERSTES BUCH. DER TAGELÖHNER.. 1
ZWEITES BUCH. DER BÜRGER.. 52
DRITTES BUCH. DER KÄMPFER.. 102
VIERTES BUCH. DER BEFREIER.. 206
FÜNFTES BUCH. DER VATER.. 290
ERSTES BUCH. DER TAGELÖHNER
I
Grausam schüttelt der Wintersturm an der Hütte. Wie er über die Ebene fegt, die riesigen Bäume knarren lässt, die hier und dort die Menschenhand stehen gelassen, wie er die armen hölzernen Höhlen verachtet, in die sich die Eindringlinge verkriechen, so lässt er alle erbeben, die nachts im Schutz der abgeholzten Stämme unter einem dumpfen Dach Schutz fanden vor den Elementen. Die drinnen, die in der Hütte, sind es gewohnt. Sie hören’s nicht mehr, auch hat die Arbeit von gestern sie ganz ermüdet; sie schlafen, Eltern und Kinder.
Nur der Vierjährige ist aufgewacht, jetzt, da der Sturm am Kamin einen Stein ergriffen hat und gegen die Wand geworfen. Denn gerade dort liegt der Blättersack, auf dem er mit der Schwester schläft. Er hat die äußere Seite, denn Sarah friert so sehr, wenn der Wind durch die Fugen fährt, und wenn sie auch etwas älter ist, so ist sie doch zarter geraten, aber der Junge ist knochig und fest. Wenn sie nur nicht immer das Fell auf ihre Seite zöge, von dem Fuchs, den der Vater neulich geschossen hat; sie hält’s im Schlafe krampfhaft fest, er kann es ihr nicht entreißen. Dicht neben sich sieht er ihre kleine Hand, ein Ohr und die zerdrückten dunklen Haare, und unten an den Zehen spürt er die ihrigen, denn unten hat er sich miteingewickelt, da lässt er nicht los. Gut, dass die Glut einen Schimmer durch den Raum verbreitet, so kann sich das wache Kind durch seine Augen unterhalten.
Da sieht er etwas durch den Dunst der Hütte schimmern, ganz nahe, so golden und glänzend, wie die Mutter sagt, dass es im Himmel sei: das ist der große Blecheimer, den sie jeden Abend am Bache füllt. Drüben aber scheint noch was anderes zu glühen, es hängt an der Wand. Das ist Vaters Axt, die die Kinder nicht anrühren dürfen, denn sie ist furchtbar scharf, gleich ist ein Finger weg; und unter der Axt schläft er dort drüben neben der Mutter. Heut schnarcht er wieder ziemlich laut.
Leise, traumhaft gehen die Gedanken des Knaben zur schlafenden Mutter hinüber, und etwas wie ein leises Entbehren steigt in ihm auf, wenn er denkt, dass er früher selber dort bei ihr gelegen hat, wie er noch kleiner war. In die Wärme ihres Körpers flieht die früheste der Erinnerungen zurück und lässt ihn fühlen: einmal war es besser, etwas hat er schon besessen und verloren. Indem er dies denkt, wird ihm noch kälter, aber rufen darf er nicht, das hat der Vater verboten. Es wird schon gehen, er muss sich selber helfen, und so streckt er seine kleinen Arme aus, um Mutters Rock zu fassen, den sie über die Kinder gebreitet hat und der nach Sarahs Seite heruntergefallen war. Aber so weit langt er noch nicht, und doch weht es kalt zwischen den Stämmen durch, gerade wo er liegt. Jetzt entdeckt er im Feuerschein schräg über sich an einem Nagel ein Tuch, kniet auf, steht ganz, hebt sich auf seinen kleinen Zehen: gerade kann er’s noch am Saume fassen. Nun stopft er’s mit geschickten Fingern in die Ritzen über seinem Kopf, und mit einem Mal zieht es nicht mehr, er zerrt sich auch ein Stück vom Fell herüber, ja, er wird wärmer, und plötzlich ist er wieder eingeschlafen.
Als er aufwacht, brennt das Feuer lustig und warm und verjagt den grauen Tag, der durch die Ritzen blinzelt. Sarah schläft noch, aber die Mutter steht am Feuer und mischt etwas heißes Wasser in die Milch; eine von den drei Kühen ist neulich krepiert, das weiß der Junge, denn er sieht und hört allem genau zu, was ringsum vorgeht. Jetzt ist der Vater gewiss drüben im Stall, aber wie er fragt, gibt die Mutter keine Antwort, sie hat zu tun.
Spielend, langsam fährt er in seine Lederhose, zieht Jacke und Schuhe an, alles aus rohem Leder, der Vater hat es dem Büffel abgezogen, die Mutter hat sie genäht, sie tragen alle dasselbe, und jetzt gibt es Milch. Davon wird man schnell warm. Wenn er nur mit der Blechbüchse spielen dürfte, die dort am Boden liegt! Aber Blech darf man nicht anfassen, davon macht der Vater mit einem Nagel ein Sieb oder auch eine Reibe, an der man nachher Wurzeln schaben soll. Spielen darf man nur mit Holz, hat die Mutter gesagt, denn Holz gibt es, so viel man will, Bäume und Wälder, zum Bauen und zum Brennen, tausend Meilen, bis dort, wo die Erde zu Ende ist.
Wann ist Sonntag, fragt das Kind beim Feuer. Da lächelt die Mutter, denn sie weiß, dass er das Weißbrot meint, das sie immer am Sonnabend bäckt, langt nach oben nach dem Brett, das die Kinder nicht erreichen können, und schneidet mit einem großen Messer ein Stück vom letzten Brot herunter, und wie sie ihn jetzt mit seiner Blechtasse neben sich kauern sieht und das Brot in die Milch stecken, da beugt sie sich wohl herunter und küsst ihr Kind. Er hält ganz still, beide Hände mit den Kostbarkeiten ausgestreckt, und wartet, wann sie ihn wieder freigeben wird, damit er weiteressen kann. Dann sieht er sie von der Seite an und denkt sich, warum sie wohl so traurig aussieht; aber er fragt sie nicht, denn das kann sie nicht leiden.
Da steht sie schon am Tisch; das ist ein riesengroßer Baumstamm, unten sieht man es noch, oben ist er ziemlich glatt, aber man muss achtgeben, sonst splittert es in die Finger, und dann kommt das rote Blut, und der Vater schimpft.
Inzwischen ist auch die Schwester angezogen, jetzt werden die Kinder in den Schuppen geschickt, Holz zu holen; grünes und trockenes, hartes und weiches haben sie schon gelernt zu unterscheiden, können auch Reisig zusammenknacken, und wenn sie ein halbes dutzendmal hin und her laufen, kommt schon ein ganzer Haufen zusammen. Dann schiebt die Mutter den großen Topf auf dem vierfüßigen Gestell zurecht und fängt gleich an zu kochen. Die Kleinen laufen und holen vor dem Haus aus dem Gärtchen ein paar Winterkräuter, das Salz ist knapp, und ohne alle Zutat will der Brei selbst hier im wilden Westen niemand recht schmecken. Denn wir sind mitten in Kentucky, um eine Zeit, wo die Hälfte der Neuen Welt noch so wild war, wie zweitausend Jahre zuvor die Alte, und der Farmer mit der Axt in diese ungeheuren Wälder vordrang, um Mais zu bauen und das Wild zu jagen. Dies hier ist der kahlste Teil, er heißt sogar Einöde, und die Quelle in der Nähe verschwindet plötzlich wieder im Felsen.
Da ist er schon, der Jäger! Gegen Mittag hören die Kinder drüben den Hund, strecken sich an der Türe, um den Lederriemen zu erreichen, der sie zuhält, und so fällt sie gerade dem Vater entgegen, der die Flinte auf dem Rücken trägt und einen tüchtigen Hasen. Er ist groß, etwas dick, dunkel und bärtig, der Vater, und was er am Leibe trägt, Fell und Leder, hat er alles selber geschossen. Das tut er lieber, als an der Hobelbank stehen, denn eigentlich ist er ein Tischler und macht Stühle und Türen für die Nachbarn ringsum. Wie er sich jetzt an den Herd setzt und auf den tönernen Teller tun lässt, was die Mutter gekocht hat, vergleicht sie der Knabe im stillen und denkt, dass es die ernste Mutter doch eigentlich schwerer hat als der bewegliche Vater.
II
Als er fünf ist, zieht die Unruhe des Vaters die Familie fort nach Nordosten. Hier ist’s belaubt und fruchtbar, am schnellfließenden Bach steht die neue Hütte. Besonders im Sommer ist das Leben schön, da friert man nicht des Nachts, und selten hat man Hunger, denn der Wald ist voll von Tieren. Nicht weit von der Blockhütte geht eine Landstraße vorbei, da gibt es viel zu sehen, denn sie verbindet eine Stadt mit der anderen, und wie der Knabe heranwächst, hört er, sie nennen die Städte Louisville und Nashville. Da kommen Wagen vorüber, manchmal mehrere an einem Tage, darauf sitzen Leute mit Kindern und Hausrat und ziehen immer in der Richtung nach Sonnenuntergang; manche reiten und schleppen ihren Sack Mais in die Stadt, andere bringen in Kästen geheimnisvolle Sachen; es ziehen auch Soldaten vorüber, der Vater sagt, sie kommen aus dem Kriege nach Hause, und einmal kommt ein Mann in schönen Kleidern, aus Wolle, sagt die Mutter, und spricht mit dem Vater über die Wälder im Westen und was sie kosten.
Lange dürfen die Kinder nicht an der Straße spielen, dann werden sie gerufen, müssen Unkraut im Gemüse jäten, Beeren suchen und Pilze; die trocknet die Mutter zu Hause und hebt sie für den Winter auf. Als er sechs Jahre ist oder sieben, nimmt ihn der Vater mit aufs Feld, nicht bloß zum Spielen, sondern jetzt soll er säen helfen, immer eine Reihe tief, eine Reihe hoch, das macht müde, aber man macht es doch und passt auf, dass man es gut macht. Inzwischen hilft Sarah zu Hause der Mutter, die Kühe zu melken, auch abends beim Spinnen; sonntags aber sitzen sie vor ihrer Hütte, dann singt die Mutter mit einer leisen, schönen Stimme alte Lieder. Manchmal erzählt sie ihre Geschichten aus der Bibel, denn sie hat das wunderbare Gedächtnis der Ungelehrten, und über ein Leben hin werden diese Verse dem Knaben immer mit der Stimme verbunden bleiben, die sie ihm zuerst sagte. Der Vater sitzt dabei und raucht, und wenn der aufmerksame Knabe beide vergleicht, muss er sich wohl zur Mutter hingezogen fühlen; sie ist zarter und jünger, und obwohl sie nicht kleiner ist, können die Kinder doch besser zu ihr heran. Wie der Knabe sie mit seinen forschenden Blicken heimlich studiert, die dunkle, gelbliche Haut, die scharfen Züge, Stirn, Kinn und Backenknochen hart, so greift der Blick aus ihren merkwürdig traurigen, grauen Augen ihm ganz ins Herz, und er versteht, warum sie gern langsame Lieder singt.
Eines Sonntags aber, wie sie alle fortgehen, um die Freunde im Dorfe zu treffen, da sieht er sie plötzlich lustiger als die anderen, sie tanzt auch am meisten und will gar nicht müde werden. Da staunt der Knabe, denn er erkennt zum ersten Male den Wechsel von Trauer und Lust; in schlafenden Gefühlen regt sich’s leise, er ahnt, dass in der Stille der Mutter manches verborgen sein mag, und er erschrickt.
Zuweilen darf er auch mit der Mutter zu anderen Farmern in der Nähe gehen, dort sitzt sie dann und näht. Diese Leute haben ein ganzes Haus, die Küche unten ist größer als zu Hause, oben haben sie in zwei Zimmern richtige Betten stehen, die hat sein Vater für sie gezimmert. Warum? Weil sie mit Zimmern und Nähen Geld verdienen und ein neues Pferd kaufen können. Aber warum haben die anderen mehr Geld? Die sind reich. Warum? Keine Antwort.
Mit steigender Verwunderung betrachtet der Knabe die Nachbarn. Onkel und Tante sind auch hierhergezogen. Vielleicht gefällt ihm am meisten die Tante Sparrow: das ist eine lebensvolle Frau, schnell, klug und fest, mit grauem Kopfe, gesünder als seine Mutter. Die kann den Kindern was erzählen, denn in der Jugend ist sie weit fort gewesen und weiß aus dem großen Kriege zu berichten, in dem sie einst die Engländer besiegten. Sie kann die Bibel lesen und sogar in einer kühnen Art auf einem Bogen schreiben, als hätte sie nie eine Axt in der Hand gehalten.
Da fragen die Kinder auch Vater und Mutter wohl einmal nach ihrer Jugend aus. Die Mutter sagt, weit weg von hier liegt Pennsylvanien, dort ist ihr Großvater ein Quäker gewesen, ein frommer und guter Mann; als aber der Junge nach ihrer Mutter fragt, und wo eigentlich die Tante hergekommen ist, merkwürdig, da gibt sie keinen klaren Bescheid.
Dafür erzählt der Vater gern, denn das macht ihm beinahe so viel Freude wie das Reiten; heut erzählt er von den Indianern. Früher nämlich sind sie aus dem schönen Virginia hierher ins magere Land Kentucky gekommen, aber in Wirklichkeit stammen sie aus dem Norden, wie die Mutter, und haben mit dem Süden gar nichts zu schaffen. Damals sind die Indianer den Weißen noch nachgeschlichen, viel näher als heute. Ja, damals, als der Vater selber so ein Junge war, wie heut sein Sohn, der ihm mit großen Augen und festgeschlossenen Lippen zuhört, da war er mit Vater und Brüdern nahe bei der Hütte im Wald, als plötzlich ein Schuss fiel. Der Vater fiel um, die Brüder rannten um Hilfe zur Hütte, der Kleine blieb allein zurück; aber der Vater rührte sich nicht mehr, denn den hatten die Rothäute aus den Gebüschen totgeschossen. Jetzt kamen die Indianer herauf und wollten den Jungen mitschleppen: der schreit und wehrt sich, bis der Bruder wiederkommt, seine eigene Flinte nimmt und losschießt. Da feuert’s von allen Seiten, und das Kind rennt in die Hütte.
Mit Staunen hört der Knabe die Geschichte. So haben sie den Großvater umgebracht, grad ihn, nach dem er selber Abraham heißt. Wer weiß, was einmal dem Vater geschehen könnte! Aber der lacht und sagt, jetzt sind andere Zeiten. Wie schön der Vater erzählen kann, denken die beiden Kinder; aber lesen kann er nicht und lacht gern die Mutter aus, wenn sie fürs Lernen ist. Wenn der Vater Schränke und Fenster machen kann, jagen, säen und Holz fällen, was soll ihm dann noch das Lernen? Wenn man selber lesen könnte! Wenn man auch schreiben könnte, wie die Tante! Jetzt darf er ein paar Wochen lang in die Schule gehen, aber die ist vier Meilen entfernt, und wenn es nass ist, geht man in den Schuhen aus Hasenfell nicht besser als barfuß. Die Schule ist ein Blockhaus, kaum größer als daheim, aber hier gibt es zwei Fenster aus Schmirgelpapier, auch einen größeren Kamin, und der Lehrer ist ein Pfarrer. Der lässt ein Buch im Kreise herumgehen, zeigt ihnen die Zeichen, lässt sie eins neben dem anderen langsam buchstabieren, zusammensetzen und immerfort laut wiederholen. Das also ist das Lesen? Aber eine Geschichte ist es noch lange nicht, und schreiben, wie die Tante, lernen sie gar nicht.
Dafür gibt es in diesem Jahre andere Neuigkeiten. Der Vater ist Straßeninspektor geworden, und wenn der Kleine mitgeht, hört er im Städtchen zu, wie sie über die Leute sprechen, wie sie aus Indiana erzählen, einem wunderbar fruchtbaren Lande, wohin die Reiter und Wagen gegen Sonnenuntergang ziehen, und von dem großen Fluss Ohio, der zwischen den Ländern fließt. Auch Aufseher ist der Vater geworden, eine Art Polizei, und da er das alles lieber tut als das Tischlern zu Hause, kommt er viel herum, und überall stellen sich die Leute dazu, weil er so gut erzählen kann. Das lernt der Junge, denn er hört fein zu und merkt sich’s, wenn der Vater dieselbe Geschichte heut ein bisschen anders erzählt als gestern. Trifft der Vater einen Neger, so hält er ihn an: ob er ein Papier hat, das ihm erlaubt, hier zu gehen und zu tragen, was er auf dem Rücken schleppt. Warum? fragt der Knabe. Das verstehst du noch nicht.
Einmal, in Hodgenville, soll er nach den Gefangenen sehen. Was sind Gefangene? Böse Männer, die dort, mit einer Kette am Fuß. Und mit Entsetzen starrt das Kind in die ergrimmten Züge der bösen Männer, wie sie den Vater ansehen, der mit einem großen rostigen Schlüssel die Tür zu ihrem Loch aufschließt; dann schließt er wieder zu, jene bleiben allein zurück. Aber des Knaben Mitgefühl bleibt bei den geketteten Männern. Es gibt also Menschen, denkt er, die anderen Menschen Ketten an die Füße hängen? Das ist noch schlimmer als die Reichen, denen der Vater Stühle und denen die Mutter Hemden machen muss, damit wir Brot und Tee kaufen können.
Es gibt auch viel anderes zu sehen und zu denken, diesen Sommer. Der Vater fällt die höchsten Bäume. Die Axt, die er mit Öl pflegt und am Stein wetzt, die er dann immer an der Hose angehängt trägt, schlägt nun die alten Riesen dicht über der Wurzel. Warum? Wir haben doch ein Haus. Das wird ein Floß. Was ist ein Floß? Ein Ding wie ein Schiff, man kann damit den Fluss hinab zum Meere fahren. Wo ist das Meer? Im Süden. Jetzt kann er schon die Stricke halten und ein bisschen mitschieben, denn der Vater bindet die Stämme zusammen und schiebt das Ganze vom Ufer in den kleinen Fluss, der soll weiter im Westen in den großen Ohio münden. Schließlich rollt er zehn große Fässer heran, und der Junge hört, dass sie der Vater gekauft hat und dass sie voll sind mit Whisky. Die Mutter seufzt viel in diesen Tagen, und schließlich erfahren die Kinder, warum. Der Vater hat die Hütte verkauft und das ganze Land ringsum, denn er will nach Indiana ziehen, wo alles reicher und fruchtbar sein soll; denn wenig arbeiten und viel ernten, das ist sein Geschmack. Er hat zehn Fässer Whisky für sein Land bekommen und zwanzig Dollar in die Hand. Wer weiß, was drüben im Westen auf sie wartet!
Schließlich ist alles fertig, Mutter und Kinder stehen am Ufer, winken dem Vater zu, mit seinem neuen, langen Ruder stößt er ab, und bald ist er verschwunden. Aber nicht lange, da kommt er wieder, erzählt viel und lacht, klopft die Mutter auf die Schulter, scheint guten Mutes und voller Hoffnung, denn Indiana ist ein Paradies. Es ist Herbst geworden, die Regenwochen haben begonnen, als sie alles zusammenpacken, Kochgeschirr und Werkzeug, Felle und Kleider; dann wird es auf zwei Pferde gepackt, Mutter und Schwester steigen auf das eine, der Junge darf vor dem Vater auf dem anderen sitzen, und nun reiten sie selber die Strecke nach Westen, auf der sie so viele haben ziehen sehen. Fünf Tage dauert die Reise, nachts gibt der Vater acht, während die drei in Decken auf dem Waldboden schlafen, denn hier ist man nicht sicher vor Tieren und vor Menschen.
III
Pigeon Creek, der Taubenschlag, wie sie das neue Haus nennen, ist größer und heller, als die Hütte in Kentucky war. Der Vater hat es mit seinen Verwandten schnell aufgebaut, während sie alle zur Not in einem fremden Blockhaus unterkamen. Denn vor und nach ihnen kommen Onkel, Tante und Vettern hier in der neuen Gegend an, auf die alle Farmer hoffen. Der Junge war froh, wie er den Vater längere Bäume schneiden sieht, um die Hütte größer zu machen als die vorige, und auch, dass diese einen Boden unterm Dach hat.
Der Vater ist immer guter Laune, denn jetzt endlich soll es ihm glücken; er sieht den Reichtum schon ganz nahe, und jagen kann man tage- und wochenlang, denn hier gibt es viel Wild. Die neue Farm steht auf einem kleinen Hügel, von Feldern und dichtem Unterholz umgeben. Der Bach ist jetzt etwas ferner, die Kinder müssen das Wasser eine Viertelstunde weit holen und sollen im Blecheimer nichts verschütten; dann muss der Achtjährige von jetzt ab auf dem Speicher oben schlafen. Man klettert auf ein paar Pfosten hinauf, die der Vater zwischen die Stämme der Holzwand geschlagen hat, das ist leicht und macht Spass; oben aber ist es stockdunkel, weil der Feuerschein fehlt und kein Fenster das Morgenlicht hereinlässt; im Winter hat’s der Junge trotzdem besser oben, weil das Dach sehr niedrig ist und die Fugen gegen den Regen sorgsamer verklebt sind als unten gegen den Wind; aber im Sommer ist es entsetzlich heiß und keine Luke zum Lüften.
Dafür ist mehr Bewegung ringsum; denn Mutters Eltern sind auch hierher nach Indiana gezogen, sie heißen auch Sparrow und haben ihren adoptierten Sohn mitgebracht, Denis Hanks, einen Jüngling von achtzehn Jahren; zum kleinen Abraham sind sie freundlich und gut, auch noch gar nicht alt.
Man muss zusammenhalten, denn hier ist es noch wilder, und die Bären haben auch schon einen Menschen erwischt. Deshalb brennt draußen vor der Hütte ein ewiges Feuer, um die Tiere zu verscheuchen, auch um die Luft ums Haus herum zu reinigen. Denn sie ist sumpfig, Tiere und Menschen leiden, und schon die Kinder müssen Perurinde essen gegen Malaria; aber selbst, wenn es nützt, so legt sich’s schwer auf das Gemüt, besonders bei Kindern, und sie werden nicht leicht heiter sein. Und doch treibt eine merkwürdige Furcht vor der Prärie diese Leute immer wieder in die Wälder, in denen sie sich erst Löcher schlagen und mühsam durch Roden und Umackern alles vorbereiten müssen, um Mais zu pflanzen. Da müssen die Kinder zugreifen, besonders ein so kräftiger Junge, im Frühling säen, im August ernten helfen, mit dem Axtrücken im hohlen Baumstumpf die Körner aus dem Korn schlagen, das ganze Jahr aber mit der Mutter und bald an ihrer Stelle das Schwein füttern, die Kuh melken und immer für Holz und für Wasser sorgen. So geht das Leben gleich, jeden Tag und jedes Jahr. Im Winter kann man sich nur manchmal waschen; viele Tage hocken alle in der Hütte am Feuer; dann kommt der Nachbar, und alle trinken, rauchen, schnupfen, spucken, auch die Frauen, und sie erzählen sich gruselige Geschichten.
Aber einmal, im Oktober, nachdem sie schon zwei Jahre hier draußen sind — vielleicht haben die Kühe Schlechtes gefressen, oder ist es nur der feuchte Boden —, da bricht ein heftiges Fieber aus und erfasst schnell alles Lebende ringsum. Die Pferde fallen, die Schafe winden sich am Boden, die Milch muss weggegossen werden, die Menschen stecken sich an, stöhnend liegen sie auf ihren Blättersäcken, und der nächste Doktor ist 35 Meilen entfernt und hat in seinem Umkreis alle Hände voll zu tun. Dumpfheit und ein verzweifelter Wunsch, die Nächsten und sich selbst zu retten, wogen und branden durcheinander, niemand kümmert sich um die gesunden Kinder. Wer kocht zu Hause, wer sorgt für das gesunde und kranke Vieh, wer schleift die Axt, wer trocknet das Reisig, wer schabt die Rüben, wer näht die Felle, wer? Die Mutter liegt krank, alle liegen sie auf einmal krank und fangen an zu sterben.
Die Nachbarn sterben, Großvater und Großmutter sterben beide auf ihren Blättersäcken in der Hütte, und dann stirbt die Mutter selber. Ihre schwindsüchtige Natur, die hagere, schlecht ernährte Gestalt, der Mangel an Lebenswillen geben der Krankheit Raum und Kraft; der Knabe aber, beinahe zehn Jahre alt, steht neben der stummen, bleichen Frau und kann ihr und kann sich nicht helfen. Den großen schweren Vater sieht er weinen, der struppige Bart wird ganz nass, zwischen Schrecken und Neugier gehen die ersten Stunden hin. Seitdem der erste Nachbar gestorben ist, hat der Junge den Vater Särge zimmern sehen, Bretter aus rohem Holz, und wenn er sie nagelte, ging der Schall den Kranken durch Mark und Bein und auch den Gesunden.
Jetzt schielt er herüber, wie der Vater das Maß nimmt an der toten Mutter, im Stillen sagt er sich, dass sie sehr groß war, und wenn er ihm dann verstohlen zuschaut, wie er sägt und nagelt, die Bretter mit Pflöcken verbindet, denn Nägel aus Eisen gibt es nicht, ruft ihm der Vater wohl zu, er solle das oder jenes bringen, und dann hilft der Junge. So geht es den ersten Tag recht lebhaft zu, mit Gängen und Fragen, man kommt nicht zum Bewusstsein des Geschehenen.
Dann aber, wie sie die Mutter in den Kasten legen und den Kasten in die Erde, und kommen zurück, und ihr Bett ist leer, da überfällt den nachdenklichen Knaben eine große Verlassenheit. Der Vater gefällt ihm nicht mehr, ein raues Wort, ein Schlag von ihm fällt ihm ein, alles Gute kam von der Mutter her, die hat ihn nie geschlagen, hat immer gesorgt, und wenn sie traurig aussah, hat sie zuweilen zu dem Jungen hinübergeblickt, der ihr ähnlich zu werden schien. Das Gefühl eines geheimen Zusammenlebens, das vielleicht nie sich aussprach, erfüllt das Kind, wächst rasch aus seiner Sehnsucht stärker und wird ihn sein Leben lang nicht verlassen. Der Hang nachdenklich-ernster Naturen zum Unerreichbaren oder Verlorenen steigert in ihm Erinnerung und Liebe zur Mutter und verdoppelt seine Schwermut.
Ein Jahr später macht sich der Vater bereit zu verreisen, er will in die Stadt und wird nicht gleich wiederkommen. Vielleicht sagt er’s den Kindern, dass er ihnen eine neue Mutter mitbringen will, oder der Vetter hat irgendwelche Gespräche erlauscht. Sicher bringt der nachdenkliche Junge die vierzehn Tage voll Unruhe zu, denn mit elf Jahren hat er gewiss schon vom Ruf der Stiefmütter gehört, und eines Abends im Dezember sind sie plötzlich da. Vier Pferde haben den Wagen aus Kentucky hierher nach Westen gezogen, sie scheinen gut genährt und der Wagen trefflich im Stande. Ängstlich schlagen die Kinderherzen: wie wird sie sein? Eine große, helle, gesprächige Frau steigt heraus, mit lockigem Haar und freundlichen Zügen, aber was blinzelt da noch hervor? Verlegen, wie die Kinder am Gitter des Blockhauses, blicken drei andere Kinder aus dem Wagen, und der Vater, der Verlegenste von allen, führt seine Kinder zu ihren und sagt ihnen, sie hießen Johannes, Mathilde und Sarah. Noch eine Sarah! denken die anderen, aber es bleibt ihnen keine Zeit, denn bald fängt der Vater an, Körbe und Kisten abzuladen, aus denen sich Stoffe und Sachen entwickeln, ein polierter Schrank und schließlich richtige Betten.
In ein paar Tagen ist aus dem ersten zögernden Händedruck ein erstauntes Spiel geworden zwischen den Kindern und mit der neuen Mutter, und wie der Vater sie ruft, hören sie, dass sie am Ende selber Sarah heißt. Gleich fängt sie an, alles zu verbessern, die Spalten müssen verklebt, der Tisch muss abgerieben werden, und bald liegt der Junge oben auf dem Boden in einem wirklichen Bett, zusammen mit Johannes Johnston: der erzählt ihm, so habe sein Vater geheißen, er sei genau im gleichen Herbst gestorben, wie hier die Mutter vom Hause. Also kannte der Vater die neue Mutter schon früher, vielleicht schon lange? denkt der Junge und sucht dies Dunkel zu ergründen. Jedenfalls gibt es viel Lärm, denn in der Hütte wohnen nun drei Große und fünf Kinder.
Obgleich es nicht bewiesen ist, dass die zweite Mutter Lincolns lesen konnte, weiß man, sie schätzte Bücher und hielt darauf, dass die Kinder alle in die Schule zum Einsiedler gingen, der nicht weit in einem Blockhause saß. Damit gewinnt sie rasch das Herz des Knaben, denn dem geheimnisvollen Schatze sich zu nähern, der in den Büchern vergraben sein muss, das nimmt ihm schon lange die Ruhe, wenn er einmal den Pfarrer, den Landmesser oder den reisenden Advokaten reden hört. Der Vater will einen Tischler aus ihm machen und lacht die neue Mutter aus, wenn sie vom Lernen spricht: er hat auch nichts gelernt, und doch geht es ihm gut. Denn sein schalkhaftes Wesen, voll von Geschichten, lässt ihm die Welt und sein Leben immer heller erscheinen, als sie sind, und lässt ihn immer hoffen. In die Kirche gehen sie am Sonntag, es ist ein kahler Raum, und oft spricht irgendeiner aus der Gemeinde, doch das verstehen die Kinder kaum. Im Schulhaus aber, da lernt er rasch und kann bald selber schreiben. Dass er besser und schneller gelernt hat als die anderen, hat später sein Vetter versichert.
Nur dass das Papier so selten ist und so teuer! Da malt er denn zu Hause mit einem rußigen Holzscheit, das er sich geschnitzt, auf einen Kistendeckel, und wenn es leidlich gelungen ist, dann überträgt er es sorgsam auf das kostbare Papier und übt so sehr früh, das Wichtige zu bedenken und sich kurz zu fassen. So lernte Abraham Lincoln das Schreiben. Und doch wurde er Vierzehn, ehe er richtig schreiben konnte.
Sehr beweglich sind seine Finger nicht, denn bis zum elften Jahre hat er sie nur zum Tragen und Schieben benutzt, und im Winter frieren die Kinder so, dass man ihnen angewärmte Kartoffeln in die Hände drückt, damit sie in der Schule nicht mit erfrorenen Fingern ankommen. Ist das Geld knapp oder braucht der Vater Hilfe, so darf er nicht in die Schule, denn das Holz für den Ofen zu Hause geht vor, ein Kalb ist acht Dollar wert, ein Buch ist nichts wert, und für einen Farmersohn im wilden Westen ist die Axt wichtiger als die Feder.
Die Axt lernt er jetzt brauchen, denn weil er für seine Jahre sehr groß ist und auch sehr stark, rechnet der Vater schon mit der Kraft seines Elfjährigen. Jetzt nimmt er ihn auch mit auf die Jagd, die Flinte hat er ihm gezeigt, nun soll er schießen. Sie sind ganz nahe bei den Hühnern, leise kommen sie näher, dort ist ein tüchtiger Truthahn: zielen und schießen! Er tut’s, und das Tier liegt am Boden. Sie treten heran. Plötzlich erschrickt der Knabe. Zum ersten Male begreift er die gefährliche Macht, die sich ein Wesen über das andere anmaßt, er steht vor dem getöteten Tier und vergisst zum ersten Male die Vorfreude, die ihn sonst vor dem Sonntagsbraten erfüllte, den der Vater nach Hause gebracht hat. Nichts fühlt er als Schrecken, dem Vater gibt er die Flinte zurück, der stutzt und fragt nicht viel. Aber er mag verdrießlich werden, wenn er den Jungen, der gleich so gut getroffen hat, sich später wehren sieht, wieder zu schießen. Mitten in der Prärie, groß und geschickt, und kein Jäger? Vielleicht denkt der Junge an die Gefangenen, vergleicht auf seine Art das eine mit dem anderen und sucht vergeblich Licht in dieser Dumpfheit.
Gewiss ist nur, Abraham Lincoln hat einmal in seinem Leben und nie wieder einen Schuss getan.
IV
Am schönsten ist es jetzt, zur neuen Mühle zu reiten: dort sind so viele Leute, und alle, scheint es, haben hier Zeit, ein jeder wartet, bis der Vordermann seinen Mais gemahlen hat. Jeder spannt sein eigenes Pferd vor, auf dem er her geritten kam, und lässt es am Querbaum in der Runde gehen. Hier wird viel geschwatzt, und man kann manches lernen. Sie sprechen vom neuen Präsidenten, wie die Wahl wohl enden wird, und dass es sich darum dreht, ob die Sklavenstaaten siegen oder die anderen. Davon hat der Junge schon einmal in der Kirche gehört, und wenn er jetzt den Vater wieder fragt, so erklärt der ihm, er hielte es mit den Methodisten, die alle Sklaven abschaffen wollen, weil es unchristlich ist, dass ein Mensch den anderen in Ketten tun und peitschen darf, soviel er will.
Den Vater sieht der Junge oft von der Seite an, passt auf, was er sagt und tut, wie er mit der neuen Mutter umgeht, und ob er gern arbeitet; im Grunde gefallen sie einander nicht sehr, und der Vater zieht seinen Stiefsohn Johnston, den Leichtfuß, entschieden vor. Oft hört er, der Vater reitet aufs Gericht, dann hört er ihn auf einen Nachbar schimpfen und auch auf die Regierung, weil sie jetzt von ihm das Geld für die Felder verlangt, die er damals von ihr bekam. Hat er nicht jahrelang darauf gearbeitet und alles erst urbar gemacht? Und dafür will der Staat auch noch Geld? Als ob man ein Sklave wäre! Klug kommt er dem Sohne nicht gerade vor, und dass er nicht lesen kann und nichts davon wissen will, wird ihm in den Augen des Jungen auch nichts nützen. Nur dass er lieber Geschichten erzählt, statt zur Arbeit zu gehen, das gefällt dem Sohn, denn hier ist weit und breit niemand und nichts, was seinen Ehrgeiz anregen könnte. Wie, wenn der Vater recht hätte und nicht die Mutter? Als Vaters Vater Abraham, nach dem der Junge heißt und den die Indianer erschossen haben, in die Wälder zog, da hat er nur geholzt und gejagt und ist wochenlang niemand begegnet.
Aber dann hört er wieder, dass Vaters Brüder es alle weitergebracht haben, die sind reich und haben große Höfe irgendwo, aber sie lassen sich nicht blicken. Wenn der Junge mit seinem großen und lustigen Vetter Denis spricht, erfährt er immer etwas, dann geht er nach Hause auf seinen Boden und denkt im Dunkeln lange nach. Neulich hat er gehört, dass der Vater die Nichte seines Herrn geheiratet hat. Also war er selber früher ein Knecht? Noch mehr: er hat sie schon damals zur Frau haben wollen, aber da hat sie ihn abgewiesen und Johnston genommen, weil dieser reicher war; dann hat auch der Vater eine andere genommen, und erst als ihre beiden Ehegatten tot waren, voriges Jahr, da ist sie seine Frau geworden.
Wunderliche Gedanken weben und schwanken in seinem Knabengehirn. Also war die richtige Mutter für seinen Vater eigentlich die falsche Frau? Hat sie vielleicht deshalb oft so traurig ausgesehen? Und doch kann er der neuen Mutter nicht zürnen, er liebt sie, denn sie sorgt für alle gleich; und in grübelnden Gefühlen schläft er neben Johannes ein, seinem Stiefbruder, mit dem er weder Vater noch Mutter gemein hat.
Manchmal mag er denken, sie sind zu viel, denn es gibt nicht genug für alle zu essen, und einmal, als der Vater im täglichen Tischgebet dem Heiland für die Mahlzeit dankt, ruft der Junge, der nur Kartoffeln vor sich sieht: „Na, Vater, heut ist aber nicht viel zu danken!“ Überhaupt fängt er an, auf seine eigene Weise Glossen zum täglichen Leben zu machen. In der Mühle ruft er dem Pferd bei jeder Drehung zu: „Geh los, altes Luder!“ und schlägt es mit der Peitsche. Als er es wieder haut und ruft: „Geh los“, schlägt das Pferd mit dem Huf nach ihm und trifft ihn so vor die Stirn, dass er ohnmächtig weggetragen wird. Als er am anderen Morgen erwacht, lösen sich von seinen Lippen die beiden fälligen Worte: „— altes Luder!“ Da lachen alle, er aber erzählt es noch nach Jahrzehnten, denn niemals wird er aufhören, sich selbst zu beobachten und aus der inneren Prüfung zu lernen.
Arbeiten mit Armen und Beinen liebt er gar nicht, aber lernen möchte er immer, keineswegs möglichst viel wissen, nur erfahren, vergleichen, die menschliche Natur begreifen, vor allem sich selber. Freilich liest er alles, was er findet, aber er findet nicht viel, und zum Lesen ist am Tage wenig Zeit und abends wenig Licht. Dann hockt er sich, wenn es im Sommer noch hell ist, mit hochgezogenen Knien unter das Vordach, nachts setzt er sich ans Feuer, und wenn es verglüht, schürt er es behutsam nur so viel an, dass er dabei lesen kann, denn die wenigen Lichte, die die Mutter samt der Seife selber macht, sind für den Feiertag bestimmt. Was liest der halbwüchsige lange Junge, wenn er auf dem Bauche liegt und die Arme aufstützt?
Was der Zufall hierher nach Westen weht, eröffnet ihm ganze Gebiete des Wissens wie durch einen Türspalt und schließt sie hinter sich wieder zu. „Pilgrims Progress“ führt ihn zu einer ersten innerlichen Prüfung, Robinson ist nichts als eine erhöhte Darstellung ihres eigenen Pionierdaseins, und die Bibel klingt wie eine ewige Melodie aus den frühesten Kindertagen immer mit. Aber da fliegen zwei andere Bücher durch irgendeinen Reisenden oder Pfarrer ins Haus: Äsops Fabeln erschließen ihm die ersten Ironien über die menschlichen Schwächen, daran übt sich sein Geist, zugleich stärkt sich sein Mitgefühl. Washingtons Leben aber, auch Franklins, mit vielen Geschichten aus dem Kriege, führt ihm mit einer Fülle von Anekdoten die Formung solcher Geschichten zu, wie er sie bisher nur immer vom Vater erzählen hörte. Einmal bringt ein Verwandter ein dickes Buch mit, das dem Onkel gehört: Ballays Etymologisches Lexikon; da findet der Fünfzehnjährige jedes englische Wort und was es bedeutet. Welch ein Schatz des Wissens! Dann kommt noch ein spannenderes hereingeweht: „Lessons in Elocution“ von W. Scott, Anleitung zum Reden, zum Stil, Regeln, wie man das anstellt, und viele Beispiele: das Leben großer Männer, Reden von Demosthenes an, Szenen aus Shakespeare, zum Vortragen. Und gar der „Kentucky Preceptor“! Da sind Gedanken über Mut, Frauen, Pflicht, Freiheit, Sklaverei, Jeffersons Antrittsrede: eine Art Bildungsbuch, hin rauschend über den guten Boden dieses jungfräulichen Herzens und Hirns wie ein fruchtbringender Sturzbach! Alles liest er genau, und weil es nur wenige Bücher sind, so liest er sie gleich ein dutzendmal. Manchmal ist auch etwas aus der Stadt in eine alte oder neue Zeitung eingepackt, und so ergänzt sich in dem Knabenhirn, was die Männer miteinander gesprochen haben.
Darf er einmal in die Stadt mitreiten, nach Gentryville, so nimmt er sich im Laden die Zeitung vom Tische, liest von den neuen Wahlen, und dass sie Jackson, einen Volksmann, wählen wollen, gegen das Treiben der adligen Halskrausen dort unten im Süden.
Denn immer kehrt in den Gesprächen, denen er schweigend zuhört, in den Zeitungsfetzen, die er erwischt, das Wort vom Süden und vom Sklavenhalter wieder, und auch in der kleinen Kirche, die sie in der Nähe bauen, als er vierzehn Jahre alt ist, dreht sich’s oft darum. Verstehen kann er es nicht völlig: dann sitzt er ganze Stunden still für sich und versucht, aus den Brocken sich Formen zu bilden.
In der Kirche, die nur ein Blockhaus ist, liest der Priester im Winter beim Feuerschein vor, und die Leute singen Psalmen und Hymnen; auch zu Hause wird viel gebetet, aber das scheint den Knaben alles weniger zu fesseln als seine eigene, zufällig sinnvolle Wanderung durch die menschliche Seele. Wenn ihn jetzt ein Mann von Welt und Geist kennenlernte, der müsste ihn für einen angehenden Dichter halten, und das ist er auch, er macht Verse und liest sie dem Freunde vor. Vor allem drückt er sich sehr tief die Dinge ein, die er liest, hört und sieht: „Wir lernten durch Sehen, Riechen und Hören, erzählte später sein Vetter. Wir redeten darüber so lange, bis die Sachen ganz dünn, fettig und fadenscheinig waren.“
Mit jedem Jahre wächst der Umkreis seiner Erfahrung, obwohl sich seine enge Welt zu Hause kaum erweitert. Aber jetzt kann er zuweilen bis zum Ohio reiten, dort treffen sich viele Menschen. Da halten an sandigem Ufer die Archen an, Hausboote, kleine Kielboote kommen dazwischen durch; die großen Flöße, mit Schweinen und mit Mehl beladen, werden von vielen Ruderern kunstvoll durch die Strömung getrieben, aber wenn einmal einer von den neuen Dampfern kommt, der ist immer kaputt, und die Leute sitzen und hämmern über den rostigen Maschinen. Den Jungen fesseln Boote und Flöße mehr als die unheimlichen Maschinen, denn hier kennt er das Material, vom Vater weiß er, wie man einen Baumstamm aushöhlt, wie man ein Floß zusammenbindet.
Das geht alles nach Süden, dem Meer zu, das tausend Meilen weit am Ende des Mississippi anfangen soll. Nach diesem Süden zieht es die Farmer alle, wenn sie ihre Produkte verkaufen wollen, dort braucht man sie, dort ist viel Geld, denn dort wächst die Baumwolle, und deshalb sind dort die Sklaven. Immer enden seine Gedanken dort unten im Süden, aber alle reden davon mit einer Art von Furcht und manche wie mit schlechtem Gewissen. Das merkt der Junge, der am Strande sitzt, zugreift, wo eine geschickte Hand gebraucht wird, und dafür die Leute ausfragt.
V
Mit Sechzehn ist er schon so stark, dass sie ihn den besten Holzfäller nennen, mit Siebzehn misst er sechs Fuß vier Zoll. In einer dritten Schule, die er wieder ein paar Monate besuchen kann, lernt er jetzt auch ein paar altmodische Manieren; Lincoln ist, alles in allem gerechnet, noch nicht ein Jahr zur Schule gegangen. So fließend er schreibt, die Hände werden doch hart und ledrig, denn meistens führen sie Hobel oder Säge, den Pflug oder die Zügel, am meisten aber die Axt, die ihn viele Jahre nicht mehr verlassen wird. Wenn die Leute einen Riesen gefällt haben wollen, so rufen sie ihn, denn man weiß, er schlägt tiefere Kerben als alle anderen. Er kann auch ein ganzes Hühnerhaus auf den Schultern tragen, und so heißt ihn der Vater für Fremde arbeiten und lässt sich die 20 Cent auszahlen, die der Sohn am Tage verdient. Welche Gedanken wälzt der wunderliche junge Mensch bei diesen Geschäften? Muss er nicht an die Mutter denken, die für Geld zu Fremden nähen ging, obwohl sie doch Haus und Hof besaß? Fällt ihm vielleicht der Gefangene wieder ein, dessen Tür der Vater damals verriegelte? Und hat der Vater nicht einmal gesagt, erst schuften und dann noch zahlen wäre Sklaverei?
Das Grübeln steigert sich mit jedem Jahr; lange kann er an einer Wand auf der Erde hocken, die Beine hoch und „auf den Schulterblättern sitzen“. Sitzen und Liegen passt besser zu ihm als Gehen und Reiten; zwar, seine Körperarbeit fordert Bewegung von ihm, aber er ist dabei nicht glücklich, und wenn er geht, schlenkert er mit den beiden langen Armen. Malaria, karge Kost und harte Arbeit haben ihn bei seiner Riesengröße schmal gelassen, den Brustkorb nicht entwickelt, die Schultern nach vorn fallen lassen und vollends, durch Erbschaft von der Mutter her, ein gelbliches, trockenes, schon sehr früh faltiges Gesicht mit groben Zügen ausgebildet. Wahrscheinlich sagen die Mädchen, der lange Abraham ist hässlich, denn sie verstehen nichts vom Charakter dieses großgefügten Kopfes, sie sehen nicht die Kühnheit dieser männlichen Nase, begreifen nicht den stummen Ernst dieser schmalen Lippen, die auf die ewige Frage zweier grauer, trauriger Augen schweigen. Sie sehen nur das Grobe, Kahle an ihm und mögen dem Vater recht geben, der als ein Zimmermann von seinem Sohne gesagt hat: „Er sieht aus wie mit der Axt zugehauen, aber noch nicht gehobelt.“
Auch ist er wunderlich und gilt bald für einen komischen Kauz. Mitten auf dem Felde legt er manchmal den Spaten weg, zieht ein Buch heraus und fängt an zu lesen: mit vorgeschobener Unterlippe, laut, möglichst auch für die arbeitenden Kameraden; es kommt sogar vor, dass er sie ausruhen heißt, sich auf ein Gitter setzt oder auf einen Stein und anfängt, zu ihnen zu reden. Zuerst wundern sich die anderen, bald merken sie, dass er etwas weiß, vom Fluss, von der Wahl, aus alten Zeiten, aber dann fangen sie zu lachen an, denn er erzählt alles als Geschichte, wie er’s von seinem Vater und wohl auch aus dem Äsop gelernt hat. Am liebsten aber kopiert er den Geistlichen, predigt wie dieser und bringt die anderen zum Lachen. Ums Reden, ums Üben ist es ihm zu tun, er braucht nur Zuhörer, gleichviel wen und wofür. Einmal kommt der Vater dazu, stößt ihn herunter und schimpft auf seine Faulheit.
Ein andermal sieht er die Jungens eine Schildkröte quälen, indem sie Feuer auf ihren Schild tun: da jagt er sie fort und schreibt zu Hause einen Aufsatz gegen die Tierquälerei. Wahrscheinlich ist das sein erster Versuch gewesen, er hat aber um diese Zeit auch schon gegen die Betrunkenen und den Schnaps geschrieben: jemand hat das den älteren Leuten gezeigt. Sieht es nicht aus, als wollte der wunderliche Bursche Mensch und Tier helfen? Einen Hund rettet er aus dem Treibeis; in einem Ringkampf kommt er dem Unterlegenen zu Hilfe, und alle fürchten ihn als Gegner, denn im Laufen und Springen bleibt er mit seinen langen Beinen, im Ringen mit seinen Riesenkräften doch immer Sieger. Weil er so stark ist, ruft man ihn, wenn ein Kalb getötet werden soll, und er, der niemals jagt und keinem Kaninchen was zu Leide tun kann, erschlägt das Tier kunstgerecht mit einem Schlage und zerlegt es, als wäre er Jäger von Beruf; dafür gibt es 30 Cent extra pro Tag. Darum schätzen ihn die Leute; nur wundern sie sich, dass das derselbe Junge ist, der für sie einen Brief schreiben und schön adressieren kann.
Er hat auch eine komische Art, plötzlich zerstreut zu sein und ohne Grund loszulachen, die niemand recht versteht als die Stiefmutter. Er hat nie eine Unwahrheit gesagt, berichtet diese kluge Frau, und das ist gewiss die Wahrheit. Weil er aber mit seinen siebzehn Jahren manches Unrecht erlebt oder doch das gewöhnliche Schicksal des armen Jungen oft als ungerecht empfunden hat, gibt er gut acht, wo anderen Unrecht geschieht: dann setzt er seine Körperkräfte ein. Deshalb hört er auch gut zu, wenn das Wandergericht in dem größten Blockhaus eines Nachbardorfes sich versammelt, und er passt auf, ob sie auch den zum Hängen verurteilen, der nur einen Indianer erschlagen hat. Halb unbewusst geht sein Mitgefühl zu den Indianern, denn sie sind die Vertriebenen und Bedrückten; aber er will mit dem Kopf nachprüfen, was ihm das Herz sagt und die Erfahrung des Zuhörenden vermittelt. Als er einmal einen berühmten Advokaten sprechen hörte, nahm er sich vor — so erzählte er später —, es auch so weit zu bringen; als er ihm aber die Hand hinstreckte, glühend, dankend, sah der vornehme Herr an dem schmutzigen langen Jungen vorbei. Er hieß Breckwridge, und 35 Jahre später werden sie sich wiedersehen. Jetzt borgt sich der Junge ein Gesetzbuch des Staates Indiana und tut den ersten Blick in die Welt des Rechtsstaates.
Auch für sich selber sucht er einen gewissen Grad von Freiheit zu erlangen und schafft sie sich mehr durch seinen starken Arm als durch die schreibende Hand; denn nur ein starker und geschickter Bursche kann auf dem Ohio zwei Reisende mit allem Gepäck rasch vom Fluss auf den Dampfer befördern, dass sie ihm schließlich ein Silberstück zuwerfen. Es ist ein halber Dollar! Lincoln hat nicht gewusst, dass man in einer Stunde einen halben Dollar verdienen kann. Dies und die Erfahrung der Dankbarkeit von Fremden gräbt sich tief in sein Gemüt, er wird es nie vergessen.
Als er siebzehn ist und Sarah neunzehn, soll sie heiraten. Vermutlich hat man ihm die Durchsicht der Papiere übergeben. Sicher hat er, bei seinem Wunsch nach Selbsterkenntnis, bei seiner Passion zu durchschauen und zu vergleichen, schon zuvor mit den Vettern über die Vorfahren gesprochen und ist dabei auf einen ungeklärten Punkt gestoßen. Ja, er braucht sich nur selber zu fragen, warum seine und Sarahs tote Mutter in ihren Papieren Nancy Hanks hieß, die Großeltern aber Sparrow. Musste dieser forschende Blick, wenn er die Tante fragte, nicht eine Verwirrung erkennen, und wurde seine Neugier nicht gesteigert durch irgendein dunkles Wort von einem der Vettern? Gewiss ist dies, dass er erfuhr, was man dem Kinde verschwiegen hatte. Die Großmutter war in Wahrheit nur Mutters Tante: die kräftige, lebhafte Tante Sparrow aber, die eine so schwungvolle Handschrift hatte, jetzt eine alte Frau, die war seine richtige Großmutter. Warum verschwieg man das den Kindern? Was lag zurück? Mit steigendem Erstaunen erfährt es der Jüngling: Seine eigene Mutter, deren Gedächtnis er ehrte, war ein natürliches Kind ihrer Mutter Hanks; ihre sittenstrengen Eltern hatten sie fortgejagt, das vaterlose Kind übernommen, und ihre kinderlose Schwester hatte es aufgezogen, ohne ihm ihren Namen zu geben; später hat die Großmutter den Sparrow zum Mann genommen und hat ihm noch neun Kinder geboren.
Wer also war sein Großvater? fragt sich der grüblerische junge Mensch. Und er forscht weiter und erfährt, die alte Frau, die aus Virginia stammte, war jung, als damals der Krieg zu Ende ging. In Washingtons Leben hat er’s ja gelesen, wie zu jener Zeit Soldaten und Abenteurer den Süden durchzogen. Dass da ein feuriges Mädchen zu einem Kinde kam, ist nicht erstaunlich, dergleichen hat er selber unter den Nachbarn ein oder das andere Mal erlebt; dann wurde sie eben des Mannes Frau, und alles war vergeben.
Hier aber war ein Unbekannter, und wenn auch der Enkel kaum alles erfahren haben mag, was man vom Wandel der Großmutter wusste, so musste er doch schließen, dass es ein Mann des Südens war, der seine Mutter erzeugt hat. Was für ein Mann? Ein Offizier? Wohl möglich. Ein Herr? Wahrscheinlich. Vielleicht ein Sklavenhalter.
Volle Verwirrung ergreift das Gehirn des Fragenden. Die Frage dauert an, sie wird nie enden, und erst viel später wird er einem Freunde anvertrauen, er schriebe seine besondere Art und seine Gaben dem Unbekannten in Virginia zu, der sein Großvater gewesen. Jetzt fühlt er nur, es steht nichts fest auf Erden, umher wankt alles; eine tiefe Niedergeschlagenheit vergrößert seine angeborene Schwermut und das Gefühl von Verlust und Einsamkeit, die ihn schon lange bedrücken. Die Mutter im Hause, so gut sie ist, ist doch nicht seine Mutter, die Großmutter war keine Großmutter, der Vater hat zuerst eine andere gefreit als die, die er begehrte. Jetzt aber, wo Sarah ins Haus der Grisbys heiratet und er das Hochzeitslied dazu dichtet, merkt er es gleich, dass sie, die Geld haben und sich feiner dünken, die Schwiegertochter von oben herab behandeln.
Gleich nach der Hochzeit sieht er schon, dass sie die junge Frau hart arbeiten lassen. Im nächsten Jahre geht die Schwester im Kindbett zugrunde; sie sagen, dass es die schwere Arbeit war, die sie geschwächt hat. Muss nicht der ganze Groll des neunzehnjährigen Burschen sich nun zusammenballen? Die Mutter starb, die Schwester starb, der Vater kommt nicht weiter, die Gruppe seiner Verwandten ist durch eine Lüge in schiefe Stellung gerückt, und all dies warum? Aus Abhängigkeit. Weil es Reiche gibt, die die Armen schlecht behandeln, sie für sich nähen und Holz hauen lassen, die Schwiegertöchter zur Magd erniedrigen und, wenn es sie gelüstet, eines schönen Tages ein Mädchen verführen, als ob es eine schwarze Sklavin wäre!
Etwas später, als eine Doppelhochzeit in jener Familie gefeiert wird, beleidigen sie den Schwager vor dem ganzen Dorf, sie laden ihn nicht ein. Da erwacht in Abraham Lincoln zum ersten Male der Wunsch, sich zu wehren, und wie er’s tut, das zeigt sogleich die Form seiner Waffen: eine unschädliche Ironie, ein Bauernstückchen, das er ausheckt. Durch einen anderen Burschen weiß er’s so einzurichten, dass die Zimmer der Brautpaare verwechselt werden. Als nun nach dem Festmahl die beiden Bräute zweier Brüder in ihre Zimmer geführt, die Brautjungfern verabschiedet sind, der Wein in allen Köpfen ist, da kommt die aufgeregte Mutter der Söhne nochmals in eins der Zimmer und ruft: „Aber Ruben! Du gehst ja mit dem falschen Mädchen ins Bett!“
Am anderen Morgen wissen es alle, jeder lacht auf Kosten der Hochzeiter; Lincoln aber schreibt eine Satire, anonym, lässt sie so fallen, dass die Familie sie finden muss, weiß sie aber auch sonst zu verbreiten: „Das Buch Ruben.“ Darin kopiert er den biblischen Stil; in gepfefferten Sätzen trägt er seine eigene groteske Erfindung so weit, dass noch nach Jahren die Leute erzählten, die Geschichte ging in Indiana mehr herum als die Bibel: „Da sahen wir, dass Abraham wirklich was war!“
Die Gefühle, die ihn zu einer solchen Satire führten, hätten in einem leidenschaftlich aktiven Menschen von so entschiedenen Kräften und Gaben den Wunsch nach Rache und Revolte entwickelt. Lincoln aber ist nachdenklich, mehr Menschenerkenner als -lenker, Geschichtenerzähler mehr als Reformer, und so wächst aus den bitteren Gefühlen seiner Jugend zuweilen Spott, meist aber Mitgefühl. Den Unterdrückten helfen will er lieber als Unterdrücker strafen, und alles, was er anfassen wird, durch Rat und Handlung, wird sich aus diesem Sinn für Recht und Menschenwürde in einem Manne gestalten, der die Demütigungen des Nächsten mit denen des eigenen Herzens vergleicht.
VI
Eines Tages öffnet sich ihm ein Blick in die Helle. Auf der Landstraße im Morast ist ein Wagen zusammengebrochen, man schleppt ihn in Vaters Werkstatt, damit er die Räder herrichte, eine Dame ist mit ihren Töchtern ausgestiegen, in das Blockhaus eingetreten, sie fängt an auszupacken und zu kochen. Es scheint, dass sie einige Tage geblieben sind; Lincoln erzählt viel später, sie hätten Bücher mitgehabt und vorgelesen. „Eins von den Mädchen gefiel mir sehr gut, ich dachte nachher viel an sie. Als ich dann eines Tages in der Sonne herumlag, machte ich im Kopf ein Gedicht darüber. Darin nahm ich meines Vaters Pferd, folgte ihr, fand sie, sie war erstaunt. Ich sprach mit ihr und überredete sie schließlich, mit mir durchzubrennen. Nachts hob ich sie auf mein Pferd, und wir ritten über die Steppe. Nach ein paar Stunden kamen wir in ein Dorf und erkannten, es war dasselbe, wo wir abgeritten waren. Dort blieben wir über Nacht. Die nächste Nacht kam das Pferd wieder zur selben Stelle zurück, und so immer wieder. Da begriffen wir, dass wir nicht durchbrennen durften. Endlich überredete ich ihren Vater, sie mir zur Frau zu geben. Ich wollte die Sache immer aufschreiben, aber ich sah am Ende, dass sie doch nicht viel taugte.“
Wie diese kleine Geschichte Lincolns Dichternatur enthüllt, nicht weil er Verse machte, sondern weil er in einem Zufall das Gleichnis sah, so führt sie tief in das Seelenleben des jungen Burschen hinein. Stärker und größer als alle anderen ringsum, scheut er sich doch vor den Frauen, und obwohl später jeder Farmer dieser Gegend irgendeine Geschichte von ihm erzählte, handelt doch keine von den Mädchen. Sind sie ihm zu robust? Vielleicht auch das. Eine von seinen Schwestern, die in ihn verliebt war, schlich ihm einmal in den Wald nach, sprang ihm wie ein Indianer plötzlich auf den Rücken, verwundete sich dabei den Fuß an seiner hinten hängenden Axt. Da verband er sie, so gut es ging, und schickte sie nach Hause.
In diesen zwei schmächtigen Abenteuern scheint sich durch viele Jahre das Liebesleben eines riesigen jungen Farmers zu erschöpfen. Weil er die Mädchen scheut, erzählt er zum Ersatz gern tolle, auch wüste Geschichten; weil er sie aber nie erlebt hat, erzählte er sie auf so anständige Art, dass nie ein Mensch ihn wüst genannt hat, selbst wenn er abends aus einem groben Witzebuch den Freunden vorlas. Wagt er es einmal, wenn auch nur im Traum, das feine Mädchen zu entführen, dessen Sitten und Fremdheit ihn gefangen nehmen, so schreckt er doch rasch davor zurück und wählt am Ende den legitimen Weg, auf dem es dem armen Jungen in der Wirklichkeit gewiss nicht gelungen wäre. Zugleich flüchtet er sich vor dem gefährlichen Reich der realen Begegnungen in die Sicherheit eines Gedichtes und überträgt die Erscheinungen in eine andere Welt, wo die reiche Tochter aus dem Reisewagen und der arme Tischlersohn an der Straße nachts auf demselben Pferde über die Ebene reiten und doch nicht zueinander gelangen dürfen. Verzagtheit und Entbehrung, Sehnsucht und Furcht vor der Wirklichkeit verweben sich zum Teppich eines Traumes und zerrinnen zu einem Gedicht, das niemals aufgeschrieben wurde.
Draußen rauscht die Weit vorüber, bald wird sie den Wartenden rufen. Da man gesehen hat, wie stark und wie geschickt der junge Lincoln sich am Fluss bewährt hat, so wird er jetzt von einem Farmer angeheuert, um dessen Ware nach New Orleans zu bringen. Eine große Gelegenheit, aus den Wäldern und Dörfern herauszukommen, den Mississippi zu sehen und schließlich das Meer! Da ist er gleich dabei, macht mit dem Sohn des Farmers das Floß zurecht, auf seinen starken Schultern trägt er Mastvieh und Maismehl zum Fluss, das sollen sie im Süden verkaufen und auf dem Heimweg dafür Baumwolle, Tabak, Zucker flussaufwärts bringen.
Da tut sich, wie sie nach Cairo kommen, an der Mündung des Ohio der Vater der Ströme auf, gelb, trübe, unübersehbar breit. Neue Menschen und Gelände, neue Bäume und Vögel begegnen ihnen nun auf der Fahrt nach Süden, dann gibt es Sturm und Gefahren, Sandbänke und Stromschnellen, und schließlich lernen sie die ersten Neger kennen, auf unerwartete Art: Wie sie einmal auf einer Plantage übernachten, schleicht eine Rotte marodierender Schwarzer heran, um das Floß zu berauben. Mit einem Holzklotz stürmt der erwachte Flößer auf sie los, und wie sie vor seiner Riesenerscheinung erschrecken, lassen sie sich rasch im Wasser und auf dem Lande verjagen; aber der Angegriffene ist jetzt so böse, dass er sie mit seinem Kameraden zusammen verfolgt, bis sie am Ende blutig zu ihrem Floß zurückkehren. So war Lincolns erste Begegnung mit den Negern.
Immer breiter wird der ungeheure Strom, immer heißer der Tag, immer dunstiger die Nacht, und vielleicht fragt sich der Dichter in dem jungen Ruderer, ob so das Leben sei. Gewiss, ein Spiegelbild der ewigen Bewegung sieht er zum ersten Mal, als sie in den großen Hafen münden. Das ist New Orleans, aber das Meer ist noch nicht zu sehen; tausend Flöße scheinen den Ausgang zu verstopfen, große Schiffe, wie er sie in Indiana nie gesehen, Seeschiffe liegen hier vor Anker, in riesigen Stapeln türmen sich die Säcke mit Mehl, die von Norden kommen, alles raucht, heult, ruft, schrillt durcheinander, die langen Schornsteine der Dampfer scheinen sich am Lande fortzusetzen, denn dort kommt am Ufergelände die erste Eisenbahn. Aber was sind das für Ballen, die längs des Kais und weiter unter Blechdächern gestapelt liegen, tausende? Bei einem oder dem anderen quillt es weiß, leicht und flockig durch einen Riss: daran erkennt es der Fremde. Das also ist die berühmte Baumwolle, die so viel Lärm im ganzen Lande macht! Lincoln trägt schon seit einiger Zeit baumwollene Hosen, er hat auch einen Rock mit, den er in der Stadt tragen will. Wenn er aber an alle die Fragen denkt, die sich daran knüpfen, an Sklaven und Präsidentenwahl, mag er im Anblick dieser Ballen doch mit dem Kopfe schütteln.
Sein Staunen wächst, als sie die Ladung gelöscht haben und die große Stadt betreten. Da tummeln sich auf den Straßen Weiße, Schwarze und Mischlinge, in eleganten Wagen fahren Europäer in vielen bunten Trachten vorüber, und die Frauen tragen große Hüte, lachen und fächeln sich. Alle scheinen heiter, beschäftigt, voll Hoffnung, mitten im Genuss, alle sind unabhängig. Wo aber sind die Sklaven? Dort prangt es in großen Lettern von einem Schild: „Zahle jederzeit die höchsten Preise für Neger jeder Art! Kaufe selbst auf Auktionen! Habe eigenes Gefängnis gebaut, um sie unterzubringen!“ An der nächsten Ecke ein anderes: „Hundert Dollar Belohnung, wer meinen entlaufenen Mulatten zurückbringt! Hört auf den Namen Sam. Helles Haar, blaue Augen, rötlicher Teint, so hell, dass man ihn für einen Weißen halten könnte.“
Das also sind die Enterbten, denkt der junge Schiffer, gesucht wie kostbare Hunde, versteigert wie Pferde, eingesperrt wie Verbrecher. Alles, was er zu Hause gehört hat, vom Vater erzählt, vom Pfarrer bestätigt, in den Zeitungen erörtert, wird heut in ihm lebendig und zieht ihn auf die Auktion. Er tritt in eine blechgedeckte Halle, wo sich das pralle Licht in Schlagschatten bricht, und sieht Vorführung und Verkauf.
Da stehen ein paar Dutzend Männer in guten Anzügen, mit schönen Stiefeln, Zylinder auf dem Kopfe; ihrer Bräune sieht man an, dass sie vom Lande gekommen sind, um zu verkaufen und zu kaufen, wohlgenährte Leute in der besten Hafenstimmung, zum Vergnügen entschlossen, die ersten Whiskys schon im Magen, Männer, die sich anstoßen oder anblinzeln und laut lachen; andere halten auf sich, stehen ruhig abseits und machen sich Notizen. Das sind die Kavaliere des Südens, von denen er so oft in den Zeitungen gelesen, rohe und feine, lärmende und vornehme, durch Herrenmanieren unterschieden von allem, was er im Westen auch unter den Reichen gesehen hat. Denn diese alle sind Erben, haben Land und Vermögen von den Vätern übernommen, nie selber gearbeitet, und darum sind sie auch ohne Bedenken, wenn es gilt Menschen zu kaufen.
Vor ihnen steht in auffälliger Kleidung, überlaut und prahlend, der Händler, eine kleine Peitsche in Händen, und weist mit ihr auf einen oder den anderen nackten Neger, wie sie langsam im Kreise vorübergehen. Alle haben sie Ketten an den Füßen, und wenn einer stehenbleibt oder zu schnell läuft, wird er vom Händler und seinen Leuten gepufft und geschlagen. Dazwischen läuft auch einMulattenmädchen, zart, offenbar unberührt, die gefällt den Herren besonders. Wie sie mit ihrer Kette am Fuß auf den Wink des Agenten heraustritt, beinahe nackt, wie er dies Kleinod aus seinem Stalle sich vor den Männern hin und her bewegen lässt, um ihre gesunde Jugend vorzuführen, wie er jetzt ruft: „Die Herren Käufer sollen ein Vergnügen haben!“, denkt jeder von den Männern dasselbe, und so steigern sie gern den Preis.
Dem Fremden zittert das Herz. Er müsste kein junger Mann sein, um das aufblühende Wesen nicht mit Unruhe zu betrachten; er müsste kein weißer Farmer sein, um keine Empörung zu empfinden. Aber nun ist er überdies ein Dichter und ein scheuer Junge, der keine Frauen kennt, nun ist er Lincoln, und so wirkt alles zusammen, um ihn zu erschüttern. Was er durch Abhängigkeit erlitten, was er über Vaters und Mutters Los gegrübelt hat, verbindet sich in ihm mit der Frage nach dem unbekannten Großvater. So einer wie diese Herren hier kann es gewesen sein — und das mit sich selbst beschäftigte Herz verdunkelt sich in quälenden Gedanken. Alles Mitgefühl strömt auf diese nackten, geketteten Menschen zusammen, alle Zweifel auf diese freien, reichgekleideten Käufer. Mit verwundeten Gefühlen verlässt er den Platz.
Nach ein paar Tagen geht es stromaufwärts zurück. Als sie nach dreimonatiger Reise heimkommen, hat er eine große Erfahrung gemacht und 24 Dollar verdient.
VII
Zu Hause findet er große Bewegung. Verwandte, die noch weiter westlich wohnen, haben erzählt, dort draußen, in Illinois, ist erst das rechte Paradies, der Boden fruchtbar, und wer sein Glück machen will, der komme nur! Vielleicht haben sie übertrieben, um durch eine größere Gemeinschaft ihre Lage zu verbessern; gewiss ist, dass von den enttäuschten Kolonisten in Indiana viele ihnen glauben, denn drei Familien machen sich zur gleichen Zeit auf in die Gegend von Decatur.
Thomas Lincoln, der Vater, hat dort Verwandte, und immer auf der Jagd nach dem Glück, zugleich immer bedacht auf das Glück der Jagd, unruhig und neugierig wie er ist, verärgert wegen seiner Landprozesse, hört er nicht zu, wenn man ihn vor Fieber im Westen warnt, verkauft um 125 Dollar sein Anwesen, die Frau verkauft das ihres ersten Mannes in der Stadt für 123 Dollar, alle Habe wird aufgepackt, wie damals vor einem Dutzend Jahren, als sie Kentucky verließen; aber nun sind es acht Große und vier Kinder, sie nehmen auch viel mehr mit, vierzehn Stück Vieh ziehen aus, und sie brauchen zwei Wagen. Einen soll Abraham führen, auf dessen Kräfte alle rechnen. Der ist indessen praktisch geworden; im Laden in der Stadt kauft er sich für alles, was er hat, mehr als dreißig Dollar, Knöpfe und Nadeln, Strumpfbänder, andere Kurzwaren, auch einen Satz Messer, die hier draußen wichtig und teuer sind.
Fünfzehn Tage dauert die Reise, abends ist es eiskalt, aber als der Hund einmal jenseits des Flusses zurückbleibt, watet Abraham mit nackten Beinen nochmals zurück, ihn zu holen. Endlich kommen sie an in Decatur, dem neuen Städtchen; die Verwandten empfangen sie freundlich, so dass sie zuerst wieder bei ihnen hausen. Bald liegt die Prärie verschneit, tagelang wagt sich niemand aus der Hütte, als um Brennholz zu holen. Aber Abraham ist guter Laune, denn er hat auf dem Wege sein ganzes fliegendes Lager verkauft und mehr als den doppelten Wert verdient. Auch scheinen die Leute hier draußen frischer, sie hoffen noch, im Geiste ernten sie schon, und wenn man erst ein Blockhaus hat, wird alles gehen.
Da steht, als es wärmer wird, der einundzwanzigjährige Riese und fällt die Bäume für das neue Haus. Wenn er sie abends heranschleppt, mit Seilen an ein offenes Ochsengespann gebunden, wenn er sie dann am ausgewählten Orte spaltet, mit mächtigen Schlägen seine Axt gebrauchend, Tag um Tag, und alles setzt auf seine Kraft, die des Vaters Kräfte weit übertrifft: ist einer da, dem eine Ahnung kommt, wo diese Stämme und mit welchem Jubel sie einst begrüßt werden sollen? Niemand, am wenigsten der Holzfäller, fühlt etwas anderes als die Forderung des Tages: das Blockhaus zu errichten. Die zarten Bewegungen der Seele, Liebe und Freiheit, Verzicht und Sklaverei empfindet seine Natur als Gleichnisse; aber die Arbeit seiner starken Arme ist die Gewohnheit, und nichts deutet darauf, dass er sie besonders geachtet hätte. Als das Haus steht, wesentlich von seinen Händen gebaut, geht das Leben weiter wie in Indiana. Zusammen mit dem Vetter John Hanks gräbt er jetzt fünfzehn Acker Landes um und spaltet die Stämme für das Gitter, um Wölfe und wohl auch Menschen von der neuen Behausung fernzuhalten.
Heimat? Wie soll in ihm, der ohne Grund viermal in seinen zwanzig Jugendjahren Land, Dorf und Hütte wechseln musste, wie soll in ihm ein Heimatgefühl erstehen, ihm, dem Kentucky, Indiana, Illinois nur wie wechselnde Bilder erschienen? Lincolns Heimat ist Amerika.
Nur dass er hier etwas mehr verdient, weil man ihn überall im Umkreis holt, wo der Stärkste gebraucht wird; denn gleich in den ersten Wochen hat er im Ringkampf den Stärksten dort besiegt und so mit einem Schlage seinen Ruf begründet. Einmal kentert ein Boot, niemand weiß Rettung: da knotet er einen Baumstamm am Ufer fest, kämpft sich auf diesem Stamm heran, erwischt und zieht die beiden Schiffbrüchigen ans Land. Von solchen Taten dringt der Ruf weithin durch die junge Ansiedlung, wo noch keine Überlieferung starke, reiche oder große Männer bestimmt hat, wo alles noch ungewiss ist, sucht und sich zu ordnen anfängt.
Da ist ein alter Major aus den Freiheitskriegen, dem macht er einen mächtigen Zaun und verdient sich damit ein paar blaue Stoffhosen: jeder Meter, erzählt er, hat ihn vierhundert zu spaltende Bäume gekostet. Aber der Offizier hat Bücher, die borgt er sich, und als er in diesem bitterkalten Winter einmal im Flachboot auf dem Fluss umkippt, lange schwimmen und laufen muss, kommt er mit erfrorenen Füßen zu einem Farmer, der früher Richter war. Bei diesen guten Leuten bleibt er ein paar Wochen, hilft im Hause, bringt Holz und füllt den Eimer, wie er’s gewohnt ist, aber dazwischen liest er das Gesetzbuch von Illinois, das zweite Rechtsbuch, das ihm in die Hände fällt.