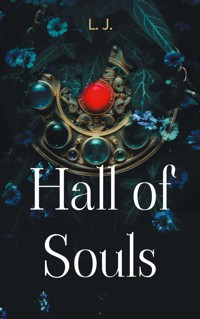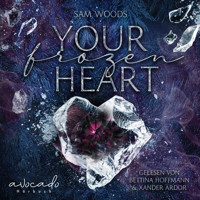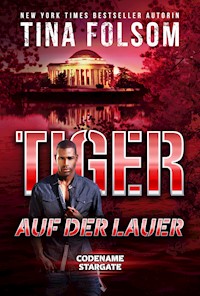Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Romane: (399) Stadt des Unheils (Klaus Frank) Dunkle Priesterin (Alfred Bekker) Wenn der Todeswalzer erklingt (Frank Rehfeld) Beverly hat eine scheußliche Ehescheidung hinter sich und ist nun erleichtert, wieder in ihren alten Heimatort, in das Haus ihrer Eltern, zurückgekehrt zu sein; obwohl auch dort einige Schatten der Vergangenheit lauern. Zunächst lebt sie sich mit ihrem Hund Rex gut ein und lernt den attraktiven Michael Clanton kennen. Dann jedoch häufen sich unheimliche Ereignisse. Ist sie etwa mit den Nerven am Ende und bildet sich nur ein, dass jemand sie verfolgt? Oder steckt ihr rachsüchtiger Exmann George dahinter? Als Beverly erkennt, dass alles ganz anders ist als gedacht, scheint es zu spät zu sein …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfred Bekker, Klaus Frank, Frank Rehfeld
Geister Fantasy Dreierband 1016
Inhaltsverzeichnis
Geister Fantasy Dreierband 1016
Copyright
Stadt des Unheils: Phenomena 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Dunkle Priesterin
Wenn der Todeswalzer erklingt
Geister Fantasy Dreierband 1016
Alfred Bekker, Klaus Frank, Frank Rehfeld
Dieser Band enthält folgende Romane:
Stadt des Unheils (Klaus Frank)
Dunkle Priesterin (Alfred Bekker)
Wenn der Todeswalzer erklingt (Frank Rehfeld)
Beverly hat eine scheußliche Ehescheidung hinter sich und ist nun erleichtert, wieder in ihren alten Heimatort, in das Haus ihrer Eltern, zurückgekehrt zu sein; obwohl auch dort einige Schatten der Vergangenheit lauern. Zunächst lebt sie sich mit ihrem Hund Rex gut ein und lernt den attraktiven Michael Clanton kennen. Dann jedoch häufen sich unheimliche Ereignisse. Ist sie etwa mit den Nerven am Ende und bildet sich nur ein, dass jemand sie verfolgt? Oder steckt ihr rachsüchtiger Exmann George dahinter? Als Beverly erkennt, dass alles ganz anders ist als gedacht, scheint es zu spät zu sein …
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author /
COVER WERNER ÖCKL
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Stadt des Unheils: Phenomena 7
von Klaus Frank
Der Umfang dieses Buchs entspricht 120 Taschenbuchseiten.
Drei Menschen sind in Briststedt verschwunden, und es scheint außer der IPA, dem Institute for paranormal Activities, niemanden wirklich zu interessieren. Als die drei Agenten der IPA in den Ort kommen, liegt eine unheimliche Atmosphäre in der Luft. Es dauert nicht lange, bis sie von einem unaussprechlichen Grauen angegriffen werden und um ihr Leben kämpfen müssen.
1
Vincent lief vor den wütenden Stimmen davon, die ihn verfolgten. Er kannte die Männer nur vom Sehen, aber er wusste, dass sie ihm Böses wollten. Keuchend rannte er über das öde Land und hoffte, dass er keine Kuhle übersah, die ihn zu Fall bringen konnte. Die Sonne hing hoch am blauen Himmel und schickte ihre mörderische Hitze, die Vincents Schädel zu versengen drohte.
Er blickte über die Schulter zurück, sah aber aus dieser Perspektive seine Verfolger nicht. Vielleicht war das ganz gut so, umso besser konnte er sich auf sein Ziel konzentrieren. Nicht weit von ihm entfernt sah er ein kleines Waldstück. Vielleicht gelang es ihm dort, die Männer zu narren, wenngleich er nicht wusste, wie er das anstellen sollte. Er fühlte schmerzhafte Stiche in seiner Seite, und sein Atem klang wie das Schnaufen eines gestrandeten Seelöwen.
Insekten zirpten und summten in seiner Nähe, vollkommen unberührt von den Ängsten, die ihn plagten. Ihre Stimmen klangen wie Spott in seinen Ohren.
Ich kann nicht mehr!, dachte er, aber ganz zu seiner Überraschung lief er dennoch weiter.
Wieder hörte er Stimmen, aber er verstand nicht, was sie sagten. Ohne es zu bemerken, verzog er sein Gesicht zu einer Grimasse, die ihn wie einen Schwachsinnigen aussehen ließ. Viele Leute glaubten gar, dass er einer war; im Laufe der Jahre hatte sich in den Köpfen der Menschen ein Bild von ihm entwickelt, in welchem er nur als Idiot seine Daseinsberechtigung hatte. Vincent verspürte keinen Anreiz, ihnen das Gegenteil zu beweisen; es lebte sich seiner Meinung nach ganz gut mit einem solchen Makel.
Doch sein Leben hing nun an einem seidenen Faden; das spürte er. Die Männer verfolgten ihn nicht, weil sie sich einen Spaß draus machen wollten, ihn zu demütigen.
Alles in seinem Körper brannte, sein Kopf genauso wie seine Füße und seine Lunge, und er stieß einen erleichterten Laut aus, als er endlich die ersten Sträucher und kleinen Bäume des Waldgebietes erreichte und von ihnen geschluckt wurde; nur noch das Hin- und Herschwingen der Äste und das ängstliche Gewusel einiger Tiere verrieten ihn.
Für einen Moment verhielt er sich still und lauschte, aber sein eigenes Keuchen übertönte die Schritte seiner Verfolger. Er konnte die Männer nun jedoch sehen. Drei waren es; sie näherten sich ihm, sodass er für einen Moment befürchtete, dass sie ihn ebenfalls sahen. Aber die Sträucher verdeckten ihn. Eilig lief Vincent weiter, durch Geäst und dornige Sträucher, die sich an ihm festkrallten und blutige Botschaften in seinen Armen und seinem Gesicht schrieben. Er machte ungelenke, hüpfende Schritte, um nicht ins Straucheln zu geraten. Er wusste nicht, wie groß dieses Waldstück war, aber er konnte sein Ende nicht sehen, und das machte ihm Mut. Er änderte unmerklich die Richtung und sprang von einer Lücke zur nächsten, die sich ihm bot.
Er warf einen flirrenden Blick zurück, übersah vor sich den Abgrund, der sich plötzlich auftat, und fiel mit einem Schrei auf den Lippen ins Leere. Sein Herzschlag schien auszusetzen. Der Aufprall, der einen Moment später folgte, erschütterte ihn und ließ ihn aufstöhnen. Für einen endlosen Moment verharrte er in der Umklammerung aus purem Schmerz, der ihm die Tränen in die Augen trieb. Er biss seine schlechten Zähne aufeinander, krümmte sich zusammen und kam sich wie ein Wurm vor, den ein perverses Kind in zwei Teile geschnitten hatte.
Er hörte ein heiseres Gekläff und spürte, dass es Zeit wurde, wieder auf die Beine zu kommen. Vorsichtig richtete er sich auf und war erleichtert, als er feststellte, dass er unverletzt war. Er war in eine Senke gefallen. Nachdenklich blickte er zu dem Abhang hinauf, den er hinuntergestürzt war, und sah die Schneise der Verwüstung, die er hinterlassen hatte.
Vincent bemerkte an der natürlichen Wand der Senke eine kleine höhlenartige Öffnung, die durch einen Busch vor allzu neugierigen Blicken geschützt war. Vielleicht nicht ganz das ideale Versteck, aber er vertraute darauf, dass ihm seine Verfolger so viel Raffinesse nicht zutrauten. Eilig verwischte er die Spuren seines Aufpralls, die sich im Laub abzeichneten, und quetschte sich in die Öffnung. Bequem war es dort nicht, aber es war auch nicht seine Absicht, lange dort zu verweilen. Schon jetzt vermutete er, dass die Männer seine Spur verloren hatten. Ihre leisen Stimmen wehten gespenstisch zu ihm hinüber, und er lächelte zufrieden.
So gut es ging machte er es sich in seinem kleinen Versteck bequem und schloss seine Augen.
2
In der letzten Zeit waren wir selten im Untergeschoss des riesigen Gebäudekomplexes der Europäischen Union in Straßburg gewesen, und noch nie war es passiert, dass wir zu dritt einberufen worden waren. Ich saß neben meinem Freund und Kollegen Stefan Crenz auf einem bequemen Stuhl, vor uns stand ein ovaler gläserner Tisch mit verschiedenen Getränken und und Papieren.
Auch unsere britische Kollegin Lita Ashton befand sich bei uns. Sie hatte uns bereits einige Male bei unseren Fällen unterstützt. Stefan und ich hatten erst bei unserem Eintreffen erfahren, dass auch sie dabei war. Unsere Wiedersehensfreude wurde nur von der allgemeinen Verblüffung übertroffen, und wir ergingen uns in Spekulationen, welcher Art die Gefahr diesmal sein mochte.
Ich mochte Lita sehr gerne und freute mich jedes Mal, sie zu sehen, auch wenn die Anlässe meist bedrohlicher Art waren. Obwohl sie recht klein war, ging von ihr eine mitreißende Dominanz aus, der man sich nur schlecht entziehen konnte. An Mut fehlte es ihr ebenfalls nicht, wie sie während unserer Einsätze bewiesen hatte.
Ich kam nicht umhin, ihr in unregelmäßigen Abständen einen Blick zu widmen. Sie hatte ihr halblanges, leicht gewelltes Haar im Nacken zusammengebunden, was vermutlich der Hitze geschuldet war, die wie eine Glocke seit Tagen über Europa lag.
Immer wieder erinnerte mich die sonore Stimme unseres Chefs, Jules Vernon, daran, dass wir nicht zu unserem Vergnügen hier waren. Wir befanden uns in den Räumlichkeiten des IPA, dem Institute for paranormal Activities, einer noch relativ neuen, von der Europäischen Union ins Leben berufenen Organisation, deren Agenten sich um die paranormalen Auffälligkeiten kümmerten, zu denen es in den vergangenen Jahren immer häufiger gekommen war. Wir, Stefan Crenz und ich, waren ausschließlich in Deutschland tätig; kürzlich noch waren wir in München unterwegs gewesen, wo ein Toter aus dem Jenseits heraufbeschworen worden war, um einen Rachefeldzug gegen seine Freunde zu beginnen. Dieser Fall war erledigt, die Akten lagen im Archiv und waren längst ausgewertet.
Nun warteten im Norden Deutschlands Aufgaben auf uns. Ich konzentrierte mich auf Vernons Worte. Neben ihm saß, wie fast immer, sein Stellvertreter Albert Armstrong, ein bleichgesichtiger Brite mit einer unangenehm näselnden Stimme. Ich mochte den Mann nicht und wich ihm aus, so weit es möglich war. Den meisten Agenten, mit denen ich mich über Armstrong unterhalten hatte, ging es so; trotzdem gab es doch einige Befürworter seiner arroganten Art, mit der er sich mit Menschen auseinandersetzte.
Ich war froh, dass er sich bislang zurückgehalten hatte und ausschließlich Vernon das Wort überließ.
»Im Süden Schleswig-Holsteins liegt ein kleiner Ort namens Briststedt. Er befindet sich im Norden von Norderstedt und nordöstlich von Quickborn. Sehr beschaulich, aber es geht dort grausig zu. Etwas scheint mit diesem Ort nicht zu stimmen, und das schon seit Jahrhunderten.«
»Seit Jahrhunderten?«, fragte Stefan nach, in seiner Stimme hörte man die Ungläubigkeit heraus.
Vernon nickte. »Sie haben richtig gehört. Immer wieder kommt es dort zu Verbrechen oder Unfällen, manchmal herrscht dort über mehrere Jahre idyllische Ruhe, dann gab es Phasen, in denen es binnen weniger Monate zu auffälligen Geschehnissen kam, die unerklärlich waren. Das Besondere ist, dass die Bewohner dieser Stadt das mit ungewöhnlicher Gelassenheit zur Kenntnis nehmen und wie immer ihrem Tagwerk nachgehen. Man sollte doch vermuten, dass es in mehr oder weniger großem Ausmaß zu einer Flucht käme, aber dem ist nicht so. Die Bewohner leben weiterhin ihr Leben, als sei nichts Böses geschehen.
Manchmal kommen Fremde zu Schaden, manchmal auch die dort lebenden Menschen. Die Behörden sind ratlos, legen jedoch auch kein Übermaß an Emsigkeit an den Tag, diese eigenartigen Vorkommnisse aufzuklären.
Es sieht fast so aus, als habe man sich mit den Fällen arrangiert. Wir haben von diesen Vorkommnissen nur aus dem Grund erfahren, weil wir Daten aus den Nachbarorten erhalten und ausgewertet haben. Aus Briststedt hingegen liegen kaum Daten vor.«
»Und wir sollen nun dem Geheimnis auf den Grund gehen«, mutmaßte Stefan und erntete ein Nicken von Vernon und Armstrong.
»Klingt so, als würden wir nach Castle Rock fahren«, sagte ich.
Ich erntete mit meiner Bemerkung verwirrte, überraschte oder missbilligende Blicke und sah mich gezwungen, eine Erklärung abzugeben. »Eine fiktive Stadt in vielen Romanen und Erzählungen von Stephen King.«
»Hm«, murmelte Vernon.
»Ein wenig mehr Ernsthaftigkeit wäre wünschenswert«, zischte Armstrong. Ich schenkte ihm ein herzliches Lächeln, was ihn noch mehr zu verbittern schien.
»Wir haben trotz aller Forschungen überhaupt keinen Ansatzpunkt dafür, was der Grund für all diese Vorkommnisse sein könnte.« Vernon schlug eine vor ihm liegende Akte auf. »Im Jahr 1985 lief ein Bewohner des Ortes plötzlich Amok und ermordete im Laufe von zwei Tagen neun Menschen, darunter seine Frau und seine sechsjährige Tochter. Er wurde schließlich von der Polizei erschossen. Der Grund für diese Irrsinnstat liegt völlig im Dunkeln.
Genauso auch im Fall Petra Meuchler, die zu einem Gartenfest einlud und ihre Gäste vergiftete, einschließlich sich selbst. Am Ende waren sechs Leichen zu beklagen.«
»Immerhin«, bemerkte ich und rüstete mich für den nächsten Rüffel, »die Frau hatte den passenden Namen.«
Niemand sagte etwas, nur Armstrong schüttelte seinen farblosen Schädel.
»Auch Touristen kamen immer wieder zu Schaden. Durchreisende, die plötzlich für immer verschwanden, mutmaßlich fanden sie ihr Ende in Briststedt, wenngleich es hierfür keine handfesten Belege gibt. Die Ermittlungen verliefen alle im Sand, auch begründet wegen des offenkundigen Misstrauens der Einwohner. Zahllose Fälle von häuslicher Gewalt liegen in unseren Archiven, auch Kindesmisshandlungen, ebenso sind Tierquäler dort zahlreich vorhanden. Doch es wurde nie etwas getan, was zur Aufklärung beigetragen hätte. Für Aufsehen erregte ebenfalls ein Massaker im örtlichen Schlachthof vor einigen Jahren, als aus unbekannten Gründen ein Mitarbeiter durchdrehte und etliche Kollegen ermordete.«
»Möglicherweise ein Fluch?«, fragte Stefan. »Etwas, das in grauer Vorzeit dort vorgefallen ist und bis heute seine Wirksamkeit entfaltet?«
»Durchaus möglich, aber auch hier gilt: Wir wissen es nicht. Die Stadtarchive geben diesbezüglich nichts Nützliches her. Von der Entwicklung würde man sagen, es handelt sich um einen ganz normalen Ort, in dem nichts Weltbewegendes geschieht.«
Ich kratzte mich am Kopf. »Und das geht tatsächlich schon seit Jahrhunderten so?«
Vernon nickte. »Kaum zu glauben, aber so ist es wohl. Schon im sechzehnten Jahrhundert wurde darüber berichtet. Briststedt stand zumindest damals völlig auf sich allein gestellt da. Die umliegenden Städte und Gemeinden sahen den Ort wohl als Hort des Bösen an und mieden ihn, so gut es ging. Geschäfte mit Briststedt waren für eine lange Zeit völlig verpönt. Das geht aus Berichten der Nachbarorte hervor. Nur in Briststedt zog man es vor, diesbezüglich zu schweigen. Heute ist das anders. Die Leute glauben nicht an den Teufel oder an Flüche. Für die meisten Menschen dürfte Briststedt ein verschlafenes Kaff sein, in dem nichts Außergewöhnliches passiert. Auch hier ist es seltsam, dass all die Verbrechen aus der nahen Vergangenheit keinen Argwohn weckten. Es scheint beinah so, als nehme man Nachrichten aus Briststedt nur beiläufig zur Kenntnis, als geschähe all das nicht.«
»Nun«, sagte Stefan lapidar, »dann nichts wie hin.«
»So ist es«, sagte unser Chef, »ich glaube nicht, dass Sie dem Kern der Sache auf den Grund gehen können, aber das ist auch nicht Ihre Hauptaufgabe.«
»Sondern?«, hakte ich nach.
»Aktuell scheint dort wieder etwas im Gange zu sein. Menschen verschwinden, sowohl Einheimische als auch möglicherweise Durchreisende. Im Moment sind uns drei Fälle von verschwundenen Personen bekannt. Die Namen finden Sie in den Ihnen vorliegenden Akten. Wir können nicht abschätzen, ob dies wirklich der Auftakt einer Reihe von weiteren Vermisstenmeldungen sein wird, doch wir sollten diesmal gewappnet sein.«
»Warum soll auch ich mit?«, fragte Lita Ashton. Es war das erste Mal, dass sie etwas sagte. Normalerweise hatte ich sie als sehr gesprächige, lebhafte Frau kennengelernt, hier jedoch hielt sie sich auffällig im Hintergrund.
»Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Da wir Ihnen so gut wie keine Anhaltspunkte mit auf den Weg geben können, scheint es angeraten, mit einem größeren Team anzureisen. Falls es nötig sein sollte, können wir zu einem späteren Zeitpunkt auch noch mehr Leute loseisen und zu Ihnen schicken.«
»Sie glauben wirklich, dass dort etwas Großes im Gange ist?«, fragte ich.
Vernon nickte. »Absolut. Briststedt könnte sich als heißes Eisen bewahrheiten, das ist meine Überzeugung. Sie sollten sich keineswegs auf einen Erholungsurlaub einstellen, auch dann nicht, wenn Sie nichts Verdächtiges ausmachen können. Hinter jedem Baum könnte eine tödliche Gefahr auf Sie lauern. Seien Sie auf der Hut.«
Für einen nüchternen Mann wie Vernon klangen diese Worte ungewöhnlich düster und pessimistisch, und ich fragte mich insgeheim, ob er uns alle Details mitgegeben hatte. »Und wann startet unser großes Abenteuer?«
»Morgen früh um acht Uhr. Sie fliegen von Straßburg, wie Ihnen bereits mitgeteilt wurde. Wegen der Dringlichkeit stellt Ihnen die Armee ein Flugzeug bereit. Ihr Gepäck haben Sie ja bereits dabei, wie ich sehen konnte. In Hamburg wartet ein Mietwagen auf Sie. Genießen Sie derweil die Stadt ein wenig; Straßburg ist ein lohnenswertes Ziel.«
3
Wir benötigten kaum eine Stunde bis zum kleinen Ort Briststedt. Unser Auto, ein silberfarbener Mercedes der C-Klasse, war mit ausreichend Platz ausgestattet, sodass drei Personen samt Gepäck bequem unterwegs sein konnten. Im Hintergrund lief leise das Radio, das uns mit Musik und Nachrichten versorgte, während wir uns über unsere Aufgabe unterhielten.
Wie Vernon bereits erwähnt hatte, besaßen wir überhaupt keine Anhaltspunkte, daher war ich überaus skeptisch. Wir konnten nur abwarten, ob während unserer Anwesenheit etwas Ungewöhnliches geschah, wovon jedoch nicht unbedingt auszugehen war. Vielleicht fanden wir Zeugen, die etwas gesehen hatten. Zwei der verschwundenen Personen lebten in Briststedt, also wollten wir bei den Familien und Mitbewohnern mit unseren Nachforschungen beginnen.
»Hier ganz in der Nähe befindet sich das Henstedter Moor«, sagte Lita, die auf dem Beifahrersitz saß und auf ihr Smartphone starrte. »Auch große Naturschutzgebiete befinden sich in der Umgebung. Vielleicht sind die drei Personen, falls ihnen tatsächlich etwas zugestoßen sein sollte, dorthin gebracht worden. Ich nehme an, es handelt sich um unwegsames Gebiet.«
»Gut möglich«, vernahm ich Stefans schläfrige Stimme von hinten. Er hatte mir erklärt, dass er in der vorherigen Nacht kaum geschlafen habe. Und tatsächlich zeigte sein Gesicht Spuren von Müdigkeit und Erschöpfung. In seinen dunklen Augen stand ein glasiger Ausdruck.
Ich nahm einen tiefen Schluck aus einer offenen Flasche mit Mineralwasser. Es waren noch zwei Kilometer bis zum Ortseingang. Ich musste zugeben, dass mich jetzt doch eine gewisse Nervosität gepackt hatte. Was würde uns in Briststedt wohl erwarten? Alte, verstockte Menschen, denen kein Wort zu entlocken war?
Konnte es so etwas geben? Ein Ort, der unter keinem guten Stern entstanden war, wo Unglücksfälle und Verbrechen seit Jahrhunderten an der Tagesordnung waren? Und warum war im Laufe der langen Zeit nie jemand auf den Gedanken gekommen, den Ort aufzugeben und zu einer Geisterstadt werden zu lassen? Die Menschen hätten gut woanders unterkommen können. Aber vielleicht war diese Idee ja schon seit Langem im Umlauf und wurde aus irgendwelchen Gründen nicht umgesetzt. Wo das Böse herrschte, verlief nicht immer alles in klaren Bahnen.
Hinter einer engen Kurve trat plötzlich eine Frau auf die Fahrbahn.
»Verdammt!«, schrie ich. Ich trat auf die Bremse, erkannte jedoch, dass ich nicht rechtzeitig anhalten konnte. Verzweifelt kurbelte ich am Lenkrad. Adrenalin peitschte durch meinen Körper; jeglicher Anflug von Müdigkeit war verschwunden. Nur um wenige Zentimeter driftete der schwere Wagen mit dem Kotflügel an der düster dreinschauenden, reglos auf der Straße stehenden Frau vorbei. Dann krachte es, als der Benz mit einem Baum kollidierte und zum Stehen kam.
Ungerührt drang aus den Lautsprechern die fröhliche Stimme des Sprechers. Ich stellte das Radio ab und bemerkte, dass meine Hand leicht zitterte.
Die Kollision mit dem Baum war nicht besonders stark gewesen, dennoch war ich mir nicht sicher, ob das Auto noch fahrtüchtig war.
Ich wandte mich erst Lita, dann Stefan zu. »Seid ihr okay?«
Lita nickte und löste ihren Gurt.
Gleiches tat auch Stefan. »Alles in Ordnung. Was ist denn in dich gefahren?«
Ich stutzte. Auch vom Hintersitz musste Stefan die Person gesehen haben. »Die Frau«, erklärte ich. »Plötzlich stand sie auf der Straße, zum Bremsen war es zu spät, ich hätte sie angefahren, also musste ich ihr ausweichen.« Ich blickte zum Seitenfenster hinaus, dann in den Außenspiegel. Niemand war zu sehen. Wohin war sie so schnell verschwunden?
»Ben, da war niemand«, sagte Lita. »Die ganze Straße war frei.«
»Nein!«, widersprach ich heftig. Ein dumpfes Gefühl machte sich in meinem Kopf breit. »Natürlich war da jemand. Ich habe die Frau doch ganz deutlich gesehen. Sie trat plötzlich auf die Straße. Ich …«
»Lita hat recht, Ben«, unterbrach mich Stefan. »Da war wirklich niemand.«
Ich verzog meine Mundwinkel. War ich denn plötzlich verrückt geworden? War ich von einer Vision genarrt worden? Ich war in der Lage, Phantome zu sehen, das war mir bereits einmal passiert, doch es war unter anderen Voraussetzungen geschehen. Wie war es möglich, dass ich urplötzlich Menschen vor mir sah, die es überhaupt nicht gab?
Das hier gefiel mir überhaupt nicht. Ich schüttelte den Kopf. »Bitte glaubt mir, da war jemand. Ich fantasiere nicht. Ich habe die Frau ganz deutlich vor mir gesehen.«
»Dann gibt es vermutlich nur eine Möglichkeit«, sagte Lita, »jemand will nicht, dass wir in Briststedt herumschnüffeln.«
»Möglich«, erwiderte ich. »Vielleicht ist es ja sogar die Stadt selbst.« Ich stieß die Fahrertür auf und verließ das Auto. Heiße Luft begrüßte mich wie ein Schlag in die Magengrube. Meine Begleiter taten es mir nach.
»Was machen wir mit dem Gepäck?«, fragte Stefan.
Ich zuckte mit den Achseln. »Lassen wir es zunächst mal hier. Wir suchen uns ein Hotel oder eine Pension. Ich denke, das Auto lassen wir hier stehen. Es behindert niemanden. Wir werden Nicole in Straßburg informieren, damit sie den Autovermieter kontaktiert.«
Lita sagte: »Unsere Waffen sollten wir mitnehmen.« Sie öffnete den Kofferraum und wühlte in ihrer Reisetasche. Sie beförderte ihre Dienstpistole, die mit einer Spezialmunition geladen war, in einen Rucksack.
Ich warf ihr ein Lächeln zu. »Gute Idee.« Auch meine Pistole der Marke Walther PPQ Classic verschwand in Litas Rucksack. Stefan folgte meinem Beispiel.
»Dann hoffen wir, dass sich unsere Wege nicht trennen. Sonst steht ihr ziemlich dumm da.« Mit einem verschmitzten Lächeln schloss Lita den Rucksack.
»Wir passen gut auf dich auf«, versicherte ich mit Nachdruck.
»Du meinst, ihr passt gut auf die Waffen auf.«
Ich verzog das Gesicht zu einem Lächeln.
Nicht weit von uns entfernt lag ein kleines Gehöft mit einem Haupthaus und einigen Nebengebäuden. Ich schirmte meine Stirn mit einer Hand ab. »Lasst uns zuerst dorthin gehen. Vielleicht können wir dort schon etwas in Erfahrung bringen.«
Langsam setzten wir uns in Bewegung.
4
Es war kein langer Marsch, den wir zurückzulegen hatten, wofür wir alle äußerst dankbar waren, denn die Sonne sandte uns ihre Strahlen mit brutaler Vehemenz entgegen und machte unsere Schädel wachsweich.
Stumm gingen wir nebeneinander. Diesen Luxus konnten wir uns gönnen, denn ein vorbeifahrendes Auto hatten wir bislang noch nicht gesehen.
Die Frau schlurfte geisterhaft durch meinen Kopf. Ausgeschlossen, dass ich sie mir eingebildet hatte, daran glaubte ich nicht für eine Sekunde. Ich erinnerte mich an meine Begegnung mit Werner Kalfanie. Ein simples Händeschütteln zur Begrüßung hatte genügt, um mir sein viele Jahre zurückliegendes Verbrechen vor Augen zu führen. Plötzlich stand sein Mordopfer, Sandra Weingart, vor mir und führte mich zu ihrem Grab. (Siehe Phenomena Band 4). War vorhin so etwas Ähnliches geschehen? War dies etwa auch ohne vorherigen Körperkontakt möglich? Ich schluckte, diese Möglichkeit bedrückte mich. Was war, wenn ich eines Tages umgeben war von einer Armee aus Geistwesen, die Absolution oder Rache von mir einforderten. Das war, dachte ich sarkastisch, der schnellste Weg ins Irrenhaus.
Allerdings war nichts dergleichen vorhin geschehen. Die Frau tauchte auf und verschwand wenige Sekunden später, ohne dass sie mir ihre Aufwartung gemacht hatte. Ich erinnerte mich an meine eigenen, nicht ganz ernsthaft gemeinten Worte von vorhin, dass der Ort unseren Besuch verhindern wollte. Die Frage, wie so etwas möglich sein konnte, stellte ich mir nicht, denn das hieße zu akzeptieren, dass diese Stadt mehr war als totes Gestein und ödes Ackerland.
Es war nicht so, dass das Licht dunkler wurde oder plötzlich keine Vögel mehr zwitscherten, nachdem wir das Ortseingangsschild passierten, es geschah nichts dergleichen, aber dennoch fühlte ich eine gewisse Spannung, als sei die Luft mit Elektrizität aufgeladen. Womöglich nur Einbildung, was kein Wunder wäre nach dem Unfall, aber dennoch wollte ich auf der Hut sein.
Im Hintergrund sahen wir eine kleine Ansammlung von Häusern, die dichtgedrängt in einer leicht abschüssigen Senke standen, rundherum war die Gegend bewuchert mit Wäldern und Weideflächen. Auch landwirtschaftlich genutzte Flächen sahen wir zuhauf. Im Ortskern sah ich eine Kirche aufragen, es war das höchste Gebäude Briststedts. Aus der Ferne wirkte der Ort wie tausende andere auch.
Wir näherten uns dem kleinen Hof. Zwar sahen wie niemanden, jedoch flatterte an einer langen Leine bunte Wäsche, vereinzelt blitzten die Fenster im Sonnenschein. Ein alter BMW stand im Hof. Jemand schien also zu Hause zu sein.
Auch auf der anderen Straßenseite, noch etwas weiter entfernt, stand ein Haus, zu dem einige Anbauten gehörten. Jedoch befanden sich die Gebäude in einem bedeutend schlechteren Zustand. Selbst aus der Ferne entdeckte ich einige fehlende Dachschindeln. Umrahmt wurde das Grundstück von wuchernden Gräsern. Der Wind wirbelte eine Staubwolke auf.
»Wirkt nicht sehr einladend«, murmelte Stefan und deutete mit dem Kinn auf das entfernt liegende Grundstück.
»Wirklich nicht.«, stimmte Lita ihm zu. »Das sind bestimmt die Außenseiter hier im Ort. Jede Wette, dass dort keine Frau wohnt.«
Ich suchte nach einer scharfen Entgegnung, jedoch fiel mir keine ein; vermutlich, so dachte ich, hatte Lita recht mit ihrer Behauptung.
Stefan schaute zum Himmel, der sich mit einem solch tiefen Blau über uns spannte, dass dies selbst für ein Postkartenmotiv zu übertrieben gewirkt hätte. Der schwache Wind kühlte die heiß-trockene Luft kaum ab. Er wischte sich mit einer übertriebenen Geste über die Stirn.
Lita fuchtelte einige Fliegen fort, die in ihrer Nähe summten. Auch um mich schwirrten sie herum und weckten üble Assoziationen zu unserem letzten Fall. (Siehe Phenomena Band 6)
»Gehen wir erst einmal zum Haus«, meinte ich. Ich spürte den Schweiß am Rücken hinunterrinnen und freute mich darauf, für einige Minuten im Schatten zu verschnaufen.
»Gute Idee«, meinte Lita. Ihr machte die Hitze scheinbar weniger zu schaffen als Stefan oder mir. Sie schirmte ihre Stirn mit der Hand ab. »Das Haus dort drüben gefällt mir wirklich nicht. Das sieht mir nach gesundem Ackerboden aus, aber alles liegt brach und wirkt im Gegenteil sogar verwildert. Und ich sehe auch kein weidendes Vieh. Wovon leben die Leute dort?«
»Ja, das ist eine gute Frage«, murmelte Stefan. »Aber möglicherweise ist der Hof gar nicht mehr bewohnt, vielleicht steht er zum Verkauf.« Er wollte noch mehr sagen, jedoch sahen wir in dieser Sekunde einen Mann aus einem Seiteneingang treten und zum Haupthaus gehen. Der Hof lag zu weit entfernt, um weitere Details erkennen zu können, doch selbst über diese große Distanz hinweg wirkte der Mann auf unerklärliche Weise unheimlich. Ich nahm an, dass wir alle diese Ausstrahlung spürten. Er verschwand im Haus, ohne einen Blick in unsere Richtung zu werfen.
Ich fühlte mich seltsam benommen, was durchaus an der Hitze liegen mochte. Ich massierte meine Schläfen, um diesem Schwebezustand zu entrinnen. Wir hatten nicht daran gedacht, Mineralwasser mitzunehmen, was ich nun bedauerte. »Gehen wir weiter. Wir sollten aus dieser Gluthitze rauskommen.« Ich klatschte in die Hände und ging voran. »Vielleicht bekommen wir dort ein kühles Bier.«
»Alkohol im Dienst? Das geht aber nicht«, protestierte Lita.
»Spielverderberin«, murrte Stefan.
»Aber das weißt du doch.« Sie warf ihm einen zwinkernden Blick zu.
Wir gingen stumm weiter, zum Reden hatte niemand mehr die rechte Energie.
»Endlich«, schnaufte Stefan. Sein Gesicht war gerötet, und Schweiß rann ihm von der Stirn. Wir gingen durch eine breite asphaltierte Einfahrt und stöhnten erleichtert auf, als wir im Schatten einer großen Buche standen. Das Grundstück war zum Teil durch hüfthohe Mauern oder durch Hecken eingesäumt. Niemand war zu sehen, doch wir hörten Stimmen aus dem Hauptgebäude. Ich warf einen Blick auf die flatternde Wäsche, die auf eine mehrköpfige Familie schließen ließ. Neben dem großen Haus und dem Nebengebäude sah ich weitere Anbauten unterschiedlicher Größe. Einige standen offen, doch viel konnte ich von meiner Position nicht erkennen. Der Wind fing sich in den Ecken und Luken der Gebäude und erzeugte eine düstere Melodie, die dem Tod ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hätte. Sand und Staub erhoben sich zu einem kurzen Tanz.
Der BMW, ein alter 5er, der auf der Fahrerseite einige Beulen aufwies, war mit einer Staubschicht überzogen.
Mein Blick fiel auf eine kleine Ansammlung von Spielzeug, das vermutlich einem Jungen gehörte. Auch ein Kinderfahrrad sah ich, das verlassen am Boden lag. Der Anblick erleichterte mich. Wer Kinder hatte, gehörte, so hoffte ich, zu der zugänglichen Art von Menschen.
Der Wind nahm an Stärke zu, kleine Staubpartikel wehten uns ins Gesicht, und wir mussten unsere Augen schützen. Stefan schimpfte leise vor sich hin und wandte sein Gesicht ab.
Sein Monolog hielt einige Sekunden an, bis Lita ihn anblaffte: »Könntest du damit bitte aufhören?« Finster blickte sie ihn an.
Verdutzt schwieg Stefan und zuckte mit den Schultern.
»Gehen wir näher zum Haus, vielleicht bemerkt man uns dann«, sagte ich. Wir setzten uns in Bewegung und näherten uns dem Haus. Dabei entdeckten wir einen großen, im Schatten liegenden Verschlag, in dem sich Dutzende Kaninchen tummelten, die augenscheinlich wohlgenährt waren.
»Süß«, meinte Lita betont fröhlich, um die ein wenig gereizte Stimmung aufzuhellen, und ging näher an den Verschlag heran. Als die Tiere ihre Bewunderin bemerkten, drängten sie sich panisch in die hinterste Ecke ihres Heims.
»Sie hingegen scheinen dich gar nicht so süß zu finden«, bemerkte ich mit einem breiten Grinsen auf meinen Lippen, was Lita mit einem bösen Blick quittierte.
»Sie sind ein wenig menschenscheu«, sagte eine Stimme seitlich von uns. Als wir unsere Köpfe wandten, sahen wir eine Frau, die aus der Haustür getreten war. Neben ihr stand ein Junge, der kaum acht Jahre alt war und uns aus großen Augen scheu anschaute. Am Hinterkopf stand ein Büschel seines blonden Haars ab, was wie eine Feder am Kopf eines Indianers wirkte.
Lita lächelte, als sie das sah, und trat näher. »Guten Tag«, sagte sie. »Ich hoffe, wir stören Sie nicht. Wir sind auf der Durchreise, doch leider hatten wir einen Unfall, und da wollten wir zunächst einmal in den Ort gehen. Dabei fiel uns Ihr Haus auf.« Sie stellte sich und uns vor.
»Sie stören nicht«, entgegnete die Frau und nickte uns freundlich zu. Ihre Augen leuchteten, was jedoch auch am Sonnenschein liegen mochte. »Sie sind herzlich willkommen. Treten Sie ein.« Danach warf sie dem schweißüberströmten Stefan einen Blick zu. »Es sei denn, Sie möchten sich erst frisch machen. Das können Sie im Haus erledigen oder auch ganz pragmatisch dort hinten am Brunnen. Das Wasser ist klar und erfrischend. Man kann es auch bedenkenlos trinken. Bedienen Sie sich nur.«
»Das würde ich gern tun«, sagte Stefan und lächelte dankbar. »Und ihr?« Er blickte uns an. »Kommt ihr mit?«
Lita und ich verständigten uns mit einem kurzen Kopfnicken. »Eine Erfrischung stünde uns allen gut zu Gesicht«, sagte Lita zu der Frau, die eine auffordernde Geste machte und meiner britischen Kollegin ein zuvorkommendes Lächeln schenkte.
»Nur zu, nur zu. Danach kommen Sie bitte ins Haus.«
Wir gingen zum Brunnen, auf dessen Umrandung aus Stein ein Blecheimer stand.
»Wie im Mittelalter«, staunte ich. Ich blickte in die Tiefe, sah das unbewegte Wasser und spürte den kalten Lufthauch, der mir von unten ins Gesicht wehte. Dann ließ ich den Eimer, an dessen Griff ein Seil geknotet war, hinab. Der Eimer schwang hin und her und stieß immer wieder gegen die Mauer des Brunnens. Schließlich hörten wir, wie er klatschend die Wasserlinie erreichte. Nachdem der Eimer gefüllt war, hievte ich ihn wieder hinauf. Das Wasser glitzerte verführerisch klar im Schein der Sonne. Notdürftig wuschen wir uns den Schweiß und den Staub aus unseren Gesichtern und Nacken und genossen das kalte Wasser.
»Es schmeckt ausgezeichnet«, sagte Stefan, der mit zwei Händen Flüssigkeit aus dem Eimer schöpfte. »Besser als jedes Mineralwasser.«
»Ich weiß nicht, ob das so klug war«, versetzte Lita. »Es könnten Bakterien drin sein.«
Stefan zuckte mit den Schultern. »Aber die Frau sagte doch …«
»Man beobachtet uns«, unterbrach ich ihn und deutete unmerklich mit dem Gesicht zu dem Haupthaus hinüber. »Die Gardine hinter dem zweiten Fenster neben der Tür hat sich bewegt.«
»Die Leute haben ein Recht, misstrauisch zu sein«, sagte Lita. »Sie werden nicht allzu oft Besuch bekommen. Ich fand es schon erstaunlich, dass die Frau uns so ohne Weiteres eingeladen hat. In der Großstadt wäre uns das nicht passiert.«
»Dann sollten wir sie nicht zu lange warten lassen und die perfekten Gäste mimen«, meinte ich und ging auf das Haus zu.
5
Auch das Innere des Hauses wirkte, obschon alles tadellos und beinah übertrieben gepflegt war, so alt, als stamme die Einrichtung aus einer anderen Epoche. Die Kleidung der Menschen, die uns erwartungsvoll entgegenschauten, tat ihr Übriges, um diesen Eindruck zu verstärken; die Leute wirkten so, als wären sie einer alten Folge von Unsere kleine Farm entschlüpft. Insgesamt befanden sich fünf Personen in dem geräumigen Zimmer. Die Frau übernahm die Aufgabe, uns miteinander bekannt zu machen. Sie deutete auf einen Mann, der uns selbst in der sitzenden Position ungemein groß und kantig vorkam. Sein Haar war grau und wirkte wie eine Betonkappe. Seine Hände, auf deren Rücken sich ebenfalls graue Haare kräuselten, waren so groß wie Bratpfannen und lagen gefaltet auf dem Tisch. Sie ruhten dort, als warteten sie darauf, zu neuem Leben zu erwachen. Es war unverkennbar, dass der Mann sein Leben lang harte körperliche Arbeit verrichtet hatte.
»Dies ist Karl, mein Mann.«
Karl nickte uns zu und richtete einen düsteren Blick auf uns, sagte aber nichts. Lita, die ihm ein schüchternes Lächeln schenkte, vermutete, dass Reden gewiss nicht zu den Stärken des Mannes zählte. Männer sind tatsächlich alle gleich, vollkommen unwichtig, woher sie stammen, dachte sie und verbiss sich ein Grinsen.
Über seinem karierten Hemd, dessen Ärmel umgekrempelt waren, trug er eine Weste, was angesichts der Hitze erstaunlich war. Ein wenig neidisch bewunderte Stefan die Muskeln, die sich unter dem Stoff abzeichneten.
»Dort haben wir Judith, die Mutter meines Mannes. Und schließlich unsere beiden Kinder, Max, den Sie bereits gesehen haben, und Evelyn, unsere Tochter, die allerdings viel lieber Eve genannt werden möchte. Und mein Name lautet Greta. Greta Sander.«
»Hi«, rief Max unbeschwert.
»Hi«, entgegnete Lita, die sofort in den Jungen vernarrt war, der ihr so vollkommen unverdorben vorkam, dass es ihr einen schmerzhaften Stich versetzte. Die Kinder, die sie sonst so oft sah, wirkten im Vergleich zu ihm geradezu verroht und ihrer Seele beraubt. Sie übernahm es abermals, sich und uns vorzustellen.
»Bitte, nehmen Sie doch Platz«, sagte Greta, während sie aus einem Nebenraum zwei Stühle heranschaffte. Der Tisch war groß genug, um drei weitere Personen aufzunehmen, sie mussten lediglich ein wenig enger zusammenrücken. Stefan nahm neben Evelyn Platz. Sie mochte um die zwanzig Jahre alt sein. Es kam ihm wie ein schlechter Witz der Natur vor, eine solch hübsche Frau an einem so öden Ort zu verstecken. Sie war gewiss der Schwarm aller jungen Männer, die in Briststedt lebten. Ihr Gesicht, das von dunklem Haar umfasst wurde, war von bemerkenswerter Schönheit. Als Stefan einmal kurz zu ihr hinüberblickte, sah er, dass in ihren dunklen Augen goldene Tupfer leuchteten.
»Und Sie sind auf der Durchreise, sagten Sie?«, bemerkte die Großmutter mit kratziger Stimme. Genau wie bei ihrem Sohn waren auch ihre Hände gefaltet. Ihr Gesicht war mit Runzeln überzogen, was sie wesentlich älter wirken ließ, als sie wahrscheinlich war. Verstärkt wurde dieser Eindruck dadurch, dass sie ihr graues Haar am Hinterkopf straff verknotet trug. Dies war auch bei Greta Sander so, nur war ihr Haar lediglich im Ansatz ergraut. Dadurch wirkte eher sie wie Judiths Kind. Karl hingegen hatte so gut wie keine Ähnlichkeit mit seiner Mutter.
»Nun ja«, antwortete ich, »so war es geplant. Leider hatten wir vorhin einen kleinen Unfall, sodass wir uns hier wohl eine Weile aufhalten werden.« Ich überdachte meine Worte, die für ein ungeübtes Ohr vielleicht allzu bewertend ausgefallen waren. »Sehr hübsch ist es hier.«
»So schön nun auch wieder nicht, junger Mann.«
Ich antwortete lediglich mit einem angedeuteten Lächeln, erwiderte jedoch nichts.
»Sie können gerne für eine Weile unser Gast sein«, schlug Greta vor.
»Das wäre unglaublich nett von Ihnen«, sagte Lita. In ihrer Stimme schwang aufrichtige Dankbarkeit mit. »Das erspart uns die Suche nach einem Hotel.«
»Die Suche wäre schnell beendet.« Greta lachte hell auf. »Es gibt nämlich keins. Nur einen Gasthof, der gelegentlich auch Zimmer vermietet. Doch dort unterzukommen, würde ich Ihnen nicht empfehlen. Das Essen dort ist sehr gut, doch auf die Sauberkeit der Zimmer wird dort weniger Wert gelegt.«
»Was redest du da?«, begehrte Karl Sander auf. Seine Stimme war ein einziges Grollen, als fänden die Worte nur unter großen Mühen ihren Weg über die Zunge in die Ohren der Zuhörer. Er blickte seine Frau finster an. »Die Zimmer sind in einem tadellosen Zustand. Hab sie selbst gesehen. Da gibt es nichts zu beanstanden.«
Greta sah ihren Ehemann mit einem milden Lächeln an, bevor sie sich ihren Gästen zuwandte. »Karl ist gut befreundet mit dem Besitzer des Gasthofes und auch oft zu Gast dort.«
Wir lachten, nur Karl blickte so finster drein wie eh und je. Ich fragte mich, auf welche Weise Karl und Greta, die vom Wesen her überhaupt keine Gemeinsamkeiten zu haben schienen, zueinandergefunden hatten.
»Bleiben Sie, so lange Sie wollen. Wir bekommen nur selten Besuch. Ruhen Sie sich ruhig aus. Du hast doch nichts dagegen, Karl?«
Der Mann brummte etwas, das einem »Nein« ähnelte, aber er machte sich nicht die Mühe, sein Missfallen zu verbergen.
»Wenn es Ihnen nicht recht ist …«, begann Lita, wurde aber sogleich von Karls Frau unterbrochen, die ihm einen Blick zuwarf, der nicht zu enträtseln war. Steckte ein Vorwurf darin, eine Warnung oder vage Belustigung?
»Natürlich ist es uns recht«, sagte sie. Sie fügte eine kurze Pause ein, vielleicht um ihren Familienmitgliedern die Gelegenheit zu geben, sie in ihrer Meinung zu bestätigten, aber es folgte keine Reaktion. »Wir freuen uns alle, dass Sie zu uns gefunden haben.«
»Kommt ihr von weit her?«, fragte Max und rutschte unruhig auf seinem Platz hin und her. Seine helle Stimme vertrieb die gedrückte Stimmung, die aufzukommen drohte, sogleich wieder.
Ich nickte. »Von sehr weit.«
»Aus der Stadt?«
»Ja. Aus verschiedenen Städten sogar.«
»Und wie ist es da so?«, erkundigte sich Evelyn und blickte Stefan an, der plötzlich, ganz im Gegensatz zu seinem sonstigen selbstbewussten Auftreten, vor Verlegenheit errötete.
»Aufregend«, antwortete er. »Ich könnte dir viel darüber erzählen.«
»Das musst du unbedingt.«
»Wenn du das willst, tu ich es gerne.«
»Aber ja. Unbedingt.«
»Und mir auch«, rief Max dazwischen.
»Mach ich.« Nun gelang es Stefan wieder, sein altbekanntes Lächeln aufzusetzen, das herzlich und manchmal verwegen zugleich war. Er streckte genüsslich seine langen Beine aus und trat versehentlich gegen die Füße der Großmutter, die ihm gegenübersaß.
»Füßeln wir schon, junger Mann?«
»Pardon«, sagte Stefan eilig. Er senkte den Blick, so entging ihm, dass Lita und ich uns angrinsten.
»Nun zeig ich euch die Zimmer, in denen ihr euch ausruhen könnt«, bestimmte Greta Sander. Sie stand auf und bedeutete uns, ihr zu folgen. Gemeinsam stiegen wir eine Holztreppe hinauf, die unter unserem Gewicht erbärmlich knarrte.
Zwei Räume mit einer Verbindungstür standen uns zur Verfügung, einen nahm Lita in Beschlag, das größere Zimmer war für Stefan und mich.
»Leider steht uns nicht genügend Platz zur Verfügung«, erklärte Greta entschuldigend, »dass jeder sein eigenes Reich bekommen kann. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Vielleicht wollt ihr die Aufteilung der Zimmer auch noch einmal überdenken.«
»Das ist wunderbar so, Frau Sander«, sagte Lita. »Die beiden Jungs verstehen sich prächtig und werden sich nicht in die Haare kriegen.«
Die Zimmer waren so sauber, als würden sie regelmäßig gereinigt. Es gab keine Betten, dafür aber in jedem Zimmer ein Ausziehsofa und andere Sitzgelegenheiten, die bequem genug wirkten, um dort eine Nacht zu verbringen.
»Ich hoffe, das genügt euch«, sagte Greta.
»Auf jeden Fall, Frau Sander«, sagte ich.
Die Frau lächelte und sagte: »Ich heiße Greta.« Dann verließ sie den Raum. Die Tür unseres Zimmers ließ sie offen.
Lita setzte sich auf das Sofa. »Sehr bequem.«
Stefan stand am Fenster und öffnete es. Da jedoch nur heiße Luft eindrang, schloss er es bald wieder.
»Von diesem Fenster aus kann man bis zum Ortskern von Briststedt sehen«, informierte er uns. »Es sind nur wenige Leute unterwegs. Sieht alles sehr übersichtlich und friedlich aus.«
»Und dennoch verschwinden Menschen spurlos«, versetzte ich. »Ich würde vorschlagen, dass wir uns noch im Laufe des Tages umsehen. Vielleicht fällt uns etwas auf.«
»Wir könnten sofort starten«, schlug Lita Ashton vor, »bevor wir uns häuslich einrichten.« Sie öffnete und schloss die Türen eines schweren Schranks, der fast eine gesamte Wand des Zimmers umfasste. »Da passt eine Menge rein.«
Ich nickte. »Auf dem Rückweg gehen wir zum Wagen und holen unser Gepäck. Dann können unsere Ferien starten.«
»Wie schön«, schwärmte Lita. »Ferien auf dem Bauernhof.«
Stefan, der immer noch am Fenster stand, zuckte plötzlich zusammen. »Das gibt es ja nicht!«, stieß er hervor.
Ich war sofort alarmiert und eilte zu ihm »Was ist?«
»Dort unten ging gerade der Junge vorbei.«
»Max?«
Stefan nickte.
»Und was ist daran so schockierend?«, fragte Lita.
»Sein Gesicht«, entgegnete Stefan. »Es war blutverschmiert.«
Wir schauten ihn entgeistert an, sodass Stefan sich gezwungen sah, eine genauere Beschreibung abzugeben. »Die untere Hälfte seines Gesichts war eindeutig mit Blut verschmiert. Ich habe ihn nur kurz gesehen, sodass ich nicht sagen kann, ob er noch weitere Verletzungen hatte.«
»Vielleicht ist er gestürzt«, sagte Lita. »Ich erinnere mich, dass ich als Kind oft schlimmes Nasenbluten hatte.«
»Ja, an so etwas habe ich auch gedacht«, stimmte Stefan ihr zu. »Auf jeden Fall sah der Bursche ziemlich bemitleidenswert aus.«
»Hat er geweint?«
Stefan überlegte einen Augenblick, dann schüttelte er den Kopf. »Nein. Im Gegenteil. Er schien nicht im Geringsten aufgeregt.«
»Ich war es damals irgendwann auch nicht mehr«, sagte Lita nachdenklich. »Irgendwann gewöhnt man sich dran. Es tut ja auch nicht weh, wenn einem das Blut aus der Nase schießt. Es sieht nur immer so aus, als wäre man ständig in Raufereien verwickelt, die man alle verloren hat.«
»Du hast dich als Kind gerauft?«, fragte ich.
Sie knuffte mich in die Seite. »Ständig«, zischte sie mit grimmiger Stimme. »Ich hatte einen guten Ruf als Klassenrowdy.«
Ich hob beschwichtigend die Arme. »Okay, das hab ich nun verstanden. Schaust du dir trotzdem die Gegend zusammen mit uns an?«
»Weil du es bist, tu ich euch den Gefallen. Und ich werde euch nichts antun.« Sie tätschelte meine Wange. »Ich hole den Rucksack aus meinem Zimmer. Unsere Waffen möchte ich nicht hier herumliegen lassen.«
Gemeinsam stiegen wir die knarrende Holztreppe hinunter. Trotz des Lärms, der sich nicht vermeiden ließ, wurde niemand auf uns aufmerksam. Niemand schien sich im Haus aufzuhalten, was uns seltsam vorkam. Diese Gelegenheit nutzten wir, um uns in aller Eile umzusehen.
Neben dem großen Raum, den wir bereits kannten, fanden wir noch zwei weitere Zimmer. Eines bewohnten die Eltern, das andere mochte der Großmutter gehören, wie wir an der Kleidung und den Gegenständen erkannten.
»Ziemlich muffig«, konstatierte ich und rümpfte meine Nase. »Müsste mal gelüftet werden.«
»In der Tat«, murmelte Lita.
Wir gingen in die geräumige Küche, die ungewöhnlich sauber und aufgeräumt wirkte, als wären die Tische und Anrichten nie in Benutzung. In der Ecke summte ein uralter Kühlschrank. Stefan, dem bei dem Gedanken an einen Braten der Magen zu knurren anfing, schlenderte auf das Ungetüm zu und öffnete die Tür. Mit einem überraschten Laut trat er einen Schritt zurück.
»Leer«, murmelte er perplex. »Vollkommen leer.«
Auch ich warf einen Blick ins Innere des Kühlschranks. Ich blickte auf die vollkommene Leere und schüttelte den Kopf.
»Vielleicht ist er kaputt«, mutmaßte Lita. Sie hielt ihre Hand ins Innere. Sie spürte die kühle Luft.
»Wovon ernähren sie sich bloß?« Stefan blickte uns an. »Und wovon ernähren wir uns?«
»Vielleicht haben sie noch woanders einen Kühlschrank stehen«, sagte Lita.
»Wird vermutlich so sein«, stimmte ich ihr nachdenklich zu. »Sie werden schon keine Touristen essen, die hier gestrandet sind.«
Als wir die Küche verließen, öffnete sich die Eingangstür, und Judith, die Großmutter, trat ein. Sie blieb einen Moment überrascht stehen, dann entspannte sie sich, als sei ihr wieder in den Sinn gekommen, dass die Familie Gäste beherbergte. »Ich hoffe, Sie sind zufrieden mit Ihrer Unterkunft.«
»Ja«, sagte Stefan und ließ ein charmantes Lächeln aufblitzen, »alles bestens. Wir wollten nun einen Verdauungsspaziergang machen.« Er spürte einen Schlag gegen seine Hüfte, den ihm Lita verpasste.
»Im Ort ist es recht nett«, erklärte die alte Frau. »Leider macht die Hitze alten Leuten wie mir sehr zu schaffen. Daher lockt mich eher der Wald. Sie haben ihn sicher bereits gesehen. Es ist schön dort, ich bin gelegentlich mit den Kindern dort.«
»Ja, den haben wir gesehen«, sagte ich. »Wir werden ihn sicher aufsuchen.«
»Machen Sie das«, entgegnete Judith lächelnd und trat zur Seite, um uns passieren zu lassen. Bevor die Frau die Tür schloss, sagte sie: »Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen auf Ihrem Verdauungsspaziergang.«
Wir sahen uns perplex an.
»Wie soll man das verstehen?«, murmelte ich und kratzte mich am Kopf.
Stefan hob nur die Schultern und ließ sie wieder fallen.
»Habt ihr mitbekommen, dass sich ihre Stimme anders angehört hat, als sie das gesagt hat?«, fragte Lita.
»Anders?«, fragte ich. »Wie meinst du das?«
»Ich hab das nicht mitbekommen«, sagte Stefan.
Lita schaute uns nachdenklich an. »Vielleicht tu ich ihr unrecht, und es hat überhaupt nichts zu bedeuten. Aber ich meine, es sei etwas Lauerndes in ihrer Stimme gewesen, etwas Abschätziges. Als … als spräche sie zu Gefangenen. Oder Opfern.«
Es war für eine Weile still, nur aus der Ferne klangen Hammerschläge zu uns durch, und ein Vogel schrie.
»Also, Lita«, sagte Stefan mit gespieltem Ärger in der Stimme, »übertreibst du nun nicht etwas? Ich schätze, du bildest dir das nur ein. Vielleicht war sie ein wenig verärgert, weil ich vom Verdauungsspaziergang geredet habe. Sie weiß schließlich, dass das nicht der Wahrheit entsprechen kann. Verständlich also, dass sie daher unwirsch reagiert hat. Aber das ist ja nun kein Grund, von Lauern oder Häme zu sprechen. Oder?« Er blickte in die Runde.
Ich nickte zustimmend. »Würde meinen, dass es genauso ist, wie du sagst, Stefan. Wenn sich überhaupt etwas an ihrer Stimme geändert hat, dann lag es daran, was du zuvor zu ihr gesagt hast. Was übrigens ziemlich dämlich war. Jetzt weiß oder vermutet sie, dass wir uns im Haus umgesehen haben. Das tun Gäste nicht, die etwas auf sich halten.«
»Könnte natürlich sein, dass ich mir da etwas eingebildet habe«, sagte Lita. Aber sie sah nicht ganz überzeugt aus. Ihre innere Stimme sagte ihr, dass sie sich nicht geirrt hatte.
Wieder ertönten Hammerschläge, und wieder antwortete ein Vogel. Es waren Laute, die mir einen Schauer über den Rücken rieseln ließen. Es waren verlorene Laute.
6
Die Hitze stülpte sich wie eine rotglühende Glocke über uns. Ein heißer Wind fuhr uns ins Gesicht. Er brachte uns zwei Botschaften. Eine bestand aus einem eigentümlichen Gestank, der in unsere Nasen drang; die andere war Staub, von dem unsere Augen zu tränen begannen.
»Scheiß Kaff!«, schimpfte Stefan. Er schirmte seine Augen mit einer Hand ab. »Fühlt sich an wie ein Wind aus der Hölle.«
»Vergiss nicht, dass wir in einer verfluchten Stadt sind«, entgegnete Lita. »Da geschehen solche Sachen.«
»Sehr witzig.« Da Stefan seine Hand vor Sonne und Staub schützte, hatte er eine bessere Sicht als wir. »Wartet mal!« Er eilte im Laufschritt, eine Schärpe aus Staub hinter sich herziehend, zu einem kleinen, aus Stein gemauerten Anbau, der einer Garage ähnelte. Er zog das Tor auf und spähte ins Innere. Lita und ich sahen, dass er sich am Kopf kratzte und das Gebäude betrat. Doch kaum eine Minute später verließ er es wieder und kam zu uns zurück.
»Nichts Besonderes«, sagte er, bevor er gefragt wurde. »Dort sind nur zwei kleine Räume, die vollkommen leer sind.«
»Hattest du vermutet, dort Vorräte zu finden?«, fragte ich.
»Ich hatte vermutet, irgendwas dort zu finden. Vorräte, Gerümpel, einen Fuhrpark. Irgendwas, verstehst du? Stattdessen nur zwei leere Kammern, die idiotischerweise massive Türen haben, als hätten sie Angst, dass dort eingebrochen würde.«
»Oder ausgebrochen«, unterbrach Lita seine Überlegungen. »Vielleicht dienen diese Räume als Zellen.«