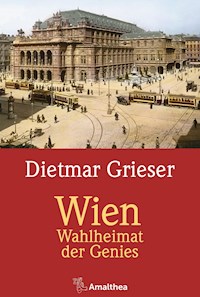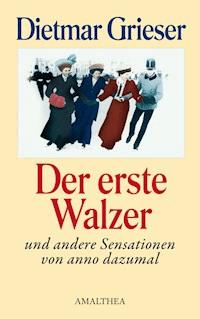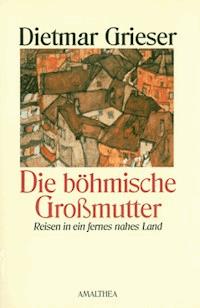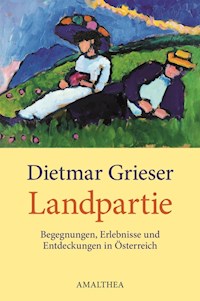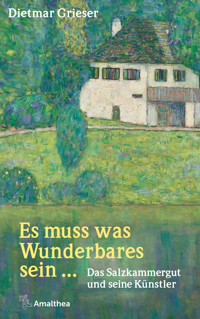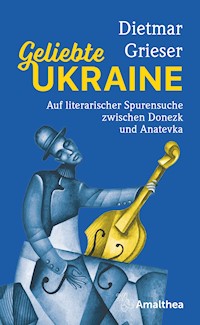
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Erfolgsautor Dietmar Grieser über ein außergewöhnliches Land In dreizehn Reisereportagen und Porträts erzählt der begnadete literarische Spurensucher berührend und eindringlich von persönlichen Erlebnissen in der Ukraine, von berühmten Ukrainern und was aus ihnen wurde – und ihren Verbindungen zu Österreich. Aus dem Inhalt: Am Originalschauplatz des Musicals »Anatevka« Mit Georg Trakl bei der Schlacht von Grodek Zu Besuch bei Paul Celans Witwe Gisèle Auf den Spuren von Scholem Alejchem Das erschütternde Schicksal des Startenors Joseph Schmidt Im Bergwerk des Donezker »Arbeitshelden« Alexej Stachanow Die Wiener Jahre des Leo Bronstein alias Trotzki Begegnung mit der österreichisch-ukrainischen Mezzosopranistin Zoryana Kushpler
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dietmar Grieser
GeliebteUKRAINE
Auf literarischer Spurensuchezwischen Donezkund Anatevka
Für Peter und Friederike
Besuchen Sie uns im Internet unter: amalthea.at
© 2022 by Amalthea Signum Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Johanna Uhrmann
Umschlagmotiv: © Eugene Ivanov/shutterstock.com
Herstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten
Gesetzt aus der Adobe Garamond Pro
Inhalt
Reisen in ein fernes nahes Land
Vorwort
Ein Reitpferd für Stachanow
Donezk 1979, 43 Jahre vor dem Großen Krieg
Spätes Glück
»Rumpfmensch« Nikolai Basilowitsch Kobelkoff
Gute Jahre
Wie der ukrainische Bauernsohn Leo Bronstein alias Trotzki nach Wien kam
Der Milchmann hat wirklich gelebt
Von Kiew nach Anatevka, 1978
Sein letzter Wille: Lachen
Zu Besuch bei den Erben des Dichters Scholem Alejchem, 1982
Wilde Klage
Am Schauplatz von Georg Trakls Kriegsdichtung Grodek, 1974
Zwei Rippen
Leo Perutz und sein Fronthund
Der »Vater« des Masochismus
Von Lemberg in die weite Welt
In Czernowitz fing alles an
Das tragische Schicksal des Gesangsstars Joseph Schmidt
Multikulti auf Bukowinisch
Das Lebenswerk der Pädagogin Eugenie Schwarzwald
Ohne Firnis
Zu Besuch bei Paul Celans Witwe Gisèle Lestrange, 1980
Kafkas Lehrer
Der Kriminologe Hanns Gross
Carmen als Salonnière
Begegnung mit der ukrainisch-österreichischen Opernsängerin Zoryana Kushpler
Topografische Bezeichnungen in der Ukraine
Text- und Bildnachweis
Namenregister
Reisen in ein fernes nahes Land
Vorwort
Es ist lange her, dass das Wiener Hauptpostamt am Fleischmarkt noch rund um die Uhr, mit Einschränkungen sogar auch sonn- und feiertags, Schalterdienst hatte. Ich habe diese mittlerweile anachronistischen Möglichkeiten seinerzeit gern genutzt, um bei meinen postalischen Erledigungen den werktäglichen Warteschlangen auszuweichen. Wenn ich dann, gar an einem Schönwettersonntag, auf dem Heimweg von der Inneren Stadt zu meinem Wohnbezirk Landstraße die Postgasse durchschritt, musste ich auf der Höhe des Hauses Nummer 8 bisweilen vom Trottoir auf die Fahrbahn wechseln, so dicht war das Gedränge vor der dortigen St. Barbarakirche: Das von manchen Wienern – leicht verkürzt – Ukrainerkirche genannte Gotteshaus zog besonders zu bestimmten Feiertagen so viele Gläubige an, dass der Innenraum bei Weitem nicht allen Platz bot.
Mein Bemühen, beim Vorbeimarsch ein paar Sprachbrocken der Umstehenden aufzufangen, führte zu nichts: Ich verstehe keines der slawischen Idiome, konnte nicht einmal sicher sein, dass das, was da an mein Ohr drang, explizit Ukrainisch war. Denn St. Barbara, so wusste ich aus Bandions Wiener Kirchenführer Steinerne Zeugen des Glaubens, stehe traditionell auch anderen Zweigen der Ostkirche und deren Zeremonien zur Verfügung, so etwa Gläubigen rumänischer, bulgarischer oder mazedonischer Nationalität. Für das autochthone Wien, so war nicht ohne Schmunzeln zu vernehmen, könnten gewisse mariatheresianische Bezüge des Kircheninneren fast von stärkerem Reiz sein als dessen orientalische Besonderheiten, darunter vor allem die an die Andreas-Kirche von Kiew erinnernde Ikonenwand. So trage das Altarbild der heiligen Barbara untrüglich gewisse Gesichtszüge der jugendlichen Kaiserin, und das Christus-Antlitz auf dem Prozessionskreuz, einer besonderen Kostbarkeit der Pfarre St. Barbara, stelle eine Petitpointstickerei dar, die von keiner Geringeren als Maria Theresias Tochter Marie Antoinette angefertigt worden sei.
Umso ukrainischer wird’s dann wieder rund um das Portal der Barbarakirche, wo der Schriftsteller Iwan Franko und der Komponist Andrij Hnatyschyn Wache halten – Letzterer in Gestalt eines lorbeerumkränzten Porträtreliefs, Ersterer als veritables Denkmal. Überhaupt ist die Erinnerungskultur der Ukrainer in Wien hoch entwickelt und von erstaunlicher Beständigkeit. So hält die lebensgroße Kolschitzky-Figur in der 1862 nach diesem benannten Gasse Ecke Favoritenstraße, obwohl inzwischen wissenschaftlich widerlegt, die alte Legende aufrecht, der gebürtige Galizier Georg Franz Kolschitzky, der sich während der Zweiten Wiener Türkenbelagerung als kaiserlicher Hofkurier nützlich gemacht hat, habe anno 1683 das erste hiesige Kaffeehaus gegründet. Stimmt nicht. Dieses Verdienst kommt dem mit türkischen Exportwaren handelnden Armenier Johannes Deodat zu.
Doch nochmals zurück zur heiligen Barbara in der Postgasse und meinem Heimweg in den dritten Bezirk. Nicht genug, dass diese Strecke, wie wir gesehen haben, sozusagen »ukrainisch« beginnt, sie endet auch »ukrainisch«: Wie oft musste ich, wenn ich nach diesen zwanzig Minuten Fußmarsch vor meinem Wohnhaus am Dannebergplatz 20 eintraf und mein Blick auf das Nebenhaus fiel, daran denken, dass dort, also auf Nummer 19, lange vor meiner Zeit (als die Adresse noch Arenbergring lautete) ein berühmter Künstler aus der Ukraine gewohnt hatte, dessen späteres entsetzliches Schicksal nicht nur die Musikfreunde in aller Welt erschüttert hat: der Sänger Joseph Schmidt. Vielleicht haben auch Sie, verehrte Leserschaft, noch den Hit Ein Lied geht um die Welt im Ohr, der den Czernowitzer Tenor in den Dreißigerjahren und darüber hinaus zum Publikumsliebling gemacht hat. Ich werde über ihn (ab Seite 113 dieses Buches) berichten – ebenso wie über etliche weitere international Namhafte unter seinen Landsleuten. Nur eines vorweg: Sollten Sie eines Tages an Joseph Schmidts Wiener Wohnadresse vorbeikommen und dort die eigentlich zu erwartende Gedenktafel vermissen, gehen Sie einfach ein paar hundert Meter weiter. Auf dem Gelände zwischen Rennweg und ehemaligem Aspangbahnhof hat die Stadt Wien 1995 einen Platz nach Joseph Schmidt benannt, und auch in »meinem«, dem Bezirksmuseum Landstraße wird des mehr als tragischen Schicksals dieses mit nur 38 Jahren in seinem Exilland Schweiz elend ums Leben Gekommenen liebevoll gedacht. Meine Anregung, ihm bei Gelegenheit eine eigene Ausstellung zu widmen, wurde von der Museumsleitung freudig aufgenommen; sie ist fix geplant.
Mit einigen Kapiteln dieses Buches soll auch der Versuch unternommen werden, die zahlreichen, vor allem historischen Berührungspunkte zwischen Österreich, respektive der Habsburgermonarchie, und der Ukraine aufzuzeigen, und dies nicht zuletzt auf der Grundlage persönlicher Erfahrungen.
Dazu zählen meine Recherchen im Raum Lemberg, dem heutigen Lwiw, wo es mir um die Erkundung des Schauplatzes von Georg Trakls monumentalem Kriegsgedicht Grodek, oder im südlichen Umland von Kiew, wo es um das reale Urbild der durch das Musical Anatevka weltberühmt gewordenen Scholem-Alejchem-Figur Tewje (»Wenn ich einmal reich wär«) ging. Letzteres, das kurzzeitige Eintauchen in die lange versunkene Kulturwelt des jüdischen Schtetls, hatte mich dermaßen tief beeindruckt, dass ich in der Folge sogar der Haupterbin des Dichters, der selbst namhaften Autorin Bel Kaufman, bis nach New York nachgereist bin. In Paris bin ich 1980 der Witwe des wohl bedeutendsten unter den aus Czernowitz stammenden Dichtern deutscher Zunge, Paul Antschel alias Celan, begegnet. Gern kennengelernt hätte ich auch den herrlichen Geschichtenerzähler Gregor von Rezzori; es hat sich leider nicht ergeben.
Für die besondere Strahlkraft herausragender Persönlichkeiten aus dem ukrainischen Kulturraum, deren Wirken draußen in der Welt starke Spuren hinterlassen hat, stehen neben vielen anderen die Namen Trotzki und Sacher-Masoch. Ersterer, der aus der Region Cherson stammende Revolutionär Leo Bronstein (Deckname Trotzki), verbrachte mit seiner Lebensgefährtin Natalia Sedowa, die in Charkow die Klosterschule besucht hatte, und den gemeinsamen Kindern sieben glückliche Jahre in Wien, während Leopold von Sacher-Masoch, Sohn des Polizeichefs von Lemberg und Verfasser von Novellen über das bäuerliche beziehungsweise jüdische Leben seiner Geburtsheimat Galizien, nach Prag, Graz und ebenfalls Wien übersiedelte (und als »Vater« des Masochismus in die Geschichte der Sexualpathologie einging).
Keiner eigenen Spurensuche in Troizk, einem unscheinbaren Dorf im südukrainischen Kreis Wosnessensk, bedurfte es, um die hochdramatische Lebensgeschichte des sogenannten »Rumpfmenschen« Nikolai Basilowitsch Kobelkoff aufzublättern, der es trotz kaum vorstellbarer Behinderung nicht nur zu sechsfacher Vaterschaft, sondern vor allem zu einer einzigartigen Karriere als international gefeierter Akrobat gebracht hat: Nirgendwo weiß man über die Höhen und Tiefen seines Lebens besser Bescheid als in den Archiven von Wien, wo der anno 1851 in dem erwähnten Kosakendorf Geborene unter übermenschlichem Kraftaufwand doch noch zu seinem Glück fand. Als er am 19. Jänner 1933 82-jährig in seiner Praterhütte starb, gaben Hunderte seiner Schaustellerkollegen und Aberhunderte Wiener Bürger dem Kindersarg, in dem Kobelkoffs Leichnam ruhte, auf dem Weg zum Zentralfriedhof das letzte Geleit.
Ein gänzlich anderes Thema ist meine im Frühjahr 1979 absolvierte Reise in eine Stadt, die 36 Jahre später und erst recht ab Februar 2022 weltpolitische Schlagzeilen machen sollte: die ostukrainische Industriemetropole und russophile Separatistenzentrale Donezk. Ich arbeitete damals an dem Buch Irdische Götter, für dessen Cover der erklärende Untertitel Idole und ihre Kultstätten vorgesehen war. Die Kapitel über den Callas-Tempel bei Desenzano, Elvis Presleys Graceland oder die Kennedy-Homestead im südirischen Dunganstown verlangten – es war mitten im Kalten Krieg zwischen Ost und West – nach einer Art Kontrapunkt in einem der Kernländer des real existierenden Sozialismus. Meine Wahl fiel auf jenen Ort, dessen Name mit einer heute weithin vergessenen Kultfigur der sowjetischen Arbeitswelt verknüpft war: Alexej Stachanow. Hier, in einer der gigantischen Kohleminen von Donezk, hatte der 1905 geborene Bergmann als Dreißigjähriger einen spektakulären Rekord aufgestellt, seine Arbeitsnorm um das Vierzehnfache übertroffen. Als »Held der Arbeit« mit Ehren überhäuft, mit Privilegien ausgestattet, ging der Name Stachanow bald auch in den westlichen Sprachgebrauch ein. Ich erinnere mich, wie man in meiner Studentenzeit Kommilitonen, die sich bei ihrem Tun besonders ins Zeug legten, sich neben dem Studium am Bau oder in der Landwirtschaft abrackerten oder sich mit anderen Gelegenheitsjobs »etwas dazuverdienten«, als »der reinste Stachanow« teils bestaunte, teils verhöhnte. Ich stand selber als 19-Jähriger eine Zeit lang an einer der Bohrmaschinen einer Landmaschinenfabrik – »im Akkord« nannte man die nicht auf Stunden-, sondern auf Stückzahl basierende Entlohnung.
Mag sein, dass es diese meine Jugenderinnerungen waren, die meinen Entschluss beflügelten, das Mekka der »Arbeitshelden« kennenzulernen: Donezk. Reisen in den sogenannten Ostblock und gar in die Sowjetunion waren damals, in den Siebzigerjahren, stets mit Komplikationen verbunden, mit Ängsten und Verboten, und wenn es sich um von der Norm abweichende, um andere als die staatlich »approbierten« Touristenziele handelte, war an die Erteilung einer Einreisebewilligung nicht zu denken. Nicht so in Donezk: Hier – und gar mit meiner erklärten Absicht, mich für etwas so Rühmliches wie die Stachanow-Bewegung zu interessieren – war ich hochwillkommen, erhielt mein Visum, mein Aeroflot-Ticket und (an Ort und Stelle) jede gewünschte Unterstützung und Information. Mehr dazu ab Seite 17.
Bevor ich daranging, diesen samt meinen anderen zum Großteil älteren Texten für das vorliegende Buch zusammenzustellen, war eine grundsätzliche Entscheidung zu treffen: Sollte ich meine Aufzeichnungen von damals aktualisieren, »auf den heutigen Stand bringen«, oder sollte ich sie – sozusagen als authentische Dokumente ihrer jeweiligen Entstehungszeit – in Inhalt wie Form belassen? Bei den Reisereportagen habe ich mich für Letzteres entschieden. Jede krampfhafte Bearbeitung, so denke ich, wäre in Wahrheit Verfälschung. So steht also, damit der heutige Leser sich auskennt, bei jedem dieser »historischen« Texte die betreffende Jahreszahl im Kapiteltitel. Jene Kapitel, welche die Lebensgeschichte berühmter Persönlichkeiten erzählen, wurden teilweise adaptiert, um dem Fokus auf Land und Leute gerecht zu werden.
Der jüngste der insgesamt dreizehn Texte stammt aus dem Frühsommer 2022 und ist – stellvertretend für die ukrainische Community im heutigen Wien – aus einem Treffen mit der Sängerin Zoryana Kushpler hervorgegangen, die von 2007 bis 2020 dem Ensemble der Wiener Staatsoper angehört hat und vor allem mit ihrer Paraderolle als Prinz Orlofsky vielen Opernfreunden in lebhafter Erinnerung ist.
Die über die Jahrhunderte zum Teil mehrfach veränderten ukrainischen Ortsbezeichnungen wurden in der jeweiligen zur Zeit der Handlung des betreffenden Kapitels gültigen Form belassen, sofern nicht aus Nostalgie altösterreichische Bezeichnungen wie Lemberg verwendet werden. Eine Übersicht über die am häufigsten verwendeten historischen beziehungsweise heutigen Städtenamen findet sich am Ende des Buches.
Noch ein letztes Wort, bevor es mit meiner kleinen Ukraine-Revue losgeht: Geliebte Ukraine ist unter meinen über vierzig Büchern nicht das erste dieser Art. Schon bei der Arbeit an dem Tschechien-Band Die böhmische Großmutter und mehr noch bei dem nachfolgenden Onkel aus Pressburg habe ich – und wohl nicht nur für meine Person – mit Bedauern, ja beschämt feststellen müssen, wie wenig wir Heutigen über unsere Nachbarvölker Bescheid wissen. Noch um einiges mehr gilt dies für die Ukraine, obwohl auch sie – in einigen Teilen – bis 1918 dem alten, dem kaiserlichen Österreich angehört hat. Dass unser beider Staaten heute nicht mehr unmittelbar aneinandergrenzen, mag einer der Gründe dafür sein. Reisen in ein fernes nahes Land habe ich seinerzeit mein Böhmen-Buch im Untertitel genannt. Möge die Ukraine oder was der mörderische Krieg aus ihr machen wird für uns in Hinkunft kein »fernes Land« mehr sein. Insofern verstehe ich den Titel des vorliegenden Buches nicht zuletzt als Aufforderung an uns alle, dieses geschundene Land und seine Menschen besser kennenzulernen, sie mit allen unseren Kräften zu unterstützen, sie zu lieben.
Ein Reitpferd für Stachanow
Donezk 1979, 43 Jahre vor dem Großen Krieg
Ich bin schlecht ausgerüstet, in der Eile des Aufbruchs habe ich nur den Kleinen Polyglott in den Handkoffer gepackt, er erwähnt das Ziel meiner Reise mit keinem Wort. Dabei ist Donezk eine Stadt von über einer Million Einwohnern, die zwölftgrößte der Sowjetunion. Aber unsere westlichen Reiseführer entscheiden nach anderen Kriterien: Ohne Kremlmauer und Holzkirche, ohne Potemkin-Treppe und Goldenes Tor kommst du da nicht hinein, Fördertürme und Kohlenhalden lassen sich schwer als touristische Fünfsternattraktionen verkaufen. Und trotzdem: eine Stadt von einer Million Menschen einfach so unterschlagen, einfach so mir nichts dir nichts auf der Landkarte ausradieren?
Ich weiß, auch die andere Seite macht Fehler. Natürlich ist es lächerlich, den Begleittext des offiziellen Donezk-Bildbandes mit einem Satz wie diesem zu eröffnen: »Jeder, der in diese Stadt kommt, verliebt sich in sie auf den ersten Blick.« Den möchte ich sehen, dem solches widerfährt. Da kann er aus dem tiefsten Sibirien anreisen: Donezk bleibt Donezk. Kohlenschächte und Wohnblocks. Und die Kohlenschächte sind das Schönere von beidem.
Ich will nur sagen: Hochjubeln ist ebenso töricht wie Ignorieren, mit dem Trotz der Verzweiflung ist dem Phänomen Donezk ebenso wenig beizukommen wie mit der Arroganz der touristischen Testtrupps. Donezk ist ein Fall für sich und will als solcher behandelt werden. Donezk ist eine Stadt mit Titel.
In der Sowjetunion, wo es bekanntlich an manchen anderen Vergünstigungen mangelt, wird umso reichlicher mit Titeln hantiert: mit Titeln, Verdienstmedaillen, Orden. Nicht nur der einzelne Staatsbürger kann sich im Laufe eines arbeitsreichen Lebens die Brust damit vollpflastern, auch ganze Kollektive kämpfen um das Prädikat »Held der sozialistischen Arbeit«, ganze Betriebe, ganze Städte. Donezk, die Millionenstadt in der Südost-Ukraine, in zaristischer Zeit Jusowka, bis 1961 Stalino genannt, ist ein solches Exemplar. Ihr hat man den Titel »Stadt des Arbeitsruhms« verliehen. Es erinnert ein wenig an die Praktiken mancher Gemeinwesen, ausdrücklich solche Künstler mit Preisen zu überhäufen, deren Œuvre unscheinbar, deren Publikumserfolg gering und deren Einkünfte bescheiden sind. Hat er schon nichts, so soll er sich die Wände mit Diplomen tapezieren können. Ausgleichende Gerechtigkeit.
Übrigens stimmt der Vergleich nicht ganz. Er stimmt nur, soweit es das Äußere betrifft: den Glamour einer Stadt. Da ist Donezk natürlich auf total verlorenem Posten – allen Grünanlagen und Kulturparks, allen Museen und Theatern zum Trotz. Und auch die Lebensqualität kann bei so verpesteter Industrieluft unmöglich Spitzenwerte erreichen. Anders sieht es mit dem materiellen Ertrag aus: Eine Stadt, deren 72 000 Kumpel in 24 Bergwerken täglich 70 000 Tonnen Kohle fördern, wird man wohl nicht als quantité négligeable abtun dürfen.
Was also tun?
Man verleiht ihr die Auszeichnung »Stadt des Arbeitsruhms«. Macht sie zum Aushängeschild marxistisch-leninistischen Leistungskults. Mit dem Bergmann Alexej Grigorjewitsch Stachanow als Hauptdarsteller, der Traktorführerin Gaganowa und der Spinnerin Proskurina in den Nebenrollen und der übrigen Bevölkerung als Komparserie.
Ich glaube, es ist die Sache wert, sich auch an einer solchen Kultstätte umzusehen.
Ich bin einmal, bei anderer Gelegenheit, von Moskau nach Leningrad geflogen – noch heute habe ich die Bordlautsprecherstimme der Aeroflot-Stewardess im Ohr: »Unsere Maschine fliegt in einer Höhe von 8000 Metern und mit einer Geschwindigkeit von 750 Stundenkilometern. Die Mannschaft dieses Flugzeuges kämpft um den Titel der sozialistischen Arbeit.« Die Sache befremdete mich damals, irgendwie war sie wohl auch außerhalb meiner Vorstellungskraft, zudem fühlte ich mich durch die Verlautbarung belästigt: Was gehen mich, den Passagier aus dem Westen, diese östlichen Wettbewerbsrituale an? Sie sollen mich sicher ans Ziel bringen, auch gegen ein Kaviarbrötchen und ein Glas Krimsekt habe ich nichts einzuwenden – aber alles andere ist ihre Sache. Bitte keine Propaganda – nicht auch noch in der Luft. So ungefähr denken wir doch alle, stimmt’s?
Dieses Mal will ich es mir nicht so leicht machen. In Donezk will ich versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen.