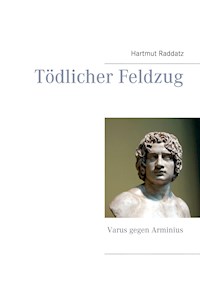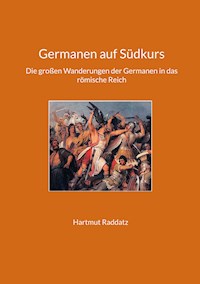
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Germanische Migranten zur Zeit des römischen Kaiserreiches - ja, wer kennt ihre Namen, ihre Ausgangspunkte sowie die erreichten, nicht erreichten Zielorte. Woher genau sie kamen, wo sie gerade waren - die Migranten wussten es des öfteren selbst nicht. Nur eines wussten sie, sie wollten, koste es was es wolle, nach Süden, Rom war ihr erklärtes Ziel. Während diese Wanderung - klimatischen Verhältnissen, Hungersnöten wie auch Überpopulation geschuldet - doch irgendwie freiwillig geschah, gab es andere, die unfreiwillig erfolgten, wie etwa die Deportation der Sachsen unter Karl dem Großen oder die Flucht deutscher Staatsbürger aus angestammten Gebieten als Folge des II. Weltkrieges.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zu diesem Buch
Dieses Buch gibt einen Überblick über die erfolgten germanischen Wanderungen ins römische Reich und spannt dabei den Bogen von Kimbern, Teutonen und Ambronen bis zur Migration der Langobarden.
Die ins Römerreich anstürmenden Germanenstämme erreichten anfangs dessen Grenzen, wurden beim Überschreiten jedoch zurückgeschlagen. Schließlich gelang die Grenzquerung, die Germanen bemächtigten sich nächstliegender Landesteile und überschwämmten im weiteren Verlauf Westrom, eroberten es und schufen eigene Herrschaftsereiche.
In der Mitte des 6. Jahrhunderts nach Christus gelang es Kaiser Justinian I. (Ostrom) mittels seiner Generäle Narses und Belisar Vandalen und Ostgoten in ihren Bereichen niederzuringen – deren Gebiete im heutigen Tunesien und Italien gelangten wieder unter römische Hoheit.
Zum Autor
Hartmut Raddatz, geb. 1937 in Lütjenburg/Schleswig-Holstein, besuchte die Gymnasien Plön und Oldenburg und trat nach dem Abitur in die Laufbahn des gehobenen Dienstes des Bundesgrenzschutzes ein.
Nach Dienstverrichtung an verschiedenen Staatsgrenzen der Bundesrepublik Deutschland widmete er sich dem Studium geschichtlicher Literatur, speziell jener über die römische Kaiserzeit. Hartmut Raddatz lebt in Bad Krozingen.
Bild auf dem Buchcover:
Ausschnitt aus dem Gemälde von Friedrich Türhaus: Schlacht zwischen Germanen und Römern am Rhein. Quelle: Wikimedia Commons.
Gewidmet
dem Vandalen Stilicho – in der römischen Armee aufgestiegen zum Heermeister, magister militum (Oberbefehlshaber der beweglichen Streitkräfte).
Sitilchos Verdienst lag in richtiger Beurteilung der militärischen Lage und folgerichtiger Handlung Anfang des 5. Jahrhnderts nach Christus.
Den anstürmenden Ost- und Westgoten bot er mittels römischer Legionen Paroli – und war zugleich auf Ausgleich bedacht.
Der einflussreiche Heermeister und Politiker Stilicho mit seiner Ehefrau Serena. Quelle: Atlas der Antike, H. Sonnabend, Palm-Verlag S. 141
Danksagung:
Meine Danksagung beginnt bei Studienrat Breyer, der mir den Einstieg in die “Lingua Latina” verschaffte. Studienassessor Schmidt, Lehrer für Latein, vermittelte mir die Ideale der Römer in ihrer Hochzeit. Herrn Hauptmann Kairies danke ich, dass er mir die Hinterlassenschaften der Römer in der Kaiserstadt “Augusta Treverorum” (Trier) zum Eigenstudium empfahl, ein Muss für jeden Römerfreund.
Bedanken möchte ich mich bei meiner Tochter Maike, die das Entstehen des Werkes mittels ihrer Schreibkraft erst ermöglichte.
Inhaltsangabe
Einleitung
Stammesbildungen germanischer Bevölkerungsteile, Infrastruktur im ersten Jahrtausend vor Christus
Kimbern, Teutonen, Ambronen – ihr Marsch durch Europa
Die Westgermanische Wanderung
Die Ostgermanische Wanderung
Die Hunnen
Die Vandalen
Die Ostgoten
Die Westgoten
Die Sueben
Die Burgunden
Die Angeln, Sachsen und Jüten
Die Langobarden
Schlusswort
Zeittafel
Fundstellen
1. Einleitung
Wie das Jahr 753 v. Chr. die Entwicklung Roms zur damaligen Weltmacht der westlichen Hemisphäre einleitete, so läutete das Jahr 375 n. Chr. den Untergang des westlichen Teils der Weltmacht Rom ein.
Landläufig verbindet man mit dieser Jahreszahl den Beginn der „Völkerwanderung“, ausgelöst durch den Hunnensturm.
Bevor diese Wanderung zu betrachten ist, möchte ich mich zunächst mit den davor stattgefundenen „Wanderungen“ der Germanen aus ihrer Heimat in den keltisch-römischen Lebensraum beschäftigen, ich meine damit die Wanderung der Kimbern und Teutonen, sodann die der Westgermanen und als drittes erst die der Ostgermanen – alles unter dem Begriff der „Völkerwanderung“ laufend.
Um die germanischen Migrationen im europäischen Raum in etwa kartenmäßig nachvollziehen zu können, bedarf es eines Blickes auf den Erdkreis, die Kugel, die unsere Welt darstellt.
Karten gab es seit eh und je, schon zu früher Zeit hat man mit mehr oder weniger Erfolg und Genauigkeit versucht, Gelände-Abschnitte kartenmäßig darzustellen – unter Einbeziehung des Bekannten wie Land, Meer, Ströme, Wälder und Gebirge, aber wie auch künstlicher Gebilde als da wären Städte, Straßen, Türme und Brücken. Morgenland, Abendland wie auch Himmelsrichtungen fanden Beachtung.
Wenn man in der Jetztzeit auf eine Deutschlandkarte blickt, erfasst das Auge das Gebiet Deutschlands und wandert dann unbewusst nach Norden, nach Skandinavien, unsere Karte ist nordorientiert. Haben wir andere Ziele im Sinn, so blicken die Augen gen Westen, Osten oder Süden, aber stets nordorientiert. Die ersten Migranten nun, um die es geht, die Kimbern und Teutonen, die Einwohner Skandinaviens hingegen blickten nach Süden, wohin sie ja auch wandern wollten, sie waren südorientiert.
Noch aus dem 15. Jahrhundert liegen zwei südorientierte Karten vor – „Klosterneuburger Karte“ des P. Fridericus aus 1421 und „Der Romweg“ des Etzlaub aus 1492.
Diese uns unbekannten Migranten, die einst Skandinavien verließen, um im Süden den Traum von einem besseren Leben zu verwirklichen, waren die Vorfahren der als Kimbern, Teutonen und Ambronen bekannten Germanen, die gegen Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. aufbrachen.
Warum wanderten sie, verließen ihre Heimat, was waren ihre Motive?
Vielleicht kamen mehrere Gründe zusammen, vielleicht war es aber auch immer nur einer, dieser dann besonders massiv in Erscheinung tretend und die Menschen fortwährend drängend, bis sich diese zum Marsch entschlossen.
Denkbar sind zum Beispiel Klimaveränderungen, die nicht ohne Einfluss auf Pflanzen, Tiere und Menschen bleiben. Somit konnte der Mensch wegen Nahrungsmangel nicht weiter existieren und war zum Handeln gezwungen. Kleine Wanderungen, Standortveränderungen waren im Prinzip schon immer die Norm, denn ein Platz war über kurz oder lang „abgegrast“. Doch auch gefährliche Nachbarstämme wie auch eine eigene Überpopulation konnten Beweggründe sein, sich örtlich zu verändern und nach Süden zu orientieren.
Vielleicht war es auch nur der Wunsch, es besser, bequemer zu haben, auch damals schon strebte der Mensch kontinuierlich nach besserer Lebensqualität. Saß er im hohen Norden doch lange Zeit des Jahres ohne Licht, ohne Wärme. Irgendetwas gab dann den letzten Anstoß und brachte das Fass zum Überlaufen, und der Marsch begann.
Viele Kenntnisse über die „neue“ Welt wird man nicht gehabt haben, eins jedoch wusste man, noch schlechter konnte es nicht werden. Und dann ging’s los, mit Mann und Ross und Wagen, Richtung Spanien, Italien, Rumänien oder sogar Ukraine (= Landbezeichnungen heutiger Zeit).
Um jeweils ins „gelobte“ Land zu gelangen, musste man gewisse Leitlinien erreichen, an denen es sich entlang zu hangeln galt. Neben Wegen, Straßen und Fernstraßen als Leitlinien boten sich sichere von Süden nach Norden verlaufenden Ströme an, die ihr Ende in der Nord- oder Ostsee fanden. Verkehrsmittel waren wohl ausreichend vorhanden, sie wurden allerdings bei dem damaligen Wegepotential sehr stark strapaziert.
Wie hilfreich auch immer diese sogenannten Leitlinien auf dem Weg nach Süden waren, irgendwann und irgendwo tauchten dann Sperrlinien – der Gegenpart – auf, die einen bremsten und die es zu überwinden galt. Zu denken wäre an die Ostsee, an quer verlaufende Ströme, weitläufige nicht begehbare Sumpfgebiete, meilenweite Waldgebiete und fast unüberwindbare Gebirgsketten.
Besonders wichtig war der Zusammenhalt der germanischen Stämme untereinander, denn nur ausreichend Kräftepotential bot die Möglichkeit des gegenseitigen Unterstützens im Bedarfsfall, und es hielt andere, fremde Mächte davon ab, sich ihnen entgegenzustellen und sie anzugreifen.
Doch es gab auch Trennungen während des Marsches wie bei den Kimbern und Teutonen, die dann fatale Folgen nach sich zogen.
Gemeinsam noch marschierend war man stark, nach der Trennung jedoch relativ leichte Beute für die gegnerischen Römer. Dieser schwerwiegende taktische Fehler der beiden germanischen Stämme bedeutete ihre Zerschlagung.
Die Römer hatten aber auch erkennen müssen, dass die Germanen im Grunde keine leichten Gegner waren, man war gewarnt. Diese beiden Stämme, die in Südfrankreich und Norditalien vernichtend geschlagen wurden, waren gleichsam bis ins gelobte Land vorgedrungen, sie hatten einen Vorgeschmack erhalten und es war ziemlich sicher, dass weitere Stämme folgen würden.
Auf welchen Wegen nun konnte man nach Süden ziehen und auf wen traf man unterwegs?
2. Stammesbildungen germanischer Bevölkerungsteile, Infrastruktur im ersten Jahrtausend vor Christi Geburt auf deutschem Boden.
Das Land, in das die „Nordmänner“ von Norden her einmarschierten, war das barbarische Europa, es war Gallien.
Germanen und Germanien in griechischen Quellen (Diodor „Weltgeschichte“V, 26-32; auszugsweise zitiert gemäß Zusammenstellung und Erläuterung von Birgit Neuwald. Herausgegeben von Alexander Heine):
„Weil das Klima viel zu rau ist, gedeihen im Land weder Wein noch Öl und da um den Galliern das eine wie das andere fehlt, bereiten sie sich ein Getränk aus Gerste, das sogenannte Bier. Außerdem trinken sie das Wasser, mit dem sie die Honigwaben ausgespült haben.
Dem Wein aber sind sie über die Maßen ergeben und trinken den von Kaufleuten eingeführten Wein unvermischt.
Sie trinken ihn in ihrer Gier so reichlich, dass sie berauscht in Schlaf oder wahnsinnsähnliche Zustände verfallen. So dient die gallische Trunksucht der gewöhnlichen Geldgier vieler italienischer Kaufleute als willkommenes Bereicherungsmittel.
Diese bringen den Wein entweder auf den schiffbaren Flüssen oder über das offene Land auf Wagen herbei und nehmen dafür einen unverschämten Preis. Für einen Krug Wein erhalten sie einen Sklaven zum Tausch - sie geben einen Trunk und erhalten einen Mundschenk dafür.“
Diese Überlieferung vermeldet einen Bedarf der Gallier an Wein und Öl, Sachen, die sie zu dieser Zeit nicht selbst erzeugen. Später führten die Römer die Weinrebe ein, wodurch sich zumeist eine Abhängigkeit verringerte.
Des Weiteren erfahren wir, dass der Schiffstransport die Transportrolle an sich spielte, eben weil ein leistungsfähiges Straßennetz für Wagen nicht existierte.
Wie sah das Straßennetz jener Zeit aus, welche Handelsrouten standen den Kelten und Römern in Gallien zur Verfügung? Denn diese Handelsrouten waren es ja, auf denen Waren und Kenntnisse vormals ins Land der Nordmänner gelangt waren und eben diese Routen waren es, die es den wandernden Menschenmassen ermöglichten, in etwa geordnet, gezielt und in gewissem Zeitrahmen nach Süden voranzukommen. Die Gebiete, in die sie einmarschierten, waren das ehemals sogenannte „Germania Magna“ sowie „Gallia“.
Eine erste größere Barriere, die es zu überwinden galt, war die Ostsee; es sei denn, die Nordleute entschlossen sich, den Weg über Jütland und Schleswig-Holstein zu nehmen. Aber da die Nordleute schon immer mit der Ostsee in Berührung gekommen waren, war sie keine Unbekannte und die Hürde war zu meistern. Feindberührung auf dem Wasser dürfte auszuschließen gewesen sein. So landeten sie an der gegenüberliegenden Küste und konnten sich entweder einen beschwerlichen Landweg suchen oder vorhandene Wasserwege in Anspruch nehmen. Irgendwann stieß man dann unweigerlich auf Rhein oder Donau.
Für die im Westbereich nach Süden strebenden Völkerschaften bot sich eine Straßenverbindung über Elbe/Weser in südwestliche Richtung an den Rhein als erste Etappe an, abzweigend entlang Elbe und Saale marschierend gelangte man an die Donau. Für den Ostbereich kamen die Oder, die an ihrer Quelle auf den Handelsweg Truso-Stupava-Donau-Aquileia traf, und die Weichsel in Frage, entlang derer Teile der Goten ihren Weg nahmen.
Hatte man erst einmal Rhein bzw. Donau erreicht, war schon ein gutes Stück unwirtlichen Landes passiert, und man war in bewohnteren Gebieten, die entlang dieser Flüsse bzw. an den dort verlautenden Wegen schon eine höhere Stufe, verbesserte Lebensqualität und wärmeres Klima boten.
Doch die eigentlichen Ziele lagen ja noch weiter südlich. Und zu diesen Zeiten waren Rhein und Donau eher Sperrlinien als Leitlinien – natürlich mussten sie auch noch überwunden werden.
Von der Donau aus konnte man auf mehreren Straßen nach Norditalien gelangen, im Osten über die Straße Stupava-Aquileia, im mittleren Bereich entlang des Inntales über den Brenner und im westlichen Bereich von Hohenasperg über Heuneburg/Donau am Ostufer des Bodensees entlang, dann über den St. Bernhard auf die norditalienische Straßenverbindung Aquileia - Mantua.
Des Weiteren war es möglich, zunächst bis zur Donauquelle, von dort an den Rhein und nach Chalon-sur-Saône durchzustoßen, womit man an der Rhone war, die ja direkt ins Mittelmeer fließt und den weiteren Weg nach Spanien ermöglicht.
Vom Rhein aus führte der Weg in den Südwesten Europas entlang der Mosel zur Saône, weiter nach Lyon an der Rhone – der weitere Weg Richtung Mittelmeer und Spanien wurde oben bereits angesprochen.
Nach der Auswertung des um das 1. Jahrhundert vor Christus vorhandenen „Wegenetzes“ in Mitteleuropa folgt nun ein Blick auf Waren und Produkte.
Was hatte dieses Gebiet an Bodenschätzen, an Erzeugnissen seiner Bewohner zu bieten? Während aus dem etwas abseits gelegenen Britannien Zinn als seltenes und wertvolles Metall seinen Weg nach Süden fand, gab es auf dem Festland Eisen, Gold, Silber und Kupfer. Die Ostseeküste war gesegnet mit Bernstein, er fand in Rom große Beachtung und wurde zum begehrten Handelsobjekt.
Übers Land verteilt fand sich die Salzproduktion, Salz war eine lebensnotwendige Ware. Weiterhin wurde verfügt über Pelze, pflanzliche Produkte, Nutzvieh und leider auch Sklaven. Im Gegenzug lieferte der Süden, supra legimus, Wein, Öl, aber auch Keramik und Bronzegefäße.
Nun ein Blick auf die damals in Mitteleuropa lebende Bevölkerung. Sie war, inklusive durchziehender Nordleute, das Potential der späteren Migranten, egal ob aus eigenem Antrieb oder letztendlich gejagt durch die von Osten heranstürmenden Hunnen.
Wer waren die derzeitigen Bewohner des Raumes in und um Mitteleuropa, wer lebte dort, wen fanden die Nordleute auf ihrem Treck nach Südeuropa vor?
Im ersten Jahrtausend vor Christi Geburt zeichnete sich folgende Dislozierung ab, es gab nachstehend angeführte germanische Siedlungsgebiete mit folgenden germanischen Völkerschaften:
Schleswig-Holstein, nordostwärtiges Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern mit: Angeln, Sachsen, Chauken, Langobarden, Semnonen, Rugier.
Innerhalb des ersten Jahrtausends breiteten sich die Germanen nach Westen wie nach Osten im norddeutschen Raum aus.
Niederlande, westliches und mittleres Niedersachsen mit: Bataver, Brukterer, Friesen, Cherusker, Angrivarier
Hinterpommern und Westpreußen mit: Burgunder, Vandalen, Bastarner, Goten
Während aus dem Westen Deutschlands Ingväonen, Istväonen, Herminonen, Sweben nach Südwesten in Richtung Frankreich und Spanien zogen, verließen den Osten Deutschlands Burgunder, Vandalen, Bastarner, Goten in Richtung Südosten, d.h. Schlesien und Südrussland.
Dabei trafen die Germanen im Westen auf Keltisches Siedlungsgebiet, die des Ostens auf Gebiet der Illyrer.
Der Verlauf der Migration erfolgte – von der Festsetzung in der Mitte Norddeutschlands – über die westliche und ostwärtige Erweiterung des Siedlungsraumes, also auf keltisches und illyrisches Territorium.
Eine gewisse Kunde über die Germanen der Zeitenwende im nördlichen Mitteleuropa übermittelt C. Plinius Secundus (23-79 n. Chr.) in seinem Werk„Naturalis Historia“ IV Buch, Kap. 96-101 (auszugsweise zitiert gemäß ÜbersetzungWinkler/König):
„Hierauf beginnt sich zuverlässigere Kunde mit dem Volk der Ingväonen zu eröffnen, welches das erste in Germanien ist. Dort bildet der ungeheure und den Ripäischen Bergen nicht nachstehende Berg Sevo bis zum Vorgebirge der Kimbern eine gewaltige Bucht; diese wird Codanus genannt und ist voll von Inseln; deren berühmteste ist Scatinavia, von unerforschter Ausdehnung, da nur einen Teil davon, soweit bekannt ist, jenes Volk der Suionen in 500 Gauen bewohnt - deshalb nennen sie (die Insel) auch eine zweite Welt. Nicht geringer an Ansehen ist Feningia.“
Zunächst nennt Plinius das Volk der Ingväonen, unter diesen Begriff fallen folgende germanische Völkerschaften:
Kimbern
Sachsen
Teutonen
Chauker
Angeln
Friesen
Unter Germanien ist „Germania Magna“ zu verstehen - in seinen Grenzen wie folgt:
Nord- und Ostsee
im Norden
Weichsel
im Osten
Donau
im Süden
Rhein
im Westen
Die genannten „Suionen“ sind das Kernvolk Schwedens, Teilstämme sind u.a. Sueben, Semnonen.
Plinius fährt fort in seiner Beschreibung: „Einige berichten, dass diese Gegenden bis zum Fluss Vistla von den Sarmaten, Venedern, Skirern und Hirrern bewohnt werden, die Bucht Cylipenus heiße und an ihrer Mündung die Insel Latris liege; ferner gebe es eine andere Bucht Lagnus, an die Kimbern angrenzend.
Das Vorgebirge der Kimbern, das weit in die Meere hinausragt, bildet eine Halbinsel, die Tastris genannt wird. Von dort sind den Römern 23 Inseln durch die Waffen bekannt.
Die berühmtesten davon sind Burcana, von den Unsrigen wegen der Menge einer (dort) wild wachsenden Frucht als „Bohneninsel“ (Fabaria) bezeichnet, ferner Glaesaria, von den Soldaten nach dem Bernstein, von den Barbaren Austeravia genannt, und außerdem Actania.“
Anschließend skizziert Plinius das Inselreich zwischen Jütland und Scatinavia mit Inseln und Buchten. Nun fällt auch der Name des germanischen Stammes, der hauptsächlich auf Jütland siedelt, es sind die Kimbern. Woher sie kamen, wurde nicht angesprochen, vermutlich aus Scatinavia, Baltia Basilia oder einem anderen nördlich gelegenen Bereich jenseits des Mare Cronium. Im Jütland lebten zudem die Teutonen, zusammen mit ihnen brachen die Kimbern um 120 v. Chr. nach Süden auf. Danach geht Plinius auf ost- und westfriesische Inseln ein, Inseln, die den Römern zur Zeitenwende durch militärische Vorstöße bekannt geworden waren.
Plinius fährt fort: „Im ganzen Meere aber bis zum Flusse Scaldis wohnen die Völker Germaniens, wobei die Ausdehnung nicht zu ermitteln ist - so maßlos ist die Widersprüchlichkeit der Gewährsleute.
Die Griechen und manche der Unsrigen überlieferten als Küste Germaniens 2500 Meilen, Agrippa bestimmte, mit Rätien und Noricum, als Länge 636 Meilen, als Breite 388 Meilen, obgleich die Breite Rätiens, das etwa zur Zeit seines Todes unterworfen wurde, allein fast größer war; denn Germanien wurde (erst) viele Jahre danach und dann nicht einmal vollständig bekannt.
Wenn es gestattet ist, eine Vermutung zu äußern, wird die (Ausdehnung der) Küste von der Meinung der Griechen und von der durch Agrippa überlieferten Länge nicht viel abweichen.”
In obigem Abschnitt wird bekannt, dass von Jütland bis zur Scheldemündung germanische Völkerschaften siedelten, ihre Namen werden nicht genannt. Vermutlich waren es Jüten, Sachsen, Chauken, Friesen und Bataver. Die anschließend gemachten Meilenangaben über germanische Gebietsteile sind schwer nachvollziehbar; die Länge des Küstenverlaufs wird sich – infolge von untergegangenen Landabschnitten nach schweren Sturmfluten – verändert haben.
Plinius nennt darauf die germanischen Hauptstämme:
„Es gibt fünf Hauptstämme der Germanen:
Die Vandiler, zu denen die Burgodionen, Variner, Chariner und Gutonen gehören.
Der zweite Hauptstamm sind die Ingväonen, die sich in die Kimbern, Teutonen und die Stämme der Chauker aufteilen.
Die dem Rhenus nächsten sind aber die Istväonen, von denen die Sugambrer ein Teil sind.
Im Landesinneren wohnen die Hermionen, zu denen die Sueben, Hermundurer, Chatter und Chrusker gehören.
Der fünfte Teilstamm sind die Peukiner und Bastarnen, die den oben erwähnten Dakern benachbart sind.”
In diesem Abschnitt ordnet und disloziert Plinius die germanischen Stämme Germania Magna‘s.
Als erste nennt er diejenigen, die im Nordosten und Osten siedelten. Es sind die Vandiler, vermutlich die Vandalen, als eigenständiger Stamm, ihr Hauptgebiet lag in Schlesien. Sie kamen jedoch ursprünglich aus Skandinavien. Als zweite nennt Plinius die Burgodionen, gemeint sind die Burgunder, sie wohnten am Unterlauf der Oder, zogen von dort als erste Etappe an den Oberlauf des Mains. Als dritte spricht er die Variner an, sie lebten an der Warnow in Mecklenburg-Vorpommern. Als vierte werden die Chariner, Harier als zweiter Name, genannt, sie hatten ihr Domizil am Oberlauf der Oder. Als fünfte spricht er von den Gutonen, gemeint sind die Goten. Sie kamen aus Schweden und lebten zur Zeit des Plinius an der Weichselmündung.
Von den Teutonen, Teil der Ingväonen, ist bekannt, dass sie ihre Heimat an der Westküste Jütlands wegen häufiger Springfluten und den daraus entstandenen Schäden an Menschen, Land und Habe verließen. Über die Chauken ist überliefert, dass sie westlich und ostwärts der Unterweser siedelten, sie gehörten zu den Ingväonen.
Von den Istväonen, Sammelname für germanische Stämme zwischen Rhein und Weser, wurden namentlich die Sugambrer angeführt. Da sie den von Caesar besiegten Tenkterern und Usipetern Asyl gewährt hatten, außerdem als Aufständische gegen die Römer in Erscheinung getreten waren, wurden sie zwangsweise als „Kugerner“auf Höhe Xauten auf das linke Rheinufer umgesiedelt; ein Teil von ihnen wurde anderen Stämmen zugewiesen.
Für das Landesinnere Germaniens sind die Hermionen bezeugt, es handelt sich um germanische Stämme an oberer und mittlerer Elbe. Dazu zählten des Weiteren Sueben am Main, Hermunduren an mittlerer Elbe, Chatten zwischen Fulda und Eder sowie Cherusker am Nordharz.
Als letzte Gruppe spricht Plinius die Peukiner und die Bastarnen an: die Peukiner sind ein Teilstamm der Bastarnen, sie besiedeln die Insel Peuke im Donaudelta. Die zunächst an der oberen Weichsel siedelnden Bastarnen wanderten nach Südosten, nahmen ihre Wohnsitze im 2. Jahrhundert vor Christus in Bessarabien.
Plinius schließt seine Beschreibung über Land und Leute Germania Magnas wie folgt ab:
„In den Ozean münden berühmte Flüsse: Guthalus, Visculus oder Vistla, Albis, Visurgis, Amisis, Rhenus und Mosa.Nach innen aber erstreckte sich der Herkynische Bergrücken, der keinem anderen in Berühmtheit nachsteht.
Im Rhenus aber selbst liegt in einer Länge von 100 Meilen die sehr berühmte Insel der Bataver und die der Kanenefaten, sowie andere (Inseln) der Frisier, Chauker, Frisiavonen, Sturier und Marsaker, die zwischen Helenius und Flevus zerstreut sind.
So heißen die Mündungen, in die sich der ausströmende Rhenus von Norden her in Seen, von Westen her in den Fluß Mosa ergießt; zwischen diesen bewahrt er in der mittleren Mündung ein mäßiges Bett für seinen Namen.“
Als letzte Völkerschaften benennt Plinius zunächst diejenigen, die an der Rheinmündung und auf der Rheininsel wohnen. Es ist die Insel der Bataver, heute unter der Bezeichnung Betuwe zwischen Lek und Wal mit dem Hauptort Noviomagus, heute Nijmegen.
Des Weiteren werden benannt die Kanenefaten, siedelnd im heutigen Kennemerland mit dem Hauptort Haarlem. Dazu kamen die Frisier, heute „Friesen“, sie wohnten zwischen Ems und Ijssel. Man unterscheidet größere und kleinere Frisier – kleinere Frisier werden auch Frisiavonen genannt.
Ein weiterer größerer Stamm waren die Chauker, die ostwärts der Friesen siedelten. Am entgegengesetzten Ende dieses Gebiets, zwischen Wal und Schelde, siedelten die Sturier. Und schließlich gab es noch die Marsaker, sie bewohnten die heutige Provinz Zeeland an der Scheldemündung.
Einen weiteren Bericht über die Kenntnisse des damaligen Germaniens zur Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. hinterlässt Pomponius Mela, ein römischer Geograph.
Pomponius Mela schreibt in seinem Werk „De Chorographia“ (auszugsweise zitiert gemäß „Germanen und Germanien in römischen Quellen“, Zusammenstellung, Erläuterung von Birgit Neuwald, herausgegeben von Alexander Heine):
„Germanien wird auf der einen Seite durch das Rheinufer bis zu den Alpen, südwärts durch die Alpen selbst, östlich durch die Nachbarschaft sarmatischer Stämme, an der Nordseite durch das Ufer des Ozeans eingegrenzt.
Seine Bewohner sind Riesen an Mut und Gestalt. In beiden erhöhen sie durch Übung ihre angeborene Wildheit; den Mut stählen sie durch ständigen Krieg, den Körper durch Gewöhnung an alle Mühsal, hauptsächlich an die Kälte.
Unbekleidet leben sie bis zur Zeit der Reife, und das Knabenalter dauert bei ihnen sehr lange; die Männer kleiden sich in kurze Gewänder, oder in Baumbast, mag der Winter auch noch so streng sein. Im Schwimmen zeigen sie nicht nur Ausdauer, sie betreiben es sogar eifrig als eine besondere Kunst. Krieg führen sie mit ihren Nachbarn; den Anlass dazu nehmen sie willkürlich; auch kämpfen sie nicht, um zu herrschen oder ihren Besitz zu erweitern – bestellen sie doch selbst ihren Besitz nicht mit Sorgfalt – sondern damit das Land rings um sie herum wüst liege.
Ihr Recht beruht auf der Gewalt, schämen sie sich doch selbst der Räuberei nicht; nur gegen ihre Gastfreunde sind sie gütig, nur gegen Schutzflehende milde.
Ihre Lebensart ist so roh und ungesittet, dass sie sogar rohes Fleisch genießen, entweder frisch oder – wenn es in den Fellen der zahmen oder wilden Tiere eingetrocknet ist – nachdem sie es durch Kneten oder Treten aufgefrischt haben.
Im Lande selbst hemmen viele Flüsse den Verkehr; zahlreiche Berge machen es rauh und zum großen Teil ist es unwegsam durch Wälder und Sümpfe. Von den Sümpfen sind die größten: der Suesische, der Mebische und der Melsiagum; unter den Wäldern sind neben dem Herkynischen noch genug andere bekannt, doch der Herkynische, der sechzig Tage Weges einnimmt, ist sowohl größer als auch bekannter als die übrigen. Von den Bergen sind die höchsten der Taunus und der Retico, die vielleicht ausgenommen, deren Namen römische Lippen kaum aussprechen können.
Von den Flüssen, die in das Gebiet anderer Stämme hinüberfließen, sind die Donau und Rhodanus (Rhone), von den Nebenflüssen des Rhenus Moenis (Main) und Lupia (Lippe), von denen, die in den Ozean münden, Amisis (Ems), Bisurgis (Weser) und Albis (Elbe) die berühmtesten.
Oberhalb des Albis liegt der ungeheure Codanische Meerbusen, voll von großen und kleinen Inseln.
Deshalb erstreckt sich das Meer, das die Ufer gewissermaßen im Schoß hält, nirgendwo weit hinaus. Nirgendwo ist es dort einem offenen Meer ähnlich; sondern da die Gewässer, wo sie können, zwischen den Inseln hinfließen, und oft ihren Lauf ändern, strömen sie unstet und zerteilen sich in einzelne Kanäle, wie Flüsse.
Wo das Meer die Küste des Festlands berührt, wird es von den Ufern der Inseln, die nicht weit und fast überall gleich weit davon abliegen, eingeengt, so dass es in seiner geringen Breite einer Meerenge gleicht.
Dann krümmt es sich und folgt der Biegung einen langen Landzunge.Auf dieser wohnen die Kimbern und Teutonen; weiter jenseits von ihnen das letzte Volk Germaniens, die Hermionen.“
Nachdem Pomponius Mela zunächst den Grenzverlauf Germania Magnas bekanntgibt, schildert er anschließend, in gewisser Weise Bewunderung ausdrückend, die Art der körperlichen Ertüchtigung bei den Germanen sowie deren Kämpferwillen. Interessant ist auch deren Einstellung zum Krieg, sie führen ihn nicht, etwa um sich zu verteidigen im Falle eines gegnerischen Angriffs, nein, das Land um sie herum soll wüst sein.
Auch macht Pomponius Mela eine Aussage über das Verkehrswegesystem Germania Magnas. Es wird zwar als nicht unerheblich behindert durch Flüsse, Sümpfe und Wälder eingestuft, aber es wird immerhin als vorhanden und eingeschränkt brauchbar konstatiert.
Es dürfte den Germanen natürlich bekannter und vertrauter gewesen sein, speziell in schwierigem Gelände, wie Wälder und Sümpfen, als den römischen Eroberern. Diese Tatsache, dieser Vorteil dürfte sich in den Anfangszeiten der Auseinan-dersetzungen für die Germanen positiv ausgewirkt haben, aber die Römer holten auf in Sachen Orts-und Wegekenntnis. Bekannte Berge und Flüsse spricht er an, auch die Völkerschaften der Kimbern und Teutonen finden Erwähnung.
Landläufig bekannter und wohlwollendster Berichterstatter über Land und Leute Germania Magnas dürfte Tacitus sein (55 – 117 n.Chr.).
Im Kapitel 16 seines Werks „Germania“ schreibt er über Dörfer u. Wohnsitze der Germanien (auszugsweise zitiert gemäß „Caesar-Tacitus“ Berichte über Germanen und Germanien, herausgegeben von Alexander Heine):
„Dass die Völker der Germanen keine Städte bewohnen, ist hinreichend bekannt; sie dulden nicht einmal miteinander verbundene Wohnsitze. Abgesondert und zerstreut bauen sie sich an, wie ein Quell, ein Feld, ein Gehölz ihnen eben gefiel.
Dörfer legen sie nicht nach unserer Weise so an, dass die Gebäude verbunden sind und zusammenhängen, sondern jeder umgibt sein Haus mit einem Raume, sein es zum Schutze gegen Feuersgefahr, sei es aus Unwissenheit in der Baukunst.
Nicht einmal Mauersteine und Ziegel sind bei ihnen in Gebrauch; zu allem bedienen sie sich rohen Holzes, ohne Schönheit und Anmut.
Einige Stellen bestreichen sie sorgfältig mit einer so reinen und glänzenden Erde, dass sie wie Malerei und Farbenbezeichnung aussieht.
Sie pflegen auch unterirdische Höhlen auszugraben und belasten diese oben noch mit vielem Dünger, als Zufluchtstätte für den Winter und zum Behältnis für die Früchte, weil sie die Strenge der Kälte durch solche Anlagen mildern, und wenn einmal der Feind kommt, er nur das offenliegende verheert, während das Verborgene und Vergrabene entweder unbemerkt bleibt oder es eben deshalb entgeht, weil man es suchen muss.”
Soweit eine kurze Skizzierung nach Tacitus über die Art und Weise, wie die Germanen wohnten. Dazu ist die Frage erlaubt, ob denn die „gewaltigen Menschenmassen“, von denen durch die Historiker berichtet wird, auf Einzelhöfen und in Dörfern wohnten.
Tacitus sagt z.B. nichts über Örtlichkeiten, wo etwa diese beschriebene Wohnkultur der Germanen vorherrschte. Es dürfte anzunehmen sein, dass es an bestimmten Orten in Germania Magna mit entsprechender Eignung größere Wohnsiedlungen gegeben haben muss. Immerhin führt C. Ptolemäus (um 150 n. Chr.) ca. 100 Ortschaften mit Stadtcharakter auf deutschem Boden an. Den römischen Großsiedlungen/Städten entsprachen sie noch nicht, da in Germania Magna Bauingenieure sowie Baumaterialien nicht zur Verfügung standen.
Wie Plinius berichtet auch Tacitus über die zu seiner Zeit bekannten Völkerschaften Germania Magnas, aber ausführlicher und mehr ins Detail gehend, sicherlich aufgrund erweiterten Kenntnisstandes.
Großen Raum widmet Tacitus den Chatten, die das heutige Bundesland Hessen besiedelten, ebenfalls den Chauken.
Tacitus bringt ein gewisses System in seine Beschreibung der Völkerschaften, indem er zunächst die ostwärts des Rheins siedelnden benennt und beschreibt, später die sich im Rücken derer anschließenden.
Einen kurzen Hinweis gibt er über die Kimbern: