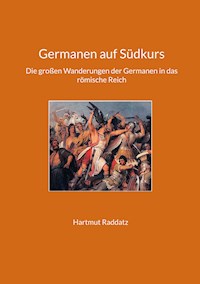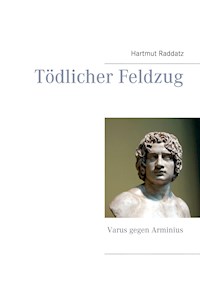
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bekanntlich fand die Schlacht im Teutoburger Wald (Arminius mit germanischen Völkerschaften gegen den römischen Statthalter Varus und seine römischen Legionen) im Jahre 9 n.Chr. ostwärts des Rheins in Germania Magna statt. Bis heute bleiben aber viele Fragen zu diesem Ereignis offen. Auf welchen Wegen marschierten Varus Legionen durch Germanien und zu welchem Ziel? Etwa zu einem Sommerlager an der Elbe/Saale? Und wo trafen die Legionen auf ihrem schicksalhaften Rückmarsch in ihre Winterlager am Rhein auf die Kräfte des Arminius, an welchem Ort fand die Schlacht überhaupt statt? Diesen Fragen geht der Autor nach. Anhand der zu jener Zeit (Zeitenwende) existierenden bzw. angenommenen „Fernstraßen“ vom Rhein bis zur Elbe/Saale begibt er sich auf Spurensuche. Dazu untersucht er die heutigen Städte entlang den Marsch-straßen auf römische Hinterlassenschaften. Funde sollten der Beweis sein, dass die Straßen über Jahrzehnte (teilweise Jahrhunderte) durch Römer benutzt wurden, so auch zur frühen Kaiserzeit. Mithin ergibt sich ein vorstellbares Bild von der Existenz der römischen Legionen in der von Rom geplanten „Provincia Germania“ und von ihrem Wirken. Und dieses Bild liefert auch einen möglichen Ort dieser Schlacht im Jahre 9 n.Chr.!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu diesem Buch
Bekanntlich fand die Schlacht im Teutoburger Wald (Arminius mit germanischen Völkerschaften gegen den römischen Statthalter Varus und seine römischen Legionen) im Jahre 9 n. Chr. ostwärts des Rheins in Germania Magna statt.
Bis heute bleiben aber viele Fragen zu diesem Ereignis offen. Auf welchen Wegen marschierten Varus Legionen durch Germanien und zu welchem Ziel? Etwa zu einem Sommerlager an der Elbe/Saale? Und wo trafen die Legionen auf ihrem schicksalhaften Rückmarsch in ihre Winterlager am Rhein auf die Kräfte des Arminius, an welchem Ort fand die Schlacht überhaupt statt? Diesen Fragen geht der Autor nach.
Anhand der zu jener Zeit (Zeitenwende) existierenden bzw. angenommenen „Fernstraßen“ vom Rhein bis zur Elbe/Saale begibt er sich auf Spurensuche. Dazu untersucht er die heutigen Städte entlang den Marschstraßen auf römische Hinterlassenschaften. Funde sollten der Beweis sein, dass die Straßen über Jahrzehnte (teilweise Jahrhunderte) durch Römer benutzt wurden, so auch zur frühen Kaiserzeit.
Mithin ergibt sich ein vorstellbares Bild von der Existenz der römischen Legionen in der von Rom geplanten „Provincia Germania“ und von ihrem Wirken. Und dieses Bild liefert auch einen möglichen Ort dieser Schlacht im Jahre 9 n. Chr.!
Zum Autor
Hartmut Raddatz, geb. 1937 in Lütjenburg (Schleswig-Holstein), besuchte die Gymnasien Plön und Oldenburg und trat nach dem Abitur in die Laufbahn des gehobenen Dienstes beim Bundesgrenzschutz ein. Nach Dienstverrichtung an verschiedenen Staatsgrenzen zur Bundesrepublik Deutschland, widmete er sich privat zunehmend dem Studium geschichtlicher Literatur, speziell jener über die römische Kaiserzeit.
Sein größter Traum ist die Auffindung des bis heute immer noch unbekannten Ortes der Schlacht im „Teutoburger Wald“ des Jahres 9 n. Chr.
Hartmut Raddatz lebt heute in Bad Krozingen nahe Freiburg im Breisgau.
Umschlagsbild: Arminius, Quelle: Wikimedia Commons
Gewidmet dem todgeweihten gallo-römischen Legionärim Dienste des Varus unddem überlebenden cheruskischen Freiheitskämpferim Dienste des Arminus
Danksagung:
Meine Danksagung beginnt bei Herrn Studienrat Breyer, der mir den Einstieg in die „Lingua Latina“ verschaffte. Studienassessor Schmidt, Lehrer für Latein, vermittelte mir die Ideale der Römer in ihrer Hochzeit.
Herrn Hauptmann Kairies danke ich, dass er mir die Hinterlassen-schaften der Römer in der Kaiserstadt „Augusta Treverorum“ (Trier) zum Eigenstudium empfahl – ein Muss für jeden Römerfreund.
Bedanken möchte ich mich auch bei meiner Tochter Maike, die das Entstehen des Werkes mittels ihrer Schreibkraft erst ermöglichte, für all ihre Geduld und Arbeit mit mir und „meinen Römern“.
Inhaltsangabe
1. Einleitung
2. Lagefeststellung und – beurteilung an der Rheingrenze durch Augustus, politisch–strategische und wirtschaftliche Zielsetzung hinsichtlich
„Germania Magna“
3. Fernhandels- und Verkehrswegekonzept
4. Die Römer als Nutzer der in Germania Magna vorhandenen Verkehrswege zur Zeitenwende
4.1. Das Medium Straße – ein Vorspann
4.2. Des
„Reiches Straße“
von Mainz über Frankfurt/M nach Leipzig - unter Berücksichtigung ihrer taktischen Eignung als römische Vormarschstraße und entlang dieser Straße aufgefundene römische Hinterlassenschaften
4.3. Die Straße Frankfurt/M nach Hildesheim unter Berücksichtigung ihrer taktischen Eignung als römische Vormarschstraße und entlang dieser Straße aufgefundene römische Hinterlassenschaften
4.4. Der
„Hellweg“
von Neuss nach Magdeburg, unter Berücksichtigung seiner taktischen Eignung als römische Vormarschstraße und entlang dieser Straße aufgefundene römische Hinterlassenschaften
5. Umsetzung der militärischen Vorbereitungsmaßnahmen und Durchführungsplan für eine Eroberung Germania Magnas
5.1. Vorbereitung
5.2. Durchführung
6. Die LEGION auf dem Marsch, im Gefecht und im Lager – über welches Potential verfügte sie?
6.1. Straßen
6.2. Fahrzeuge
6.3. Die Legion im 1. Jahrhundert nach Christus
7. Feldzüge des Drusus und Feldzüge des Tiberius
7.1. Feldzüge des Drusus
7.2. Feldzüge des Tiberius
8. Die unmittelbare Zeit nach der Varusschlacht, strategische Konsequenzen für Roms Eroberungsvorhaben hinsichtlich Germania Magna
9. Feldzüge des Germanicus
10. Augustus´ politisch-strategische und wirtschaftliche Zielsetzung hinsichtlich Germania Magna, ihre Umsetzung, ihr Ergebnis und ihre Folgen für die Rhein-Donau Linie
11. Schlußfolgerung
12. Anlagen
12.1. Griechische Quellen
12.2. Römische Quellen
12.3. Zeittafel
12.4. Fundstellen
12.5. Karten der Antike
1. Einleitung
Wie Rom, die ewige Stadt, nicht an einem Tage erbaut wurde, so wuchs auch das Imperium Romanum erst ganz allmählich zu einer stattlichen Weltmacht. Nicht allein von den Begehrlichkeiten dessen, was die gierigen Augen sahen, ganz besonders auch von folgenden Erwägungen hing es ab, ob sich wieder einmal eine Erweiterung des Territoriums anbahnte: War es der jeweilige Herrscher, der die Sache vorantrieb oder hatte dieser eben kein Interesse daran – sei es wegen des momentanen Zustands des Staates, der eine Erweiterung noch nicht zuließ, sei es aus finanziellen Gründen oder wegen fehlender Bewaffnung, Ausstattung und Ausrüstung oder sei es wegen mangelnder Truppenkapazität. Manchmal war es auch der letzte Happen, der gerade noch nicht verdaut war, noch schwer im Magen lag. So gab es einiges zu bedenken, ehe der nächste Coup in Angriff genommen wurde.
Um die Zeitenwende hatte sich das ehemals kleine Rom jedenfalls schon beträchtlich gemausert, mehrere Nachbarn unterworfen und botmäßig gemacht. Und ein Ende der Expansion zeichnete sich noch nicht ab. Im Osten, Süden und Westen strahlte die Sonne morgens, mittags und abends auf das aufstrebende Imperium.
Nur der Norden hatte sich bislang einem „Wachstum“ gleichsam entzogen. Während das italische Festland sowie griechisches und mazedonisches Gebiet, der nahe Osten, ein Uferstreifen Nordafrikas und spanisches Gebiet noch vor der Zeitenwende betreten, besetzt und beherrscht wurden, waren Gallien, Britannien und Germanien bisher nicht in den Fokus römischen Interesses getreten. Das sollte sich kurz vor und nach der Zeitenwende nun rasant ändern, Expansion war angedacht. Das Territorium würde dann abgerundet, komplettiert und konsolidiert – so plante man es wohl.
In Gallien machte der berühmte Feldherr und Staatsmann Gaius Julius Caesar 58 vor Christus dann Ernst. Fast acht Jahre benötigte er, um die Völkerschaften Galliens im heutigen Frankreich, in Belgien, Luxemburg und im heutigen Deutschland westlich des Rheins zu unterwerfen. 51 v. Chr. war es dann soweit, Caesar konnte melden, Gallia capta.
Caesar wäre nun kein herausragender Feldherr, wenn er im Verlauf des Bello Gallico nicht das weitere Umfeld Galliens, spricht Britannia und Germania im Auge gehabt hätte. Beiden Gebieten stattete er mehr oder weniger erfolgreich Stippvisiten ab.
Dazu überliefert Orosius, römischer Historiker des frühen 5. Jahrhunderts n. Chr. (Quelle: „Die antike Weltgeschichte in christlicher Sicht“, Band II, Buch VI, Kapitel 9, übersetzt und erläutert von Adolf Lippold, Artemis Verlag Zürich und München) folgendes:
1. „Damals baute Caesar eine Brücke, setzte nach Germanien über und befreite Sugambrer und Ubier von einer Belagerung. Die Sueben, ein sehr starkes und wildes Volk, das nach zahlreichen Berichten 120 Gaue und Völkerschaften umfasste, und ganz Germanien erschreckte er durch seine Ankunft.
2. Bald darauf brach er die Brücke ab und zog sich nach Gallien zurück. Dann rückte er in das Gebiet der Moriner vor, von wo aus der nächste und kürzeste Übergang nach Britannien besteht. Nach Ausrüstung von etwa 80 Lastschiffen und Schnellseglern fuhr er nach Britannien. Zuerst durch einen harten Kampf mitgenommen, dann durch einen widrigen Sturm getroffen, verlor er den größten Teil seiner Flotte, ein nicht geringe Anzahl von Soldaten und fast die ganze Reiterei.
3. Zurückgekehrt nach Gallien, entließ er die Legionen in die Winterlager und ordnete den Bau von 600 Schiffen beiderlei Typen an.
4. Mit diesen fuhr er im Frühling zum zweiten Mal nach Britannien hinüber während er selbst mit dem Heer gegen den Feind aufbrach, wurden die vor Anker liegenden Schiffe vom Sturm erfasst und stießen entweder untereinander zusammen oder wurden auf den Sandstrand geworfen und zerstört. 40 davon gingen unter, die übrigen wurden unter großer Beschwerlichkeit ausgebessert.
5. Die Reiterei Caesars wurde beim ersten Zusammenstoß von den Britanniern besiegt und der Tribun Labienus dabei getötet. In der zweiten Schlacht schlug er die unter größten Verlusten für sie besiegten Britannier in die Flucht.
6. Dann marschierte er zum Tamesis, der nach der Überlieferung nur an einer Stelle mit Hilfe einer Furt überschreitbar ist. An seinem jenseitigen Ufer hatte sich unter Führung des Cassovellaunus eine ungeheure Menge von Feinden festgesetzt und das Flussufer sowie fast die ganze Furt unter dem Wasser mit stark zugespitzten Pfählen verrammelt.
7. Sobald dies Hindernis von den Römern entdeckt wurde und sie es umgingen, verbargen sich die den Angriff der Legionen nicht aushaltenden Barbaren in den Wäldern. Von dort aus fügten sie den Römern häufig schwere Verluste zu.
8. Unterdessen ergab sich die sehr stark befestigte Stadt der Trinobanten mit ihrem Führer Mandubragius und stellte Caesar 40 Geiseln. Diesem Beispiel folgten sehr viele andere Städte und schlossen ein Bündnis mit den Römern.
9. Durch ihre Hinweise nahm Caesar die zwischen zwei Sümpfen gelegene dazu durch einen Schutzgürtel von Wäldern geschützte und mit allen Dingen sehr gut versorgte Stadt des Cassovellaunus nach schwerem Kampf.“
Nach diesen Begegnungsgefechten zwischen Römern und Britanniern trat vorerst Ruhe ein, eine Besetzung Britannischen Territoriums stand derzeit nicht in Rede. Erst im Jahre 43 n. Chr., als sich am Rhein die Lage gegenüber den Einwohnern Germania Magnas beruhigt hatte, kam es zur römischen Invasion Britanniens. Und im Laufe des ersten Jahrhunderts n. Chr. gewannen die Römer die Oberhand und errichteten die neue Provinz „Britannia“. Nahezu 400 Jahre sollte diese „Ehe“ Bestand haben.
Über Caesars Übergänge über den Rhein nach Germania Magna erfahren wir durch Caesar selbst in seinem Werk: „De Bello Gallico“.
Dazu einige Auszüge aus dem Gallischen Krieg, 4. Buch:
Caesars Erster Übergang über den Rhein
16 „Nach Beendigung des Krieges gegen die Germanen hält es Caesar aus vielen Gründen für nötig, den Rhein zu überschreiten. Der gewichtigste von allen, war der, dass er die Germanen ihrer eigenen Sicherheit wegen in Besorgnis setzen wollte, weil er sah, dass sich dieses Volk so leicht zu Einfällen nach Gallien verleiten ließ – sie sollten erfahren, dass ein Heer des römischen Volkes Macht und Mut genug habe, über den Rhein zu gehen.
17 Obgleich sich ihm daher wegen der Breite, des starken Gefälles und der Tiefe des Stromes für den Brückenbau sehr große Schwierigkeiten entgegenstellten, so glaubte er doch, er müsse darauf bestehen oder dürfe sonst das Heer gar nicht hinüberführen.
18 … und das Heer wurde hinübergeführt…
19 Caesar verweilte einige Tage in ihrem Gebiete, ließ alle ihre Ortschaften und Gehöfte in Brand stecken, das Getreide abmähen und zog sich dann ins Gebiet der Ubier zurück… er glaubte aber für den Ruhm und den Vorteil der Römer genug getan zu haben, da alles das vollbracht war, um dessen Willen er das Heer hinüberzuführen beschlossen hatte: Den Germanen hatte er Furcht eingejagt, die Sigambrer bestraft, die Ubier von ihrer Bedrängnis befreit. So zog er sich denn, nachdem er im Ganzen 18 Tage jenseits des Rheins verweilt hatte, nach Gallien zurück und ließ die Brücke abbrechen.“
Und im Gallischen Krieg, 6. Buch, heißt es:
Caesars Zweiter Übergang über den Rhein
9 „Nachdem Caesar aus dem Lande der Menapier in das der Treverer gekommen war, beschloss er aus zwei Gründen den Rhein zu überschreiten; erstens, weil die Germanen den Treverern Hilfstruppen gegen ihn geschickt hatten, und zweitens damit nicht Ambiorix bei jenem Zuflucht finden könnte
…
Im Land der Treverer zunächst der Brücke, ließ er eine starke Schutzwache zurück, um dem Ausbruch einer Empörung bei diesem Stamme vorzubeugen; die übrigen Truppen und die Reiterei setzt er über den Fluss.
10 … Zugleich trug er den Ubiern auf, häufig Kundschafter zu den Sueben zu schicken und die dortigen Vorgänge auszuforschen. Jene leisteten den Befehlen Folge und berichteten schon nach Verlauf weniger Tage: Alle Sueben hätten sich, nachdem ihnen zuverlässige Kunde über das römische Heer zugekommen wäre, mit ihrer gesamten vereinigten Streitmacht und den Truppen ihrer Bundesgenossen ganz an die äußerste Grenze ihres Landes zurückgezogen.
Dort sei ein Wald von unermesslicher Ausdehnung namens Bacenis. Dieser erstrecke sich weit ins Innere und schütze als eine natürliche Grenzmauer die Cherusker vor den Unbilden und Überfällen der Sueben und die Sueben vor denen der Cherusker.“
2. Lagefeststellung und -beurteilung an der Rheingrenze durch Augustus, politisch-strategische und wirtschaftliche Zielsetzung hinsichtlich „Germania Magna“
Caesars Stippvisiten nach Britannia und Germania Magna erfolgten Mitte der 50er Jahre des ersten vorchristlichen Jahrhunderts.
Sie entsprangen weder einem Imponiergehabe noch waren sie im eigentlichen Sinne als Drohgebärde zu verstehen. Gewiss wollte Rom sich als Macht darstellen und bekannte Volksgruppen, romfreundliche, unterstützen, aber Roms Auftreten entstand wohl eher aus einem anderen Grund: Germania Magna schloss unmittelbar an Gallien an und war damit potentieller Freund oder Feind. Auch spielte der Hintergedanke, dass Germania Magna einst römische Provinz werden könnte, eine gewisse Rolle.
Dazu musste man also über den Rhein nach Osten mit dem Barbaricum Kontakt aufnehmen. Hinsichtlich einer Provinz ging es nun immer um folgendes: Wird dieses Gebiet mit seinen Bewohnern für Rom eine Bereicherung, ein lukrativer Zuwachs oder eben nicht. Rom prüfte somit, wieviele Bewohner hat das Land, was gleichbedeutend ist mit Zuwachs an Sklaven, Steuerzahlern, Absatzmärkten und nicht zuletzt an Soldaten, sprich Legionären. Desweiteren war zu prüfen, inwieweit war es fruchtbares Ackerland oder war es ergiebig an Bodenschätzen gleich welcher Art. Gab es eine Art „Verkehrsinfrastruktur“?
Bis Rom jedoch zur Tat schritt und sich jene genannten Landstriche per Kampf zu eigen machte, floss noch viel Wasser den Tiber, den Rhein wie die Themse hinab. Und während das Unternehmen hinsichtlich Germania Magna mehr oder weniger in einem Fiasko endete, war man bezüglich Britannia nach hartem Kampf erfolgreich.
13 v. Chr. stand Augustus mit seinem Beraterstab und vor allem mit Drusus an den westlichen Gestaden des Rheins, irgendwo zwischen Köln und Mainz. Über das Gebiet ostwärts des Rheins, das er zu erobern trachtete, war allgemein das bekannt, was etwas später Plinius Maior (Gallius Plinius Secundus, der ältere) schrieb:
… „Es gibt fünf germanische Volksstämme: die Vandalen, von denen die Burgundionen, Varinner, Chariner, Gutonen Teile ausmachen; zweitens die Ingävonen, zu denen die Kimbern, Teutonen und Chaukischen Stämme gehören; sodann am Rhein die Istävonen, wozu die Sigambrer zu rechnen sind; ferner mitten im Lande die Hermionen, deren Unterabteilung die Sueben, Hermundurer, Chatten, Cherusker sind; die fünfte Abteilung bilden die Peuciner und die Basterner, die Nachbarn der oben genannten Daker.
Ins Meer münden folgende bekannte Ströme:
Guttalus (Oder)
Vistillus oder Vistla (Weichsel)
Albis (Elbe)
Visurgis (Weser)
Amisius (Ems)
Rhenus (Rhein)
Mosa (Mosel)
Das Innere des Landes durchzieht der Herkynische Waldrücken, der keinem an Berühmtheit nachsteht.“
Diese Aussage des Plinius Major entstand zwischen 23 und 79 n. Chr., mithin ca. 70 Jahre nach Augustus Aufenthalt am besagten Rheinufer. Dazu gilt folgendes: Fest steht, dass vieles längst Bekannte an Inhalten deutlich später schriftlich fixiert wurde.
Durch Pomponius Mela erfahren wir über die germanischen Völkerschaften/Landschaften nachstehend Aufgeführtes:
„Germanien wird auf der einen Seite durch die Rheinufer bis zu den Alpen, südwärts durch die Alpen selbst, östlich durch die Nachbarschaft sarmatischer Stämme, an der Nordseite durch das Ufer des Ozeans eingegrenzt.
Seine Bewohner sind Riesen an Mut und Gestalt. In beidem erhöhen sie durch Übung ihre angeborene Wildheit; den Mut stählen sie durch ständigen Krieg, den Körper durch Gewöhnung an alle Mühsal, hauptsächlich an die Kälte. Unbekleidet leben sie bis zur Zeit der Reife und das Knabenalter dauert bei ihnen sehr lange; die Männer kleiden sich in kurze Gewänder, oder in Baumbast, mag der Winter auch noch so streng sein…
Im Land selbst hemmen viele Flüsse den Verkehr; zahlreiche Berge machen es rauh, und zum großen Teil ist es unwegsam durch Wälder und Sümpfe. Von den Sümpfen sind die größten:
der Suesische,
der Metische und
der Melsiagum;
Unter den Wäldern sind neben dem Herkynischen noch genug andere bekannt, doch der Herkynische, der 60 Tage Weges einnimmt, ist sowohl größer als auch bekannter als die übrigen. Von den Bergen sind die höchsten der Taunus und der Retico, die vielleicht ausgenommen, deren Namen römische Lippen kaum aussprechen können.
Von den Flüssen, die in das Gebiet anderer Stämme hinüberfließen, sind Donau und Rhodanus (Rhone), von den Nebenflüssen des Rheins Moenis (Main) und Lupia (Lippe), von denen, die in den Ozean münden, Amisis (Ems), Bisurgis (Weser) und Albis (Elbe) die berühmtesten.“
Soweit das Wissen des Augustus und seiner Berater.
Trotzdem waren noch weitere theoretische Überlegungen künftigen Vorgehens seitens Roms anzustellen, ehe von Augustus das ersehnte „Go“ an Drusus erfolgte, mittels dessen Augustus die Invasion ins Germanische beginnen konnte:
Militärische Überlegungen:
Aufmarschbasis Rhein
Truppengestellung
Marschziele
Marschwege
Truppenstandorte
Wirtschaftliche Ziele:
Einrichten von Märkten
Einrichten von Produktionstätten
Import germanischer Produkte
Export römischer Produkte
Einführung der Geldwirtschaft
Bevölkerungspolische Ziele:
Gründung von Städten
Einrichtung einer Verwaltung
Einführung von Gesetzen/Rechtsprechung
Einrichtung kultureller Aktivitäten
Das Ergebnis der Unternehmungen gegen die Germanen wertet Augustus selbst in „Monumentum Ancyranum“:
… „Bei allen Provinzen des römischen Volkes, dessen Völker benachbarte waren, die unserem Befehl nicht gehorchten, habe ich die Grenzen erweitert. Die gallischen und spanischen Provinzen und ebenso Germanien habe ich befriedet, ein Gebiet, welches durch den Ozean von Gades bis zur Mündung der Elbe begrenzt…“
Sueton schreibt dazu in seinem Werk über Augustus:… „Und die Germanen drängte er über die Elbe zurück…“
Wollte Augustus ursprünglich Germania Magna bis zur Weichsel okkupieren, was aus o.a. Satz wie auch aus Ahenobarbus Feldzug um die Zeitenwende ersichtlich wird, beschränkte er sich später auf die Linie „Elbe-Sudeten-Beskiden-Karpaten“, welche auch nur zeitweise in Teilen erreicht werden sollte. Was letztlich übrig blieb, waren die „Agri Decumates“ und eine ca. 120km breite Einflusszone ostwärts des Rheins.
Desweiteren ergaben sich für Augustus folgende grundlegende strategische Aspekte hinsichtlich der bevorstehenden Eroberung Germania Magnas. Wer Germania Magna erobern wollte, musste die von Nordwesten nach Südosten hindurch verlaufende „Beckenreihe“ sein eigen nennen:
Weserbecken
Thüringer Becken
Böhmisches Becken.
Zur Abrundung des künftigen Herrschaftsgebiets sollten später die Einverleibung des Pannonischen und Mösisch-Thracischen Beckens erfolgen.
Zu beachten und zu beurteilen waren die in Germania Magna vorhandenen größeren Ströme. Man siedelte an ihnen an geeigneten Plätzen. Die Anwohner bewegten sich und ihre Waren auf ihnen von Ansiedlung zu Ansiedlung, die Ströme dienten somit als Transportwege, was später durch die römischen Besatzer weitgehend genutzt wurde. Für wandernde Völker, durchziehende Heere und gallische Händler waren sie als Leit- und Sperrlinien von großer Bedeutung, indem sie Bewegung ermöglichten, erschwerten oder unmöglich machten. Jede Neuheit, jeder Verkaufshit bewegte sich zu jener Zeit hauptsächlich auf den Strömen oder entlang ihrer Uferstraßen, sofern vorhanden. Erst allmählich wurden vorhandene Trampelpfade, Fuß-oder Reitwege zu Fahrwegen erweitert, zu Straßen, die sich später auch an Waldrändern, wie auch an Gebirgszügen entlangwanden.
Natürlich gab es auch schon einige wenige Fernhandelswege, die das Land durchzogen.
Seit alter Zeit begangene Wege wurden zu Straßen. Bedeutungsvoll für die geplante Eroberung von Germania Magna durch Rom sind:
Des Reiches Straße von Mainz/Frankfurt nach Leipzig
Die Straße Frankfurt/Main nach Hildesheim
Der Hellweg, Bundesstraße 1
Somit waren Straßen und Ströme nutzbar für die von West nach Ost geplante Eroberung Germania Magna’s. Vor allem Mainz und Xanten sollten Ausgangspunkte für die Romanisierung Germania Magna’s werden, zu erreichende Ziele waren zunächst Magdeburg/Elbe und Halle/Saale.
Mögliche taktische Szenarien waren damals folgende:
Gewinnen und Halten Elbe/Saale Linie
Gewinnen und Halten Oder/Neiße Linie
Gewinnen und Halten Weichsel Linie
War man nun anfangs erfolgreich, so gelang aber bereits hinsichtlich der Oder/Neiße Linie wie auch der Weichsel Linie nichts. Mögliche Abläufe und Ziele für die Eroberung des neuen Gebiets bis zur Elbe könnten folgende gewesen sein:
Besetzung bedeutsamer Fernhandelswege zugleich nutzbar als Heerwege
Gewinnen und Inbesitznahme der Beckenreihe in Germania Magna
Besetzen und Ausbau der Elbe/Sudeten Linie
Aufbau einer Verkehrsinfrastruktur in G.M.
Einrichtung eines Produktions- zugleich Absatzraums
Romanisierung der „Neuen Provinz“
Rechtsangelegenheiten
Verwaltungswesen
Geld- und Steuerwesen
Römische Lebensart
3. Fernhandels- und Verkehrswegekonzept
Die Handelswege zur Zeitenwende verliefen in Germania Magna vornehmlich entlang der Flüsse, der Küsten, bedeutsame in geringer Anzahl zu Lande. Wo genau sie verliefen, ist nur selten nachweisbar. Wenn sie an Bedeutung verloren hatten, wurden sie nicht mehr frequentiert, nicht gewartet, sie überwucherten und waren irgendwann nicht mehr erkennbar. Gelegentlich tauchten Teile von ihnen per Zufall wieder auf, wurden freigelegt – als Bohlenwege.
Als Grundlage der Auffindung eines geplanten bzw. übernommenen und in Teilen verbesserten Straßennetzes der Römer in Germania Magna um die Zeitenwende sollen Landkarten, Berichte und Funde dienen – einbezogen und ausgerichtet auf damalige Siedlungsplätze.
Doch zunächst muss sich die Betrachtung auf eine Handelsstrategie richten, will sagen, auf welchen Wegen kommt was von woher und geht wohin? Was heute gilt, galt auch früher, etwas gewagt, was früher galt, galt auch noch früher. Aus dem 13. Jahrhundert haben wir an Erkenntnissen über ältere Kaufmannsstädte folgende Nachrichten:
Städte wie Basel, Konstanz, Ulm, Augsburg, Regensburg und Wien trieben Handel mit Italien. Städte wie Köln, Brügge und Gent trieben Handel mit England. Verbindungsschiene beider Lager war der Rhein. Städte wie Lübeck, Wismar, Rostock, Stettin, Danzig, Memel, Riga und Reval trieben Handel mit nordischen Staaten und Russland. Die Verbindungsschiene zwischen den „Rheinstädten“ und den Ostseehäfen war der Hellweg.
Dieses Fernhandelsnetz besteht seit langem, immer leicht abgewandelt, angepasst hinsichtlich der Straßenführung.
Wirtschaftliche Ziele Roms hinsichtlich des Fernhandelskonzepts:
1. Römische „Waren“ für Germania Magna
Dinge des täglichen Bedarfs
Tongeschirr
Technisches Know-How
Wein, Öl
Ackerbau
Straßenbau
Häuserbau
Stadtanlagen
2. Germanische „Waren“ für das Imperium
Kupfer, Eisen, Zink
Bernstein
Gänse, Fisch
Häute, Pelze
Frauenhaar
Sklaven
3. Aufbau von Lizenzfirmen, Vertrieb
Einrichtung von Produktionsstädten in der Nähe des Rohmaterials
Erweiterung des Wegenetzes
Förderung der Verbrauchermärkte
4. Siedlungsplätze in Germania Magna
Die Deutschlandkarte des Ptolemäus von 150 n. Chr. weist 96 Siedlungsplätze auf. Genaue Gradmessungen waren zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt – somit gibt es keine exakte Entsprechung der tatsächlichen Lage.
Nördliche Region
Fabiranon→Bremen
Lakiburgion→Rostock
Mittlere Region (Hellweg)
Agrippinensis→Köln
Luppia→Braunschweig (?)
Meswion→Magdeburg (?)
Mittlere Region (Straße Frankfurt/Main - Hildesheim)
Amisia→Marburg(?)
Mittlere Region (Straße Mainz- Leipzig)
Arelatia→Erfurt (?)
Kalaigia→Halle
Mittlere Region (Rheinschiene)
Mogontiacum→Mainz
Bonna→Bonn
Vetera→Xanten
Wegenetzstraßen/Wasserläufe
Rheintalstraße (Basistraße)
Hellweg
Straße Frankfurt/Main – Hildesheim
Straße Mainz – Leipzig (Halle)
Bernsteinstraße Nordseebernstein
Jütland
Hamburg
Elbe
Saale
Boehmischer Wald
Donau
Inn
Brenner
Bozen
Eisachtal
Mittelmeer
Rom
Bernsteinstraße Ostseebernstein
Samland, Truso
Thorn
Oder
March
Mährische Pforte
Donau
Neusiedler See
Slowenien
Aquileia
Wasserläufe
Einfallschneise Lupia/Lippe
Einfallschneise Moenus/Main
Rhenus Basisfluss
Amisis→ Ems
Visurgis→ Weser
Albis→ Elbe
Guthalus→ Oder
Vistla→ Weichsel
Lupia→ Lippe
Rura→ Ruhr
Siga→ Sieg
Logana→ Lahn
Adrana→ Eder
Lagina→ Leine
Alara→ Aller
Okara→ Oker
Mosa/Mosella→Mosel
Moenus→ Main
4. Die Römer als Nutzer der in Germania Magna vorhandenen Verkehrswege zur Zeitenwende
4.1. Das Medium Straße – ein Vorspann
Der Pfad, der Weg, die Nebenstraße, die Hauptstraße, die Autobahn, die Wasserstraße, die Luftstraße, sie alle haben sich im Laufe der Menschheitsgeschichte entwickelt. Eines aber war ihnen von Anfang an gemeinsam und ist es auch geblieben: Auf ihnen erfolgte und erfolgt noch heute die Bewegung des Menschen von A nach B. Die Straße (der Verkehrsweg) verbindet.
Der Mensch in A und der Mensch in B, sie wollen sie zueinander. So muss einer von ihnen die Straße, die Verbindung zwischen ihnen, benutzen. Gleiches gilt, wenn er zurück will; und so ist es auch meistens, man begibt sich von A nach B, um etwas zu erledigen und kehrt anschließend zurück. Das wäre die Grundidee.
In dieser Weise hat das Medium Straße den Menschen schon immer gedient. Die Nutzungszwecke wurden erweitert, das Medium wurde immer wieder verbessert, auf den neuen Stand gebracht, der Massenabläufe und Geschwindigkeit garantieren muss. Der friedliche Charakter der Straße ermöglicht den Verkehr von Mensch zu Mensch, den Austausch von Erzeugnissen im gegenseitigen Geben und Nehmen für Bares oder Tauschgüter. Daraus entwickelte sich der unfriedliche Charakter der Straße, die den Transport von Angreifern ermöglichte, um das einseitige Nehmen von Land, Leuten und Erzeugnissen durchzuführen. Ganze Straßennetze wurden für eine Okkupation und Einverleibung fremder Territorien nach taktischen Gesichtspunkten geplant und angelegt, Vorhandenes wurde mit einbezogen. Meister darin war das Imperium Romanum – auf dem Höhepunkt seiner Macht verfügte es über 85.000km Staatsstraße.
Benötigt wurde dieses gigantische Netz für marschierende Soldaten, Reiter, Gespanne; auf ihm erfolgten Vor- und Rückmarsch, Ab- und Nachschub sowie Übermittlung von Nachrichten. Brennpunkte der Straßen waren Furten, befestigte Übergänge über Flüsse, Kreuzungen und Engen im Gelände. Die Straßen bedurften an diesen neuralgischen Punkten eines besonderen Schutzes durch Kastelle, Wachtposten, berittene Streifen. Entlang der Straßen wurden Standlager, Festungswerke angelegt, um mittels ihrer Belegung einen Vormarsch sicherzustellen, als Nachschublager zu dienen oder im Falle eines Rückzugs der eigenen Kräfte Angreifer wirksam aufzuhalten.