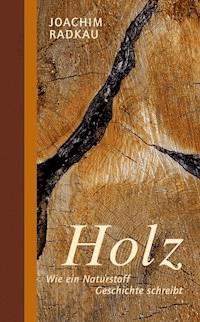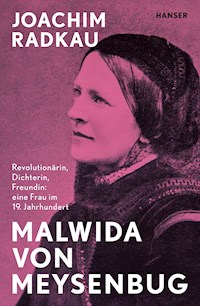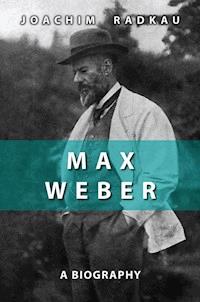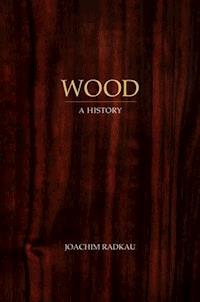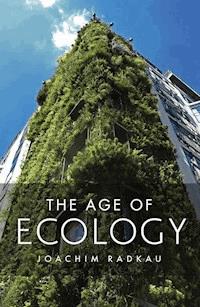Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bald werden uns kleine Reaktoren im Garten mit Energie versorgen. Das Waldsterben lässt sich nicht mehr aufhalten. Der Sozialismus macht ein Ende mit der sozialen Ungerechtigkeit. Wirklich? Joachim Radkau hat erforscht, wie sich die Deutschen seit 1945 ihre Zukunft ausgemalt haben. Hoffnungen und Ängste, Prognosen und Visionen, fatale Irrtümer und unerwartete Wendungen: Im Rückblick staunt man, wie sicher wir zu wissen glauben, was auf uns zukommt. Dabei sind diese Vorstellungen oft Grundlage weitreichender Entscheidungen, ob es nun um die Umwelt geht, um die Rente oder die Bildung. Ein ungewöhnlicher Blick auf die deutsche Geschichte von einem der originellsten Historiker unserer Tage.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 947
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bald werden uns kleine Atomreaktoren im Garten mit Energie versorgen. Das Waldsterben lässt sich nicht mehr aufhalten. Der Sozialismus macht ein Ende mit der sozialen Ungerechtigkeit. Wirklich? Wer wissen will, was eine Gesellschaft bewegt, sollte sie nach ihren Vorstellungen von der Zukunft fragen. Joachim Radkau hat erforscht, wie sich die Deutschen seit 1945 ihre Zukunft ausgemalt haben. Hoffnungen und Ängste, Prognosen und Visionen, fatale Irrtümer und unerwartete Wendungen: Im Rückblick staunt man, wie sicher wir zu wissen glauben, was auf uns zukommt. Dabei schwirren diese Vorstellungen niemals nur in den Köpfen herum, oft sind sie Grundlage weitreichender Entscheidungen mit ganz realen Konsequenzen, ob es nun um die Umwelt geht, um die Rente oder die Bildung: Ein ungewöhnlicher Blick auf die deutsche Geschichte, der Radkaus Ruf als einer der originellsten Historiker unserer Tage glänzend bestätigt.
Hanser E-Book
Joachim Radkau
Geschichte der Zukunft
Prognosen, Visionen, Irrungen in Deutschland von 1945 bis heute
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-25625-5
Alle Rechte vorbehalten
© Carl Hanser Verlag München 2017
Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München
Motiv: © firina/Thinkstock und © SergiyN/
Thinkstock
Satz: Greiner & Reichel, Köln
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Inhalt
Einleitung: Der Historiker und die Zukunft – ins Stocken geratene Anläufe und neue Zugänge
1 »Forderung des Tages« – »Und der Zukunft zugewandt«: Der deutsch-deutsche Zukunftskontrast, die offenen und die verborgenen Zukünfte und der Überraschungseffekt des »Wirtschaftswunders«
2 Agraraussichten vor dem Urgrund der Hungerzeit: Ein Zwiespalt der Zukünfte und deren Überrumpelung durch ungeahnte Innovationsschübe, Überproduktion und ökologische Revolution
3 »Die Zukunft hat schon begonnen« – aber was für eine? »Die Russen kommen« – »Die Roboter kommen«: Oder doch nicht wie erwartet?
4 Das ambivalente »Atomzeitalter«: »Wir werden durch Atome leben« – oder den Atomtod sterben? Der Zickzack atomarer Zukünfte: Ein Prototyp der Dialektik von Furcht und Hoffnung
5 Zwischen Heimat und Ferne: Reale und virtuelle Räume der Zukunft
6 Drohende deutsche Bildungskatastrophen – von Picht bis PISA
7 Von den Technokraten bis zu den Achtundsechzigern: Der diffuse Zukunftsboom der 1960er Jahre und seine Krise nach 1970
8 DDR-Horizonte von Ulbricht zu Honecker: Die Zukünfte kollidieren mit der Gegenwart
9 Von »No Future« zu »Our Common Future« – von »Euroschima, mon futur« zum »Zukunftsfähigen Deutschland«
10 Vom »kranken Mann Europas« zum erneuten Exportweltmeister: Ein Zickzack deutscher Zukünfte vor der offenen Zukunft
11 Vom »Ende der Arbeitsgesellschaft« zu »Arbeit 4.0«: Ein Zickzack in den Zukünften der Industriearbeit
12 Zwischen Herausforderungen der Zukunft und des Hier und Jetzt: Ein noch zu erkundendes Spannungsfeld der Umweltbewegung
Ein vielstimmiges Finale: 10 Thesen
Dank und Nachgedanken
Anmerkungen
Bildnachweis und Quellen
Personenregister
»Hoffnungseinbruch«: Schaubild des Instituts für Demoskopie Allensbach, das von Anfang an jeweils zum Jahresende die Zukunftsgestimmtheit der Bundesbürger erfragte.
Einleitung: Der Historiker und die Zukunft – ins Stocken geratene Anläufe und neue Zugänge
DIE URLUST AN DEN URSPRÜNGEN DER URSPRÜNGE UND DAS VERGNÜGEN DER RETROSPEKTIVEN BESSERWISSEREI: STOLPERSTEINE BEIM UMKREMPELN DER GESCHICHTE. Eine anekdotenreife Szene aus einem Bismarck-Seminar des Historikers Heinz Gollwitzer an der Universität Münster ist mir noch nach über fünfzig Jahren in Erinnerung: Da hielt ein Student ein Referat über das Sozialistengesetz von 1879. Am 11. Mai jenes Jahres hatte der Klempnergeselle Max Hödel auf den Kaiser geschossen; am 2. Juni war das Attentat von Karl Nobiling, dem Doktor der Staatswissenschaften, gefolgt; dieses benutzte Bismarck zum Verbot der Sozialdemokratie, ohne dass ein Zusammenhang der Attentäter mit dieser Partei nachgewiesen worden wäre. Aus dem Seminar kam die Frage: »Warum hatte Bismarck nicht schon Hödels Attentat zum Anlass genommen?« Der Referent: »Och, er wollte wohl erst das Attentat von Nobiling abwarten.« Da schaute Gollwitzer, sonst meist ernst, mit zuckenden Mundwinkeln umher – wir begriffen und fingen an zu lachen. Als ob Bismarck schon damals die »Bismarck-Zeit« wie in einem nachträglichen Geschichtsbuch vor Augen gehabt und daher gewusst hätte: Auf Hödel folgt Nobiling!
Ist diese Geschichte bloß komisch? Für mich wurde sie zum Aha-Erlebnis. Hödel hin, Hödel her – aber die fixe Idee, die Akteure der Vergangenheit hätten den Fortgang der Geschichte kennen müssen, spukt auch zehn Etagen höher in Historikerhirnen herum, selbst dann, wenn das Überraschungsmoment der damals einstürmenden Geschehnisse offenkundig ist. Historiker bekennen sich zwar zu dieser Prämisse kaum je direkt; aber sie urteilen in einer Weise, die diese Voraussicht voraussetzt. Das gilt nicht zuletzt für den streitbaren Hans-Ulrich Wehler. So vermisste er, über ein Jahrzehnt nach erfolgter Wiedervereinigung, bis 1989 bei der SPD, der er sonst nahestand, eine »aktive Einigungspolitik«, ja erkannte bei ihr gegenüber der DDR geradezu eine »politische Blindheit«.1 »Die kurzlebige Existenz der DDR hat in jeder Hinsicht in eine Sackgasse geführt.«2 Aber kein anderer als Wehler selbst hatte noch im April 1989 in Buffalo einen Vortrag mit dem Titel gehalten: »The ›German Question‹ in Europe 1648–1989 – Why Germany Should Not be Reunited«3, wobei er – wie in heutigen Titeln beliebt – »Warum?« vom Frage- zum Bekräftigungswort umdreht, das Fragen abschneidet. Damit hatte er eine Fortexistenz der DDR auf unabsehbare Zeit in Aussicht gestellt. Mit dieser Sichtweise stand er noch zu jener Zeit ganz und gar nicht allein.4 Einstige Fehlprognosen nicht wegzuwischen, sondern in Erinnerung zu rufen öffnet historische Einsichten eigener Art, nicht zuletzt über die Bedeutung des Überraschungseffekts in der Geschichte.
Im Zuge der Recherchen für meine Dissertation über die deutsche USA-Emigration nach 1933 lernte ich den schon im Jahr der Machtergreifung emigrierten Historiker George W. F. Hallgarten (1901–1975) kennen, der damals in Washington lebte. In den Jahren darauf schrieben wir gemeinsam das Buch Deutsche Industrie und Politik von Bismarck bis heute. Hallgarten legte mir gegenüber Wert darauf, 1933 sei er einzig als Pazifist und Anhänger der politischen Linken emigriert, nicht wegen seiner jüdischen Herkunft; kaum einer der deutschen Juden sei damals auf die Idee gekommen, dass er in NS-Deutschland nicht nur in einer etwaigen Beamtenkarriere, sondern auch an Leib und Leben bedroht sei.5 Groteske Ironie des Schicksals: Hallgarten war Mitschüler, ja Schulfreund von Heinrich Himmler (»my once tender and sensitive former friend«) gewesen.6 Zu der Zeit, als wir miteinander in Kontakt traten, hatte ein amerikanischer Psychohistoriker die These aufgestellt, Himmlers Antisemitismus sei einem untergründigen Neid auf den jungen Hallgarten, den Spross der Münchener Schickeria, entsprungen. Diese Unterstellung, dass er selbst, wenn auch schuldlos, am Ursprung des Holocaust stehe, brachte Hallgarten aus der Fassung; er wollte mit mir ein ganzes Buch schreiben, um nachzuweisen, dass die mörderische Judenfeindschaft Himmlers wie überhaupt künftiger Nationalsozialisten frühestens 1917/18, in der Endphase des Krieges, entstanden sei, daher hätten die meisten deutschen Juden die tödliche Neuartigkeit dieses Antisemitismus zu lange nicht begriffen.
Ich wimmelte dieses Buchprojekt ab, weil ich Forschungen, bei denen vorweg feststeht, was herauskommen soll, nicht schätze; und doch mag Hallgarten aus seiner eigenen Erfahrung etwas Richtiges erkannt haben. Bei all seinen Sarkasmen zum wilhelminischen Deutschland hielt er doch nicht viel von Wehlers damaliger Konstruktion des Kaiserreichs als eines geschlossenen Systems, das per se zum Verhängnis prädestiniert war; er besaß einen ausgeprägten Sinn für das Überraschungs- und Überrumpelungsmoment der Geschichte: Manche Umbrüche können ebendeshalb geschehen, weil sie vom Gros der Zeitgenossen zumindest in dieser Form nicht vorhergesehen wurden. Niemand, der das Leben liebt, hätte 1933 die NSDAP gewählt, hätte er (oder sie) im Voraus gewusst, was kommt: eigentlich eine denkbar simple Einsicht!
Der Historiker soll die Menschen vergangener Zeiten verstehen. Aber wo deren Handeln keine bloße Alltagsroutine und nicht lediglich reaktiv ist, muss man zum Verständnis damalige Zukunftserwartungen rekonstruieren, und diese können sich himmelweit vom tatsächlichen Fortgang der Geschichte unterscheiden. Diese Logik ist eigentlich so naheliegend wie nur möglich, und man sollte meinen, die Historiker hätten voller Neugier der Geschichte der Zukunftserwartungen nachgespürt – aber ebendies ist verblüffend selten geschehen, und wo es solche Ansätze gab, blieben diese, mit wenigen Ausnahmen, regelmäßig stecken. 1959, in der Zeit von Mao Tse-tungs »Großem Sprung«, verkündete gar der Historiker Hermann Heimpel, der als Erfinder des Begriffs »Vergangenheitsbewältigung« gilt: »Die Geschichtswissenschaft muss den Sprung in die planetarische Zukunft wagen«7, und wurde damit viel zitiert; aber ihm lag es fern, diesen großen Sprung zu wagen. Einst suchte ich zusammen mit meiner Ehefrau Orlinde, wir beide von der lustvollen Seite von 1968 beschwingt, der Lust in der Geschichtswissenschaft nachzugehen: Da entdeckten wir mit Staunen, dass schon Droysen, der bedeutendste Geschichtsdenker des 19. Jahrhunderts, die Historiker dazu auffordert, das dynamische Element in der Geschichte zu erforschen, statt ewig den Wurzeln nachzuspüren; und doch setzte er sich damit nicht durch.8 Wie ist dieses Rätsel zu erklären?
Eine Antwort liegt nahe: Wer sich der Geschichte zuwendet, dessen Leidenschaft richtet sich erst einmal auf die Retrospektive, und in diese steigert man sich dann hinein; so schwelgt die Urlust des Historikers im Spüren nach den Ursprüngen und immer weiter nach den Ursprüngen der Ursprünge … Und nicht selten verstärkt sich diese Libido durch eine andere Lust: die der Besserwisserei aus der Rückschau. Das ist eigentlich ein billiges Vergnügen, mit dem man nicht unbedingt renommieren kann; aber beim Rückblick auf die NS-Verbrechen und die Weltkriege erlangt es einen Zug von moralischer Überlegenheit. In diesem Sinne wurde »Erinnerungskultur« zur Parole populärer Geschichtsvermittlung. Wenn in den 1950er Jahren und danach Angehörige der älteren Historikergeneration, die der Kriegsfreiwilligen von 1914 und derer, die sich 1933 zu Hitler bekannt hatten, zuweilen daran erinnerten, dass man sich zum Verständnis der Geschichte in einstige Zukunftshorizonte hineinversetzen müsse, weckte dies bei Jüngeren den Verdacht auf Apologie, und nicht ohne Grund.
Reinhard Wittram (1902–1973), dessen Büchlein Das Interesse an der Geschichte (1958) für mich wie für viele Mitstudenten der erste Einstieg ins Geschichtsstudium war, brachte 1966 die Essaysammlung Zukunft in der Geschichte heraus, die mit Betrachtungen über die »vergangene Zukunft« begann. Zwischen den Zeilen mag man spüren, dass er durch die Zukunft der Zwischenkriegszeit im Grunde gerne seine eigene NS-Vergangenheit entschuldigen würde; aber gewissenhaft, wie er war, zuckt er davor im Gedanken an Auschwitz zurück: »es hieße alle Gewichte verwirren …, wenn wir bei dem Bemühen um die Vergegenwärtigung des Nationalsozialismus in unsere eigene Naivität des Jahres 1933 oder 1937 oder irgendein Ereignis der nächstfolgenden Jahre ohne das Wissen um das Grauen der Vernichtungslager ins Auge fassen wollten …«9 Das einst als Credo der Historiker gern zitierte Wort Leopold von Rankes, jedes Zeitalter sei »unmittelbar zu Gott«, blieb dem Historiker im Anblick der NS-Verbrechen im Halse stecken.
EINE ERSTE ENTDECKUNG: DIE PRODUKTIVITÄT DES PRAGMATISCHEN PESSIMISMUS. Um ehrlich zu sein: Auch ich selbst bin oft genug beim Thema »Zukunft« ins Stocken geraten – bezeichnenderweise kamen mir viele Gedanken des Buches nicht so sehr beim gezielten Grübeln, sondern eher im Halbschlaf, wenn abgesunkene Erinnerungen hochtauchten. Auf dem tiefsten Grund eine Erinnerung aus meiner Schülerzeit, Anfang 1961: Da hatte ich an einem Wochenendseminar mit Wolfgang Leonhard teilgenommen, der mit seinen Insiderkenntnissen aus der SED-Führung zu jener Zeit Furore machte. Damals hatte ich die Mao-Biographie von Robert Payne gelesen, die noch die einstige Faszination des Autors durch den chinesischen Revolutionär verrät.10 Ich meinte zu Leonhard, solch ein Revolutionär, der eine große Vision hat und aus dem Stegreif Gedichte macht, das sei doch wirklich ein anderes Kaliber als diese Bonner Alltagsmenschen. Er dagegen mahnte zur Vorsicht mit Staatschefs, die Visionen haben und Gedichte fabrizieren: Alltagsmenschen wie hierzulande bekämen den von ihnen Regierten oftmals weit besser!
Damals war noch längst nicht ins öffentliche Bewusstsein gedrungen, dass Maos »Großer Sprung« – diese Parole mit Kick, gerade für Jugendliche – weitaus mehr Menschenleben gekostet hatte als selbst der Holocaust; und doch überkam mich nach dieser Entgegnung ein peinliches Gefühl, das ich bis heute in Erinnerung habe. Mir wurde bewusst: Ich hatte mich mit großen Worten wichtig getan in einer Art, wie das damals unter »kritischen« Intellektuellen der Stil war; in Wahrheit hatte ich von der weiten Welt keine Ahnung, wogegen Leonhard wohl wusste, wovon er redete. War es etwa ein Vorzug der alten Bundesrepublik, dass die Politiker – zumindest bis in die frühen 1960er Jahre – die Zukunftsvisionen gemeinhin den Publizisten überließen? Oder lag da doch ein Defizit der Bonner Politik, zumindest auf die Länge der Zeit? Über 53 Jahre danach, in Nachrufen auf den verstorbenen Leonhard, war zu lesen, dass er sich in seinen alten Tagen nach »langfristigen Perspektiven« in der Politik geradezu »gesehnt« habe.11
Bahnbrechend war in der Zukunftsgeschichte Die Entdeckung der Zukunft von Lucian Hölscher. Da stehen visionäre Zukunftsentwürfe im Zentrum, die die gesamte Gesellschaft und Kultur umfassen; die »Periode des Höhepunkts« ist ausgerechnet die Zeit von 1890 bis 1950: die Zeit des Hochimperialismus, der Weltkriege, des Faschismus und des Stalinismus. Das bestätigt die Warnung, die der Philosoph Hermann Lübbe mir gegenüber äußerte: »Träume vom Paradies führen in die Hölle!« Die Zeit nach 1950 dagegen ist bei Hölscher »die Periode des Niedergangs«. Eben von dieser Zeit handelt jedoch dieses Buch. Es war keine große Zeit der Utopien, aber eine Zeit der nüchternen, oft genug pessimistischen Zukunftsszenarien, auch eine Zeit spezieller, auf bestimmte Sektoren begrenzter Zukunftsentwürfe, für automatisierte Industrien etwa, für das Verkehrswesen, die Bildung und die Energiewirtschaft. Und dann, nach 1970, das dramatische Hell-Dunkel der ökologischen Zukünfte!
All dies enthält die Chance, die Zukunftsgeschichte tiefer in der realen Geschichte zu verwurzeln, ob als Spiegel von Zeitstimmungen, als Triebkraft des Handelns oder als Quelle von Überraschungen. Ebendies ist das Ziel dieser Darstellung. Zukunftserwartungen machen nicht zuletzt durch die von ihnen wider Willen bewirkten Überraschungseffekte Geschichte. Und die resultieren in typischen Fällen aus der Synergie diverser Entwicklungen, die bis dahin voneinander getrennt wahrgenommen wurden. Wenn man aus den Schulen immer wieder die Klage hört, die Schüler fänden die deutsche Nachkriegsgeschichte im Kontrast zur NS-Zeit so langweilig, lässt sich dies ändern: durch die Konzentration auf das dramatische Wechselspiel von Erwartungen und Überraschungen!
Den unmittelbaren Anstoß zu diesem Buch gab mir die Bekanntschaft mit Michael Wettengel und seinen Recherchen über den Parlamentarischen Rat, der 1948/49 das Grundgesetz ausarbeitete. Da hatte er den Zukunftserwartungen dieser oft leidgeprüften Parlamentarier besondere Aufmerksamkeit gewidmet, mit dem für mich überraschenden Ergebnis, dass diese ganz überwiegend »skeptisch bis pessimistisch« waren.12 Kaum einer hatte auch nur die leiseste Ahnung vom kommenden »Wirtschaftswunder« und dem Aufstieg der Bundesrepublik, durch den das »Grundgesetz«, das damals bewusst den Beiklang des Provisorischen besaß, zur stabilsten deutschen Verfassung werden sollte. Stattdessen grassierte in Erinnerung an die Ermordung von Erzberger und Rathenau die Sorge, durch die Mitarbeit an der Vorbereitung des neuen Weststaats in den Augen der Chauvinisten zum Kollaborateur zu werden und die eigene persönliche Sicherheit zu gefährden. »Wir sollten uns alle darüber klar sein, dass wir Politik mit dem Kopf unter dem Arm machen«, erklärte damals der SPD-Abgeordnete Rudolf-Ernst Heiland13; Politik mit dem Kopf unter dem Arm machte Wettengel zum Titel seiner Abhandlung. Damit reihte Heiland sich und seine Kollegen unter die »Kephalophoren« ein: ein Terminus für die zahlreichen Heiligen, die ihr abgeschlagenes Haupt tragen.14
In einer solchen Stimmung wurden die Grundlagen der Bundesrepublik gelegt, derweil in der Ostzone mit einem Schwall von Zukunftspathos ein brüchiges Staatsgebilde installiert wurde. Ein schlagender Beweis für die Produktivität von Skepsis und Pessimismus und dafür, dass die großen Visionen gar nicht jene schöpferische Kraft besitzen, die ihre Lobredner ihnen zuschreiben? Oder enthielt »Politik mit dem Kopf unter dem Arm« auch ein Stück Selbstdramatisierung zu Märtyrern, gerade auch gegenüber den Besatzungsmächten, die diesen Parlamentariern viel zu schaffen machten; war man im Innern zuversichtlicher, als man nach außen zeigte? Zu den wenigen, die in diesem Gremium ganz offen Humor und gute Laune verbreiteten, gehörte Theodor Heuss; nicht zuletzt daraus erklärt sich das durchaus situationsgebundene Charisma des kommenden Bundespräsidenten.
Wieder und wieder hatte ich Phasen, da konnte ich das Pochen auf die »Zukunft« mit dem gewissen motzigen Ton nicht mehr hören. Und auch heute: Immer wieder, wenn geltungsbedürftige Stadtplaner mit großen Projekten kommen, durch die vertraute Stadtviertel verhunzt, Steuergelder verplempert und – wie stets mit gewaltiger Überschreitung der Kostenvoranschläge und obendrein einem Rattenschwanz von Schludrigkeiten – Betonklötze als Jahrhundertbauwerke verkauft werden, wobei das ewige »Zukunft-Zukunft-Zukunft« wie ein Kuckucksruf erklingt und Kritiker als Ewiggestrige abgekanzelt werden, kribbelt es mich, auf diese »Zukunfts«-Rhetorik eine Breitseite zu feuern, ja »Vision« zum Unwort zu deklarieren – und dann zucke ich davor zurück. Braucht man nicht doch Zukunftsvisionen, gerade auch um einen derartigen Murks wirksam zu verhindern? Und wie steht es mit der Umweltbewegung, der ich seit über vierzig Jahren anhänge? Ist nicht gerade für sie der Gedanke an die Zukunft essenziell? Nicht zuletzt in Reflexionen darüber besteht für mich der praktische Sinn dieses Buches.
SECHS ANLÄUFE ZUR ZUKUNFTSGESCHICHTE – ABER WIE WEITER? Eine selbstkritische Rückschau. Über Jahrzehnte holte mich das vertrackte Thema »Zukunft« immer wieder ein; stets geriet ich daran durch konkrete historische Stoffe sehr unterschiedlicher Art, nicht durch geschichtstheoretische Betrachtungen; aber immer wieder blieb ich irgendwo stecken. Auf welche Weise dabei das Wissen zur Weisheit wird, blieb eine offene Frage. Dass bei einem Großteil der futuristischen Populärliteratur »Zukunft« einen polternden, auftrumpfenden Ton besitzt – wohinter sich in der Regel ein bloßer Bluff verbirgt, der einem nach ein paar Jahren in Antiquariaten fast umsonst nachgeschmissen wird –, trug dazu bei, dass dieses Genre bei mir einen intellektuellen Brechreiz hervorrief und mir die Lust an fortgesetzten Zukunftsreflexionen verdarb. Bei den Vorarbeiten zu diesem Buch wurde mir erst nach und nach bewusst, dass ich mindestens ein halbes Dutzend Anläufe zur Zukunftsgeschichte hinter mir habe, die mein gesamtes Historikerdasein durchziehen und immer neue Fragen aufwerfen, die vorerst im Raum stehenbleiben müssen. Um diese kurz zu rekapitulieren:
1. DIE EMIGRATION AB 1933. Meine Arbeit an der Dissertation zu diesem Thema fiel in die Jahre um 1968; mein Doktorvater war der Hamburger Historiker Fritz Fischer, der Star der damaligen Linken, und die Wahl meines Themas – das nicht von Fischer, sondern aus mir selbst kam – entsprach ganz der »antifaschistischen« Stimmung jener Zeit, noch ohne eine Ahnung davon, dass Migration ein äußerst zukunftsträchtiges Thema werden sollte. Damals dachte man bei den USA-Emigranten an erster Stelle an Herbert Marcuse und Ernst Bloch, die Zukunftsvisionäre und Mentoren von Rudi Dutschke. Aber als ich jetzt zum ersten Mal nach langer Zeit wieder in meine Dissertation schaute, war ich überrascht über die Wiederentdeckung des Kapitels »Emigranten als Kritiker des ›Utopismus‹«.15 In der Tat, das war damals eine (erst einmal enttäuschende) Entdeckung: Marcuse und Bloch waren überhaupt nicht repräsentativ für jene Emigration; ganz im Gegenteil: Eine lange Galerie bedeutender Geister zeugt davon, dass das Trauma von 1933 in typischen Fällen geradezu eine Allergie gegen großspurige Zukunftsvisionen welcher Art auch immer hervorrief. Das verstehe ich besser nach Lektüre der Zukunft der Weimarer Republik von Rüdiger Graf: einer der bislang ganz wenigen großangelegten Arbeiten zur Geschichte der Zukunftserwartungen. Da ist man verblüfft über den damals von rechts bis links grassierenden oft »geradezu überschwänglichen Optimismus«.16 Umso traumatischer muss die darauf folgende böse Überraschung gewirkt haben. Nach 1945 traf sich der Anti-Utopismus führender Emigranten mit der Grundstimmung der Mehrheit der Deutschen: Nicht zuletzt durch diese Konvergenz wurde die Emigration zu einem Bestandteil auch der deutschen Geschichte. Aber war das ein Fortschritt hin zur politischen Weisheit – ein dauerhafter, nicht bloß ein situationsgebundener?
2. DAS ÜBERRASCHUNGSMOMENT VON 1933. Solche Entdeckungen im Schrifttum des Exils, bestärkt durch die Zusammenarbeit mit Hallgarten, stießen mich immer wieder auf die Frage, wieweit sich die NS-Katastrophe hatte vorhersehen lassen. 1976 brachte ich mit einem Freund ein Schulbuch Nationalsozialismus und Faschismus heraus; da widmete ich dieser Frage ein eigenes Unterkapitel17, ohne mir allerdings ganz darüber klar zu sein, was Schüler aus einstigen Fehlprognosen lernen können. Gewiss war mir nur das eine, dass die selbstzufriedene Vorstellung, die Hälfte der Deutschen sei 1933 blind oder böse gewesen und wir heute seien zum Glück viel besser, mit einem »Aus-der-Geschichte-Lernen« wenig zu tun hat. Ein paar Jahre später griff ich die Frage wieder auf, als ich für eine Tagung über das Ende der Weimarer Republik Prognosen der Weltbühne über den Nationalsozialismus analysierte18: Selbst in dieser legendären Zeitschrift der Linksintelligenz wimmelte es von unglaublichen Fehlurteilen!19
In spätere Auflagen des Schulbuches fügte ich in das genannte Unterkapitel einen Text aus dem Buch Hitlers Weg (1932) von Theodor Heuss ein, das ich auf einer Bergwanderung im Rucksack gehabt hatte und das mit seiner aus der Rückschau bizarren Mischung aus Hellsicht und Blindheit viel zu grübeln gibt: Das wurde einer der Anstöße zu meiner Heuss-Biographie.20 Auch hier war die Quintessenz nicht leicht. Heuss liebte es, sich in Gestalten, über die er schrieb, zu spiegeln und ein Stück von sich selbst zu entdecken: Auf diese Weise gelangen ihm Geistesblitze bei einem Wilhelm Busch, aber unterliefen ihm Irrlichter bei einem Hitler. Im übrigen war er weder zum aktiven Widerstand noch zur Emigration bereit: Auch dieser begrenzte Handlungsspielraum beeinflusste sein Urteil. Prognosen und Handlungsperspektiven hängen oft zusammen.
Am 17. Januar 1919, zwei Tage bevor er bei den Wahlen zur Nationalversammlung durchfiel, hatte Heuss in Stuttgart eine Wahlrede gehalten, die später unter dem Titel »Deutschlands Zukunft« die Reihe seiner »Großen Reden« eröffnete. Da stellte er die kühne Behauptung auf: »der deutsche Nationalgedanke ist nicht mit Brutalität und Herrscherwillen durchsetzt, sondern findet seine Ziele und Grenzen im Geistigen.«21 Noch einmal hielt er am 18. März 1946 eine Rede »Um Deutschlands Zukunft«, wieder unmittelbar nach einem verlorenen Krieg; da versicherte er den Berlinern, die sich schon vom Westen abgehängt fühlten: »Es gibt kein Entrinnen aus dem deutschen Gesamtschicksal.«22 O doch, das gab es für die Westzonen sehr wohl; das sollte sich schon bald herausstellen. Heuss, der für seine Person noch in seinen alten Tagen eine überraschende Zukunft haben sollte, erwies sich nicht als begnadeter Prophet; als Präsident hat er sich meist der Zukunftsrhetorik enthalten, und dies ganz bewusst: »Ich bin nicht in der Korporation der Propheten aktiv geworden.«23 Auch darin war er beispielgebend für die frühe Bundesrepublik. Aber – gerade diese Zurückhaltung kann zukunftsträchtig sein!
3. DAS ÜBERRASCHUNGSMOMENT VON 1914. Als ich bei den Recherchen zu meinem Zeitalter der Nervosität in Patientenakten von Neurasthenikern vor 1914 stöberte, da die Nervosität als die große Epidemie der Zeit galt, war ich von zweierlei Entdeckungen frappiert: zum einen davon, dass sich das kaiserliche Deutschland hier nicht entfernt so martialisch präsentierte wie in jener Literatur (die Bücher meines Doktorvaters inbegriffen), die jene Jahre als gewitterschwüle Vorgeschichte des großen Krieges schildert, und zum anderen davon, dass kaum einer dieser sonst so ängstlichen und übersensiblen Neurastheniker sich vor einem kommenden Krieg sorgt.24 Die Nervengeschichte gab mir den unmittelbaren Anstoß zur Beschäftigung mit Max Weber, dessen Korrespondenzen eine Fundgrube für die Nervensorgen jener Zeit sind; aber wieder: Selbst bei diesem großen Geist, dem gerne prophetische Hellsicht nachgerühmt wird, findet man in den Vorkriegsbriefen auch nicht den kleinsten Hinweis auf dem kommenden Krieg!25 Nicht anders bei dem jungen Heuss, obwohl er ebenso wie Weber ein politischer Mensch war und auch an Interna der Reichsregierung herankam.26 Lujo Brentano, der brillanteste deutsche Nationalökonom jener Zeit, mit Weber wie mit Heuss bestens bekannt, führte zwei Wochen vor Kriegsausbruch, wie sich ein Hörer später erinnerte, »mit seiner ganzen unwiderstehlichen Logik triumphierend« den Nachweis, »dass die Verflechtung und die Vernunft der modernen Weltwirtschaft jeden Krieg, zumindest jeden längeren Krieg völlig unmöglich mache«.27 Erst in jüngster Zeit haben Historiker eine Fülle von Zeitzeugnissen entdeckt, die gegen die Erwartung eines großen Krieges vor der Julikrise von 1914 sprechen.28 1962 erinnert sich der Ökonom Moritz Julius Bonn, Jahrgang 1873, in einem Brief an den befreundeten Theodor Heuss, sie beide hätten ihre Jugend in einer Zeit verlebt, in der »fast alle von der Empfindung erfüllt waren, sie lebten in den Stunden der aufgehenden Morgensonne«.29 War das eine Verklärung der eigenen Jugend aus der Wehmut des Alters? Aber im Jahr 1900 verfasste der 24-jährige Konrad Adenauer für seinen ältesten Bruder ein Hochzeitsgedicht, das begann: »Herrlich liegt vor Euch die Zukunft, wie das weite sonnbeglänzte Meer …«30
All dies kann dazu führen, nicht nach immer neuen Ursprüngen der Ursprünge zu suchen, sondern auch das Überraschungsmoment des Geschehens schärfer ins Visier zu nehmen.31 Die realhistorische Bedeutung früherer Zukunftserwartungen kann ebendarin bestehen, dass diese den Überrumpelungseffekt realer Kontingenzen, unvorhergesehener Verknotungen diverser Ereignisketten verstärken. Der hin und her fliegende Vorwurf der Nervenschwäche kann Kurzschlussreaktionen zur Demonstration der Nervenstärke hervorrufen. Zwar glaubt Lucian Hölscher in seiner Entdeckung der Zukunft (1999) feststellen zu können, in der Neuzeit habe es »wohl kaum einen Krieg« gegeben, »der von den Zeitgenossen gleichermaßen intensiv erwartet, befürchtet, ja sogar erhofft worden ist wie der Erste Weltkrieg«.32 Aber vielleicht ist ebendies der springende Punkt: Ganz verschiedenartige Zukunftserwartungen übten in der Julikrise 1914 durch ihr Zusammenschießen einen fatalen Synergieeffekt aus: die Hoffnung eingefleischter Militaristen auf einen »frischen, fröhlichen Krieg«, nach dem man zu Weihnachten wieder siegreich daheim war, der fatalistische Glaube des Kanzlers Bethmann Hollweg an die Unvermeidlichkeit des Krieges und die Zuversicht eines Brentano, dass ein großer Krieg ebendeshalb, weil seine Folgen so unausdenkbar seien, am Ende doch nicht kommen werde, da die Staatsmänner ja nicht verrückt seien. Hölscher verweist auf futuristische Kriegsliteratur der Zeit vor 1914; aber da stellt sich – für die damalige ebenso wie für die heutige Zeit – die Grundfrage, wieweit solche Sensationsbücher, Frühformen der Science-Fiction, tatsächlich die Erwartungen breiter Bevölkerungsschichten unter Einschluss der Politiker spiegelten oder ebendeshalb Furore machten, weil sie Unglaubliches präsentierten.
4. EINE ZUKUNFT, DIE ZUR VERGANGENHEIT WIRD: DIE DEUTSCHE ATOMWIRTSCHAFT. Als ich Ende 1973 mit meinen Recherchen zur Genese der bundesdeutschen Atomwirtschaft begann, mehr aus purer Neugier als aus irgendeinem Kalkül – es war ja damals für einen Historiker ein ziemlich verrücktes Unterfangen! –, intendierte ich eine Vorgeschichte der Zukunft. Meine erste Entdeckung bestand darin, dass es die zivile Kernkraft, von der seit den 1950er Jahren so viel geredet wurde, realiter noch kaum gab, die Geschichte der Kernenergie vielmehr bis in die jüngste Zeit eine Geschichte der Zukunftserwartungen war. Wie so viele Intellektuelle meiner Generation hielt ich es für gegeben, dass das »friedliche Atom«, beste Erfüllung des Pazifistentraums »Schwerter zu Pflugscharen«, die Menschheit aus der Energienot erlösen werde und man an der Bonner Atompolitik die Zögerlichkeit zu kritisieren habe.33 Nur langsam und zunächst widerwillig, dann jedoch von der Flut neuer Einsichten durch die Kernenergie-Kontroverse überwältigt, öffnete ich mich der Einsicht, dass die Anti-AKW-Bewegung alles in allem die besseren Argumente hatte.34 Aber noch an der Erstfassung meiner Geschichte der deutschen Atomwirtschaft (1983) kritisierten Kernenergie-Gegner (zu Recht), dass ich mir Schlupflöcher für eine künftige Pro-Kernenergie-Haltung offengelassen hatte: In der Tat war ich mir nicht sicher, ob die Kernkraft in irgendeiner Form nicht doch eine Zukunft hatte. An mir selbst erfuhr ich den Reiz, aber auch die Tücke eines Themas mit offener Zukunft.
In der damaligen Einleitung bezeichnete ich die »Schrumpfung des Zeithorizontes« als den Grundfehler der Atompolitik: Statt inhärent sichere Reaktortypen zu entwickeln, habe man sich auf die von den USA schon preiswert angebotenen Leichtwasserreaktoren verlegt, die mit einem extrem hohen Restrisiko verbunden sind. Die Atomstrategen hätten ein Verwirrspiel mit der Zeit getrieben: Sie hätten eine dröhnende Zukunftsrhetorik betrieben, aber in Wahrheit kurzfristig – und kurzsichtig kalkuliert.35 Der »Verlust der Zukunft« habe die Kerntechnik angreifbar gemacht »für neue, um die Zukunft besorgte Bewegungen«.36 In der Neufassung des Buches dreißig Jahre darauf, nach dem beschlossenen deutschen Ausstieg aus der Kerntechnik, habe ich diese Passage gestrichen. Aus der Rückschau erscheint mir meine damalige Vorstellung utopisch, bei einer derart komplizierten Technik sei ein politischer Entscheidungsprozess möglich gewesen, der aus der verwirrenden Vielzahl theoretisch möglicher Reaktortypen denjenigen mit höchster Sicherheit ausgewählt hätte.
Schon Reinhard Wittram, der mir einst so altmodisch erschien, hatte 1966 einen besorgten Blick auf die Kerntechnik geworfen. Nicht umsonst war er in Göttingen Kollege des Physikers Werner Heisenberg gewesen, des Halbgottes der entstehenden atomaren »Community«. Er erkannte in der Kernenergie ein Anzeichen dafür, dass in der Gegenwart »die Voraussage von der Planung abgelöst«, ja die Gegenwart überhaupt zunehmend von der Zukunftsplanung beherrscht werde. »Der Historiker hat davon Kenntnis zu nehmen, dass die Zukunft wie ein Feuer die Gegenwart frisst.«37 Wirklich? Als ich mit mehr Glück als Verstand Zugang zu den Akten der Bonner Atompolitik erlangte und aus meiner ursprünglichen Schnapsidee eine dicke Habilitationsschrift machen konnte, bestand eine meiner größten Überraschungen in der Entdeckung, dass die vier bundesdeutschen Atomprogramme, die gerade auch von den Gegnern so wichtig genommen worden waren, für den praktischen Verlauf der Dinge nahezu bedeutungslos waren. In Wahrheit herrschte nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart: Auch darin kann die Quintessenz einer Geschichte der Zukunftserwartungen bestehen!
Eric J. Hobsbawm, einer der größten Sozialhistoriker des 20. Jahrhunderts, der die längste Zeit seines Lebens auf eine sozialistische Zukunft hoffte, erkannte nach dem Zusammenbruch des Kommunismus – der zugleich ein großes Stück Geschichte perspektivlos erscheinen ließ – das »bedrohlichste Phänomen unserer Zeit« darin, dass die neue Jugend »in einer Art permanenten Gegenwart« aufwachse, ohne Geschichte und ohne Zukunft.38 Der sozialdemokratische Umweltpolitiker Michael Müller jedoch, der den britischen Historiker sonst hochschätzt, klagte mir gegenüber, Hobsbawm verfolge diesen Gedanken nicht weiter, auch wenn sein Zeitalter der Extreme implizit sehr wohl Zukunftsausblicke enthält39: immer wieder dieses Abbrechen von Ansätzen zur Zukunftsgeschichte! Da fühlte sich Müller, der als Vorsitzender der Kommission zur Endlagersuche für den Atommüll die abgründigste Zukunftsbewältigungs-Aufgabe vor sich hatte, bei der Suche nach einer neuen Zukunft im Zeichen der Nachhaltigkeit40 von dem Historiker allein gelassen. Dabei betont Hobsbawm geradezu heftig: »Die Geschichte allein ermöglicht uns eine Orientierung, und jeder, der ohne sie auf die Zukunft blickt, ist nicht nur blind, sondern gefährlich …« Und doch rückt er nicht mit einer eigenen Prognose heraus, und dies mit Grund: »Jeder von uns, der sich jemals an Prognosen herangewagt hat, ist damit mehrmals auf die Nase gefallen.«41 Der Historiker, der sich an Prognosen heranwagt, hat Grund, sich dabei zu prüfen, ob die Zukunftsszenarien wirklich seiner historischen Analyse oder nicht vielmehr seinen Hoffnungen und Ängsten entspringen. Das ist ein Weg, um aus der Geschichte der Prognostik zu lernen.
Offenbar gibt es nicht die eine große Gegenwarts-Zukunfts-Geschichte, sondern ein immer neues Wechselspiel der Zeiten. Der Althistoriker Christian Meier, der seine Studenten wiederholt dazu anhielt, Erwartungen für das kommende Jahr zu notieren, in einem Umschlag zu verschließen und sich nach einem Jahr überraschen zu lassen42, erkannte kurz nach Hobsbawm ein »Verschwinden der Gegenwart«, allerdings als ein keineswegs neues Phänomen: Schon Machiavelli habe gelehrt, für den Staatsmann sei es wichtiger, »die Zukunft als die Gegenwart zu bedenken«.43 Auch der politisch viel erfahrene Philosoph Hermann Lübbe erkennt zur gleichen Zeit eine »Gegenwartsschrumpfung«, für den Wissenschaftler besonders peinvoll ablesbar an der »abnehmenden Halbwertszeit wissenschaftlicher Literatur«44, die zunehmend aus Bibliotheken ausrangiert und im Internet zu Ramschpreisen angeboten wird. Oder ist das nur ein Zeichen, dass auch in der angeblichen »Wissensgesellschaft« die Gehirne nicht größer werden?
5. ZUR ZUKUNFTSGESCHICHTE DES WALDES. Nach Abschluss meiner Atomwirtschaft, 1980, folgte ich meiner Sehnsucht in die Wälder und stürzte mich in die Geschichte der Wald- und Holzwirtschaft im Vorfeld der Industrialisierung. Den Anstoß dazu gab mir das Finale von Werner Sombarts Riesenwerk Der moderne Kapitalismus, das im Verlauf der frühen Neuzeit ein »drohendes Ende des Kapitalismus« als Folge fortschreitender Abholzung der Wälder und immer katastrophalerer Holzverknappung erkannte.45 Vor diesem Hintergrund wurde die auf Steinkohle basierte Industrialisierung zur Reaktion auf eine ökologische Krise. Und kaum hatte ich mit dem Projekt begonnen, erscholl auch schon der Alarm über das Sterben der Wälder – welch eine Verlockung zur Aktualisierung der Geschichte: »Waldsterben damals – Waldsterben heute«!
Aber in den Archiven geriet ich durcheinander; da fand ich viele Anzeichen dafür, dass die alten Klagen, die sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts zu einem Großalarm massierten, in typischen Fällen interessengebunden waren und von einer akuten Katastrophe der Holzversorgung keine Rede war. Im Eifer des Gefechts machte mir nunmehr der Anti-Alarmismus Spaß, und ich entfachte die Holzverknappungs-Kontroverse46, die seither unter Forsthistorikern immer neu aufflammt.47 Zeitweise war ich förmlich als Feind der Förster verschrien, da die große Holzverknappung des 18. Jahrhunderts zum Gründungsmythos der modernen, auf Nachhaltigkeit verpflichteten deutschen Forstwirtschaft gehört. Aber ich schätzte ja diese forstliche Tradition und sah in den Förstern gar keine Feinde; und Geschichte nur deshalb zu betreiben, um sich über Menschen früherer Zeiten zu mokieren, ist ein allzu billiges Vergnügen.
Mein langjähriger Kollege Reinhart Koselleck (1923–2006), in seiner Generation der führende Geschichtsdenker zum Thema »Zeit«, erkannte um 1800 eine große Wende im Zukunftsdenken: Bis dahin hätten die Menschen in der Vorstellung eines ewigen Kreislaufs des Gleichen gelebt; von jetzt an wurde die Zukunft zu einem ganz Neuen.48 Vor diesem Hintergrund konnte der Holzalarm dann doch etwas Tiefgründiges bekommen: als eine Vorwegnahme der Zukunft, wenn man die am Ende des 18. Jahrhunderts erkennbaren Ansätze industriellen Wachstums fortlaufend ins Futurum fortschrieb, ohne eine neuartige Energiebasis mitzudenken. Dann hätten die Warnrufe eine durchaus drohende chronische Krise zu einer akuten Katastrophe hochstilisiert, um etwas zu bewegen. Volker Hauff, der Vertreter der Bundesrepublik in der Brundtland-Kommission der 1980er Jahre, die die Zauberformel »Nachhaltige Entwicklung« in die Welt setzte, meinte zu mir sogar, der »Holznot«-Alarm um 1800 sei ein historischer Augenblick der Hellsicht gewesen, worauf der Siegeszug der Kohle die Menschen wieder in einen »zweihundertjährigen Tiefschlaf« eingelullt habe.49 Ein Hinweis darauf, dass sich die Kosellecksche Zukunftswende um 1800 keineswegs linear bis in die Gegenwart fortsetzt, sondern von einem Zickzack abgelöst wird, der im Detail untersucht werden muss: Diese Einsicht hat mich bei der Arbeit an diesem Buch bestimmt.
In der Neufassung des »Holz«-Buches zog ich bei dem »Waldsterben«-Alarm der 1980er Jahre eine ähnliche Quintessenz wie bei dem »Holznot«-Alarm von 1789: Eine chronische Gefährdung des Waldes wurde zur akuten Katastrophe hochstilisiert.50 Apropos, entgegen Kosellecks makrohistorischer Schau: Schon seit der Antike, bereits »in einer so dynamischen Zeit wie dem 5. Jahrhundert vor Christus« (Christian Meier)51, ist die Geschichte der Zukunftserwartungen in heftiger Bewegung – Grund genug, auch dort ebenso wie für die neuesten Zukünfte nicht nur Makro-, sondern auch Mikrohistorie zu betreiben. Koselleck hat das Thema »Zukunft« nicht empirisch bis in die neueste Zeit verfolgt, sondern sich stattdessen im Zeichen der »Erinnerungskultur« der Denkmalforschung zugewandt.
6. »DIE ÄRA DER ÖKOLOGIE«: VERGANGENHEIT ODER ZUKUNFT? Als ich mich nach etlichem Zögern an eine globale Geschichte der Umweltbewegung heranwagte, hatte ich es fast noch mehr als einst bei der Atomwirtschaft mit einem zur Zukunft hin ganz und gar offenen Thema zu tun. Schon der Buchtitel Die Ära der Ökologie ließ sich mehrdeutig verstehen: Er konnte eine mehr oder weniger abgeschlossene Epoche bezeichnen, aber auch eine Zukunft, die gerade erst begonnen hat. Wie kann sich da ein Historiker mit Anstand aus der Affäre ziehen? Diesmal wollte ich die Zukunftsoffenheit schon in der Grundstruktur zum Ausdruck bringen, indem ich bei aller Erzählfreudigkeit doch auf ein master narrative verzichtete und stattdessen ein Nebeneinander verschiedener Dramen präsentierte, die fundamentalen Spannungen des environmentalism entspringen, wie sie von Amerika bis Ostasien zu beobachten sind.52 Eine Meistergeschichte suggeriert allzu leicht die Illusion, dass wir die Zukunft der Mensch-Umwelt-Beziehung kennen, oder gar die Einbildung, wir stünden bereits am Ende der Geschichte.
Ganz am Schluss habe ich dann doch, wenn auch mit Vorsicht, eine Prognose auf eine mögliche Zukunft gewagt: Der von Friedrich Nietzsche angezweifelte »Nutzen der Historie für das Leben« bestehe womöglich darin, dass man in der eigenen Gegenwart den »historischen Augenblick« entdeckt, »wo das Trägheitsmoment bestehender Strukturen durchbrochen wird«. Und dann habe ich mit etwas mulmigem Gefühl noch hinzugefügt: »Wer weiß, vielleicht erleben wir einen solchen Augenblick schon bald.«53 Zwei Wochen nach Auslieferung des Buches geschah die Reaktorkatastrophe von Fukushima mit nachfolgender deutscher Energiewende, und nun wurde dies Finale von manchen als prophetisch bezeichnet, zumal ich die Verdrängung des nuklearen Risikos in Japan angesprochen hatte.54 Aber ich werde mich auch weiterhin vor Katastrophen- und Wendeprognosen hüten.
»UND JETZT SIND WIR EBEN IN EINEM ZACK«: BETRACHTUNGEN ZU LETZTEN GEDANKEN VON JÜRGEN KUCZYNSKI, ZU UNTERSCHIEDLICHEN PROGNOSETYPEN UND ZUR DIALEKTIK DER ZUKUNFTSGESCHICHTE. Im turbulenten Wendejahr 1990 war ich als Referent zur Berliner Sommer-Universität geladen; ich sollte über Geschichte und Zukunft der Technik in der noch bestehenden DDR reden: welch eine delikate Aufgabe! In der damaligen Literatur, auch der westdeutschen, bekam die DDR in der Technologie oft erstaunlich gute Zensuren, schon wegen der hohen Zahl der dort ausgebildeten Ingenieure55; ein junger Fabrikarbeiter jedoch, dessen einzige Aufgabe darin bestand, einer uralten Maschine das Schmieröl abzuwischen, mit dem sie sich ständig beschlabberte, und mit dem ich 1985 durch das nächtliche Dresden bummelte, war mir gegenüber vor Frustration förmlich explodiert: Wir im Westen hätten ja keine Ahnung, wie hoffnungslos heruntergekommen die DDR-Industrie sei!
Aber natürlich wollte ich im Sommer 1990 nicht als Unglücksprophet auftreten, auch wenn ich schon damals nicht glaubte, dass die Einführung der D-Mark in der DDR die gleiche Schubwirkung haben würde wie 1948 die Währungsreform im Westen. Ich begnügte mich mit verhaltenen Tönen, erinnerte skeptisch an die Zuversicht der frühindustriellen Liberalen, freies Eigentum wirke wie ein »elektrischer Schlag« und verwandele Lethargie in emsiges Leben, und schloss mit dem Hinweis, die Elektrotherapie sei »mit Recht in Misskredit geraten; sie gibt kein gutes Leitbild für die deutsche Vereinigung.«56 Zur gleichen Zeit machte ich mir in einem Aufsatz zur bundesdeutschen Technikgeschichte der 1950er Jahre geradezu einen Spaß daraus, die Technomanen mit ihrem Innovationsfimmel zu foppen und so anschaulich wie möglich zu zeigen, dass sich das »Wirtschaftswunder« auf gar keine Zukunftstechnik, sondern durchweg auf verbesserte Anwendung konventioneller Technik oder kleine trickreiche Neuerungen stützte, die dem Lebensgenuss dienten: Wallnussknackmaschine zur Pralinenherstellung gegen östlichen Sputnik-Rummel.57 Da erschien mir die (vermeintlich) von der Raumfahrt faszinierte DDR-Führung wie ein Hans Guckindieluft. Aber galt das noch für die Ära Honecker? Durch Gespräche mit DDR-Technologen kamen mir Zweifel.
Jürgen Kuczynski, der grand old man der DDR-Historiographie, einst ein Vertrauter von Erich Honecker, ließ sich auf der Sommer-Universität von seiner Verunsicherung über den Zusammenbruch seiner Welt nichts anmerken. Als ihn ein verstörter Altkommunist, der die Welt nicht mehr verstand, fast flehentlich um eine Orientierungshilfe bat, hatte er kein Problem: Schon Genosse Engels habe ganz richtig erkannt, dass der Fortschritt in der Geschichte nicht geradlinig verlaufe, sondern im Zickzack. »Und jetzt sind wir eben in einem Zack.«
In der Tat musste Engels erleben, wie die Hoffnung auf Revolution in eine unbestimmte Zukunft entschwand; aber der »Zickzack« stammte nicht von Engels, sondern war original Kuczynski. Der brachte mit 92 Jahren als letztes Opus seines Lebens ein Büchlein Vom Zickzack der Geschichte (1996) heraus. Da bekennt er, noch in seinem Buch von 1984 60 Jahre Konjunkturforscher (sehr anders als die meisten Zukunftsbücher heute selbst antiquarisch zu keinem Preis mehr erhältlich) habe er bei aller Erinnerung an die vielen Fehlprognosen noch an die Möglichkeit solcher Voraussagen geglaubt. »Heute teile ich diese Ansicht nicht mehr.« Und zustimmend zitiert er das Gefrotzel des Londoner Economist: »Ein Wirtschaftswissenschaftler … ist ein Experte, der morgen wissen wird, warum die Dinge, die er gestern voraussagte, heute nicht eingetreten sind.«58
Die Konjunkturprognosen sind ein Reich für sich, zum Teil ein esoterisches; das werden wir noch sehen. Überhaupt gibt es Prognosen höchst unterschiedlicher Art und Qualität. Da gibt es die klassischen Utopien, von der Utopia des Thomas Morus bis zu Francis Bacons Neu-Atlantis: zwar am berühmtesten, für den Historiker jedoch am wenigsten relevant, da sie hoch über der Realität schweben. Da gibt es die Vorhersagen der professionellen Prognostiker, die typischerweise die Verbindung zu den Planern suchen, die ihre Prophezeiungen in eine self-fulfilling prophecy zu transformieren vermögen. Da gibt es den Zweckoptimismus, in der deutsch-deutschen Geschichte nach 1945 besonders ausgeprägt beim SED-Regime, und den Zweckpessimismus von Adenauers geflügeltem Wort »Die Lage war noch nie so ernst« bis zu den Alarmrufen von Wirtschaftsleuten in den 1990er Jahren über den gefährdeten »Standort Deutschland«. Da gibt es futuristische Wunsch- wie auch Angstträume –, und da gibt es die der Gegenseite spöttisch unterstellte German Angst, die seit langem zum Standardrepertoire der Sprücheklopfer in Abwehr der Bedenkenträger gehört; was davon zu halten ist, wird uns noch beschäftigen. Da gibt es die auf Knalleffekte kalkulierten Zukünfte futuristischer Bestseller, aber auch die mitunter ganz anderen Zukunftserwartungen breiter Bevölkerungsschichten; da fand ich bei den Allensbach-Meinungsforschern ungeahnte Schätze, die mir zum Gutteil durch Thomas Petersen erschlossen wurden, der mir schrieb: »Nach meiner Erfahrung ist kaum etwas lustiger als die Zukunftsszenarien der Vergangenheit.«59 Und last but not least die Zukunftsspekulationen der Unternehmer, die sie oft für sich behalten oder gar Optimismus mit Pessimismus kaschieren, um einen Konkurrenzvorteil zu erlangen oder die Politiker einzuschüchtern60, aber auch Zukunftsbeschwörungen der Politiker, mit denen nicht selten kurzfristige Kalküle kaschiert werden: »Zukunft« als Objekt eines Versteckspiels! Man sieht: Bei diesem Thema gibt es eine Menge zu entdecken, Anreize genug für detektivische Historiker; aber sobald man zu differenzieren beginnt, präsentiert sich diese Materie erst einmal abschreckend diffus.
So gesehen ist es kein Wunder, dass Vorstöße der Historiker hier immer wieder ins Stocken kamen. Auch der 92-jährige Kuczynski, der einst sein Leben zum zielstrebigen Vollzug einer höheren kommunistischen Prädestination stilisiert hatte61, schrieb sein Zickzack der Geschichte zu einer Zeit, als er damit rechnen konnte, dass ihm der Tod das Weiterforschen in diesem Zickzack ersparen würde. Unterhalb der altberühmten Zukunftsentwürfe präsentiert sich die Zukunftsgeschichte erst einmal als formloses Potpourri, und schon gar im 20. Jahrhundert zerfasert sie immer mehr; den Historiker überkommen Zweifel, ob sich aus alledem Geschichte, Struktur, Zusammenhang ergibt, abgesehen davon, dass er bei der Lektüre vieler einschlägiger Literaturprodukte einen Widerwillen überwinden muss.
Und doch, das soll dieses Buch zeigen: Es gibt da Strukturen, große Linien und enge Verflechtungen mit der realen Geschichte, und sei es dadurch, dass diese von Überrumpelungseffekten profitiert, die durch Fehlprognosen verursacht wurden. Und zugleich lohnt es sich, ins Detail zu gehen: Wunschvorstellungen erzeugen fast automatisch die Sorge, dass die Wünsche enttäuscht werden – auch dies eine Dialektik der Zukünfte.62 Strategien, die im Blick auf eine vorgestellte Zukunft monomanisch verfolgt werden, provozieren Gegenkräfte. Viele Prognosen sind charakteristische Zeitprodukte; keineswegs sind sie ganz willkürlich, sondern gerade wegen ihres luftigen Wesens sind sie umso mehr auf Vernetzungen und auf Rückversicherungen in der Realität angewiesen, ganz besonders dann, wenn sie zur Orientierung der Handelnden herhalten sollen.
Michael Wettengel, dem ich den unmittelbaren Anstoß zu diesem Buch verdanke, warnte mich gleichwohl vor einer breit angelegten Zukunftsgeschichte, die sich nicht auf die Erwartungen einer bestimmten Gruppe in einer bestimmten Situation wie die des Parlamentarischen Rates von 1948/49 beschränkt. »Es gibt der Zukünfte einfach zu viele, und sie sind widersprüchlich und schwer fassbar. Eigentlich ist das wie ein Urwald voller Gewächse, eine Art grüne Hölle der Zukünfte.«63 Und doch lohnt es sich, Schneisen durch diesen Dschungel zu schlagen: Da entdeckt man, dass er eben doch kein bloßes Durcheinander ist, sondern ein Ökosystem eigener Art. Gleichwohl tut es gut, sich davor zu hüten, in die Zukunftsgeschichte gar zu viel Ordnung hineinzulegen und – wie es im Gefolge Kosellecks manchmal geschah – für bestimmte Perioden regelrechte »Zeitregimes« anzusetzen. Stattdessen lohnt es sich, darauf zu achten, ob nicht gerade solche Prognosen, die zur fixen Idee geworden sind, Gegenentwürfe provozieren.
Ein Kapitel der Allgemeinen Theorie von John Maynard Keynes handelt vom »Zustand der langfristigen Erwartung«; dies ist ein Zustand von relativer Stabilität, da er sich auf Vertrauen gründet und dieses nur langsam wächst.64 Wie man in Keynes’ Sachregister sieht, ist die »Erwartung« für ihn ein zentrales Thema, als Antrieb von Investitionen, und zugleich ein zu entdeckendes, oftmals nicht offen zugegebenes Motiv.65 Da wird es spannend. Nicht selten sind Zukunftserwartungen überdies transnational und zeigen sogar Gemeinsamkeiten zwischen West und Ost. Und darin liegt der spezielle Reiz der Zukunftsgeschichte: Je mehr die Prognosen bis zur letzten Konsequenz betrieben werden, desto mehr entwickeln sie ihre Dynamik, ihre Dialektik; je mehr sie auf Provokation angelegt werden und/oder in der Praxis stolpern, desto mehr rufen sie Gegenreaktionen, konträre Zukünfte hervor. Dafür bietet die deutsche Geschichte nicht nur vor, sondern mindestens so sehr nach 1945 schlagende Beispiele; um diesen Zickzack herauszubringen, muss man die chronologische Aufeinanderfolge mit Längsschnitten kombinieren, die ein Motiv durch die Dekaden verfolgen.
DER UNGLÜCKSPROPHET IM ZICKZACK. Mitunter erfolgte ein Zack sogar prompt: Der publizistische Paukenschlag des 83-jährigen Philosophen Karl Jaspers Wohin treibt die Bundesrepublik? (1966), der die bundesdeutschen Politiker dafür anklagt, dass sie nach 1945 den »Grundakt der Umkehr nicht vollzogen« hätten66 – obwohl man gerade damals aus der aufgewühlten Bundestagsdebatte über die Verjährung der NS-Verbrechen, mit der Jaspers beginnt, das genaue Gegenteil herauslesen könnte –, provozierte die Gegenschrift des 1939 aus Deutschland emigrierten Politikwissenschaftlers Karl J. Newman Wer treibt die Bundesrepublik wohin? (1968), der dem Philosophen vorwirft, dass er mit seiner Forderung nach einer kollektiven Willensbildung großen Stils in der Pose des Demokratie-Predigers eine in Wahrheit totalitäre Botschaft verkünde.67 Auch der junge Erhard Eppler, das künftige Oberhaupt des grünen SPD-Flügels, bemerkte 1966 in einem Artikel »Wohin treibt Karl Jaspers?«, dass manche Stellen des Buches im Neuen Deutschland, andere dagegen »in der rechtsradikalen Presse abgedruckt werden können«.68 Da plädierte Jaspers sogar dafür, das maoistische China notfalls mit einem atomaren Präventivschlag zu bedrohen!69 Aber wider alles Erwarten wurde der greise Philosoph, eben noch ein unerbittlicher Kalter Krieger, für den 1965 der Bundespräsident Lübke der einzige Lichtblick in der Bonner Politik gewesen war70, mit dieser Schrift als Wegbereiter der Achtundsechziger wahrgenommen; Newman sah den erklärten Freud-Feind Jaspers71 in einer Reihe mit dem Freudianer Herbert Marcuse! Als der liberale Politologe Kurt Sontheimer 22 Jahre darauf Jaspers’ Streitschrift neu edierte, obwohl er sie »manchmal geradezu grotesk« fand, bemerkte er kopfschüttelnd, Jaspers habe »anscheinend in dem Bewusstsein« gelebt, »auf eine Katastrophe zuzugehen«.72
Jaspers, der 1933 keinerlei Hellsicht gezeigt und die Emigration damals zum Ausdruck von Dummheit erklärt hatte73, profilierte sich später in Beschwörung der verbrecherischen Vergangenheit als Unglücksprophet; der Emigrant Newman warf ihm vor, »die Gegenwart und Zukunft der Vergangenheit zu opfern«.74 Wenn ein kritischer Kopf in Deutschland nach 1945 Geschichte und Zukunft verknüpfte, lag es nahe, das Werdende argwöhnisch auf eine Wiederkehr von NS-Elementen hin zu beäugen; die Frage, ob dieser Umgang mit der Erinnerung die Voraussicht gefördert oder vom Zickzack der Zukünfte eher abgelenkt hat, wird sich in diesem Buch wiederholt stellen. Die bundesdeutsche Geschichte, die sich (bislang) aus der Rückschau gerade vielen Jüngeren im Kontrast zur NS-Zeit als eine wenn auch löbliche, so doch etwas langweilige Erfolgsstory präsentiert, wandelt sich in der Geschichte der Zukunftserwartungen über weite Strecken zu einer Balance an Abgründen.
»Expect the Unexpected!« steht auf Warnschildern an einer Straße, die in endlosen Haarnadelkurven aus der Gangesebene hoch nach Darjeeling führt; gerade aus historischer Erfahrung passt diese Warnung nicht nur an Himalaya-Straßen. Manchmal ist das Unerwartete ja auch erfreulich, ob »Wirtschaftswunder« oder Wiedervereinigung. Wenn ich an trüben Tagen auf meinen Spaziergängen ausschließlich Hundefrauen und Hundeherrchen begegne und immer wieder durch Gebell aus meinen Gedanken gerissen werde, verfolgt mich die Horrorvision, es könne immer so weitergehen, dass die Deutschen lieber Hunde als Kinder haben – zumal man den Hunden noch Kommandos zubrüllen kann –, bis aus der Bundesrepublik die Hunderepublik Deutschland geworden ist: meine Variante von Deutschland schafft sich ab! Aber dann sehe ich Scharen fröhlicher Kinder und denke an den Zickzack der Geschichte, wo Trends in Gegentrends umschlagen. Und bei alledem bekenne ich mich verschämt zu dem Wunschtraum einer großen segensreichen Konvergenz, wo sich per Effizienz und Recycling ökologischer und ökonomischer Fortschritt miteinander vereinen, das Ideal der Nachhaltigkeit sowohl die erneuerbaren Ressourcen wie die finanzielle Solidität fördert, der Umweltschutz als Basis von Gesundheit und Wohlbefinden die weltweite Verständigung vorantreibt und sich durch Frauenbildung und Besserstellung der Frauen das Problem der Übervölkerung von selbst erledigt. Denkbar ist das alles! Aber auch die Sorge, dass die Dinge der Welt sehr anders laufen, ist leider begründet, und es wäre blind, sie als bloße Angstmacherei ins Lächerliche zu ziehen. Die Zukunft entzieht sich dem systematischen Zugriff; nur durch ein immer neues unruhiges Hin- und Herschauen, durch scharfe Beobachtung der Vielfalt und Widersprüchlichkeit der Gegenwart kommt man ihr womöglich ein wenig näher.
1
»Forderung des Tages« – »Und der Zukunft zugewandt«: Der deutsch-deutsche Zukunftskontrast,die offenen und die verborgenen Zukünfte und der Überraschungseffekt des »Wirtschaftswunders«
DAS VORLÄUFIGE ENDE DES FORTSCHRITTSGLAUBENS. Sigfried Giedion, von 1928 bis 1938 in Zürich Generalsekretär des Congrès Internationaux d’Architecture Moderne und Autor mehrerer Klassiker zum Fortschritt in Technik und Architektur, schloss 1948 sein großes Werk Die Herrschaft der Mechanisierung mit dem Seufzer: »Heute, nach dem Zweiten Weltkrieg, gibt es wahrscheinlich kaum Menschen, wie entlegen sie auch leben mögen, die nicht ihren Glauben an den Fortschritt verloren haben. Der Fortschritt hat die Menschen in Schrecken versetzt, und er ist nicht mehr eine Hoffnung, sondern eine Bedrohung. Der Fortschrittsglaube gehört jetzt mit vielen anderen entwerteten Symbolen in die Rumpelkammer.«1 Bei dieser Fortschrittsfurcht handelt es sich also keineswegs um eine von Öko-Alarmisten geschürte German Angst der jüngsten Zeit, sondern um eine international verbreitete Seelenlage, die der noch frischen Kriegserfahrung entsprang.
Gewiss war sie bei den Deutschen, ob sie den Krieg an der Front oder daheim bei den Luftangriffen erlebt hatten, besonders schmerzhaft. Selbst bei einer Untersuchung unter robusten Hüttenarbeitern, die von moderner Technik lebten, wurde sie von Meinungsforschern 1953/54 registriert. »Denn der Krieg steckt uns noch in den Knochen, und jeder, der vom technischen Fortschritt spricht, denkt an den Krieg«, äußerte ein fünfzigjähriger Reparaturschlosser – so sehr ist die angeblich blinde Fortschrittsgläubigkeit der 1950er Jahre ein Mythos der fortschrittskritischen Öko-Ära! Und keineswegs nur Bildungsbürger zweifelten an den Segnungen dieser Art von Zukunft. Ein Schmelzer bemerkte zum Stichwort »technischer Fortschritt«: »Seit etwa 1870 ist die Technik großen Stils im Gang. Seitdem haben wir drei Kriege gehabt, von denen einer immer noch schlimmer ist als der vorherige …«2 Genereller Zweifel am technischen Fortschritt kann sich sehr wohl mit kompetenter Handhabung der konkreten Technik vertragen.
Einer der zu jener Zeit bekanntesten Rundumschläge über die bundesdeutsche Gesellschaft war Friedrich Sieburgs Buch Die Lust am Untergang (1954). Dieser einstige Pariser Korrespondent der Frankfurter Zeitung, der zuerst 1929 durch Gott in Frankreich berühmt wurde, steigt am Ende seines Buchs in eine Zeitmaschine und beschließt es mit einem Gespräch mit dem fortschrittsgläubigen Voltaire, dem er sich als Mensch des 20. Jahrhunderts vorstellt und der von ihm eine Preisrede auf die Herrlichkeiten der damaligen Zukunft erwartet. Sieburg jedoch: »›Herr Voltaire‹, sagte ich und flüsterte geheimnisvoll, ›wissen Sie, dass meine Zeit die Mittel hat, den ganzen Erdball in die Luft fliegen zu lassen? Was sagen Sie nun?‹ rief ich und lächelte ebenso blöde wie erwartungsvoll. ›Hinaus‹, schrie der kleine Mann und hob sich vor Wut auf die Zehenspitzen, ›hinaus! Ich werde dem Diener klingeln!‹«3 Der Witz ist nun allerdings, dass der Titel Die Lust am Untergang pure Effekthascherei ist; denn das gesamte Buch lang ärgert sich der Autor darüber, dass die Bundesdeutschen trotz grausiger Vergangenheit und noch abgründigerer Zukunftsperspektive ganz einfach vor sich hin leben und kräftig zulangen, wo sie es sich leisten können. Aber wie sollte man anderes von ihnen erwarten, nach solchen Erfahrungen?4
Noch im Oktober 1951 ergab eine westdeutsche Meinungsumfrage, dass ganze zwei Prozent der Befragten die Gegenwart als die Zeit erlebten, in der es den Deutschen am besten gegangen sei; zwei Jahrzehnte später werden es über 80 Prozent sein.5 Der Schock der Notzeit wirkte bis weit in das »Wirtschaftswunder« hinein. Nach einem üppigen Essen fällt es schwer, sich auch nur um ein, zwei Stunden zurück in den Zustand des Hungers zu versetzen; umso schwerer fällt es heutigen Deutschen, sich den Seelenzustand der Mehrheit der deutschen Bevölkerung 1945 und danach sinnenhaft vorzustellen. Denn da beherrschte der Hunger alles. So weit war es erst nach Kriegsende gekommen, als die Kriegsverluste nicht mehr durch Ausbeutung besetzter Gebiete zu kompensieren waren; »unter Hitler haben wir nicht gehungert« bekam man noch in den 1950er Jahren mit bedeutsamem Unterton zu hören. Erst vierzig Jahre danach, als der Hunger längst vergessen, das Kriegsende dagegen aus der Rückschau zum Beginn einer großen Erfolgsgeschichte geworden war, fand Bundespräsident Richard von Weizsäcker den Beifall neuer Generationen, als er den 8. Mai 1945 zum »Tag der Befreiung« erhob. Er selbst, 1920 geboren, hatte die Notzeit noch in Erinnerung und gab zugleich zu verstehen, dass die große Mehrheit der Deutschen den 8. Mai erst im Lauf der Zeit als einen solchen Tag zu empfinden vermochte; damals waren die Empfindungen (auch in der Familie Weizsäcker) tief gespalten gewesen: »Der eine kehrte heim, der andere wurde heimatlos. Dieser wurde befreit, für jenen begann die Gefangenschaft. … Verbittert standen Deutsche vor zerrissenen Illusionen, dankbar andere Deutsche für den geschenkten neuen Anfang.«6 Aber auch viele von denen, die das NS-Regime verabscheuten, hatten Schlimmes durchzumachen. Die meisten Deutschen waren in jener Zeit ganz auf die eigene Existenz, die eigene Not, das pure Überleben zurückgeworfen; man braucht nicht die Psychoanalyse zu bemühen und einen kollektiven Verdrängungsakt zu konstruieren, wenn man sich damals einfach nur nach jener Zeit zurücksehnte, in der man nicht zu hungern brauchte, und im übrigen über das vergangene Böse schwieg.
Selbst Carlo Schmid, der damalige Zukunftsmann der SPD, als Baudelaire-Übersetzer der Liebling französischer Literaten, wurde nach dem französischen Einmarsch in Tübingen vorübergehend verhaftet und zusammengeschlagen.7 Diese Erinnerung verfolgte ihn noch lange, obwohl er von seiner ganzen Art her ein Bonvivant und Frankreich-Freund war, der lieber auf Hoffnungsschimmer schaute und auch im zerstörten Deutschland notfalls im Geisterreich des George-Kreises seine Zuflucht fand.8 Dann, Anfang 1946, als De-facto-Regierungschef der französisch besetzten Zone Württembergs, publizierte er (noch als »Karl Schmidt«) Reden und Aufsätze unter dem Titel Die Forderung des Tages.
DIE VORAUSSCHAUENDE »FORDERUNG DES TAGES«. Das war ein Goethe-Zitat, das als geflügeltes Wort bereits seine Geschichte hatte. Es war ein Aufruf zur Tagespolitik, gegen das Abheben in Phantasiewelten. »Was aber ist deine Pflicht? Die Forderung des Tages«, heißt es in den Maximen und Reflexionen; und als Weimarer Minister hatte Goethe Alltagspflichten genug, zu deren Erledigung er sich einen Ruck geben musste. Unter dem Titel Die Forderung des Tages publizierte der zum engagierten Republikaner gewandelte Thomas Mann 1930 Reden und Aufsätze aus früheren Jahren. Schon 1910 hatte unter dem gleichen Titel Wilhelm Ostwald, Chemie-Nobelpreisträger von 1909, gesammelte Abhandlungen in einem 600 Seiten starken Band herausgebracht. Der »Forderung des Tages« nachzukommen bedeutete für ihn konkret, »den Beruf des Universitätsprofessors mit dem des praktischen Idealisten« zu vertauschen, der die Menschheit dazu anhielt, ihren Stolz nicht im verschwenderischen Umgang mit Energie zu suchen, sondern vielmehr darin, »mit möglichst geringem Aufwand roher Energie unsere Kulturbedürfnisse zu befriedigen«. In der Zukunft erkennt er gewaltige Fortschritte hin zur Nutzung der Solarenergie. »Forderung des Tages« war für ihn also weit entfernt von engstirnigem Pragmatismus.9 Aber unter die gleiche Goethe-Maxime stellte er im August 1914, obwohl nach wie vor im Prinzip »Internationalist und Pazifist«10, auch sein Bekenntnis zum Krieg11: die »Forderung des Tages« als vermeintlicher Zwang der Gegenwart, der die Zukunft erschlägt. Mit dem Aufruf »der ›Forderung des Tages‹ gerecht zu werden«, schloß Max Weber seine an Münchener Studenten gerichtete Rede »Wissenschaft als Beruf« im November 191712, zu Beginn des letzten Kriegswinters; doch was er mit dieser Forderung meinte, reicht über den Tag hinaus: Die ergebe sich dann von selbst, »wenn jeder den Dämon findet und ihm gehorcht, der seines Lebens Fäden hält«. Auch im Gestus der Abwehr von Wunschwelten, in der demonstrativen Umkehr zur Pflicht der Gegenwart verstecken sich Zukunftsideen!
Gilt das auch für den phantasievollen Carlo Schmid 1946? Unter dem Titel »Die Forderung des Tages« stand sein Neujahrsartikel; und dieser ist noch aus heutiger Sicht beispielhaft in dem Hin und Her seiner Reflexion über den Umgang mit Zukunft und Gegenwart. Da beklagt er, dass viele Landsleute ihr Gleichgewicht »in der Hingabe an die Starre der Hoffnungslosigkeit gefunden« hätten, »die – so paradox das klingen mag – heute ihr zuverlässigster Trost ist, denn sie glauben damit mutig ein Schicksal zu bejahen«. Auch dies ist eine Art, sich in der Gegenwart einzurichten; und genau dagegen zieht Schmid zu Felde: »Aber dies ist eitler Selbstbetrug und es gibt keine dringendere Aufgabe, als unser Volk aus diesem Dämmerschlaf zu einem mutigen Wachsein aufzurütteln …, in dem das Hier und Jetzt der Existenz nicht als auswegloser Abschluss eines Gestern erlebt wird, sondern als Tor, das in einen Morgen führt, den wir mit den Bildern unseres Hoffens und Wollens prägen können …« Aber dann gleich dieser Rückzieher:
»Doch da gilt es gleich zum Anbeginn vor einer Gefahr zu warnen, die so tödlich ist wie die Lethargie …, nämlich der Uferlosigkeit des Hoffens und dem Glauben an die Umkehrbarkeit der Zeit. Was wir auch tun mögen, wie sehr wir auch unsere Muskeln spannen werden – nie wieder werden wir zu Umständen kommen gleich denen, die die Älteren unter uns noch gekannt haben.«13
Selbst für einen Optimisten wie ihn war damals also ganz unvorstellbar, dass es kein Jahrzehnt später zumindest im Westen dem Gros der Deutschen besser gehen würde als je zuvor! Ein Programm für den Neuaufbau seines Landes und eine Vision für ein künftiges Deutschland entwickelte er nicht.14 Er wurde Mitglied der SPD und trug wie kein anderer dazu bei, dieser Partei ein neues kulturelles Flair zu verleihen; aber anders als Kurt Schumacher und viele alte Kämpen der Partei glaubte er an keinen Sozialismus in greifbarer Zukunft.15 Für einen von seiner Biographie her ganz nach Westen orientierten Württemberger klammerte er sich auffallend lange an die Fiktion eines weiterexistierenden Gesamtdeutschlands und drohte sich zeitweise durch seinen Widerstand gegen die Gründung des Weststaats sogar ins politische Abseits zu manövrieren.16 Noch im Parlamentarischen Rat insistierte er geradezu pedantisch darauf, das Grundgesetz lediglich als ein Provisorium und das westdeutsche Gebilde als ein unvollkommenes zu verstehen, was den ihm sonst wohlgesinnten Theodor Heuss dazu veranlasste, den korpulenten Kollegen mit Reimen anzupflaumen: »Der Carlo celebriert wie ein Gedicht/die hohen Worte seines Staatsfragments,/auf jedem Komma wuchtet sein Gewicht –/jetzt die Cäsur, dann fühlsam die Cadenz.«17 Und doch präsentierte Der Spiegel in einem Carlo-Schmid-Titel am 12. März 1949 den »elastischen Bullen aus Tübingen, der auf mehreren Klavieren mit einiger Bravour spielen oder sogar tanzen kann«, unter der Überschrift »Zum Herrschen geboren« (einer angeblichen Astrologen-Prophezeiung über ihn) wie den Führer des kommenden Weststaats, der zugleich die SPD zur Volkspartei macht18: ihn, der dann doch mit seiner staatsmännischen Begabung nie so recht zum Zuge kam.
Umso mehr kann man an Schmids Zögerlichkeit ermessen, was neue Generationen nach 1945 im Westen kaum mehr nachvollziehen konnten: wie schwer es zu jener Zeit war, die Zukunft eines geteilten Deutschlands zu denken – wie längst nicht nur bei eingefleischten Nationalisten das Gefühl vorherrschte: »Das kann doch nicht wahr sein!« Bei einem Politiker kam im Gedanken an die zahllosen Exnazis wohl auch die Sorge hinzu, durch Mitarbeit an dem neuen Staat als Kollaborateur und Verräter auf die Abschussliste nationalistischer Untergrundorganisationen zu geraten: »Politik mit dem Kopf unter dem Arm« zu betreiben. Erst aus der Rückschau wirkt diese Sorge grundlos. Die Situation war dieses Mal eben ganz anders als 1918: Wer die deutsche Einheit retten wollte, musste sich mit der sowjetischen Besatzungsmacht verständigen; und dazu waren Altnazis am allerwenigsten imstande. Nur durch Neutralisierung war die Einheit zu retten; wer jedoch auch nur die geringste Aussicht haben wollte, die Amerikaner zum Abzug aus Westdeutschland zu veranlassen, musste sich mit den amerikanischen Isolationisten und obendrein dortigen sowjetfreundlichen Linken zusammentun; und gerade deutsche Nationalisten waren die allerletzten, die zu solchen Koalitionen fähig waren.
Man kann annehmen, dass vor allem dieser unlösbare Widerspruch eine neue nationalistische Sammlung blockierte. Altnazis zerfielen in Neutralisten und Kalte Krieger, und noch viel mehr von ihnen übten sich geflissentlich in der neuen politischen Korrektheit. All jene Warner, die sich die Nazis nach dem Brecht-Vers »Der Schoß ist fruchtbar noch« wie eine homogene ewig gleiche regenerationsfähige Rasse vorstellten, waren im Grunde auf die Selbstinszenierung des NS-Regimes hereingefallen: Der »typische Nazi« existierte vorwiegend in der NS-Propaganda und in der Anti-Nazi-Karikatur, wogegen die NSDAP in Wahrheit ein situationsgebundenes Konglomerat heterogener Kräfte war, das in der neuen Lage nach 1945 wieder in seine Bestandteile zerfiel. Wenn man sich an die Begeisterung der Massen für Hitler erinnert, überrascht das schwach ausgeprägte Nationalgefühl in den Jahrzehnten nach 1945; die Sorge, dass nach dem Ende des Besatzungsregimes zahllose Krypto-Nazis die Maske abwerfen und das Rad der Geschichte zurückdrehen würden, erwies sich als grundlos.
Viele, die den 1967 von Alexander und Margarete Mitscherlich publizierten Essayband Die Unfähigkeit zu trauern nur dem Titel nach kannten, bildeten sich ein, hier werde der Mangel an Trauer über die Opfer des NS-Regimes angeklagt; in Wahrheit zielte der Titel auf den Mangel an Trauer um den einst geliebten »Führer«!19 Das Gros der Deutschen war zu jener Zeit einfach nur froh, das NS-Regime los zu sein. Für Joachim Fest, Jahrgang 1926, war »das nahezu spurenlose Verschwinden« der bis dahin allgegenwärtigen und alles beherrschenden NSDAP bei Kriegsende die große Überraschung seiner jungen Jahre.20