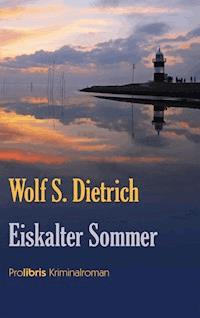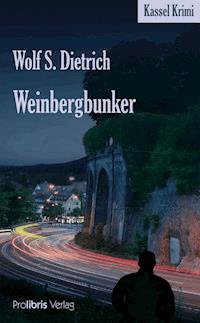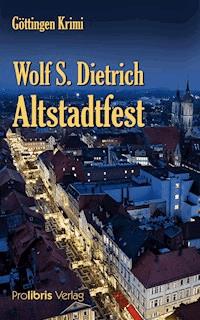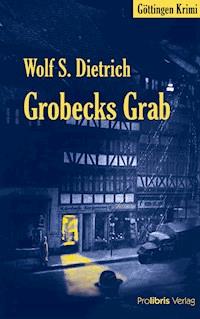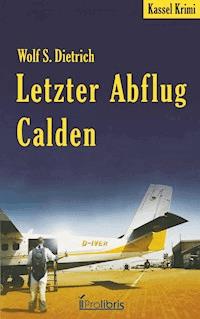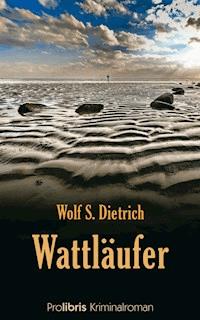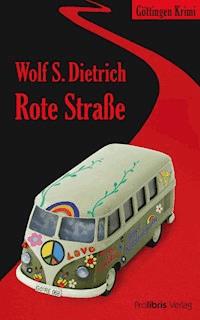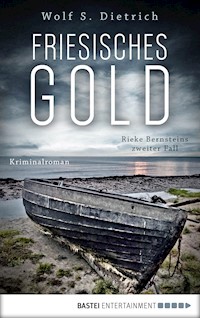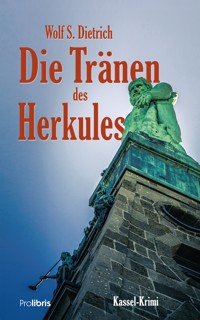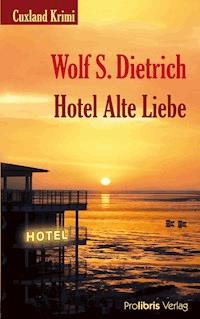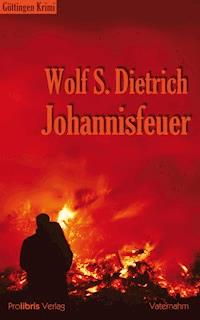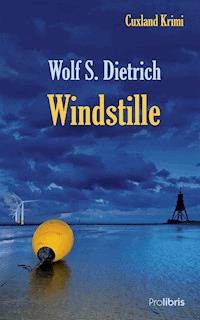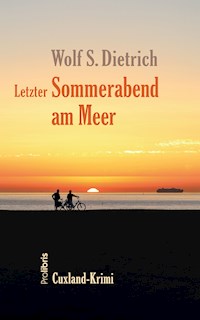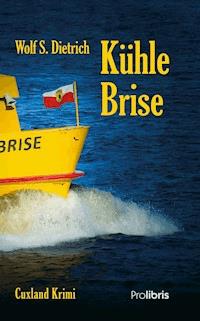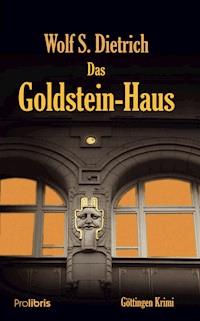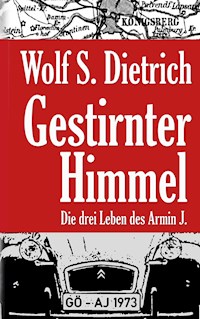
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Städtischen Krankenhaus Königsberg verzeichnet die Schwester mit zierlicher Schrift den Namen eines Neugeborenen in einem großen Buch: Jedosch, Armin. 19. Februar 1930. Vater und Mutter achten auf Wohlergehen und Anstand, die Großväter sind bewunderte Künstler ihres Handwerks. Doch der aufkommende Nationalsozialismus wirft erste Schatten. Der Krieg, der von Deutschland ausgeht, wendet sich gegen die Menschen, auch im eigenen Land. Armins Jugendzeit beginnt zwischen Luftschutzkeller und Löscheinsätzen, mit Leichenräumen und Ostwalleinsatz. Zaghafte Liebesträume ersticken im Brandgeruch des Kriegsalltags. Mordende, brandschatzende und vergewaltigende Horden ziehen durch die Trümmerwüste, machen auch vor Armins Familie nicht halt. Der junge Jedosch hungert, kämpft ums Überleben, flieht nach Litauen, kehrt ins zerstörte Königsberg zurück, verliert seine Angehörigen. Schließlich gerät er auf abenteuerlichem Weg nach Thüringen, später in den Westen. Hier bilden Politik und Wirtschaftswunder der fünfziger und sechziger Jahre die Kulisse für dramatische Entwicklungen. Liebeswirren und Familiengründung, Motorsport und Existenzkampf als Kraftfahrzeugmechaniker bestimmen das wechselvolle Leben des erwachsenen Armin Jedosch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer
neuer und zunehmender Bewunderung, je öfter
und anhaltender sich das Nachdenken damit
beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir und
das moralische Gesetz in mir.
Immanuel Kant
Inschrift auf der Gedenktafel am Dom zu Königsberg
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
ERSTER TEIL: ANFANG UND ENDE
1. KATZENAUGEN
2. SCHULTÜTEN
3. MANDELENTZÜNDUNG
4. WINTERSTIEFEL
5. KASTANIENERNTE
6. SONNENKÖNIG
7. KREUZOTTERN
8. BRANDNACHT
9. JUNGVOLK
10. RUSSEN
ZWEITER TEIL: FURCHT UND ELEND
11. FEUER UND FLAMME
12. WUNDERGLAUBE
13. OSTWALL
14. KÖNIGSBERG BRENNT
15. RÄUMKOMMANDO
16. STECKSCHUSS
17. EVAKUIERUNG
18. KAPITULATION
19. TRAUSEN
20. HEIMKEHR
21. LITAUEN
22. WESTWÄRTS
DRITTER TEIL: WOLLEN UND VOLLBRINGEN
23. HAMBURG
24. WIEDERSEHEN
25. LEHRJAHRE
26. INGRID
27. VERÄNDERUNGEN
28. GERTRUD
29. WECHSELBÄDER
30. ENTSCHEIDUNGEN
31. ULRIKE
32. WENDE
EPILOG
PROLOG
Das gleichmäßige Brummen der Triebwerke wirkt einschläfernd. Gertrud unterdrückt ein Gähnen, sieht auf die Uhr. Vor mehr als einer Stunde ist der russische Flieger in Hannover gestartet. Der Sitz beginnt unbequem zu werden. Alle Zeitschriften sind durchgeblättert. Ihr Mann ist in den Reiseführer vertieft. Sie sieht nach draußen. Unter ihnen kräuselt der Wind die Wellen zu weißen Schaumkronen. Bis zum Horizont erstreckt sich das bewegte Meer, kein Land zu erkennen. Sie beugt sich vor, um durch das gegenüberliegende Fenster zu sehen.
In diesem Augenblick neigt sich die Tupolew zur Seite, das Ende der Tragfläche scheint die Kämme der Wellen zu berühren. Unwillkürlich greift Gertrud nach Armins Hand.
Ihr Mann schlägt das Buch zu. »Der Landeanflug beginnt. Wir sind gleich da.«
Gertrud nickt wortlos. Viele Male hat sie den Vorgang erlebt. Auf Mallorca oder Teneriffa oder Gran Canaria. Und immer wieder in Hannover und Frankfurt. Aber diesmal ist es anders. Sie sitzen in einer russischen Maschine und werden in einer russischen Stadt landen. Und sie wird der Vergangenheit ihres Mannes begegnen.
Armin Jedosch spürt Unruhe aufsteigen, sein Herz klopft schneller. Als sie die Gangway hinabsteigen und die Betonpiste betreten, ergreift ihn ein unbekanntes Gefühl, eine Mischung aus gespannter Erwartung und Beklemmung, aus Neugier und Furcht. Vorerst drängen Anforderungen der Administration die Gefühle zurück. Gepäckausgabe, Pass- und Zollkontrolle, Begrüßung durch die Reiseleitung. Doch als der Bus mit den Besuchern aus dem Westen auf die Stadt zurollt, als das graue Band der Fahrbahn sich mit jedem Kilometer in die Cranzer Allee zurückverwandelt, als Pflastersteine der Straße fühlbar und Umrisse des Domes sichtbar werden, verflüchtigen sich fünfzig reale Jahre, kehren Bilder, Klänge und Gerüche aus der Kindheit zurück.
Die Wirklichkeit des Hotels, Menschen, Räume, Reiseleitung - alles verschwimmt zu einem Traum, während er seine Frau zur Kneiphofinsel führt - zu den Zeugen einer realen vergangenen Zeit.
Den gewaltigen Mauern des Domes haben Krieg und Witterung nichts anhaben können. Doch Jedoschs Taufkirche fehlt das Dach. Nun deckt der Himmel das Gotteshaus. Eigentlich ganz passend. Seine Augen suchen die Inschrift. Die Tafel hat einen neuen Platz gefunden, kyrillische Buchstaben sind hinzugefügt. Unbewusst bewegt er die Lippen. Die Worte des Philosophen kennt er auswendig, sie haben ihn ein Leben lang begleitet. Im Seitenschiff flackert eine Kerze. Sie treten näher, stoßen auf ein großes Kreuz mit einer kleinen Tafel: Den Opfern der Kinder. Plötzlich sind die Bombennächte wieder da. Jedosch hört das Heulen der Geschosse, sieht Leichen an den Straßenrändern, Männer-, Frauen-, Kinderkörper. Die Bilder treiben ihm Tränen in die Augen.
Vom Pregelufer führt er Gertrud zur Bastion Grolmann und zum Oberteich. Die Promenade ist verwildert und fast zugewachsen. Aber Jedosch kennt den Weg zu den Kaskaden, findet den Freigang an der Mauer der Städtischen Krankenanstalten. Dort zeigt er auf ein altes Tor, dessen Flügel windschief in den Angeln hängen. Wie oft ist er hier vorübergeeilt, um den Befehlsstand zu erreichen. Als sie vor dem verfallenen Eingang stehen, ist ihm, als höre er Alarmsirenen.
Rasch zieht er Gertrud weiter. »Komm, ich zeige dir den Hinterroßgarten.«
Zielstrebig steuert er auf einen Punkt. »Hier stand mein Elternhaus. Da drüben gab es eine Straße. Und dort« - er deutet über die Dächer - »stand die Altroßgärter Kirche.«
»Und wo«, fragt Gertrud, »ist der Bunker, von dem die Reiseleiterin gesprochen hat?«
»Den zeige ich dir morgen«, entscheidet Jedosch. Zu viele Bilder kreisen in seinem Kopf. Harry Lasch ist auch dabei. Harry flüstert. Von schweren Kämpfen, von aussichtslosen Kämpfen, von Kapitulations-gedanken. Harrys Vater war Kommandant der Festung Königsberg.
Suchend irrt sein Auge über den Paradeplatz. Dann erkennt er den Eingang. Die Straßenführung ist verändert worden, der ehemalige Befehlsbunker ist noch an seinem Platz, auch wenn er jetzt auf der anderen Seite der Straße liegt. Ein Schild verkündet Öffnungszeiten. Der freundliche Museumswärter führt die Besucher durch dämmerige Gewölbe. In der Stätte der Erinnerung werden Fotos und Dokumente, Generalstabskarten und Möbel konserviert und bewacht. Kühl ist es im Bunker, doch die Besucher frösteln wohl eher angesichts des verlassenen Schreibtisches mit Karte, Tintenfass und Federhalter. Erschaudernd spüren sie die Nähe der Geschichte. Hat hier der General die Kapitulationsurkunde unterzeichnet? Unzählige Fotos lassen die Ereignisse des Jahres 1945 wiederkehren: Kampfhandlungen am Kaiser-Wilhelm-Platz, getötete Soldaten in russischen und in deutschen Uniformen, Bombentrichter in den Vororten, Rauchsäulen über den Dächern, Panzer in der Innenstadt. Und immer wieder: brennende Häuser.
Jedosch schläft unruhig in dieser Nacht. Zwischen Halbschlaf und Traum ziehen Bilder vorüber: Das Dachgeschoß des Krankenhauses steht in Flammen, hastig bringt der Stoßtrupp die Tragkraftspritze in Stellung, Hitzewellen schlagen ihm entgegen. Vor dem lodernden Feuer erscheint das Gesicht des Großvaters. »Das Hitlerzeug muss weg.« Uniformteile fliegen in die Flammen.
Plötzlich steht ein Rotarmist im Zimmer, zielt mit der Maschinenpistole auf Armins Schläfe. »Frau, komm!«
Am Morgen ist er froh, dass sie für einen Tag die Stadt verlassen. Irina, die freundliche Reiseleiterin, hat einen Ausflug arrangiert. Durch das Samland rollt der Bus in Richtung Rauschen. Rechts und links der Straße hohes Gras, Lupinen, Distelblüten. Jedosch vermisst die wogenden Ähren. Die einstige Kornkammer des Deutschen Reiches ist Brachland. Auch die Schlachtfelder von Germau bedeckt wilde Vegetation. Im Dorf gibt es ein Denkmal. Und Friedhöfe. Auch für deutsche Soldaten.
Rauschen. Das alte Ostseebad zwischen Wald und Wasser heißt heute Swetlogorsk, hat seine Rolle tauschen dürfen mit Cranz, ist Badeort für die Betuchten, gepflegt und gut erhalten. Stalin habe den Grundstein gelegt, erfahren sie, als er der Roten Armee befahl, das Dorf zu schonen.
Morsch und brüchig wirken die Häuser von Cranz dagegen, neue scheint es nicht zu geben. Warmes Sonnenlicht mildert den Eindruck von Verfall, und das blaue Wasser zu beiden Seiten der Kurischen Nehrung lenkt den Blick von der maroden Stadt.
Später steht Armin Jedosch an der schmalen Stelle, wo Ostsee und Haff sich fast berühren. Mit den Augen wandert er über die Weite des Gewässers, zur Elchniederung, nach Gilge und Labiau. Und nach Nidden.
Nidden steht nicht auf dem Ausflugsprogramm. Doch er möchte den Ort wiedersehen, Gertrud die Wanderdüne zeigen und das dunkelbraune Holzhaus mit Giebeln in Niddener Blau, in dem Thomas Mann seinen Joseph-Roman schrieb. Jenes Haus auf dem Schwiegermutterberg, das Reichsjägermeister Göring sich nach der Flucht des Dichters als Jagdhütte angeeignet hatte. Jedosch will den Gasthof wiederfinden, in dem die Familie zur Sommerfrische weilte.
Ein Taxi bringt sie hin. Sie wandern durch den Ort, der heute zu Litauen gehört, bestaunen schmucke Häuser und saubere Straßen. Die Gräber auf dem Friedhof sind gepflegt, auch die mit deutschen Namen.
Sie erklimmen die riesige Wanderdüne, stemmen sich gegen den Wind und lassen sich von der Landschaft überwältigen. Das Mannsche Sommerhaus steht noch an seinem Platz, ist frisch renoviert. Drinnen, hören sie, tagen Wissenschaftler aus Litauen und Deutschland, um über seine Zukunft zu beraten.
Im Hafen dann traut Jedosch seinen Augen kaum. An der Kaimauer dümpelt ein Kurenkahn. Kann das sein? Mit einem solchen Boot war der sechzehnjährige Armin zum Fischen gefahren. Sollte der Kahn die fünfzig Jahre überdauert haben? Sogar der hölzerne Wimpel dreht wie eh und je am Mast.
Doch das Boot hat keine Fäulnis an den Planken, nicht einmal Seepocken am Rumpf. Ein Nachbau.
Die Rückkehr in die Stadt lässt den Kontrast ins Auge springen: Gegen die Harmonie der ostpreußischen Landschaft erscheint das Stadtbild zerrissen. Betonklötze und Plattenbauten rufen dem Besucher zu: Kaliningrad ist nicht Königsberg. Trotzdem bleiben Anhaltspunkte für Erinnerung. Ein kleiner Umweg würde sie zum Friedhof führen. Ob er die Grabstelle wiederfinden kann? Er gibt dem Fahrer ein Zeichen. Die neue Ringstraße bringt sie zur ehemaligen Labiauer Allee.
Der Taxifahrer zuckt mit den Schultern und dreht die Handflächen nach oben. Armin Jedosch ist sicher, dass hier irgendwo das Grab seiner Mutter sein muss. Doch statt des Löbnicher Friedhofs sieht er nur Wald. »Nix Friedhof«, wiederholt der Chauffeur bedauernd. Jedosch sieht sich um. Sollte ihm die Erinnerung einen Streich gespielt, sollte ihn sein Ortssinn verlassen haben? Kurz entschlossen öffnet er die Wagentür. »Warte, Gertrud! Ich sehe mich mal um.«
Der Verlauf der Straße scheint unverändert. Er schätzt die Entfernung, zählt die Schritte und dringt in das Dickicht ein. Weit kommt er nicht, Gestrüpp und tote Bäume verbinden sich zu einer undurchdringlichen Wildnis.
Sein Fuß stößt gegen einen Stein, lenkt den Blick nach unten. Kein Felsbrocken, ein Grabstein. Jedosch geht in die Hocke, befühlt bemoosten Granit, ertastet eine Inschrift. Eine Jahreszahl, ein Name: 1941, Wilhelm Heinrich Ober ..., Hier ruht in Frie ...
Weitere Buchstaben stecken im Erdreich. Seine Sinne haben nicht getrogen, hier war der Friedhof. Man hat das Gelände planiert und der Natur überlassen. Immerhin fahren keine Autos oder gar Panzer über die Gräber. Jedosch richtet sich auf, atmet heftig. Irgendwo liegen die Gebeine seiner Mutter und seiner Großmutter. In die Erregung drängen Bilder aus der Vergangenheit. Er sieht einen verzweifelten Jungen mit Hacke und Schaufel den widerspenstigen Boden bearbeiten.
Als sie in die Arnoldstraße einbiegen, spürt Jedosch jeden Herzschlag. Das Haus des Großvaters scheint unverändert. Nein, nicht ganz. Mit jedem Schritt des Näherkommens altert das Gemäuer. Sekundenschnell durcheilt die Hausfront ein halbes Jahrhundert. Doch das Gesicht bleibt unverkennbar. Die Eichentür - verwittert, gedunkelt, ein Loch anstelle des schmiedeeisernen Schlosses — hängt noch in ihren Angeln, Fensterkreuze zeigen noch dieselben Zimmer an.
Wer eintritt, findet links die Kellertür und rechts drei Stufen, die zur Wohnung führen. Die Haustür ist nur angelehnt. »Komm, Gertrud, lass uns einen Blick in den Flur werfen.«
Reste des Terrazzo-Fußbodens schimmern durch die Staubschicht, an den Wänden Spuren von Tapete. Eine Klingel neben der Wohnungstür. Zeit zu gehen, fremde Menschen mag Jedosch nicht stören, schon gar nicht am Sonntag, fürchtet wohl auch Misstrauen, Unverständnis, Zurückweisung.
Der Taxifahrer möchte klingeln. Wenn die Besucher aus dem Westen diesen weiten Weg gewagt haben, sollen sie auch sehen, was sie suchen. Er ignoriert Jedoschs abwehrende Gesten, drückt den Klingelknopf.
Die blonde Frau sieht von einem zum anderen, hört des Fahrers Erklärung, wendet sich und ruft in die Wohnung hinein. Ein Mann erscheint im Unterhemd, Tapetenkleister an den Händen, reißt die Augen auf, spricht Deutsch. »Habe ich gewartet zwanzig Jahre auf dieses Moment!«
Er zieht Gertrud und Armin Jedosch in die Wohnung. In Windeseile werden Tapeziertisch, Kleister und Tapetenrollen beiseite geräumt, Tische und Stühle herbeigeschafft, die Besucher zum Sitzen genötigt. Anatoli stellt sich vor. Er stammt von der Wolga, hat mit Deutschen gelebt, ihre Sprache gelernt, interessiert sich für die Geschichte dieser Stadt, in der er seit zwanzig Jahren als Lehrer arbeitet. Seine Frau heißt Ewgenija. Sie zaubert Kaffee, Tee und Kuchen auf den Tisch. Anatoli öffnet eine Wodkaflasche.
»Wir trinken auf Freundschaft«, ruft er ein ums andere Mal, füllt die Gläser nach, will alles wissen über das Schicksal der Familie Fenselau, die früher hier gewohnt hat. Ja, den Namen von Armins Großvater kennt er. Stolz präsentiert er eine vergilbte Seite aus dem Königsberger Adressbuch, zeigt auf den Eintrag: Fenselau, Fritz, Schneidermeister, Arnoldstraße 10, Parterre.
»Ja«, bestätigt Armin Jedosch, »das war mein Großvater.«
»Erzähl!«, fordert Anatoli, »erzähl von Großvater!«
Wir schreiben das Jahr 1930. Der Himmel steht im Sternbild des Wassermanns. Nein, wir glauben nicht an die Macht der Sterne. Wir registrieren, gewissermaßen nebenher, den Stand der Gestirne, weil sie in dem Leben, das in diesem Augenblick beginnt, eine Rolle spielen. Sie bestimmen nicht das Schicksal, aber sie haben ihren Platz in diesem beginnenden Leben. Es sind andere Kräfte und Elemente, die den Weg zwischen Geborenwerden und Sterben vorzeichnen, Wegweiser aufstellen, Steine auslegen und Wendungen verursachen, die über helle Wiesen oder durch dunkles Dickicht führen, lebensbedrohliche Spalten aufreißen oder unvermutet Brücken schlagen.
Den winterlichen Nachthimmel beherrscht der rote Planet. Mars leuchtet rötlich im Osten am Abendhimmel, wandert nächtens erst nach Süden, dann nach Westen, entfernt sich nach und nach vom Regulus im Löwen und bewegt sich auf das Sternbild des Krebses zu, gewinnt an Kraft und Helligkeit. Sirius im Großen Hund, Prokyon im Kleinen Hund, Pollux in den Zwillingen, bilden mit Kapella, Aldebaran und Rigal das Wintersechseck. Wenn Mars im Westen verblasst, kämpft Venus noch als strahlender Morgenstern im Südosten gegen die Morgenröte. Tag für Tag verliert sie diesen Wettstreit früher. Die Sonne bewegt sich im aufsteigenden Teil ihres Jahreslaufes, klettert höher, erreicht das Sternbild Wassermann.
Es ist keine gute Zeit und kein guter Ort für ein beginnendes Leben, denn wir befinden uns in Deutschland. Die Stadt ist zu groß, um dem späteren Inferno zu entgehen, sie liegt zu weit im Osten, um glimpflich davonzukommen. Noch streift das Sonnenlicht am Tag durch freundliehe Straßen, ruht das Mondlicht in der Nacht auf friedlichen Häusern. Kein Schwarm von Kampfflugzeugen verdunkelt den Tag, kein Teppich aus Granaten zerreißt die Stille der Nacht.
Liebe achtet nicht auf Jahr und Ort, fragt nicht nach guten oder schlechten Zeiten. Das Auge sieht den Himmel offen, sagt der Dichter, es schwelgt das Herz in Seligkeit. Wer wollte da eine Zukunft denken, die doch undenkbar ist? Kinder werden gezeugt und geboren, auch in dieser Stadt, in dieser Stunde. Im Städtischen Krankenhaus verzeichnet die Schwester mit zierlicher, verschnörkelter Schrift den Namen eines Neugeborenen in einem großen Buch: Jedosch, Armin. 19. Februar 1930.
Die Luft ist kalt und klar in diesen Wintertagen. Die Menschen atmen die Frische, recken sich dem Licht entgegen, das den Tag wieder früher weckt. Sie fühlen das nahende Ende des Winters, dessen Schönheit und Stärke den Zenit erreicht, wenn die Zeit seines Hinscheidens gekommen ist.
Noch lauert der Fluss im Untergrund. Seine Arme, die er inmitten der Stadt ausgebreitet und wieder geschlossen hat, sind zu Eis erstarrt. Die Insel mit dem Dom, die er umarmt, der er in anderen Jahreszeiten für den flüchtigen Betrachter des fließenden Wassers Bewegung zu verleihen scheint, ist fest mit der Stadt verbunden. Kirche und Insel und Stadt sind eins, die Konturen durch Schneepolster geglättet.
Mächtige Mauern schirmen die Taufgesellschaft von der Außenwelt ab. Es ist, als gebe es nur dieses Kirchenschiff, die kleine Gemeinde von Gläubigen und Ungläubigen, die der Zeremonie beiwohnt, und das Kind, das die Mutter über das Taufbecken hält, während der Pfarrer seine Formel spricht.
Vielleicht wandern die Gedanken des einen oder anderen Familienmitgliedes hinaus in die Wirklichkeit. Onkel Paul, der Kommunist, mag daran denken, dass die Partei eines gewissen Adolf Hitler beängstigenden Zulauf hat. Er weiß um die viereinhalb Millionen Arbeitslosen in Deutschland und fürchtet für die Reichstagswahl im September eine Verschiebung der Machtverhältnisse zugunsten des Rattenfängers.
Er ahnt nicht, könnte sich auch nicht vorstellen, was ihn, die Familie und das Kind erwartet. Auch der junge Vater weiß darüber nichts. Er sieht voller Hoffnung in die Zukunft. Die Geburt eines Sohnes mag ihm passend erscheinen für den Anbruch einer neuen Zeit, die er von der Bewegung erwartet.
Vielleicht haben auch andere ihren Köpfen nicht verbieten können, Bilder und Gedanken, Hoffnungen und Ängste mit in die Kirche zu nehmen. Doch nun hält der Anblick der Taufzeremonie den Gedankenfluss an. Die junge Mutter strahlt Schönheit und Glück aus, der Täufling rührt die Herzen, die Szene zaubert Lächeln in die Gesichter.
Die Mutter ist erfüllt von der Freude über den gesunden Jungen. Die Schmerzen der Geburt hat sie vergessen. Sie streicht die Wassertropfen aus dem Haarflaum des Säuglings und drückt ihn vorsichtig an sich. Sie verschwendet keinen Gedanken an die Politik, denkt jetzt nicht an die arbeitslosen Massen, an die Kämpfe zwischen Kommunisten, Sozialdemokraten und Nationalsozialisten. Allenfalls sorgt sie sich um das Taufmahl, fragt sich, ob der Vater den Wein bereitgestellt und die Mutter die Gedecke vollzählig aufgelegt hat.
Im Geist des Herrn soll sie ihr Kind erziehen, spricht der Pfarrer. Das sagt ihr nichts. Aber zu einem anständigen Menschen will sie ihren Sohn heranbilden. Dazu ist sie fest entschlossen. Das moralische Gesetz will sie in ihm verankern. So wie es auf der Schrifttafel des Philosophen zu lesen ist, dessen Gebeine in diesem Dom ruhen.
Nicht weit vom Ort der Geburt — gegenüber dem Städtischen Krankenhaus, im zweiten Stock des Hauses Hinterroßgarten Nummer siebzehn — wächst das Kind heran, unberührt von den Ereignissen in der Stadt oder im Land. Vater und Mutter achten gleichermaßen auf Wohlergehen und Anstand, die Großväter sind bewunderte Künstler ihres Handwerks. Der Schneidermeister in der Arnoldstraße gebietet über Schneiderinnen und Näherinnen und über riesige Scheren und sorgt für elegante Kleidung. Der Schuhmachermeister beherrscht in der Grolmannstraße ein Reich aus Leder, Leim und großen Nähmaschinen. Die ersten Ausflüge der Kindheit haben diese Welten zum Ziel, wo die Großmütter im Winter warme Fettkreppel oder - in hohen Kachelöfen - Bratäpfel für den Enkel bereithalten. Die Mutter umsorgt liebevoll ihren Sohn und lächelt froh, wenn das Kind im Schlaf ihr Ohrläppchen festhält. Glücklicher kann eine Kindheit kaum sein.
Während der Junge größer wird und lernt und sich die Welt erobert, ereignet sich Geschichte. Die Stadt, das Land, die Welt verändern sich. Bis das Bild der Gestirne zum sechsten Male wiederkehrt, entsteht ein neuer Bahnhof, wird eine neue Handelshochschule gebaut, landet Adolf Hitler bei seinem Deutschlandrundflug auf dem Flughafen. Der Bürgermeister wird gestürzt, jüdische Geschäfte werden zerstört und »arisiert«, der Hansaplatz wird Adolf-Hitler-Platz.
In der Hauptstadt wird Hitler zum Reichskanzler ernannt, der Reichstag aufgelöst, die Presse gleichgeschaltet. Gewerkschaften werden abgeschafft, Parteien verboten.
Deutschland verbrennt die Bücher seiner Dichter und Denker, die Fuldaer Bischofskonferenz mahnt die katholischen Christen zur Treue gegenüber der Obrigkeit. Das Land unterwirft sich dem Nationalsozialismus.
ERSTER TEIL
ANFANG UND ENDE
1
KATZENAUGEN
Die Strümpfe werden angezogen.« Der strenge Ton der Mutter ließ keinen Widerstand zu. Armin zog einen Flunsch und presste die Lippen zusammen. Wie er diese weißen Kniestrümpfe mit den fransigen Bommeln hasste! Sie gehörten zum Sonntagsanzug, und den mochte er nicht. Er durfte darin nicht toben, musste darauf achten, dass er sich nicht schmutzig machte. Und obendrein sollte er die blöde Ballonmütze tragen, unter der die Kopfhaut schwitzte und juckte.
In diesem Augenblick war Armin wütend. Seine Mutter war ihm der liebste Mensch auf der Welt. Und sie war schön, die schönste Frau, die er kannte. Wenn sie sich weniger elegant gekleidet hätte oder in der Kittelschürze vor die Tür gegangen wäre — Armin wäre entsetzt gewesen. Aber dass sie ihn zwang, diese unpraktischen Sachen anzuziehen, fand er gemein.
Er würde aufpassen müssen, dass auf dem Anzug keine verräterischen Spuren entstanden, wenn er auf Opas Hinterhof die Katzen aufscheuchte. Wenn die Erwachsenen am Tisch laut durcheinanderredeten, achteten sie nicht auf ihn. Dann würde er sich heimlich hinausschleichen. Er tastete nach dem Stein, den er sich für die Katzen aufgehoben und in der Hosentasche versteckt hatte. Das Bild der aufspringenden Meute gefiel ihm, sein Gesicht entspannte sich, er ließ sich die Auswahl der Kleidung gefallen, ohne weiter zu murren.
Der Himmel war klar, die Strahlen der Frühlingssonne wärmten schon ein wenig, die Luft roch frisch. Die Familie machte sich auf den kurzen Weg zu den Großeltern. Die Straße war belebt, als sie aus der Haustür traten. Mit großen Augen verfolgte Armin einen chromblitzenden Horch, der röhrend und raumheischend Straßenbahn und Pferdefuhrwerke überholte.
Die lange Straße, die hier Hinterroßgarten hieß, weil sie zum Roßgartenviertel gehörte, führte aus der Innenstadt nach Norden. Die alte Landstraße verband seit Menschengedenken die Stadt mit dem Samland. Am Roßgärter Tor schließlich änderte sie ihren Namen in Cranzer Allee. Die eleganten Herrschaften in der Limousine waren wohl auf dem Weg ins Seebad Cranz, um die Frühlingsluft auf der Terrasse des Café Königsberg zu genießen. Sehnsüchtig sah der Junge dem Auto nach. Er wusste, dass in dieser Richtung die Pferde-Rennbahn lag. Onkel Paul hatte ihn einmal dorthin mitgenommen. Der Geruch der Tiere und das Donnern der Hufe hatten ihn gefesselt.
»Wenn ich groß bin«, verkündete er, »fahre ich in einem Automobil zur Rennbahn.«
Die Mutter lächelte. »Ja, mein Junge, das wirst du bestimmt tun.« Sie beugte sich herab und fragte: »Nimmst du deine Mutter auch mal mit?«
»Na, klar!«, antwortete er. »Ich heirate dich, und dann nehme ich dich mit.«
Das anschwellende Heulen eines Sanitätsfahrzeuges erforderte Armins Aufmerksamkeit, ließ den Dialog abbrechen. Mit atemberaubender Geschwindigkeit näherte sich ein weißer Kastenwagen mit roten Kreuzen auf Türen und Fenstern und verschwand in einem der Tore des Städtischen Krankenhauses. Als der Sirenenton erstarb, sah Armin sich in einer schicken Uniform am Steuer eines solchen Automobils, dem alle anderen Platz machen mussten. Eigentlich wollte er seit dem Besuch auf dem Rennplatz Jockey werden, jetzt war er wieder unsicher. Die Großväter sprachen immer davon, dass er ein Handwerk erlernen sollte. »Handwerk hat goldenen Boden.« Aber was der Fußboden aus goldglänzendem Bernstein, den er sich vorstellte, mit einem Beruf zu tun haben sollte, war ihm verborgen geblieben.
Die Mutter zog an seinem Arm. »Komm, Bubi, jetzt wollen wir aber gehen, die kleine Oma wartet bestimmt schon auf uns.«
Er setzte seine Füße in Bewegung. Der Gedanke an warme Waffeln und Kakao verdrängte die schwierige Frage nach dem richtigen Beruf. Hüpfend, dabei die Fugen der Pflasterung meidend, eilte er der Mutter voraus.
Sie folgten der Straße bis zum Rößgärter Tor und wandten sich nach rechts. Nur wenige Schritte in die Grolmannstraße hinein führten sie zum Haus der Großeltern. Der kleine Opa empfing sie an der Haustür.
»Da seid ihr ja«, dröhnte er mit tiefer Stimme und öffnete die Arme. Der Enkel sprang an ihm hoch und drückte seine Nase in den prächtigen Kaiser-Wilhelm-Bart. Der kleine Opa war gar nicht klein. Armin nannte ihn den kleinen Opa, weil er zur kleinen Oma gehörte. Die war nämlich wirklich klein. Und damit unterschied sie sich von der großen Oma in der Arnoldstraße.
Opas Bart roch eigentümlich nach einer Mischung aus Tabak, Rasierschaum und Walnüssen. Armin liebte diesen Geruch. Aus hundert verschiedenen Düften hätte er den Bart des kleinen Opas erkannt.
Er landete wieder auf dem Boden und huschte in die Küche, von wo das Klirren von Glas und Porzellan verriet, dass Oma das Geschirr für den Sonntagnachmittagskaffee bereitstellte. Die Gasflamme zischte unter dem Waffeleisen, und es duftete verführerisch nach Teig.
»Da ist ja unser Bubi«, rief die kleine Oma und nahm das Bonbonglas vom obersten Regal. Dann drückte sie den Enkel an die Brust, und als sie ihn freigab, durfte er wie immer eines der bunten Bonbons auswählen und aus dem Glas hangeln. Opa erschien gerade rechtzeitig, um ihn daran zu hindern, auf den Hinterhof zu entwischen. »Halt, mein Freund! Es ist an der Zeit, den Wachstumsfortschritt zu kontrollieren. Ich glaube, du bist wieder ein Stück gewachsen. Und weil du jetzt bald zur Schule kommst, wollen wir festhalten, bei welchem Zentimeterstand dieses große Ereignis stattfindet. Nimm schon mal Aufstellung!«
Armin stellte sich an den Türrahmen. Selbstverständlich war er gewachsen, dass würden sie schon sehen. Er streckte sich, damit seine Größe auch richtig registriert werden konnte. Opa kramte einen Kopierstift aus einer Schublade und nahm ein Frühstücksbrett aus dem Ständer.
»Stillgestanden!«, kommandierte er und drückte Armin das Brett auf die Haare. Er leckte kurz an der Spitze des Stiftes und ergänzte die Leiter der kleinen Striche am Türpfosten um eine neue Markierung. »Abtreten!«, brummte er und betrachtete zufrieden das Ergebnis. Dann legte er Stift und Brettchen zurück, zog einen Zollstock aus der Schublade und drückte ihn Armin in die Hand. »Wer einen Zollstock öffnen kann, darf auch zur Schule gehen.«
Wie oft hatte Armin bewundernd zugesehen, wenn der Großvater aus dem kurzen dicken Päckchen Holzstreifen mit wenigen geschickten Bewegungen einen langen, geraden Maßstab zauberte. Einmal hatte er heimlich versucht, es ihm nachzutun, doch das störrische Ding hatte sich nur wie eine Ziehharmonika ein kleines Stück auseinanderziehen lassen. Dann war es wieder zusammengeschnurrt und hatte ihm auf die Finger geschlagen. Aber jetzt war er alt genug, um zur Schule zu gehen. Also würde er auch den Zollstock öffnen können. Vorsichtig zog er an den Enden, die schon ein wenig hervorstanden, und zu seiner eigenen Überraschung entfaltete sich das Ding ohne Widerstand. Es war nicht so gerade wie beim Opa, aber die Erwachsenen klatschten Beifall, und Opa verkündete ein Lob: »Bravo, mein Junge, du hast die Probe bestanden.« Stolz reichte Armin den Maßstab zurück. Opa zog ihn gerade und hielt ihn an den Türpfosten. »Einhundertelf Zentimeter. Groß genug für die Schule bist du. Der Ernst des Lebens kann beginnen. Aber mach uns keine Schande, Bubi! Ich möchte nicht hören müssen, dass du deiner Lehrerin die Kreide oder das Tintenfass versteckst.« Die Vorstellung schien ihn zu erheitern, er schmunzelte in sich hinein.
»Nun bring du den Jungen nicht auf dumme Gedanken!«, schimpfte die kleine Oma und schob ihren Mann aus der Küche. »Ihr könnt jetzt verschwinden. Ich habe noch zu tun. Armin kann mir helfen, wenn er möchte.«
Armin hatte längst die Schüssel mit dem Waffelteig entdeckt und nickte nachdrücklich. »Ja, ich helfe Oma beim Waffelbacken.« Er schob einen Stuhl näher an den Tisch, um auf die Sitzfläche zu klettern. Vielleicht konnte er an die Schüssel kommen. Wenn er schnell war, sah Oma nicht, dass er mit dem Finger durch den Teig fuhr. Omas Waffeln waren das Leckerste, was er sich vorstellen konnte, aber der Teig aus der Rührschüssel reizte ihn fast noch mehr.
Dass Opa seine Schwäche für das Verstecken von Gegenständen erwähnt hatte, war ein wenig unangenehm. Er war schließlich wirklich schon groß, es würde ihm nicht noch einmal passieren, dass er etwas versteckte und nachher selbst nicht wiederfand. Als er Omas Portemonnaie in der leeren Milchkanne versenkt hatte, war die Familie in helle Aufregung geraten. Seltsamerweise hatte er das Versteck vergessen, sodass die Unruhe einige Stunden angehalten hatte.
Zum Glück ging niemand darauf ein, die Familie versammelte sich im Wohnzimmer. Füreinen Augenblick war er allein und konnte rasch den Finger in die Teigschüssel tunken. Als er die Beute ableckte, kamen ihm die Katzen in den Sinn. Rasch ließ er sich vom Stuhl gleiten und schlich unauffällig durch den Flur zum Hinterausgang.
Vor den Mauern zu den Nachbarhäusern duckten sich wellblechgedeckte Schuppen voller Geheimnisse. Durch Astlöcher und Türritzen boten sich Anblicke seltsamer Figuren. Gartengeräte und Gerümpel, Holzstöße und Werkzeuge erzeugten wunderliche Schattengestalten, die - in Stille verharrend, gelegentlich aber ächzend oder stöhnend, quietschend oder knarrend, mal drohend, mal lockend - bizarre Arme nach Armin ausstreckten. Manchmal waren sie verschwunden, dann sah er nur Feuerholz und Schubkarren, Sensen und Hacken, Äxte und Sägen.
Vom Frühjahr bis zum Herbst beherrschten Katzen den Hinterhof. Auf den Schuppendächern aalten sie sich in der Sonne, streckten sich und maunzten, putzten sich und gähnten, rollten sich zusammen und blinzelten verschlafen in den Tag.
Einmal hatten statt der Katzen unheimliche Wesen mit glühenden Augen auf den Schuppendächern getanzt. Es war ein warmer Herbsttag, die Eltern hatten Armin erlaubt, bei den Großeltern zu schlafen, weil sie sehr früh am Morgen zu einer Reise aufbrechen wollten. Kurz vor dem Schlafengehen hatte er seinen Kuschelteddy vermisst und auf dem Hinterhof nach ihm suchen wollen. Als er die Tür öffnete, erstarrte er. Vom Schuppendach funkelten ihn glühende Geisteraugen an. Erst waren es zwei, dann vier, plötzlich unzählige Augenpaare, die - regungslos verharrend, dann blitzschnell verschwindend und an anderer Stelle auftauchend — ihn aus der Dunkelheit in ihren Bann schlugen. Der Ruf der Großmutter hatte den Zauber gebrochen, doch das Bild der tanzenden Geisteraugen war für immer eingebrannt.
2
SCHULTÜTEN
An diesem Morgen war Armin früh wach. Die Sonne schickte goldgelbe Strahlen durch die Spalten zwischen den Vorhängen und ließ silberne Staubkörnchen darin tanzen. Fasziniert folgten seine Augen den gleißenden Schienen, die aus der Gardine kamen und auf den Dielen vor der Zimmertür endeten. Er war versucht, danach zu greifen, sie luden ihn ein, sich hinaufzuschwingen und die Schräge hinabzurutschen. Doch als er sich aufrichtete und die Bettdecke von sich warf, war dieses Kribbeln im Bauch wieder da. Plötzlich wusste er, was ihn geweckt hatte. Heute war der große Tag. Er würde in die Schule gehen und Lesen und Rechnen und Schreiben lernen. Er sprang aus dem Bett. Der Schulranzen wartete an seinem Platz. Armins Vater hatte einen großen Haken an den Tisch geschraubt. Gemeinsam hatten sie den Ranzen zur Probe dort aufgehängt. Vater hatte ihm vorgeführt, wie er ihn so hängen konnte, dass er sich bequem öffnen ließ. Dann hatten sie die Schiefertafel und den hölzernen Griffelkasten hineingetan und den kleinen Schwamm mit einem Lederband befestigt. Vater hatte ihm auch ein Schreibheft gegeben. Und weil er noch keine Schulbücher besaß, hatte der Vater aus dem Bücherschrank im Wohnzimmer ein Buch mit gedruckter Schrift geholt. Das hatte er mit in den Ranzen packen dürfen. So war er wie ein richtiger Schuljunge ausgerüstet. Seine Bilderbücher konnte er nicht mitnehmen, dafür war er jetzt zu groß.
Armin setzte sich auf den kleinen Stuhl vor den Arbeitstisch und packte die Schultasche aus. Der Ranzen roch wunderbar nach Leder. Bevor er ihn wieder an seinen Platz hängte, steckte er den Kopf hinein und sog den Duft in die Nase.
Nachdem er alle Utensilien vor sich ausgebreitet hatte, zog er den Griffelkasten zu sich heran. Er befühlte die polierte Oberfläche, dann schob er den Deckel zur Seite. Leicht ließ er sich in den Führungen hin- und herbewegen, es war ein Vergnügen, den präzisen Lauf zu beobachten.
Er legte den Deckel zur Seite und leerte den Inhalt des Griffelkastens aus. Der Anblick seines neuen Besitzes erfüllte ihn mit Freude und Stolz. Im Kaufhaus Kiewe hatte es viele Sorten Griffel gegeben. Die beiden schönsten hatte er sich aussuchen dürfen, außerdem einen weichen und einen harten Bleistift, einen glänzenden metallenen Bleistiftspitzer und einen langen, schlanken Federhalter mit zwei Federn. Schließlich hatte er sogar ein Tintenfass bekommen. Der Vater hatte es zwar in den Wohnzimmerschrank eingeschlossen, aber eines Tages würde er es benutzen dürfen. Dann würde er - wie sein Vater in der Bank und wie seine Großväter, wenn sie Rechnungen schrieben - die Feder eintauchen, ein wenig über ein Löschblatt streichen und dann mit elegantem Schwung die Buchstaben und Zahlen auf das Papier zaubern.
Die unberührte schwarze Fläche der Schiefertafel rief nach Beschriftung. Ob er es einfach schon mal probieren sollte? Vorsichtig nahm er einen der Griffel und tippte mit der Spitze auf die Tafel. Ein winziger Punkt erschien an der Stelle. Er drückte kräftiger und vollführte eine schwungvolle Bewegung, wie er sie oft beobachtet hatte. Doch die Tafel antwortete mit einem hässlich schrillen Geräusch, der Griffel knackte, und die jungfräuliche Fläche war mit einem unschönen Krakel verunziert. Erschrocken wischte Armin mit dem Zeigefinger darüber. Doch das Ergebnis war enttäuschend, aus dem Strich wurde ein breiter, schmieriger Streifen. Außerdem war die Spitze des Griffels abgebrochen, ein gezackter Stumpf sah ihm entgegen, und ein weißer Krümel rollte über die Tafel. Er fühlte Panik in sich aufsteigen. Was er hier tat, erschien ihm als streng Verbotenes, und die Spuren waren unübersehbar.
Armin lauschte auf Geräusche in der Wohnung. Nichts rührte sich. Er betrachtete das Ergebnis seines verunglückten Versuchs. Der Schwamm fiel ihm ein. Er angelte ihn aus dem Ranzen und wischte vorsichtig über den hellen Streifen. Die Wirkung war verblüffend. Es war kaum noch etwas zu sehen. Rasch rieb er das Schwämmchen auf der Tafel hin und her, sie nahm tatsächlich wieder die blauschwarze Farbe an. Armin war erleichtert. Er ließ die Griffelspitze unter dem Bett verschwinden und packte die Stifte wieder ein. Nichts deutete mehr auf sein Tun. Erleichtert kletterte er ins Bett zurück. Wenn Mutti kommen würde, wäre er gerade erst aufgewacht.
»Na, unser Schuljunge ist ja schon wach«. Die Mutter zog die Vorhänge beiseite und trat an sein Bett. Armin blinzelte in die Helligkeit. Sie trug ein weißes Kleid mit dunkelblauen Knöpfen und hellblauen Verzierungen an Kragen und Ärmeln und war noch schöner als sonst. Sie gab ihm einen Kuss auf die Stirn und wandte sich dem Kleiderschrank zu.
»Dann wollen wir mal sehen, dass wir die richtige Bekleidung für das große Ereignis finden«. Schlagartig wurde Armin klar, dass die Freude über den großen Tag getrübt sein würde. Er musste seine Sonntagskleidung anziehen, obwohl gar kein Sonntag war. Aber er ahnte, dass seine Mutter nicht mit sich handeln lassen würde, ihr Kleid sah so sehr nach einem festlichen Anlass aus, dass wohl die ganze Familie im Sonntagsstaat erscheinen würde; da hatte er keine Chance.
Während des Frühstücks hielt Armin unauffällig Ausschau nach einer Schultüte. Von anderen Jungen hatte er gehört, dass alle Schulanfänger eine große bunte Tüte bekamen, in der sich allerlei Süßigkeiten befinden sollten. Einer hatte sogar behauptet, sein Bruder, der schon seit einem Jahr zur Schule ging, habe ein Spielzeugauto aus Blech darin gefunden. Zu seiner großen Enttäuschung entdeckte er nicht das geringste Anzeichen für eine solche Überraschung.
Als Armin in seinem hellen Tweedanzug, den der große Opa geschneidert hatte, mit einer Fliege unter dem Kinn und der Baskenmütze auf dem Kopf an der Hand seiner Mutter den Weg zur Schule antrat, dachte er nicht mehr an die unbequeme Kleidung. Stolz trug er seinen Schulranzen durch die Straßen und gab sich dem Glücksgefühl hin, dass alle Menschen nun sehen konnten, wie er zur Schule ging.
Zur Fahrenheidschule in der Altroßgärter Predigerstraße war es nicht weit, sie mussten nur einen Häuserblock umrunden. Armin konnte das Haus der Großeltern in der Arnoldstraße sehen. Er dachte an den großen Opa, der bestimmt gerade an der Nähmaschine saß, die ratternd Stoff durch ihre Zähne zog. Der große Opa war gar nicht besonders groß, aber er war das, was man eine stattliche Erscheinung nannte. Als Sergeant der kaiserlichen Armee hatte er preußische Ideale verinnerlicht, und mit dem geschwungen gezwirbelten Bart und aufrechter Haltung strahlte er Autorität und Selbstbewusstsein aus.
Der Weg führte sie durch die Kuplitzer Straße. Vor dem Schaufenster des Schreibwarenladens standen einige Männer, die laut miteinander sprachen und heftig gestikulierten. Armin sah, wie einer der Männer auf die Titelseite der ausgehängten Königsberger Allgemeinen Zeitung zeigte und höhnisch rief: »Das ist keine Wahl gewesen, das stimmt doch vorne und hinten nicht. Niemals haben neunundneunzig Prozent für Hitler gestimmt.« Einige der anderen Männer nickten, aber die meisten schrien wütend auf und schimpften. »Halt’s Maul, Kommunist! Mit euch werden wir bald kurzen Prozess machen. Wirst schon sehen!«
Die Mutter zog ihn auf die andere Straßenseite. Armin war enttäuscht, niemand hatte von ihm und seinem Ranzen Notiz genommen.
Am Schulgebäude waren schon zahlreiche Jungen mit ihren Eltern versammelt, für einen Augenblick sah er seinen Freund Hans. Er hielt eine große Schultüte im Arm und strahlte stolz zu ihm herüber. Jetzt sah er auch die vielen anderen Schultüten, große und kleine, bunte und einfarbige. Manche trugen lustige Mützchen aus Krepppapier mit Schleifen daran. Fast jedes Kind schleppte eine solche Tüte, und Armin spürte ein seltsames Gefühl in sich aufsteigen. Sollten seine Eltern, die er über alles liebte, vergessen haben, dass ihr Kind auch so eine Schultüte brauchte? Vielleicht haben sie nicht gewusst, dass sie zum ersten Schultag dazugehörte. Andererseits wusste sein Vater doch alles; er musste vergessen haben, es Mutti zu sagen.
Doch plötzlich tanzten zwei wunderschöne Schultüten vor seinen Augen. Und als er erkannte, dass die beiden Omas die Tüten vor seiner Nase schwenkten, wusste er, sie würden ihm gehören. Er hatte nicht nur eine, er hatte zwei Schultüten!
Der Lehrer begrüßte zuerst die Eltern und Großeltern, die die Schulanfänger begleitet hatten. In wohlgesetzten Worten sprach er vom deutschen Vaterland, vom Volk der Dichter und Denker und davon, dass die Kinder nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen sollten. Armin verstand das nicht, er war doch zur Schule gekommen, um zu lernen, er wollte für die Schule lernen.
Während der Lehrer Sätze formte, deren Inhalt ihm verschlossen blieb, betrachtete Armin die ungewohnte Umgebung. Seine Schulbank mochte schon manche Schülergeneration ertragen haben. Das von Hosen und Ärmeln blankgewetzte, von Tinte und Tusche gedunkelte Holz zeigte Spuren von Stiften und Fingernägeln, von verschwitzten Kinderhänden und fettigem Butterbrotpapier. Der Klassenraum war größer als das größte Zimmer in der elterlichen Wohnung, an den Wänden hingen keine Gemälde, sondern Zeichnungen von Tieren, und es gab ein Foto von einem Mann in Uniform mit bösem Blick und einem kleinen schwarzen Bart unter der Nase. Neben dem Bild hing eine Landkarte.
Der Lehrer hatte schon etwas an die Tafel geschrieben. Armin erkannte Zahlen. Die perfekten, kerzengeraden deutschen Sütterlinbuchstaben zeigten das Datum: 1. April 1936. Seltsam, dass er nicht alles lesen konnte, schließlich war er doch jetzt ein Schulkind und in einer richtigen Schule.
Herr Mandik war groß und hager, er erinnerte Armin an den Lehrer in dem großen Buch, aus dem der Vater ihm die Streiche von Max und Moritz vorgelesen hatte. Endlich schickte er die Erwachsenen aus dem Klassenraum. Viele Mütter winkten ihren Kindern beim Hinausgehen, einige hatten Tränen in den Augen und betupften sich die Wangen mit Taschentüchern. Auch einige Jungen fingen an zu weinen. Armin zeigte seiner Mutter und den Großmüttern mit einer Geste, dass sie ruhig gehen konnten. Er hatte keine Angst, die Heulerei fand er kindisch. Schließlich waren sie jetzt groß genug, um in die Schule zu gehen, da brauchte man nicht so ein Theater zu machen. Sein Banknachbar war offensichtlich der gleichen Meinung. Armin sah, wie er mit dem Daumen auf zwei schluchzen de Jungen zeigte und verächtlich den Mund verzog. Im erhebenden Bewusstsein von Einverständnis und Überlegenheit grinsten sie sich an.
Lehrer Mandik gelang es erstaunlich rasch, die Situation zu klären, indem er den Auszug der Eltern mit energischen Handbewegungen beschleunigte und die Heulsusen aufforderte, nun mit dem Weinen aufzuhören. Zu Armins Verwunderung kehrte augenblicklich Ruhe ein.
»Wer von euch kann die Wochentage aufsagen?«, fragte er. Mehrere Jungen riefen: »Ich, ich ...«
Einige fingen an, laut aufzuzählen. »Montag, Dienstag, Mittwoch ...« Weiter kamen sie nicht. Der Lehrer schlug mit dem Rohrstock auf das Pult, sein Blick ließ die Kinder erstarren. Mit leiser Stimme, aber in einem Tonfall, der keinen Laut oder gar Widerspruch duldete, stellte er klar: »Wer etwas sagen möchte, meldet sich. Wer gefragt wird, steht auf und antwortet. Alle anderen sind mucksmäuschenstill!«
Sein Blick wanderte von einem Kind zum anderen. Er sah jedem ins Gesicht, bis es die Augen niederschlug.
»Jetzt stehen alle Jungen auf und stellen sich neben die Bank. Wir sprechen die Wochentage gemeinsam. Achtet auf meine Hand, ich gebe das Zeichen.«
Nach den Wochentagen mussten sie den Stundenplan aufsagen. Lehrer Mandik sprach vor, die Klasse wiederholte die Fächer im Chor: »Montag: Rechnen, Schreiben, Lesen, Heimatkunde. Dienstag: Rechnen, Zeichnen, Lesen ...« Später durften sie ein Bild malen. »Mein Elternhaus«.
Armin war ein wenig enttäuscht, als der erste Schultag vorüber war, denn er hatte weder Lesen noch Schreiben noch Rechnen gelernt. Doch das änderte sich bald. Tag für Tag konnte er nicht nur seinen Eltern, sondern auch den Großmüttern und Großvätern neue Buchstaben vorführen, die er auf seine Schiefertafel gemalt hatte. Und jedes Mal gab es Lob, manchmal sogar eine süße Belohnung. Das Lernen lohnte sich.
Wenn nur die Hausaufgaben nicht gewesen wären! An manchen Tagen war es einfach unmöglich, nicht am Schlossteich zu spielen. Und wenn Indianerhäuptling Großer Bär zum Angriff auf die Bleichgesichter blies, konnte man nicht einfach nach Hause gehen, um zu schreiben oder zu rechnen. Ein Indianer benutzte Pfeil und Bogen, keine Griffel oder Federhalter.
Plötzlich war dann der Tag vorüber, die Schultasche musste gepackt werden, auch wenn noch nicht alle Aufgaben erledigt waren. Der nächste Schultag war noch fern, irgendwie würde sich alles schon regeln. Doch das Wunder ließ auf sich warten. Die Schule stand auf ihrem Platz, der Lehrer erschien höchst lebendig, das Schreibheft hatte sich nicht über Nacht mit neuen Buchstaben gefüllt. Mit unbegreiflicher Sicherheit stieß Herr Mandik auf die leeren Seiten. Wortlos griff er zum Rohrstock. Die verzweifelte Hoffnung auf ein Wunder in letzter Sekunde verwandelte sich in die schreckliche Gewissheit, dass nun kam, was kommen musste: Hiebe auf den Hosenboden. Den Schmerz konnte ein Indianer ertragen, aber die Schmach, vor allen anderen Jungen gezüchtigt zu werden, trieb so manche Träne in die Augen.
Armin verschwieg seinen Eltern die demütigenden Begegnungen mit dem Rohrstock. Beim großen Opa beklagte er sich einmal. Doch zu seiner Enttäuschung geriet er nicht in Zorn auf den Lehrer. »Strafe muss sein«, schmunzelte er. »Wenn du was angestellt hast, musst du auch mit Folgen rechnen. Da beißt die Maus keinen Faden ab, mein Junge. Komm, zeig mal, was du heute als Hausaufgabe hast. Ich helfe dir, wenn ich kann. Dann geht es schneller, und du kannst noch auf den Kriegspfad ziehen.«
In den Heimatkundestunden hatten sie einen langen Text über Königsberg von der Tafel abschreiben müssen. Jetzt sollte er in Schönschrift aus dem Schulheft in das Hausheft übertragen werden. Armin hatte schon viele Seiten vollgeschrieben, nur das letzte Stück fehlte noch. Er schob seinem Großvater die Hefte hin und zeigte ihm, was er heute abschreiben sollte. Opa rückte die Brille zurecht und las halblaut, was Armin schon geschrieben hatte.
Unser Heimatkreis liegt südlich des Kurischen Haffes, das die Nordgrenze bildet, und beiderseits des Pregel. Er hat die Gestalt eines Vierecks, das sich nach Süden verbreitet. Dort stößt er an den Kreis Preußisch Ehlau, im Osten an die Kreise Labiau und Wehlau. Die Ausdehnung von Norden nach Süden beträgt etwa 40 km, die Breite an der Nordgrenze 24 km und an der Südgrenze 40 km. Der Flächeninhalt des Kreises Königsberg beträgt etwa 1000 qkm. Von Osten nach Westen durchzieht das Pregeltal den Kreis. Dort, wo sich die Arme des Pregel zum letzten Male vereinigen, bedeckt die Stadt Königsberg das ganze Tal und die beiderseitigen Ufer.
Als die Ritter des Deutschen Ordens das Samland erobert hatten, bauten sie im Jahre 1255 auf dem Berge Twangste eine Burg. Im Laufe der Jahrhunderte bildeten sich Wohnsiedlungen um die Burg. Sie hießen Kneiphof Altstadt und Löbenicht.
Im Jahre 1724 wurden sie durch Friedrich Wilhelm I zu einer Stadt vereinigt. Später traten neue Stadtteile wie Haberberg, Roßgarten und Tragheim hinzu. Außerhalb der Befestigungen bildeten sich weitere Ortschaften. So ist Königsberg eine Großstadt geworden. Die Stadt ist so schnell gewachsen, weil sie eine günstige Lage in der Nähe des Meeres und an der Mündung eines schiffbaren Flusses hat.
Der Großvater legte das Heft zurück und nickte anerkennend. »Da hast du ja schon eine Menge geschafft. Was musst du denn jetzt noch abschreiben?«
»Von Im Jahre bis hat.«
»Na, das ist doch nicht viel«, brummte der große Opa. »Das schaffst du auch noch. Fang schon mal an! Ich gehe inzwischen zur Oma in die Küche. Will doch mal sehen, ob sie nicht eine kleine Belohnung für uns hat, wenn wir fertig sind.«
Armin war froh, dass er die Hausaufgaben geschafft hatte. Diesmal war er vor dem Rohrstock sicher.
Der nächste Schultag begann anders als sonst. Kaum hatten sich die Jungen nach dem Guten-Morgen-Gruß in die Bänke gedrückt, erhob sich auf der Fensterseite ein angstvolles Geschrei. »Eine Biene, eine Biene!« Drei Jungen verließen fluchtartig die Plätze und rannten in wilder Panik durch den Klassenraum. Die anderen verfolgten gebannt das Schauspiel. Armin beobachtete Herrn Mandik. Bestimmt würde er gleich den Rohrstock tanzen lassen. Doch der Lehrer rief nur: »Stehenbleiben! Keiner rührt sich!« Die Jungen gehorchten. Mit großen Augen verfolgten sie die Bewegungen ihres Lehrers. Der öffnete ein Fenster und trieb das gefährliche Insekt mit seinen großen Händen hinaus. Als er das Fenster wieder schloss, setzte ein Flüstern und Raunen in der Klasse ein.
Herr Mandik schlug nicht mit dem Rohrstock auf das Pult, rief auch nicht sein »Ruhe jetzt!« in die Klasse; er ließ sie gewähren. Nach kurzer Zeit verstummten die Kinder und starrten verwundert auf den Lehrer. Als Ruhe eingekehrt war, fragte er: »Was für ein Tier war das?« Mehrere Finger schnellten hoch. Der Junge, der zuerst geschrien hatte, durfte antworten. »Das war eine Biene, Herr Mandik.«
Der Lehrer sah in die Klasse und schüttelte den Kopf. »Das war eine Wespe. Bienen und Wespen sehen sich zum Verwechseln ähnlich, aber es gibt auch Unterschiede.«
Herr Mandik wandte sich zur Tafel und begann zu zeichnen. In Sekundenschnelle entstanden zwei riesige Insekten. Mit dem Stock zeigte er auf die Zeichnungen und erklärte, woran sie Bienen und Wespen unterscheiden konnten.
»Herr Mandik«, fragte ein Junge, »sammeln Wespen auch Honig?«
Der Lehrer gab die Frage zurück: »Wer hat schon einmal ein Wespennest gesehen?« Einige Jungen meldeten sich. »Habt ihr darin Honig gefunden?«, wollte er wissen. Die Jungen schüttelten den Kopf.
»Nur die Bienen sammeln Nektar«, erklärte Herr Mandik. »Den bringen sie der Bienenkönigin. Honig wird erst später daraus.«
Es gab noch viele Fragen. Wo der Nektar aus den Bienen herauskam, wie daraus Honig wurde, wie man an ihn herankam, ohne von den Bienen gestochen zu werden. Noch nie war Armin der Unterrichtstag so schnell vergangen. Gern hätte er gefragt ob man Wespennester zerstören durfte. Aber die Erwachsenen waren in diesen Dingen oft komisch. Sie schlachteten Schweine und trieben Pferde mit Peitschen an, aber den Kindern sagten sie immer, dass man Tiere mit Respekt behandeln sollte. Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz hatten sie in Schönschrift ins Schulheft und ins Hausheft schreiben müssen. Darum verzichtete er lieber darauf, seine Frage zu stellen. In einem hohlen Baumstamm neben der Kirche im Friedhofspark hatte er ein Wespennest gesehen. Zu gern hätte er ausprobiert, was passierte, wenn man dort Wasser hineingoss. Wenn nur die Bienen nützlich waren, konnte eigentlich niemand etwas dagegen haben. Auf jeden Fall konnte er mit Manfred und Gerhard mal nachsehen, ob die Wespen noch da waren.
3
MANDELENTZÜNDUNG
Nur wenige Schritte vom Haus der Großeltern in der Arnoldstraße entfernt lag ein Park mit hohen Bäumen, alten Denkmälern und verwitterten Grabsteinen. Vor hundert oder mehr Jahren war hier ein Friedhof gewesen. Inzwischen gab es Friedhöfe für alle Konfessionen jenseits der Litauer Wallstraße., der alte Kirchhof war zu einem Stadtpark geworden, der von einem Parkwächter gepflegt und bewacht wurde. Der Mann in der dunkelblauen Uniform verschloss Abend für Abend die schmiedeeisernen Tore, indem er einen riesigen Schlüssel knirschend in den Schlössern drehte. Jeden Morgen öffnete er sie auf die gleiche Weise.
Im Sommer durfte Armin unter Aufsicht der Großmutter im Park spielen. Im Sandkasten unter der großen Eiche konnte er Burgen für Bleisoldaten und Ritter bauen und Straßen für Spielzeugautos anlegen.
Nachdem Armin entschieden hatte, dass Sandkastenspiele nicht mehr seinem neuen Status als Schuljunge entsprachen, schmiedete er Pläne zur Eroberung neuer Welten. Grabgewölbe im Schatten der Bäume und Kirchengemäuer forderten zu mancherlei gruseligen Fantasien heraus. Die Eingänge zu den Grabkammern übten eine ungeheure Anziehungskraft aus. Bisher hatte die Furcht vor Dunkelheit und vor Geistern von Verstorbenen ein Eindringen verhindert. Zusammen mit den Freunden konnte man vielleicht riskieren, wenigstens einen Blick hineinzuwerfen.
Der Parkwächter war nicht zu sehen. Vorsichtig schlichen sich drei Apachen durch das Tor, schlugen sich seitlich in die Büsche und rannten gebückt über die Lichtungen. Gerhard war mit Pfeil und Bogen ausgestattet, Manfred hatte eine Lanze aus Bambus in der Hand. Armin durfte heute das Holzgewehr tragen und war deshalb Anführer. Die Feuerwaffe war ein besonderer Schatz, sie stammte aus der Tischlerwerkstatt von Gerhards Vater, der sie aus einem Brett zurechtgesägt, glattgeschliffen und mit silbernen Polsternägeln verziert hatte. Gerhard gab sie ungern aus der Hand, aber unter indianischen Brüdern war es Ehrensache, dass jeder einmal an die Reihe kam, die Silberbüchse und damit die Häuptlingswürde zu tragen.
Plötzlich knirschten schwere Schritte auf dem Kiesweg. Der Parkwächter! Armin gab das Zeichen zum Verharren. Regungslos warteten die Krieger und lauschten mit angehaltenem Atem auf das Geräusch. Zum Glück entfernte es sich rasch, so dass sie weiter in das Innere des Parks vordringen konnten. Als die moosbewachsene Mauer der alten Kirche in Sicht kam, erinnerte sich Armin an das Wespennest. Er hob den Arm zum Zeichen, dass sich alle Krieger um ihn zu versammeln hätten. Flüsternd erklärte er den Freunden seinen Plan. Die Krieger stimmten begeistert zu. Die Vorstellung war verlockend. Bestimmt passierte etwas ganz Aufregendes. Und das Gefühl, etwas zu tun, was vielleicht verboten war, machte die Sache noch spannender. Eilig schlichen sie zurück, um ein Gefäß mit Wasser zu besorgen.
Als die Flüssigkeit in den hohlen Baumstamm gluckerte, ertönte zorniges Gebrumm. Im nächsten Augenblick strömte die Wespenschar aus der Öffnung. In rasenden Bewegungen tanzten die Insekten in alle Richtungen auseinander. Gerhard schrie auf, als einige auf ihn zustürzten. In wilder Panik schlug er um sich. Armin zögerte nicht, gab den Befehl zum Rückzug. »Los, weg hier!«
Drei Jungen rannten um ihr Leben. Ohne Rücksicht auf feindliche Bleichgesichter fegten sie am Parkwächter vorbei, durch das Tor auf die Straße. Erst in sicherer Entfernung hielten sie keuchend inne. Die Bilanz war deprimierend: Alle Waffen waren verloren, auf Gerhards Handrücken entwickelten sich zwei schmerzende Schwellungen.
»Wir gehen zu meiner Oma«, entschied Armin. »Die kann dir was draufmachen.«
In der Küche erinnerten sich die geschlagenen Krieger an den Verlust ihrer Waffen. Sie saßen vor dampfenden Kakaotassen an Omas Küchentisch. Gerhard hielt die Schnittflächen einer geteilten Zwiebel auf die Stichstellen.
»Wir müssen noch mal in den Park, unsere Sachen holen«, erinnerte Armin. »Wir können sie da nicht einfach liegen lassen. Wenn sie jemand findet, sind wir sie los.« Er fühlte sich für die Silberbüchse seines Freundes verantwortlich. Auf seinen Bogen mit den selbstgeschnitzten Pfeilen wollte er auch nicht verzichten. Außerdem hatte er ein schlechtes Gewissen, weil er die Freunde auf die Idee mit dem Wespennest gebracht hatte.
»Ihr könnt zu zweit gehen«, schlug die Oma vor. »Der Gerhard bleibt hier. Wenn die Zwiebel nicht wirkt und die Stiche schlimmer werden, muss er zum Arzt. Ich will das noch ein Weilchen beobachten.«
Erschrocken sahen sich die Jungen an. So schlimm hatten sie sich die Folgen eines Wespenstichs nicht vorgestellt. Aber sie kannten die Geschichte von dem Mann, der nach zehn Stichen tot umgefallen war, und Gerhard hatte immerhin zwei. Mit einer Mischung aus Angst und Mitleid betrachteten Armin und Manfred ihren Freund. Der presste die Lippen zusammen und schüttelte den Kopf. »Es tut gar nicht mehr so weh«, stieß er hervor.
»Umso besser«, sagte die Oma. Aber ihre Anweisung nahm sie nicht zurück. So schlichen sich Armin und Manfred hinaus und hinterließen den Freund in ihrer Obhut.
Sie fanden ihre Besitztümer unversehrt unter den Büschen in der Nähe des hohlen Stammes. Die Wespen schwirrten noch immer um ihre Behausung, schienen aber von den Jungen keine Notiz zu nehmen. Erleichtert zogen sie sich zurück, ihre Habe ganz unindianisch als Bündel unter den Armen tragend.
Armin erwachte mit einem rauen Kloß im Hals. Er versuchte, das lästige Ding hinunterzuschlucken. Aber das tat weh, und wenn er es geschafft hatte, war der kratzige und drückende Klumpen wieder da.
Er kletterte aus dem Bett, um sich im Spiegel zu betrachten. Von außen sah der Hals normal aus, keine Beule deutete darauf hin, dass sich im Inneren ein monströses Gebilde breitmachte. Er streckte seinem Spiegelbild die Zunge heraus und versuchte, in den Rachen hineinzusehen. Es war nichts zu erkennen. Zur Probe schluckte er noch einmal, der Kloß blieb und drückte und kratzte weiter.
Zu seiner Überraschung wusste seine Mutter gleich, als sie ins Zimmer kam, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Sie betrachtete ihn prüfend. »Hast du Halsschmerzen, Bubi?«
Als er ihren besorgten Blick sah, versicherte er rasch: »Ist aber nicht schlimm.«
»Ob es schlimm ist, wird der Doktor feststellen. Zieh dich an! Wir gehen ins Krankenhaus der Barmherzigkeit zu Professor Blomke. Es gefällt mir nicht, dass deine Mandeln schon wieder entzündet sind.«
Im ersten Augenblick war Armin begeistert, er würde nicht zur Schule gehen müssen. Aber dann fiel ihm ein, dass er bestimmt am Nachmittag in seinem Zimmer bleiben musste. Das war bitter.
»Aaaah!« Gehorsam legte Armin den Kopf in den Nacken und ließ sich von Professor Blomke die Zunge mit einem Holzstreifen niederdrücken.
»Ja, Frau Jedosch«, wandte sich der Arzt an die Mutter, »es sieht ganz so aus, als wären es wieder die Mandeln. Wir brauchen ein paar Tage Bettruhe und heiße Umschläge. Ich werde Ihnen Tropfen aufschreiben. Die geben Sie dem Jungen dreimal täglich. Dann kommt das schon wieder in Ordnung. Es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Eine leichte Mandelentzündung kommt in dem Alter nicht selten vor. Meistens verschwindet die Empfindlichkeit mit der Pubertät.«
Er gab Armin einen kleinen Klaps auf den Hinterkopf. »Und du, junger Mann, hältst dich an das, was deine Mutter dir sagt, dann kannst du bald wieder zur Schule und zu deinen Freunden.«
Armin nickte stumm. Die Erwachsenen redeten immer davon, wie wichtig frische Luft sei. Aber er ahnte, dass er mit dem Mann im weißen Kittel nicht darüber verhandeln konnte, vielleicht nur die Vormittage im Haus zu verbringen, nachmittags dagegen nach draußen zu gehen.
Im Bett liegen zu bleiben, wenn von draußen Geräusche durchs Fenster drangen und davon kündeten, dass sich allerlei ereignete, war einfach unmöglich. Nachdem die Mutter ihm das Frühstück gebracht und den Halswickel erneuert hatte, war sie zum Einkaufen gegangen. Die Gelegenheit war günstig, den Beobachtungsposten am Fenster wieder einzunehmen.
Schon am frühen Morgen, als in der Wohnung noch Stille herrschte, hatte Armin den Kopf durch die Gardinen gesteckt und das Leben und Treiben auf der Straße beobachtet. Das Brummen der Kehrmaschine hatte ihn ans Fenster gelockt. Ein Ungetüm mit gewaltigen rotierenden Bürsten war zuerst auf dem gegenüberliegenden Gehsteig entlanggekrochen und hatte alles in sich hineingefressen, was dort herumlag. Dann war es zurückgekehrt, um unter Armins Fenster entlangzurobben. Er hatte die Vibration der schweren Maschine an der Fensterscheibe und in seinem Bauch gespürt. Kurze Zeit später schob sich ein Lastwagen mit einem Wassertank auf der Ladefläche durch die Straße, einen feinen Vorhang aus glitzernden Wassertropfen hinter sich herziehend. Für einen Augenblick leuchtete ein kleiner Regenbogen in der Fontäne auf.
Danach war die erste Trambahn aufgetaucht, hatte sich klingelnd bemerkbar gemacht, kurze Zeit vor dem Haus verharrt und dann — aufgefüllt mit Männern in Arbeitsanzügen und mit Taschen, aus denen Thermosflaschen ragten — ihren Weg fortgesetzt.
Inzwischen war auf der Straße schon mehr Bewegung zu erkennen. Aus den Türen traten Frauen mit Einkaufstaschen, wandten sich nach kurzen Blicken die Straße hinauf und hinab den nächstgelegenen Geschäften zu. Jetzt sah er auch seine Mutter, wie sie die Straße überquerte und auf den Schlachterladen zusteuerte. Sie sah eleganter aus als die anderen Frauen in der Straße, die manchmal die Köpfe zusammensteckten, wenn sie vorüberging. Der große Opa schneiderte ihr Kleider und Röcke aus allerbestem Stoff und nach der neuesten Mode. Die Schuhe kamen aus der Werkstatt des kleinen Opa und waren nicht weniger elegant. Armin glaubte, das Klingeln der Ladentür zu hören, als seine Mutter dahinter verschwand.
Aus Richtung Roßgärter Tor näherte sich der erste Gemüsehändler. Ein hochrädriger, einachsiger, hölzerner Karren mit zwei langen gebogenen Griffstangen wurde von einem kräftigen Mann mit wettergegerbtem Gesicht geschoben. Der Bauer trug weite graubraune Hosen und eine grobe schwarze Jacke. Der Karren war mit einer Plane bedeckt, aber Armin wusste, dass sich darunter Kartoffelsäcke, Kohlköpfe, Körbe mit Äpfeln oder anderem Obst oder Gemüse verbargen. Vielleicht würde er sehen können, was der Bauer aus dem Samland in die Stadt brachte. Oft standen fünf oder sechs solcher Karren vor dem Elternhaus seines Freundes Hans. Die Hausfrauen kauften gern frische Waren der Bauern.
Wenn sie ihre Karren gegen den Bordstein gestellt hatten und die Plane zurückschlugen, kamen messingglänzende Waagen zum Vorschein. Mit geübten Griffen hantierten die Verkäufer mit Gewichten, berechneten den Preis und legten oft noch einen Apfel oder eine Tomate oder Gurke dazu. Armin bewunderte diese Männer, die offensichtlich blitzschnell rechnen konnten, denn kaum hatten sich die Zeiger der Waage eingependelt, riefen sie den Preis. Die Frauen öffneten die Taschen, schon rollten Kartoffeln oder Äpfel oder Tomaten hinein.
Armins Aufmerksamkeit wurde von einem anderen Fahrzeug abgelenkt. Aus der Innenstadt näherte sich ein Pferdefuhrwerk. An den Aufbauten des Wagens konnte er erkennen, dass die Bierkutscher kamen. Sie trugen Schirmmützen mit einem goldglänzenden Band, auf dem der Name der Brauerei prangte. Als sie die Gaststätte an der Straßenecke erreichten, zog der Kutscher die Zügel an. Mit einem lauten »Brrr...« brachte er das Fuhrwerk zum Stehen. Die Männer sprangen vom Bock und legten schwere Lederschürzen an. In der Tür erschien der Wirt. Er winkte den Männern zu und verschwand. Wenige Augenblicke später klappte er die schrägen Holztüren auf, die den Zugang zum Keller unter seinem Lokal verschlossen. Die Bierkutscher warfen ein großes braunes Kissen vom Wagen auf die Straße. Armin zählte mit, als sie die Bierfässer auf das Kissen fallen ließen, um sie dann zum Keller der Gaststätte zu rollen, wo sie rumpelnd in der Dunkelheit verschwanden.
Auf geheimnisvolle Weise stieg das Bier aus dem Keller in die Gaststube hinauf, wo es aus glänzenden Hähnen in die Gläser schäumte. Armin hatte schon hin und wieder für den Großvater Bier holen dürfen. Die Oma sah es nicht gern, wenn der Opa in die Gastwirtschaft ging. So ließ er sich gelegentlich von Armin einen Krug Ponarther nach Hause holen.
Er ging gern dorthin. Die vielen Männer in der rauchgeschwängerten Luft redeten laut und gestenreich, die Gerüche von Bier und Buletten, von Schweiß und Suppenküche verbanden sich zu einer aufregenden Mischung. Außerdem gab ihm der Wirt regelmäßig ein paar Erdnüsse, die er mit stillem Vergnügen kaute, während er - darauf wartend, dass der Bierkrug gefüllt wurde — die Männer beobachtete. Einmal durfte er sich auch einen Bierfilz mitnehmen. Inzwischen konnte er lesen, was auf die runde Pappscheibe gedruckt war: Das köstliche Ponarther Märzbier — special.
Am Abend, als er eigentlich schon schlafen sollte, nahm Armin noch einmal seinen Beobachtungsposten ein. Wenn er ganz an die Seite des Fensters rutschte, konnte er die Straßenlaterne auf der anderen Straßenseite sehen. Gerade kam der Mann von den städtischen Gaswerken. Heute trug er nicht die lange Stange mit dem Windlicht, heute hatte er eine Leiter auf der Schulter. An der Laterne stoppte er, klinkte die eisernen Haken der Leiter in die Ringe am oberen Ende des Laternenpfahls ein und stieg hinauf. Am Gürtel trug er eine Ledertasche. Daraus nahm er einen Schlüssel, öffnete die Lampe, indem er den oberen Teil umklappte. Dann schob er eine Papphülse über den Glühstrumpf und wischte mit einem Lappen die Glasscheiben ab. Schließlich zog er die Schutzhülle wieder ab, drehte das Ventil auf, entzündete den Glühstrumpf und schloss die Laterne. Der Lichtschein war schwach, nahm nur langsam an Helligkeit zu. Als der Laternenanzünder seine Leiter schulterte und weiterzog, konnte Armin erkennen, wie das Licht auf die Straße fiel und einen runden Fleck auf Gehsteig und Straße zeichnete.
Er dachte an das Gedicht vom Laternenmann, das sie in der Schule gelernt hatten. Es war seltsam, plötzlich konnte er den ganzen Text hersagen, in der Schule war er immer hängengeblieben.
Sonne steckt jetzt hinterm Haus,
Und das Kinderspiel ist aus!
Ja, die Kleinen sind schon heim,
Gucken dort am Fensterlein.
Kommt ein Mann dahergegangen,
Kommt mit einer großen Stangen.
Seht, dort drüben steht er still!
Was er nur mit der Stange will?
Kling! — da geht ein Türlein auf.
Pfuff! — Sitzt schon ein Lichtlein drauf.
Noch ein Klapp! — Der Mann hat Eile.
Bald gibt’s Lichter eine lange Zeile.
Armin seufzte, als ihm bewusst wurde, dass er noch den ganzen nächsten Tag und vielleicht auch noch den übernächsten in der Wohnung bleiben musste. Er starrte auf das Holzpflaster, ohne es wirklich wahrzunehmen, wanderte in Gedanken die Straße entlang, am Städtischen Krankenhaus vorbei, sah in der Grolmannstraße das Haus des kleinen Opas, sah die Nähmaschinen mit den dicken Nadeln, den Opa mit der Schusterahle hantieren und die Oma in der winzigen Küche wirtschaften.
Er überquerte die Wrangelstraße, ließ den Dohnaturm links liegen, sah sich plötzlich in der Hansa-Badeanstalt am Oberteich. Bisher hatte er es noch nicht geschafft, wie die anderen Kinder zu schwimmen. Der Vater hatte zwar versucht, es ihm beizubringen, aber das Ergebnis war recht kläglich gewesen. Seine Eltern hatten ihm verboten, mit den Schulkameraden im Ruderboot auf den See zu fahren, solange er noch nicht schwimmen konnte. Einige Boote besaßen am Heck eine dritte Dolle. Wenn man dort das Ruder anlegte, konnte man durch Pendelbewegungen Vortrieb erzeugen. Nichts wünschte er sich sehnlicher, als es Hans Wölm nachzutun, der mit bewundernswerter Geschicklichkeit das Boot mit nur einem Ruder in Fahrt bringen konnte. Bei diesem Wriggen,