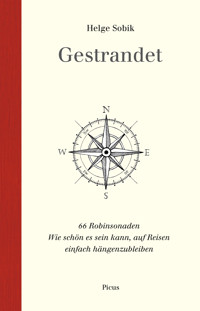
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In 66 Reisefeuilletons erzählt Helge Sobik von Reisezielen, an denen es leichter als anderswo passieren kann, dass man strandet – weil man das letzte Ausflugsschiff aufs Festland verpasst hat, wieder mal Nebel dazwischenkommt, der Airport plötzlich gesperrt ist, weil Giraffen auf der Piste stehen und partout nicht weichen wollen, der letzte Bus einfach nicht auftaucht und gerade am Haken des Abschleppwagens für immer auf den Schrottplatz gezogen wird – oder einfach, weil die Verlockung, noch ein wenig dazubleiben, zu groß war. Sobiks Geschichten richten den Blick auf den Alltag der fremden Gegend und Kultur und schildern oft unverhoffte Begegnungen. Quintessenz ist zumeist: Wie gut es sich plötzlich anfühlt, genau da gestrandet zu sein – und wie schön, zu spüren, was es hier unerwartet zu entdecken gibt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Copyright © 2024 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien
Alle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Buntspecht, Wien
Karten: Adobe Stock, iStockphoto
Umschlagabbildung: © lublubachka/Adobe Stock
ISBN 978-3-7117-2147-1
eISBN 978-3-7117-5509-4
Informationen über das aktuelle Programm des Picus Verlags und Veranstaltungen unter
www.picus.at
Helge Sobik
Gestrandet
66 RobinsonadenWie schön es sein kann, auf Reisen einfach hängenzubleiben
Picus Verlag Wien
inhalt
Prolog
Gestrandet
… im Addu-Atoll
… am Kabini River
… in Mumbai
… in Muscat
… in Fujairah
… auf Sir Bani Yas
… in Jerash
… in Alexandria
… in Marsa Matrouh
… auf Djerba
… auf San Pietro
… auf Folegandros
… auf Mykonos
… auf Skopelos
… auf Athos
… in Venedig
… in den Schären von Västervik
… auf Christiansø
… in den Dünen bei Hvide Sande
… am Loch Lomond
… auf der Belle-Île-en-Mer
… auf der Dune du Pilat
… in den Cevennen
… in Okzitanien
… in Andorra
… im Val d’Aran
… am Gold von Biskaya
… in Aragón
… im Ebro-Delta
… am Cabo de Gata
… an der Costa de la Luz
… auf Culatra
… in der Serra da Estrela
… auf Porto Santo
… in Casablanca
… in Fès
… in Tunis
… in den Saurierbergen von Tataouine
… in Karthum
… in Meroë
… in der Masai Mara
… auf den Seychellen
… in Ceará
… in Punta del Este
… am Rio de la Plata
… in Palenque
… auf Cayman Brac
… auf Les Saintes
… in Key West
… auf Nantucket
… in Tombstone
… in Utah
… in Las Vegas
… auf dem E.T.-Highway
… auf dem Rodeo Drive
… auf Catalina Island
… an den Virginia Falls
… in Prince Rupert
… in Dawson City
… in Tokio
… auf Fraser Island
… in Yangon
… auf Pangkor Laut
… in Sigiriya
… in Wayanad
… auf den Lakkadiven
prolog
Wenn sie verreist, braucht sie länger als andere, um anzukommen. Sie ist es gewöhnt. Es liegt daran, dass sie von allem weiter weg wohnt als die anderen. Und daran, dass so oft etwas dazwischenkommt. Mary Naptuna ist am Ende der Welt zu Hause. Aus demselben Grund bekommt sie selten Besuch. Selbst ihre Familie aus London ist in über zwanzig Jahren Ehe nicht ein einziges Mal vorbeischauen gekommen, wie sie mit ihrem Mann Steven ganz oben auf der Kuppe des Planeten lebt. Das kann auch daran liegen, dass nur zweimal die Woche ein Linienflugzeug bei Mary und Steven in Sachs Harbour auf Banks Island in der westlichen kanadischen Arktis einschwebt. Und daran, dass der Flug oft kurzfristig wegen Nebels gestrichen wird. Und sich die Wetterlage tagelang nicht ändert. Manchmal muss Pilot Blake Lawson mit seiner über dreißig Jahre alten Twin Otter im rechten Winkel zur Piste wieder starten, weil der Wind es nicht anders zulässt. Er wirft dann die beiden Propeller an, gibt Vollgas, kreuzt kurzerhand die gut zwanzig Meter breite sandige Startbahn und rattert mit Spezialbereifung über die Moose der baumlosen Tundra Richtung Norden, bis er genügend Tempo hat, um abzuheben und später am Himmel eine lang gezogene Kurve gen Süden zu fliegen: nichts Ungewöhnliches in Sachs Harbour auf Banks Island in der kanadischen Arktis. Die Twin Otter ist für solche Manöver gebaut. Es gibt sogar ein paar Buschpiloten hier oben in der Arktis, die mit voller Überzeugung behaupten, die Maschine liebe so etwas.
Steven Naptuna kennt all das. Er ist dort oben aufgewachsen, will nirgendwo anders hinziehen. Für ihn ist der Ort im Abseits der Nabel der Welt. Und Mary aus London will nirgendwo anders mehr zu Hause sein als bei ihrem Steven. Macht nichts, dass Sachs Harbour der einzige Ort auf der Insel ist, die es ungefähr auf die Größe Irlands bringt und über weniger als acht Kilometer Straße verfügt. Egal, dass dort weniger als hundertzwanzig Menschen leben, Eisbären auf der Insel klar die Mehrheit stellen und im Hinterland Tausende Moschusochsen wie seit Urzeiten leben. Niemand würde sich wundern, liefe hier plötzlich eine vergessene Mammutfamilie durchs Bild. Mary ist hier gestrandet, der Liebe wegen, für ein ganzes Leben.
Wenn andere irgendwo auf der Welt stranden, ist es meist nur für Stunden, manchmal für Tage: bis der Sturm vorbei und die Fähre repariert ist und wieder fährt. Bis sich der Nebel gelegt hat oder anderswo alle Tragflächen zum wiederholten Male enteist sind und ein Flieger wieder abheben kann. Bis jemand irgendwo noch Ersatz für die durchgerostete Achse des altersschwachen Busses gefunden hat. Bis eine sturzbetrunkene Crew wieder ausgenüchtert, eine Piste am Hang nach einem Erdrutsch wieder befahrbar ist. Tausend mögliche Gründe. Bis hin zu einer Pandemie, die einen unverhofft an Grenzübertritt oder Heimreise hindert.
Auch das sind gute Gründe: weil man sich entschieden hat, freiwillig länger zu bleiben, weil es noch so viel zu entdecken gibt und man einfach nicht wieder wegwill – weil der Alltag der anderen so schön ist, die Gespräche mit Fremden so gut sind. Weil das Essen so gut schmeckt, es ein Fehler war, das Hotelzimmer nur für drei Nächte zu buchen und es ein glücklicher Umstand ist, dass es für eine ganze weitere Woche verfügbar ist, ehe überhaupt erst wieder eine Anreise erwartet wird. Aus dem Stranden kann Großes werden: weil man womöglich ein Leben lang bleibt – und sei der Ort noch so abgelegen. Wie Mary Naptuna aus London. Wegen Steven aus Sachs Harbour.
Wie schade eigentlich, dass unsere durchtechnisierte Welt heute fast überall so organisiert ist, dass man seltener strandet als früher oder wenigstens schneller Rettung naht, ein Problem gelöst wird – und es doch weitergeht. Dabei gibt es noch Orte, bei denen die Voraussetzungen eher als anderswo hergeben, dass man dort strandet. Der Flughafen der kanadischen Westküstenstadt Prince Rupert ist so ein Beispiel. Er wurde einst auf der vorgelagerten Insel Digby Island errichtet – ohne dass sich jemand ausreichend Gedanken darüber gemacht hat, dass Digby so oft nebelverhangen ist, viel häufiger als das nahe Festland …
Selbst in Großstädten kann man hängenbleiben, weil kein Flecken der Welt gegen Wetterunbilden gefeit ist. Venedig und das Hochwasser ist so ein Beispiel, wenn plötzlich nichts mehr geht – oder zu wenig, um das gewohnte Reisetempo beizubehalten. Hausgemachtes Chaos ist ein weiterer weit verbreiteter Grund, Mumbai mit seinem Straßenverkehr das beste Beispiel dafür. Bangkok wäre ein weiteres. Und so viele große Städte mehr.
Längst kann man ohnehin an jedem Ort und mit jedem Verkehrsmittel stranden, nicht mehr nur im ursprünglichen Wortsinn mit dem Schiff und an einer Küste. Zu stranden hat zudem über die Zeit den negativen Beiklang von einst verloren. Wer früher strandete wie Robinson, der tat das als Schiffbrüchiger. Immer war es die letzte Rettung und als Alternative hatte das Schicksal nur den Tod durch Ertrinken im Sortiment. Manche rettende Küste hatte Palmen, Wälder, hilfsbereite Menschen anzubieten, andere nur Felsen oder Eis. Manchem schlug Feindseligkeit oder Ablehnung entgegen. Wem es widerfuhr, da wie dort zu landen, der wollte nichts sehnlicher als zurück in sein altes Leben, das oft den halben Erdball entfernt spielte. Wer aber heute von »Robinson-Urlaub« spricht, der verschwendet keinen Gedanken mehr an das Schicksal des Schiffbrüchigen aus der Literatur und unzähligen Verfilmungen, sondern sieht vorm inneren Auge nur Palmen, Strand und sanfte türkisblaue Wellen als erstrebenswerte Ferienkulisse, die mit nur wenigen anderen Privilegierten zu teilen ist, die dafür tief in die Tasche greifen. Robinson ist in der Wahrnehmung zum Dauerurlauber geworden, dem das Schicksal einen Jackpot beschert hat und dessen Alltag erstrebenswert ist und mit viel Geld erkauft werden kann.
Ähnlich ist es mit dem Stranden. So ärgerlich es anfangs meist ist, wenn eine Reise ungewollt unterbrochen ist, so viele Chancen bietet das doch jedes Mal: auf neue Entdeckungen, interessante Begegnungen, auf reichlich Erzählstoff für die Zeit zu Hause, wenn man denn eines Tages mit meist nur ein wenig Verspätung dort wieder eintrifft. Auf Erinnerungen für immer, mal kleiner, mal größer. Auf Einblicke, Ausblicke, Begegnungen. Und neue Ideen.
Einige wenige fordern das Risiko heraus, suchen geradezu die Gefahr, und einfach nur zu stranden, ist ihnen zu wenig. Wenn sie hängenbleiben, dann soll es wenigstens bedrohlich sein. Die meisten brauchen das nicht. Sie wünschen sich einfach, weit entlegene Gegenden des Planeten zu bereisen oder Vertrauteres ganz neu zu entdecken. Dass sie dabei womöglich stranden könnten, gehört dazu. Was dann? Entspannen. Neugierig sein. Loslaufen und mit allen Sinnen wahrnehmen.
Manchmal bekommen sogar Mary und ihr Inuit-Ehemann Steven Naptuna inzwischen Besuch von Fremden, die den weiten Weg unternehmen und ein halbes Dutzend Mal umsteigen, bis sie endlich ganz oben auf dem Planeten angekommen sind. Sie mieten sich wie ich im geheizten Gästehaus ein, gehen mit Steven auf Moschusochsen-Safari und halten anschließend ihren großen Zeh in den Amundsen-Golf. Diese Leute sind von ewiger Neugierde getrieben: auf das, was sich hinter einem merkwürdig klingenden Ortsnamen im Flugplan oder auf der Landkarte verbirgt, hinter Pangnirtung oder Kangiqsualujjuaq, hinter Umm al Qaiwain oder Tristan da Cunha. Oder Sachs Harbour, Ikaahuk in der Sprache der Ureinwohner, hinter dem nächsten Berg, der übernächsten Kurve oder einfach nur hinter einer hohen Mauer.
Erlebnisse kann man organisieren. Es lohnt sich, offen zu bleiben für all das, was nebenher geschieht, ganz zufällig. Oft steht eine große Erinnerung für später dahinter, wenn man solche Nebenstränge in der Handlung einer Reise zulässt. Seltsamerweise ist man dafür offener, wenn man es sein muss. Wenn man auf Hilfe angewiesen ist oder einfach nur aus dem vorgeplanten und oft eng getakteten Gerüst herausfällt, weil etwas schief geht: ein Abholer nicht kommt, das letzte Zimmer in einem eigentlich gebuchten Hotel schon an jemand anders vergeben ist, der denselben Anspruch darauf hat und bleiben will. Was dann geschieht? Das ist grundsätzlich immer anders, weil es so vielen Einflüssen von außen unterworfen ist. Manchmal ist es schade, wenn der Abholer einfach nur verspätet war und nach zwei Stunden doch noch mit seinem Auto und einer dicken Beule in der Beifahrertür um die Ecke biegt. Zu stranden setzt keinen Mindest- oder Maximalzeitraum voraus. Manch einer, der für ein paar Minuten aus seinem erwarteten Ablauf geschleudert wurde, fühlt sich, als wäre er gestrandet. Andere stranden für eine Nacht, eine Woche, ein ganzes Leben.
Es kommt vor, dass man nicht erst auf dem Heimweg, sondern schon vorm Ziel strandet. Mir erging es mit Sachs Harbour auf Banks Island so. Bis zu Mary und Steven Naptuna bin ich erst fünf Jahre nach dem ersten Versuch vorgedrungen. Beim ersten Anlauf war das Wetter konsequent dagegen. Ich bin bis Iqaluit im Mackenzie-Delta der Northwest Territories gekommen. Flüge nach Banks gab es nicht: alle gecancelt, auf Tage, zu viel Nebel hier wie dort und keine Wetteränderung in Sicht. Wie so oft im Sommer. Das zweite Mal gelang der Besuch, und endlich weiß ich, wie die arktische Blüte auf Banks Island im Juli aussieht und dass es nichts Weicheres und Wärmeres gibt als Handschuhe aus Moschusochsen-Wolle.
Diesmal wollte die Natur, dass ich länger blieb. Und nun dort strandete, wo ich sein wollte. Am ersten Tag schwammen Kinder im Arktischen Ozean, und das Thermometer zeigte fünfundzwanzig Grad. Am Morgen des zweiten Tages waren es zwanzig Grad, am Abend nur noch zwei. Und nachts fing es ein wenig an zu schneien, ehe der Nebel kam und den Flughafen drei Tage lang im Klammergriff hielt: kein Flugzeug rein, keines raus. Steven fuhr mit mir angeln, um die Zeit zu vertreiben – und erzählte die Märchen der Vorfahren. Manchmal ist es kostbar, wenn Nebel aufkommt, die Natur einen Vorhang vor die Welt zieht und man länger bleiben muss. Mit Musandam im Oman war es so ähnlich. Beim ersten Mal waren die Grenzposten dagegen, mich durchzulassen. Beim zweiten Versuch vier Jahre später waren die Formalitäten auf einen knappen Gruß geschrumpft. Die Welt war kleiner geworden. Immer sind es die Unwägbarkeiten, die aus Reisen Erlebnisse machen.
Wohin die nächste Reise geht? Vielleicht auf die Insel Kish im Persischen Golf. Sie gehört zum Iran, war das Ferienparadies des Schahs, ist heute so etwas wie das Experimentierfeld für ein kleines bisschen mehr Freiheiten im Land der Mullahs – und nur dreißig Flugminuten von Dubai entfernt. Oder auf die Andamanen und Nikobaren, die indischen Inselgruppen im Golf von Bengalen, denen die touristische Entdeckung noch bevorsteht. Oder wieder zu Mary und Steven. Weil sie so viel vom nächstgelegenen Nachbarort erzählt haben, von Ulukhaktok auf Victoria Island. Bloß gut anderthalb Flugstunden entfernt. Wenn kein Nebel ist. Klingt gut. Ich werde wohl mal hinfahren.
GESTRANDET … Im addu-atoll
am südlichsten zipfel der malediven
Zielflughafen: Gan
Airport-Code: GAN
Hängenbleibegrund: Flugausfall wegen Monsunregens
Sie sind wieder da, haben ihre Fahrräder an die Hauswand gelehnt, hocken unter dem alten Mangobaum gegenüber von den Fischerbooten, haben die letzten Regentropfen von dem wackeligen Holztisch gewischt, ihr Schachbrett ausgebreitet, die Figuren aufgebaut: wie gestern Morgen. Und wie am nächsten Tag. Ein Tropensturm wie der aus der letzten Nacht bringt die Männer aus Feydhoo und Maradhoo nicht aus der Ruhe. Dass es mal prasselt, blitzt und donnert wie die Ouvertüre zum Weltuntergang: na und, kennen sie genau – und wissen, dass morgens wieder die Sonne am Himmel stehen und der Wind die Wolken weggeschoben haben wird. Dass der Flugplan erst ein, zwei Tage später wieder halbwegs gilt und Urlauber in den Inselhotels entsprechend länger bleiben müssen, ihre internationalen Anschlüsse verpassen? Für sie ist das nicht wichtig, es interessiert sie nicht. Es ist einfach ein unvermeidbarer Begleitumstand. Wahrscheinlich ist es sogar ein Glück. Schließlich kommt man, um hier zu sein. Nicht, um wieder zu gehen.
Die Männer sind an diesem Morgen so entspannt wie immer zu ihrem Schachtisch in Sichtweite des türkis schillernden Ozeans geradelt, haben manche große Pfütze umzirkelt und nun in Teams aus mehreren Spielern nur noch das Schicksal von König und Dame im Blick, während sie mit Strohhalmen jeder eine aufgeschlagene Kokosnuss leer schlürfen. Alltag im Addu-Atoll knapp unterhalb des Äquators.
Manchmal kommen ein paar Neugierige zu Besuch, die ebenfalls mit Rädern unterwegs sind, lehnen ihre Drahtesel an den Mangobaum, schauen den Schachspielern zu, plaudern mit Händen, Füßen und ein paar gemeinsamen Brocken Englisch. Es sind Fahrradurlauber – Leute, die hier die Malediven auf zwei Rädern erkunden. Es sind Robinsons, die nicht mehr auf Eilanden mit hundertfünfzig Metern Durchmesser abtauchen, sondern diesmal etwas sehen wollen. Sie möchten herumkommen im Paradies, wollen schauen, wie die Malediver leben – und fliegen dafür nach Addu ganz unten im Inselstaat.
Es ist ein Atoll mit einsamem Rekord. Über fünf mit Dämmen und Brücken verbundene Addu-Inseln spannt sich die mit siebzehn Kilometern längste Asphaltstraße der Malediven. Zweispurig ist sie, einen akkurat weltstädtischen Mittelstreifen hat sie. Rechts schillert der Ozean in Türkis, links sind es die Kokospalmenhaine in Dunkelgrün, in die hinein sich Dörfer und Gärten ducken. Und auf dem Rückweg ist alles seitenverkehrt.
Ein paar Hundert Meter sind die Querwege lang, allesamt aus Sand, die von der Hauptstraße ins Grün hinein und weiter bis zur gegenüberliegenden Küste der lang gezogenen Inseln abzweigen. Sie führen an bunt gestrichenen Häusern vorbei, an kniehoch ummauerten Gärtchen voller Bananenstauden, an Hängematten und Holzstühlchen, an Moscheen und Friedhöfen und kleinen Läden. Und an vielen lächelnden Menschen, an neugierigen Kindern, die aufgeregt winken. Es sind noch nicht viele Fremde, die nach Addu kommen und hier radeln. Und es ist nicht so, dass sie es immer gedurft haben.
Erst Reformpräsident Mohamed Nasheed, der sich nur drei Jahre im Amt hielt, hat die zuvor praktizierte Trennung zwischen reinen Hotel- und für Fremde fast durchweg verbotenen Einheimischeninseln aufgehoben. Sein diktatorischer Vorgänger Gayoom, unter dessen dreißigjähriger Herrschaft Nasheed sechs Jahre im Gefängnis saß, wollte keine wirkliche Berührung der Kulturen.
Nasheed sah das anders. Alle können voneinander lernen und sich gegenseitig voranhelfen. Die Einheimischen können zudem an den Fremden verdienen, können kleine Cafés eröffnen und Souvenirs verkaufen – und die Touristen plötzlich maledivischen Alltag erleben, Fischern, Handwerkern und Bauern bei der Arbeit zusehen. Und den Schachspielern auf Feydhoo.
Addu galt lange als das vergessene Atoll über siebzig Flugminuten von der Hauptstadt Male, um die herum sich in den gut erschlossenen nördlichen Atollen die meisten Hotelinseln gruppieren. Erst die Eröffnung eines ersten Luxushotels hier unten schaffte plötzlich neue Perspektiven. Von der Resortinsel Villingili sind es acht Speedboat-Minuten bis zu den Schachspielern auf der Insel Gan und den dort bereitstehenden neuen Leih-Fahrrädern an der Siebzehn-Kilometer-Straße. Bis zur Entdeckungstour durch den Insel-Alltag.
Eine Gangschaltung hat keiner dieser Drahtesel – nicht erforderlich auf Inseln, wo maximal dreißig Zentimeter Höhenunterschied zu bewältigen sind. Die Klingel fehlt ebenso – weil auch sie auf Eilanden fast ohne Verkehr keiner braucht.
Orange getüncht ist die Tankstelle für die wenigen Autos hier, die paar mehr Mopeds und Roller. Eine Fahrradpumpe hat der Tankwart dort ebenfalls bereitliegen – falls mal jemandem die Luft ausgehen sollte. Gelb und lindgrün sind die kleinen Restaurants nicht weit davon, kaugummiblau die Schulgebäude. Und so leicht es sich auf dem fast schnurgeraden Asphalt mit Linksverkehr in die Pedale treten lässt, so sehr knirscht und knackt der Korallensand der Nebenstraßen unter den Profilreifen. Und manchmal muss man sich ducken, wenn die Arme kleiner Kokospalmen in den Weg ragen oder Bananenblätter einem einen Klaps an die Stirn zu geben drohen.
Am schönsten ist es dort, wo so etwas geschehen kann: abseits der langen Piste, mitten in den kleinen Straßen. Um die Mittagszeit riecht es nach Reis, nach kräftig gewürztem Fischcurry aus dem hellblauen Steinhaus – und nach gebackenen Früchten aus dem Holzhaus gegenüber. Und Kinder rennen hinter einem Fußball her – wie neulich erst ihre Vorbilder aus der maledivischen Nationalmannschaft, die hier zu Gast waren. Sie hatten für ein Länderspiel trainiert. Ausgetragen wurde das Match später in Malé. Die Insel-Kicker haben drei zu zwei gegen die Philippinen gewonnen. Einer der Schachspieler aus Feydhoo war extra für viel Geld in die Hauptstadt geflogen, um das Nationalteam anzufeuern. Er hatte viel zu erzählen, als er zurückkam: vom Gedränge dort, den vielen Motorrädern, den hupenden Taxis in Malé, den hohen Häusern, der dichten Bebauung, den kurzen Straßen. Der Alltag ist dort ein anderer, und Palmen gibt es fast keine. Man hat sie abgesägt und ausgegraben, um an ihrer Stelle all die vielen neuen Häuser zu bauen. Die Männer aus der Runde schauen ihn mit großen Augen an, einer zieht den aus Holz geschnitzten schwarzen Turm um ein Feld nach rechts. Kaum einer von ihnen hat das Addu-Atoll je verlassen. Sie wissen, dass es viele Inseln nördlich von ihnen gibt und dass irgendwo Festland kommen muss. Aber warum hinfahren? Lieber schnell beim rollenden Kiosk noch eine frische Kokosnuss mit Strohhalm holen.
… am kabini river
in indiens reich der elefanten und tiger
Zielflughafen: Bangalore
Airport-Code: BLR
Hängenbleibegrund: Vollsperrung der einzigen Straße wegen Bauarbeiten an der angrenzenden Staumauer
Meenakshi hat einen neuen Job und musste dafür nach Karnataka umziehen. Mit vierundfünfzig ist das ein großer Schritt – aber jetzt hat sie es angenehmer, arbeitet fürs selbe Geld nur noch halbtags. Vorher war Meenakshi am Strand von Goa zu Hause, hat dort von morgens bis abends immer wieder geduscht, sich dabei bereitwillig fotografieren und manchmal sogar anfassen lassen. Sie ist ins Meer gestiegen, am Strand auf und ab gelaufen, hat fürs Fotografieren ein paar Rupien bekommen, die immer jemand anders für sie eingesteckt hat. Jetzt lebt die Dickhäuterdame als Hotelelefant am Kabini River weit im Binnenland des Subkontinents, duscht dort vormittags mit den Kindern der Gäste, lässt sie anschließend im Sattel Richtung Nagarhole-Nationalpark reiten – und dreht kurz vorm Dschungel wieder um, weil ihr Mahout es so will und es ihr so ebenfalls viel lieber ist.
Manchmal nur hört sie die wilden Elefanten aus dem Wald rufen, leise und aus weiter Ferne, wenn der Wind das Tröten herüberträgt. Zahlreich sind sie. Hunderte, viele mehr als Tiger und Panther zusammen. Sie trampeln durchs Dickicht von Indiens wildreichstem Nationalpark, pflücken Blätter, sind von den Safarigeländewagen aus gut zu beobachten. Genau wie die Affen, die die Autos manchmal ein Stück des Weges begleiten – und sich offenbar zu festen Zeiten zur Menschenbeobachtung in den Bäumen direkt an der Piste durch den Urwald verabredet haben und oftmals lautstark um die besten Plätze rangeln.
Irgendwo in diesen Wäldern wohnte Mogli mit Baghira, tanzte im Dschungel, sang auf den Lichtungen, sprach mit den Tieren der Wildnis. Vielleicht ist er hinter dem Vorhang aus Riesenbambus, aus Lianen und Laub noch immer zu Hause – und hat längst Enkel. Nur Balu der Bär ist ausgewandert. Denn Bären gibt es hier nicht mehr. Aber Tiger sind noch da, auch gut hundertdreißig Jahre nach Rudyard Kiplings »Dschungelbuch«, über fünfzig nach Walt Disneys Zeichentrick-Kinoversion der Abenteuer des kleinen Jungen aus dem Urwald – so viele wie kaum irgendwo anders in Indien: Etwa achtzig Tiger leben im Nagarhole-Nationalpark, mehr noch im unzugänglicheren angrenzenden Bandipur-Nationalpark. Nur zwölfhundert sollen es in freier Wildbahn im ganzen Land insgesamt sein.
Es ist still in den Nationalparks am Kabini River, der aus Kerala kommt, im Nachbarbundesstaat Karnataka gestaut wird und sich in den Weiten Südindiens verliert, ohne je irgendwo zu münden. Von den Bäumen hängen allenthalben grüne Girlanden, bilden dichte Vorhänge, verhindern jeden Blick mehr als zehn Meter hinein in den Wald. Es riecht diesen Morgen ein bisschen nach Schiffsdiesel auf dem breiten Fluss, und es ist, als ob das Safariboot den Frühnebel mit dem Bug vorsichtig in die Kulissen schöbe. Über Nacht ist es repariert worden. Gestern erst saßen die Urlauber stundenlang an Bord fest. Der Motor hatte den Geist aufgeben, und zur Erfrischung ins Wasser zu steigen oder einen Landgang zu wagen, wäre viel zu gefährlich gewesen. Das fühlte sich an wie zu stranden und war doch das Gegenteil davon. Zum Glück tat das Funkgerät noch seinen Dienst, und nach vier Stunden war ein Ersatzboot da, um die Teilzeitabenteurer abzuholen. Mit einem Tag Verspätung knüpfen die meisten von ihnen da an, wo ihr Ausflug zuvor unfreiwillig geendet hatte: voller Überzeugung, dass der Motor diesmal mitmachen werde.





























