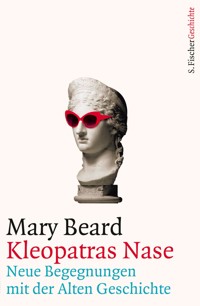Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Die Gesundheitssituation im Schuldienst ist prekärer als in vielen anderen akademischen Tätigkeitsfeldern. Beschäftigte leiden hier überproportional häufig unter Erschöpfungssymptomen, Unzufriedenheit mit der Berufswahl und Überforderungsgefühlen. Das wirkt sich zum einen ganz unmittelbar auf die Lebensqualität der Betroffenen aus. Zum anderen haben Einschränkungen im Wohlbefinden Lehrender durchaus Konsequenzen für Lernende. Guter Unterricht ist auf Dauer nur mit gesunden Lehrerinnen und Lehrern zu bewerkstelligen. Das Buch zeichnet ein differenziertes Bild der Belastungssituation im Schuldienst und liefert praxistaugliche Vorschläge zur Verbesserung des Arbeitsalltags, ergänzt um Konzepte der Stressbewältigung und Präventionsprogramme zur Gesundheitsförderung im Lehrberuf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autoren
Prof. Dr. Ulf Kieschke, Dipl.-Psych., forscht und lehrt seit 2013 als Professor für Empirische Bildungsforschung an der PH Ludwigsburg, Arbeitsschwerpunkte: Lehrerprofessionalisierung; Kompetenz- & Gesundheitsentwicklung in beruflichen Handlungsfeldern; Eignungsdiagnostik & -beratung.
Dipl.-Psych. Felicitas Krumrey ist akademische Mitarbeiterin im Bereich Empirische Bildungsforschung an der PH Ludwigsburg und Gesundheitscoach.
Ulf Kieschke Felicitas Krumrey
Gesundheit und Gesundheitsförderung im Lehrberuf
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2019
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-036078-5
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-036079-2
epub: ISBN 978-3-17-036080-8
mobi: ISBN 978-3-17-036081-5
Vorwort
Als das Polit-Magazin CICERO im Mai 2018 großformatig mit dem Schriftzug »Der Klassenkampf« titelte, war damit keine publizistische Warnsignal- oder Glückwunschrakete anlässlich des 200. Geburtstages von Karl Marx (1818–1883) gezündet worden. Die »Barrikaden«, zu deren Sturm oder Verteidigung geblasen wurde, waren keine Schanzvorrichtungen, die Revoluzzer »alter Schule« aufgetürmt hätten, sondern eher die klassischen Inhalte und Formen von Schule überhaupt. Thema war folglich das, was vor und hinter der Schulbank passiert, und mitnichten das, was in der Bank als Geldhaus seinen Anfang oder sein Ende findet. Die Nachrichten waren wie in revolutionären Zeiten üblich mehr schlecht als recht: »Das Niveau an Deutschlands Schulen sinkt rapide, im internationalen Vergleich fallen sie immer weiter zurück« (CICERO, 5, 2018, S. 4). Zumindest in einer Hinsicht konnte entwarnt werden: »Doch das liegt nicht an den Lehrern. Sondern an einer Politik, die Ideologie und Weltverbesserungspläne vor den pädagogischen Erfolg setzt« (ebd.). Diese Klarstellung trifft sich freilich in einem wichtigen Punkt mit der Auffassung derer, die Probleme im Bildungssystem großzügig »inkompetenten« und/oder »ausgebrannten« Lehrkräften ankreiden. Aus beiden Meinungs-Blickwinkeln werden Lehrerinnen und Lehrer als zentrale Akteure im schulischen Bildungsgeschehen betrachtet (selbst wenn sie den »bildungspolitischen Schlamassel« auszubaden haben, den andere ihnen einbrockten). Besagte Akteure stehen auch im Mittelpunkt unseres Textes. Der ist allerdings anders als der CICERO-Artikel nicht als »Bericht von der pädagogischen Front« (ebd., S. 15) abgefasst. Vielmehr soll in aller Nüchternheit (was hoffentlich nicht heißt, in einem langweilenden Tonfall) begutachtet werden, was die Wissenschaft an zentralen Konzepten, empirischen Befunden und Handlungsempfehlungen zum Thema »Lehrergesundheit« beizusteuern hat. Wir sind keineswegs die Ersten und Einzigen, die das versuchen, und werden mit Sicherheit nicht die Letzten sein (das Thema hatte publizistisch in den vergangenen Jahren regelrecht Hochkonjunktur: vgl. z. B. Klusmann & Waschke, 2018; Rothland, 2013; Nieskens & Nieskens, 2017; Heyse, 2011, 2016; Paulus, 2010). Umso dringlicher scheint es geboten, das Büchlein, das wir den erwähnten verdienstvollen Publikationen beigesellen wollen, mit einer erläuternden Kursangabe auf den Weg zu bringen.
Die Schulforschung kennt Schulen vor allem als naheliegende Studienobjekte und weit weniger als wissenschaftsorganisatorische »Denkkollektive«, die ihr Untersuchungsfeld nach bestimmten Argumentationsmustern und unverwechselbaren Prämissen durchpflügen. Von echten Schulen der Schulforschung zu reden, um deren »Oberhäupter« sich dann »Adepten« mehr oder minder weitläufig scharen, wäre schwierig. Sie existieren wohl nicht in der verhältnismäßig klar umrissenen Gestalt der »Frankfurter Schule« der Kritischen Theorie, der »Bielefelder Schule« der deutschen Geschichtswissenschaft oder der »Münsteraner Schule« um den Philosophen Joachim Ritter. Natürlich aber gibt es inhaltliche und methodische Vorzugsperspektiven, die den Angang eines bildungswissenschaftlichen Themas jeweils zentral prägen. Für unser Vorhaben ist eine solche Rahmung durch die Arbeiten gegeben, die wir dem stark persönlichkeitspsychologisch orientierten Forschungsprogramm der Potsdamer Wissenschaftlergruppe um Prof. Uwe Schaarschmidt verdanken. Im Kern ging es dort um berufsbezogene Selbstregulationsstile, die mitsamt diverser Kontextfaktoren hinsichtlich ihrer Relevanz für Gesundheitschancen genauer angeschaut wurden (vgl. Schaarschmidt & Fischer, 2001; Schaarschmidt, 2005; Schaarschmidt & Kieschke, 2007; Schaarschmidt & Fischer, 2016; Schaarschmidt, Kieschke & Fischer, 2017). Die Affinität zu jenem Ansatz hat zum einen biographische Gründe: Der Erstautor des Bandes, in dem Sie gerade blättern, war über zehn Jahre in der Potsdamer Forschergruppe tätig. Sie ist aber auch – wie wir in unserem Text neuerlich zu zeigen hoffen – sachlich gut vertäut, im Übrigen nicht zuletzt deswegen, weil sie problemlos zu systemischen Betrachtungsweisen aufschließen kann. Es wird (wenn alles nach Plan der Verfasser läuft) deutlich werden, dass ein persönlichkeitspsychologisch grundierter Zugriff auf das Thema »Lehrergesundheit« alles andere als »einseitig« oder »fatal reduktionistisch« ist. Die Behauptung jedenfalls, die Persönlichkeit einer Lehrkraft spiele weder für gesundheitliche Belange noch für die Unterrichtsqualität eine Rolle, wäre ein guter Test-Kandidat für die Tucholsky-Vermutung, manche Aussagen seien so falsch, dass nicht einmal ihr Gegenteil richtig sein könne (vgl. Tucholsky, 1985, Bd. VI, S. 171). Denn natürlich ließe sich der Diskurs ebenso wenig mit der steilen These kapern, an Personeneigenschaften hänge einfach alles. Persönlichkeit absorbiert, ersetzt oder entwertet längst nicht die Wirkung anderer themeneinschlägiger Faktoren (Fachlichkeit, Didaktik, Strukturmerkmale des Arbeitssettings etc.).
Wie immer gilt: Zum Gelingen des Bandes haben viele beigetragen, zum Misslingen wir alleine. Wir danken ausdrücklich Herrn Prof. Wilfried Schubarth, der den Text angeregt hat, den Mitarbeiter*innen des Kohlhammer-Verlages, die das Projekt konstruktiv begleitet haben, Frau Dr. Simone Wittmann, die bei der Endredaktion des Manuskripts behilflich war und den Mitgliedern des Berliner Montags-Kolloquiums, deren Impulse gern aufgenommen wurden (insbesondere Herrn Dipl.-Psych. Matthias Heyne ist Dank für vielfältige Rückmeldungen und Fingerzeige abzustatten!).
Dieses Buch sei in herzlicher Verbundenheit Uwe Schaarschmidt gewidmet.
Ludwigsburg, im März 2019
Ulf Kieschke
Felicitas Krumrey
Inhalt
Vorwort
Einleitung
1 Grundkonzepte der Gesundheitsforschung
1.1 Was ist Gesundheit?
1.2 Zum Begriff der Gesundheitsressource
1.3 Gesundheit ist relativ?!
1.4 »Stress« im Fokus der Gesundheitsforschung
2 Zur Gesundheitssituation im Lehrerberuf
2.1 Anmerkungen zu Strukturbesonderheiten des Tätigkeitsfeldes
2.2 Exkurs: Persönlichkeit und Gesundheit
2.3 Die Potsdamer Lehrerstudie im Überblick
3 Über Geschlechtsunterschiede im Belastungserleben von Lehrkräften
3.1 Zu Geschlechtsdifferenzen in Krankheitsrisiken und Gesundheitschancen
3.2 Lehrerinnen und Lehrer im AVEM- Vergleich
4 Gesundheitsförderung im Lehramtsstudium
4.1 Eignungsberatung für angehende Lehrkräfte
4.2 Kompetenz- und Gesundheitstrainings im Lehramt
5 Lehrergesundheit als Thema in Schulentwicklungsprozessen
5.1 Warum Gesundheit keine rein individuelle Angelegenheit ist. Eine kurze Problemskizze zur Einführung
5.2 Führungshandeln als Gesundheitsdeterminante in Schulen
5.3 »Denkanstöße!« – ein Unterstützungsprogramm für Kollegium und Leitung (Schaarschmidt & Fischer, 2016)
6 Schlussbetrachtungen
Literaturverzeichnis
Einleitung
Ein kompetenter Mensch ist, wer sich den Regeln gemäß irrt.P. Valéry, Schlimme Gedanken und andere (Werke, Bd. V, S. 465)
Feuerzangenbowlen-Gemütlichkeit stellt sich eher selten ein, wenn vom Lehrerberuf die Rede ist. Es sei denn, dies geschieht auf die charmant-verschmitzte Art, in der Heinz Rühmann als Pfeiffer »mit drei f« dem Publikum des legendären Ufa-Klassikers zuprostete (vgl. zur hochdramatischen Produktionsgeschichte des Films: Ohmann, 2010). Aus Sicht manches Außenstehenden entschädigen Langzeitferien, relative Arbeitsplatzsicherheit bei guter Bezahlung und familienfreundliche Verpflichtungen zur Halbtagspräsenz vor Ort aber allemal für die Härten des Jobs, die keineswegs geleugnet werden (schwierige Schüler in zu großen Klassen; Unterrichtsvor- und -nachbereitungsaufwand etc.). Das Heikle dabei: Solche Einschätzungen verfehlen wichtige Aspekte der Berufspraxis (z. B. den Verwaltungsanteil der Tätigkeit und den Fakt, dass der Ausbau von Ganztagsschulangeboten stetig voranschreitet). Sie verharmlosen zudem eine in vielen wissenschaftlichen Studien offengelegte Problematik. Die Gesundheitssituation im Schuldienst nämlich ist prekärer als in anderen akademischen Arbeitsfeldern. Beschäftigte leiden hier überproportional häufig unter Erschöpfungssymptomen, Unzufriedenheit mit der Berufswahl und Überforderungsgefühlen (einige Studien beziffern die Gruppenstärke akut Betroffener in der Gesamtlehrerschaft auf über 50 %; vgl. Schaarschmidt & Kieschke, 2007). Das lässt nun in mehrfacher Hinsicht aufhorchen. Erstens geht es um die Lebensqualität Hunderttausender von Menschen. Zweitens sind Gesundheit und berufliche Leistungsfähigkeit fraglos miteinander verknüpft: Einschränkungen im Wohlbefinden Lehrender haben mitunter empirisch greifbare Konsequenzen für Lernende (vgl. z. B. Klusmann, Richter & Lüdtke, 2016; Pakarinen et al., 2010). Guter Unterricht ist auf Dauer jedenfalls nur mit gesunden Lehrerinnen und Lehrern zu bewerkstelligen. Gesundheitsprobleme verursachen drittens über den subjektiven Leidensdruck hinaus handfeste objektive Kosten (Stichworte: Kompensation von krankheitsbedingten Unterrichtsausfällen; finanzielle Aufwendungen für medizinische und/oder psychologische Behandlungen, gegebenenfalls gar für eine vorzeitige Pensionierung etc.).
Vor jenem Hintergrund soll unser Buch das Thema Lehrergesundheit detaillierter aufrollen. Wir werden uns zu diesem Zweck einerseits auf Befunde der angewandten Gesundheitspsychologie und zum anderen auf Beiträge aus dem Gebiet Schulentwicklungsforschung stützen. Die Darstellung ist in fünf Großkapitel gegliedert.
Das erste Kapitel macht mit basalen Konzepten der Gesundheitsforschung vertraut. Zunächst widmen wir uns der aktuellen Debatte um den Gesundheitsbegriff. Es wird zu betonen sein, dass Einschätzungen psychischen und körperlichen Befindens je nach Perspektive und Bezugssystem durchaus unterschiedlich ausfallen können. So verfügen Mediziner über andere Analyse- und Bewertungsraster als Laien. Noch weitere Punkte sind relevant. Um vorab nur zwei zu nennen:
♦ Diagnosesysteme und Problematisierungstrends wandeln sich im Laufe der Zeit.
♦ Eigene Erwartungen und Vergleiche mit bedeutsamen Bezugspersonen im sozialen Umfeld haben Einfluss auf subjektive Gesundheitsurteile. Derlei »Kalibrierungseffekte« können mit wechselnden Intensitäten bis ins hohe Erwachsenenalter auftreten.
Kurzum, Gesundheit muss als ebenso vielschichtiges wie dynamisches Phänomen verstanden werden. Herauszustellen bleibt ferner, dass Gesundheit nicht lediglich schicksalhaftes Widerfahrnis, sondern zu Teilen eine eigenverantwortlich auszufüllende Gestaltungsaufgabe ist. Statistiken zur Gesundheitssituation in der Gesamtbevölkerung weisen psychische Beeinträchtigungen als prominenten Problembereich aus (vgl. Ellert & Kurth, 2013). Als wichtiger Ursachen- oder doch Symptomverstärkungs-Komplex gilt da (berufliche) Überlastung (»Stress«). Stress spielt zudem eine signifikante Rolle in der Entwicklung körperlicher Erkrankungen. Folgerichtig wird das Stresskonzept näher unter die Lupe zu nehmen sein.
Das zweite Kapitel bereitet Theorien und Befunde zum Belastungsgeschehen im Schuldienst genauer auf. Ein Schwerpunkt wird in der pointierten Zusammenfassung zentraler Resultate der Potsdamer Lehrerstudie (Schaarschmidt, 2005; Schaarschmidt & Kieschke, 2007) liegen. Kernidee besagter Untersuchung war es, ein differenziertes Bild der Belastungssituation im Tätigkeitssektor Schule zu zeichnen und praxistaugliche Vorschläge zur Optimierung des Arbeitsalltags abzuleiten. Besonderes Augenmerk ruhte auf Persönlichkeitsfaktoren, die einen gesundheitsförderlichen Umgang mit den Anforderungen des Berufes erleichtern. Diese deutschlandweit bisher größte Studie zum Thema schärfte den Blick für zweierlei: dafür, dass Strukturmerkmale des Jobs unterschiedlich belastungsrelevant sind (einige Probleme wiegen generell schwerer als andere) und dafür, dass die gesundheitlichen Resonanzeffekte desselben Umweltfaktors zwischen einzelnen Personengruppen bedeutsam abweichen können.
Kapitel 3 erweitert die Diskussion um geschlechtsbezogene Analysen. Zu den konsistentesten Ergebnissen der Belastungsforschung zählt der Befund, dass Frauen über stärkere körperliche und psychische Beeinträchtigungen klagen als Männer. Das zeigt sich nicht zuletzt (und gar mit besonderer Prägnanz!) im Lehrerberuf. Wir wollen möglichen Gründen dafür nachgehen. Geschlechtsbezogene Re-Analysen von Daten aus der Potsdamer Lehrerstudie werden in diesem Zusammenhang einen wichtigen Referenzpunkt bilden.
Liefern die vorgängigen Kapitel Bausteine zu einer Diagnostik der Lehrergesundheit, fasst Kapitel 4 Maßnahmen zum Umgang mit den geschilderten Problemen ins Auge. Die beste Vorbereitung auf spätere Praxis ist bekanntlich: frühe Praxis (optimaler Weise gut angeleitet und selbstkritisch reflektiert). Das hat seine Berechtigung selbstverständlich auch in Sachen Gesundheitsvorsorge. Wir wollen deshalb an ausgewählten Beispielen verdeutlichen, dass und wie entsprechende Handlungsschritte bereits im Lehramtsstudium umsetzbar sind. Speziell Fragen der Eignungsberatung und der Ausrichtung von Stressbewältigungstrainings werden uns beschäftigen. Zumindest streifen wollen wir außerdem ein Kompetenzfeld, das nach unserer Einschätzung immer noch eher stiefmütterlich »beackert« wird: Stimmbildung und Sprecherziehung. Reden gehört schließlich zu den Haupttätigkeiten im Klassenraum. Stimme und sprachlicher Ausdruck sind gewiss nicht alles, aber ohne adäquate Beherrschung jener Wirkregister ist alles nichts. Umso dringlicher erscheint es, diese Instrumente gut zu »warten« und um die Tragweite stimmlicher Effekte zu wissen (z. B. für die Ausstrahlung von Kompetenz und Autorität).
Kapitel 5 verschiebt den Fokus auf Gesundheitsfragen in Schulentwicklungsprozessen. Gesundheitschancen sind nie bloß »Privatsache« der Lehrkraft. Vielmehr werden sie zwischenzeitlich als prominentes Qualitätskriterium von Schule überhaupt gewürdigt. Dahinter steckt die Überzeugung, dass sich Leistungsfähigkeit und die Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung im Kollegium langfristig nur sichern lassen, wenn die organisationalen und »schulklimatischen« Voraussetzungen stimmen. Eingedenk dieser Prämisse sollen Möglichkeiten beleuchtet werden, Gesundheit als Aufgabenschwerpunkt in Schulmanagementansätzen nachhaltig zu verankern. Wir wollen uns dem Thema in zwei Schritten nähern. Zuerst sind Gesundheitseffekte schulischen Führungshandelns und ihre Bedeutsamkeit für etwaige Präventions- und Interventionsangebote zu eruieren. Dann möchten wir für systemische Herangehensweisen, wie sie die (arbeits)medizinische und psychologische Berufsforschung vorschlägt, anhand eines konkreten Praxisprojektes werben: des Programms »Denkanstöße!« (Schaarschmidt & Fischer, 2016).
Eine kurze Zusammenfassung der Kernargumente des Bandes und einige Überlegungen zu weiteren Forschungs- und Praxisperspektiven sollen unsere Bestandsaufnahme abrunden.
1 Grundkonzepte der Gesundheitsforschung
1.1 Was ist Gesundheit?
Wer nach Gesundheit fragt, geht buchstäblich aufs Ganze. Immerhin wurzelt der Begriff sprachgeschichtlich im Bedeutungsfeld »vollständig, heil und ganz« (lateinisch: »sanus«, mit dem auch das althochdeutsche Wort »suona« [= Befriedigung, Sättigung] verwandt sein soll, das noch im heutigen »Gesundheit« anklingt)1. Von daher hat es eine eigene Plausibilität, wenn im Falle von Unwohlsein und Krankheit mit der Erkundigung nachgehakt wird, was denn fehle – und nicht etwa mit der, was dazugekommen sei (z. B. an Symptomen und Beschwerden).
Egal jedoch, wie man es dreht und wendet: Die Konzepte »gesund« und »krank« bleiben als Gegensatzpaar zwangsläufig aufeinander bezogen. Sie reihen sich insofern in die lange Tradition dualistisch geprägter Wirklichkeitsbeschreibungen ein (hell – dunkel; gut – schlecht; arm – reich etc.). Dieses Referenzverhältnis ist selbst durch den Einspruch, Gesundheit sei mehr als die bloße Abwesenheit von Krankheit, keineswegs erschüttert oder ausgehebelt. Krankheit wird weiterhin ein Fluchtpunkt jeder Gesundheitsdebatte sein. Die amerikanische Essayistin Susan Sontag hat jene unauflösbare Polarität einmal in das schöne Bild gekleidet, allen Menschen sei eine Art »doppelte Staatsbürgerschaft« verbrieft: eine im Königreich der Gesunden und eine im Königreich der Kranken (vgl. Sontag, 1991, S. 3). Während wir noch die Vorzüge der ersterwähnten Dependance auskosten, knistern in unserer Tasche bereits die Aufenthaltspapiere für den zweiten Wohnsitz. Trösten mag man sich da mit dem lakonischen Bescheid Jean Pauls, dass auch jede Gesundheit – wenn sie nur lang genug dauere (etwa 70, 80 Jahre) – tödlich sei (vgl. Jean Paul, 1996, S. 239).
Symptomfreiheit ist nach gängigem Verständnis das »Leitsymptom« von Gesundheit. Das Unbehagen an einer Sichtweise, die schon im »Schweigen der Organe«2, ergo: im reibungslosen Normalbetrieb biologischer Wirkeinheiten die Ideallinie menschlichen Befindens erkennt, rührt anderswoher. Man befürchtet schlicht eine unnötige Verkürzung von Erörterungsperspektiven. Kritisch beäugt wird eher der Zuschnitt der Fragen als der Gehalt bisheriger Antworten. Durch eine Fokussierung auf Risiken und Barrieren, die den psychosomatischen Normalbetrieb behindern, geraten demnach schnell all jene Faktoren aus dem Blick, die Problemlösungen und Anpassungsprozesse begünstigen. Das wird zumal von Vertretern des salutogenetischen Ansatzes der Entwicklungsforschung bekräftigt (Salutogenese, von lateinisch »salus« [= Wohl, Zufriedenheit] und griechisch »genesis« [= Entstehung, Herkunft]). Deren Erkenntnisinteresse richtet sich weniger auf das, was Gesundheitschancen potenziell mindert, als auf das, was sie stabil hält oder vergrößert – und zwar sogar unter widrigen Umständen. Zum Thema werden deshalb situative und persönlichkeitsgebundene Einflüsse auf Vitalität und Widerstandsfähigkeit (für jenen Zielkomplex hat sich der Fachterminus »Resilienz« eingebürgert; vgl. Antonovsky, 1979, 1987; Bengel, Strittmatter & Wittmann, 2001). Eine solche Schwerpunktsetzung stößt trotz ihrer unbestrittenen Verdienste gelegentlich auf Kritik (Infobox 1).
Infobox 1: Zur Kritik des salutogenetischen Ansatzes
Die Suche nach Widerstandsfaktoren und »Immunisierungsstrategien« gegen äußere Störeinflüsse hat nach Einschätzung mancher Kritiker etwas Kleinmütig-Duldsames, das im schlechtesten aller Fälle Bemühungen hintertreibe, ein Übel wirklich an der Wurzel zu packen (vgl. Bröckling, 2017). Statt einen drohenden Schaden konsequent abzuwehren, würden Optionen ausgelotet, Schäden besser bewältigen oder verkraftbar machen zu können. Das Interesse an Maßnahmen, mit denen erwartete Negativfolgen eines Risikoereignisses abgefedert werden sollen, überlagere dann das Interesse an effektiver Risikominimierung (die zunächst vielleicht teurer sei). Man wolle auf das Worst-Case-Szenario gut vorbereitet sein, ohne seiner Entstehung nachhaltig vorzubeugen. Der »schwarze Peter« des Spiels lande deshalb häufig bei denen, die für Herausforderungen ungenügend gewappnet seien (gemäß der Devise »Ist der Druck zu stark, bist Du zu schwach.«). Die Diskussion kreise so eher um Verhaltensdefizite (»mangelnde Belastbarkeit«) als um veränderungsbedürftige Verhältnisaspekte (»Zuviel an Belastungen«).
Tatsächlich wäre es fatal, Verhaltens- gegen Verhältnisanalysen auszuspielen. Die Ansätze sind keine konkurrierenden »Weltanschauungen«, sondern ergänzen einander fruchtbar und adressieren Problembereiche, die bei allen wechselseitigen Abhängigkeiten sehr wohl unterschieden werden können (vgl. Dadaczynski & Paulus, 2018). Diese Unterscheidbarkeit nötigt ja längst nicht zu einer rigorosen Trennung der beiden Aspekte. Der Philosoph Herbert Schnädelbach hat mit Nachdruck die Beachtung jener Differenz angemahnt: »Offenbar macht im Denken die Unterscheidung zwischen ›Unterscheiden‹ und ›Trennen‹ Schwierigkeiten, während man wohl nicht in allen Fällen, in denen man den Kopf seines Gegenüber von dessen Rumpf unterscheidet, sofort zur Trennung überzugehen bereit ist« (Schnädelbach, 1999, S. 16).
In Abgrenzung zu pathogenetischen Herangehensweisen, die Krankheitsursachen aufdecken und beseitigen wollen, ist es das Hauptanliegen salutogenetischer Forschungsprogramme, Gesundheitsursachen zu identifizieren und in ihrer Wirkung zu verstärken. Die beiden Zugänge sind dabei keineswegs in dem Sinne redundant, dass der eine Ansatz lediglich die Befunde, Theorien und Modellrechnungen des anderen durch einen simplen Vorzeichenwechsel umpolen würde (nach dem Motto »Ein Mangel an Gefährdungsmomenten spricht bereits für ein Befindens- und Funktionsoptimum.«). In dem Maße, in dem Risiken schwinden, wachsen nicht automatisch Gesundheitschancen; was an Negativem entfernt wird, polstert Positivkonten nur selten um gleiche Beträge auf. Um es an einem Beispiel zu veranschaulichen: Der Verzicht auf Fett- und Alkoholkonsum (Wegfall von Risikofaktoren) erhöht die Werte einiger Gesundheitsindikatoren eklatant (günstige Stoffwechseleffekte; Anhebung des körperlichen Leistungsvermögens etc.), die anderer möglicherweise kaum oder erst mit deutlichem Zeitverzug (Lebenszufriedenheit; Genusserleben etc.). Es gibt nun Bedingungselemente, die das eine wie das andere zu erklären vermögen (die Abstinenz und eine hohe Lebenszufriedenheit), aber ebenso Faktoren, die eher das eine oder das andere verständlich werden lassen. Vorstellbar wären Variablenkonstellationen, die mit der Prognose von Erkrankungen vergleichsweise wenig, mit der langfristigen Vorhersage von Zufriedenheit und Handlungstüchtigkeit hingegen relativ viel zu schaffen haben. Diese Merkmale verdienten nach Logik der salutogenetischen Argumentation besondere Beachtung. Knapp und bündig: Das Gute ist etwas anderes (oder doch mehr) als das Schlechte, das uns verschont (vgl. Faltermaier, 2005, 2018; Franke, 2012).
Der Leser ahnt es längst: Das vorgängige Beispiel fußt auf einer Prämisse, die ihrerseits genauer auf Plausibilität und Tragweite abgeklopft werden sollte. Vorausgesetzt wurde augenscheinlich, dass der Begriff Gesundheit positive Bestimmungsstücke hat, in sich also differenzierter ist, als es die Sprachregelung vorgaukelte, Gesundheit sei das homogene Kontrastbild zu Krankheit (jedenfalls war gerade die Rede von verschiedenen Gesundheitsindikatoren). Ähnlich wie der philosophische Großbegriff »Freiheit« negativ (»Freiheit wovon?«) und positiv gefasst werden kann (»Freiheit wozu?«), birgt das Konzept Gesundheit offenbar eine Doppelreferenz: eine negative (»Freiheit von Beschwerden«) und eine, die positive Zielattribute umspannt. Solche sind explizit schon in dem berühmten Definitionsvorschlag erwähnt, der das Gründungsdokument der »World Health Organization« einleitet: »Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.« (Im Original: »Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity«, WHO, 1946, S. 1.) Ein Zustand vollumfänglicher Zufriedenheit mit der zitierten Definition wurde freilich nie erreicht. Kritiker bemängelten vor allem drei Punkte (vgl. Schramme, 2012):
♦ Der Satz umreißt eine Maximalvorgabe. Die Frage ist deshalb weniger, ob jemand nach WHO-Perspektive gesund oder krank ist, sondern eher, in welcher Entfernung vom kaum erreichbaren Befindensoptimum der Betreffende »strandet«. Als hehres Gestaltungsziel mag das dort Behauptete Strahlkraft haben, zur Beschreibung der »schnöden Realität« taugt die Einlassung weniger. Empirische Forschungsresultate ernüchtern zwischenzeitlich über den Verbreitungsgrad einer so auf den Begriff gebrachten Gesundheit. Nur eine von 20 Personen bejaht die Frage, ob sie vollständig gesund sei. 95 % der Über-18-Jährigen vermelden mindestens ein Gebrechen; jeder dritte Erwachsene berichtet mehr als fünf Gesundheitseinschränkungen, die ihn aktuell betreffen (vgl. Vos et al., 2015, die Daten aus 188 Ländern für ihren Report ausgewertet haben). Die oft und gern beschworene »normative Kraft des Faktischen« lässt da die faktische Verbindlichkeit der WHO-Idealnorm gefährlich kippeln.
♦ Definitionen scheitern mitunter an dem, was dem Wortsinne nach ihr eigentlicher Auftrag ist: Grenzziehungen (»definitio«, lat.: Umgrenzung). Wird ein Sachverhalt vom Begrifflichen her zu weitläufig abgezirkelt, hat man das Problem, dass jenseits der Grenze wenig übrigbleibt. Beinahe alles gehört dann irgendwie dazu. Derartige Bedenken wurden auch im Hinblick auf die WHO-Definition geäußert (vgl. Callahan, 2012). Sie erwecke den Eindruck, Übel jeglicher Coloeur (von diplomatischen Krisen und Extremwetterlagen über unhöfliches Verhalten bis hin zu schlechten Scherzen und Schulhofprügeleien) seien letzten Endes »gesundheitliche Angelegenheiten«. Das rufe die Frage auf den Plan, ob hierdurch nicht Grenzen zwischen Zuständigkeitsclaims von Politik, Wissenschaften und lebensweltlichen Aushandlungsprozessen kontraproduktiv verwischt werden.
♦ Die Definition blendet dynamische Elemente des Gesundheitsgeschehens weitgehend aus. Sie sieht als statisch an, was seiner Natur nach fragil und prozesshaft ist. Unterschätzt wird das enorme Veränderungspotenzial, das dem Phänomen innewohnt.
Dass die geschilderten Einwände erhebliche diskursive Durchschlagkraft hatten, ist an der 1986 von der WHO veröffentlichten Neudefinition des Begriffes ablesbar. Dort heißt es: »Gesundheit ist ein positiver funktioneller Gesamtzustand im Sinne eines dynamischen biopsychologischen Gleichgewichtzustandes, der erhalten bzw. immer wieder hergestellt werden muss« (zit. nach Knoll, Scholz & Rieckmann, 2017, S. 21). Einige Implikationen der abgeänderten Begriffsfassung seien eigens hervorgestrichen.
♦ Erstens: Statt auf die völlige körperlich-psychische Unversehrtheit abzuheben, wird konsequent auf eine funktionale Sichtweise umgeschwenkt. In den Vordergrund rückt die Frage, ob jemand den Anforderungen seines Alltags und den Erwartungen an die soziale Rolle, in der er jeweils agiert (z. B. Vorgesetzter, Vater, Verkehrsteilnehmer), gerecht werden kann. Und das glückt im besten Falle sogar dann, wenn der Betreffende gehbehindert, Diabetiker oder alleinlebender Hundephobiker ist (womit er durch die Raster der klassischen WHO-Gesundheitsdefinition von 1946 gerutscht wäre).
♦ Zweitens: Gesundheit wird begrifflich als eine Art Fließgleichgewicht mit unsicheren Grenzen modelliert; das »System« ist in Bewegung. Es wird von Veränderungsimpulsen angetrieben und erzeugt selber welche. Man bleibt ihm gleichwohl nicht schicksalhaft ausgeliefert, sondern trägt durch Tun oder Unterlassen selbstverantwortlich zu den Verlaufseigenschaften des schwierigen Balance-Aktes bei.
♦ Drittens schließlich: Körperliche und psycho-soziale Prozesse sind über viele Regelkreise funktional miteinander verflochten; ihre Interaktion verlangt zwingend eine ganzheitliche Betrachtung. Werden körperliche Symptome z. B. einzig als Teilstörungen autonomer Zell- oder Organverbände »verarztet«, kann das zu kurz gesprungen sein (ebenso wie die Behandlung psychischer Symptome ohne Beachtung somatischer Korrelate).
Man mag den neueren Definitionsvorschlag einigermaßen abstrakt oder – nun ja – »blutleer« finden (wenn das Wort in unserem Kontext erlaubt ist). Tatsächlich waren und sind Bemühungen im Gange, wichtige Bezugspunkte des so verstandenen Gesundheitskonzepts präziser auszuarbeiten. Frank, Vaitl und Walter (1990) etwa unterscheiden sieben Facetten körperlichen Wohlbefindens (von »Genussfreudigkeit« über »Gepflegtheit/Frische« bis hin zu »Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit«). Schaarschmidt und Kieschke (2007, S. 29) wiederum bündeln Inhalte der aktuellen Debatte um eine sachgemäße Bestimmung psychischer Gesundheit zu einem vorläufigen Fazit: »Psychisch gesund ist … ein Mensch, dem es im Alltag gelingt, sich engagiert und doch entspannt den Anforderungen zu stellen, der über eine positive Einstellung zu sich selbst und zu den eigenen Wirkungsmöglichkeiten verfügt, der Ziele verfolgt, in seinem Tun Sinn erfahren kann und sich sozial aufgehoben fühlt.« Das zur Sprache gebrachte Merkmalsprofil psychischer Gesundheit wird nicht einfach als »biologische Mitgift« vererbt (als sei es wie Glück etwas, was man »hat« oder nicht). Vielmehr gewinnt es Kontur erst in der individuellen Auseinandersetzung mit aktuellen Gegebenheiten und Aufgaben. Die Forschung interessiert sich für Rahmenbedingungen solcher Auseinandersetzungsprozesse unter dem Schlagwort Gesundheitsressourcen. Sie meint damit Einflussgrößen, die in einem empirisch nachweisbaren Zusammenhang mit Selbstbehauptungsfunktionen des Menschen stehen. Der nächste Abschnitt soll das etwas genauer erläutern.
1.2 Zum Begriff der Gesundheitsressource
Eine prägnante Definition des Ressourcenbegriffes stammt von Grawe (2000). Der Terminus ziele auf das individuelle Potenzial zur Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse. Alles, was einschlägige Bemühungen fördere und gegen äußere Störungen abschirme, habe Ressourcenfunktion. Im Rahmen seiner Theorie zu psychotherapeutischen Wirkfaktoren listet Grawe (2000) vier Grundbedürfnisse des Menschen auf:
♦ das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle,
♦ das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung,
♦ das Bedürfnis nach Bindung sowie
♦ das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz.3
Die Faktoren nun, die unsere Chancen auf Befriedigung der genannten Bedürfnisse steigern, können materieller oder immaterieller Natur sein. Einige haben ein eher individuell-persönliches Gepräge, andere tragen systemischen Charakter. Sie sind mithin auf verschiedenen Ebenen der Mensch-Umwelt-Interaktion angesiedelt. Hurrelmann, Klotz und Haisch (2014, S. 16) z. B. unterteilen Gesundheitsressourcen nach folgenden Hauptkategorien:
♦ Umweltfaktoren (Güte des Lebensraums, beschreibbar etwa durch Indikatoren für die vorhandene Infrastruktur oder für Luft- und Wasserqualität),
♦ soziale und wirtschaftliche Faktoren (sozio-ökonomische Bedingungen der Lebensführung, berufliche und private Netzwerke) sowie
♦ behaviorale und psychische Faktoren (Gesundheitsverhalten, emotionale, kognitive und soziale Kompetenzen etc.).