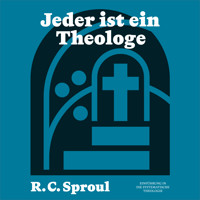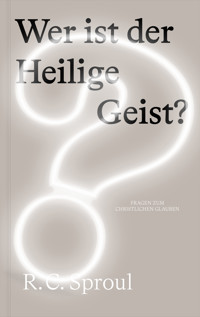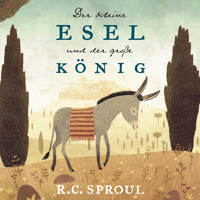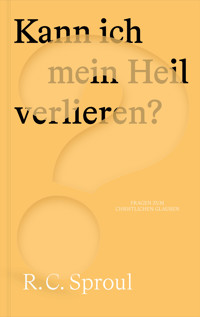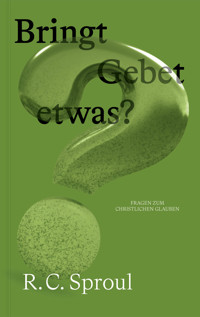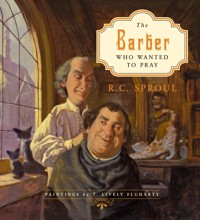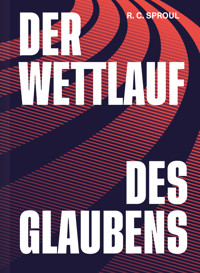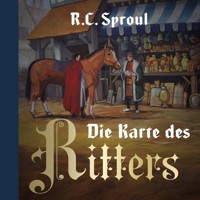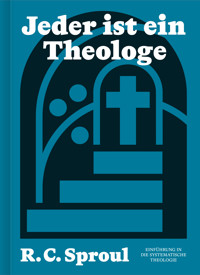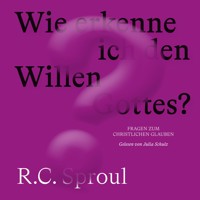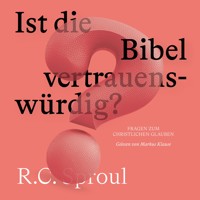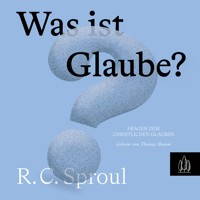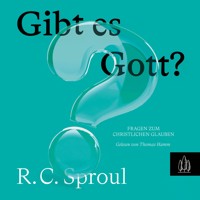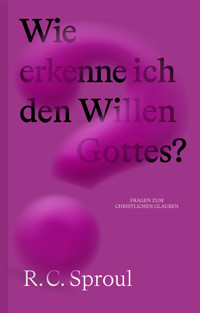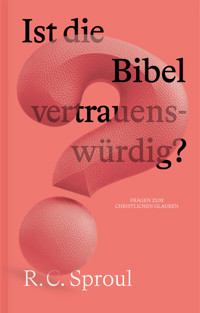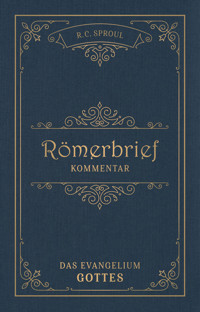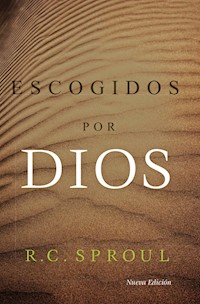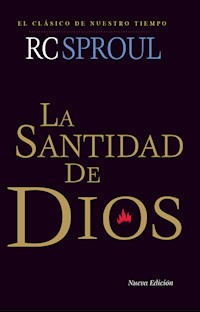Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbum Medien gGmbH
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Fragen zum christlichen Glauben
- Sprache: Deutsch
Viele Menschen glauben an Gott. Aber kann man beweisen, dass es ihn gibt?Oder müssen wir den Verstand ausschalten und einfach glauben?R.C. Sproul widerlegt in diesem Buch gängige Argumente gegen die Existenz Gottes und zeigt: Glaube bedeutet nicht, den Verstand auszuschalten. Logik und Vernunft weisen uns vielmehr auf die Existenz Gottes hin und nehmen uns jede Entschuldigung, nicht an ihn zu glauben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 78
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Viele Menschen glauben an Gott. Aber kann man beweisen, dass es ihn gibt? Oder müssen wir den Verstand ausschalten und einfach »glauben«?
R.C. Sproul widerlegt in diesem Buch gängige Argumente gegen die Existenz Gottes und zeigt: Glaube bedeutet nicht, den Verstand auszuschalten. Logik und Vernunft weisen uns vielmehr auf die Existenz Gottes hin und nehmen uns jede Entschuldigung, nicht an ihn zu glauben.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über dnb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
TITEL DES ENGLISCHEN ORIGINALS Does God Exist?
© 2019 by R.C. Sproul
Published by Reformation Trust Publishing A division of Ligonier Ministries 421 Ligonier Court, Sanford, FL 32771 This edition published by arrangement with Ligonier Ministries.
All rights reserved.
Wenn nicht anders angegeben, wurde folgende Bibelübersetzung verwendet: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
© 2022 Verbum Medien gGmbH,
Bad Oeynhausen
verbum-medien.de
ÜBERSETZUNG
Katie Domke
LEKTORAT
Florian Gostner
BUCHGESTALTUNG
UND SATZ
Annika Felder
1. Auflage 2022
Best.-Nr. 8652028
E-Book 978-3-98665-029-2
Solltest du Fehler in diesem Buch entdecken, würden wir uns über einen kurzen Hinweis an [email protected] freuen.
Gibt es Gott?
FRAGEN ZUM CHRISTLICHEN GLAUBEN
R. C. Sproul
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
•
Der Gottesbeweis
•
Vier Möglichkeiten
•
Die Illusion des Descartes
•
Selbsterschaffung, Teil 1
•
Selbsterschaffung, Teil 2
•
Selbstexistenz
•
Das notwendige Wesen
•
Der Gott der Bibel gegen den Gott der Philosophie
•
Kants moralisches Argument
•
Nichtigkeit der Nichtigkeiten
•
Die Psychologie des Atheismus
Der Gottesbeweis
•
Das Buch Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant war ein Wendepunkt in der Geschichte der Philosophie und des Nachdenkens über Gott. In seinem Werk legte Kant eine umfangreiche Kritik der gängigen Argumente für die Existenz Gottes dar. Das zwang die Kirche, sich mit wichtigen Fragen auseinanderzusetzen: Auf welche Weise betreiben wir von nun an Apologetik (d. i. die Verteidigung des Glaubens)? Wie können wir sinnvoll für die Existenz Gottes argumentieren, ohne uns selbst in den Schwierigkeiten zu verstricken, die Kant anspricht? Es gab verschiedene Ansätze, diese Fragen zu beantworten.
Der sogenannte Fideismus zum Beispiel besagt, es sei nicht möglich, überzeugend für die Existenz Gottes zu argumentieren. Stattdessen müsse die Überzeugung von Gottes Existenz auf Glauben beruhen. Viele Theologen und Christen sind dieser Ansicht. Manche gehen sogar noch einen Schritt weiter, indem sie sagen, Menschen müssten einfach den Sprung ins kalte Wasser wagen — in der Hoffnung, dass jemand sie auffängt.
Dieser Ansatz hat seine Schwächen. Auch wenn der Glaube eine entscheidende Rolle im Christentum spielt, gibt es einen Unterschied zwischen Glauben und Dummheit. Viele beteuern jedoch, das christliche Leben des Glaubens würde die Vernunft ausschließen. Der Kirchenvater Tertullian zum Beispiel fragte: »Was hat Jerusalem mit Athen zu tun?« Er sagte außerdem: »Ich glaube an das Christentum, weil es absurd ist.« Wenn Tertullian hiermit meinte, das Christentum sei aus weltlicher Perspektive absurd, können wir zustimmen. Wenn er hingegen meinte, es sei objektiv gesehen absurd, ist das eine ernsthafte Beleidigung von Gottes Charakter und dem Heiligen Geist, dem Geist der Wahrheit.
Ein anderer Ansatz, der sogenannte Evidentialismus, besagt, dass der christliche Glaube mithilfe der Geschichte verteidigt werden kann. Viele Apologeten verfolgen diesen Ansatz in der Annahme, dass Argumente aus dem Bereich der Geschichte zwar nicht für absolute Gewissheit sorgen können, aber ein hohes Maß an Wahrscheinlichkeit bieten. Diese hohe Wahrscheinlichkeit führt zu der sogenannten »moralischen Gewissheit« (Eine Gewissheit, die für praktische Zwecke bzw. für das Handeln ausreicht, die aber keine »apodiktische« bzw. mathematische oder absolute Gewissheit bietet.). Auch wenn diese Argumente nicht die gleiche Sicherheit bieten wie die logische Deduktion, so seien sie doch stark genug, um den Menschen keine moralischen Schlupflöcher zu lassen.
In unserem Rechtssystem liegt die Beweislast bei der Staatsanwaltschaft, wenn Menschen aufgrund eines Verbrechens angeklagt werden. Sie muss beweisen, dass die Person zweifelsfrei schuldig ist. Auf ähnliche Weise versuchen Evidentialisten aufzuzeigen, dass die Geschichte so deutlich die Existenz Gottes beweist, dass es keine begründeten Zweifel gibt, die dagegen sprechen. Die Beweismittel seien sogar so eindeutig, dass nur ein Narr ihre Schlussfolgerung leugnen würde.
Das Problem dieses Ansatzes liegt darin, dass ein Sünder sich auch angesichts nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit noch immer einen Ausweg bahnen kann, indem er sagt: »Du konntest es mir nicht zweifelsfrei beweisen. Es mag vielleicht für mich nicht vernünftig sein, daran zu zweifeln, doch du konntest nicht alle Zweifel vollkommen ausräumen.« Der Philosoph Gotthold Ephraim Lessing sprach in Form einer Metapher von dem großen Graben, der diese Welt von der Welt Gottes trennt. Er sagte, Ereignisse in der Geschichte seien nie in der Lage, ewige Dinge zu beweisen.
Häufig wird davon ausgegangen, es gebe nur zwei Formen der Apologetik: den Evidentialismus (den wir uns bereits angeschaut haben) und den Präsuppositionalismus (den wir gleich untersuchen werden). Allerdings gibt es zusätzlich auch die Denkrichtung der klassischen Apologetik. Der Unterschied zwischen dem klassischen und dem evidentialistischen Ansatz ist dieser: Evidentialisten zufolge machen Hinweise aus der Geschichte die Existenz Gottes sehr wahrscheinlich. Klassische Apologeten dagegen behaupten, die Beweise für die Existenz Gottes seien so schlüssig, dass sie vollends überzeugen. Es handle sich dabei um jene Art von Beweisen, die Menschen jeglicher Entschuldigung oder Ausrede berauben.
Die innerhalb der Reformierten Theologie am weitesten verbreitete Sichtweise ist jedoch eine andere: der Präsuppositionalismus. Die bekannteste Version davon wurde von Cornelius Van Til entwickelt, der viel in diesem Bereich veröffentlichte und ein großer Denker des christlichen Glaubens war.
Van Til schrieb in englischer Sprache. Da er aber aus den Niederlanden stammte und Englisch nicht seine Muttersprache war, schrieb er manchmal in einem Stil, der schwer zu verstehen ist. Folglich sind nicht nur seine Kritiker untereinander uneins darüber, was er tatsächlich gesagt hat. Auch einige seiner bedeutendsten Schüler interpretieren ihn auf unterschiedliche Art und Weise.
Der Präsuppositionalismus besagt Folgendes: Um zu dem Schluss zu kommen, dass es Gott gibt, und um seine Existenz zu beweisen, muss man die Existenz Gottes voraussetzen. Nur wenn Gottes Existenz vorausgesetzt wird, kann man zu dem Schluss kommen, dass er existiert. Hierauf könnte man gleich Einspruch erheben, da dieses Vorgehen den klassischen logischen Fehlschluss petitio principii enthält — den Irrtum des Zirkelschlusses, bei dem die Schlussfolgerung in der Annahme enthalten ist. Dies ist auch der Haupteinwand gegen die präsuppositionale Apologetik.
Van Til rechnete mit diesem Einwand und verteidigte sich, indem er sagte, jegliche Überlegung sei in gewisser Weise zirkulär. Es gebe einen Ausgangspunkt, ein Zwischenfazit und eine Schlussfolgerung, die alle miteinander zusammenhängen. Wenn man an einem vernünftigen Ausgangspunkt beginne und vernünftig weiterargumentiere, würde man auch zu einem vernünftigen Schluss kommen. Van Til zufolge unterscheidet sich sein Ansatz daher nicht von anderen, da alle Überlegungen in diesem Sinne zirkulär sind. Diese Verteidigung der zirkulären Argumentation ist jedoch aus zwei Gründen höchst problematisch.
Erstens macht eine zirkuläre Argumentation im Bereich der Logik das Argument zunichte. Zweitens änderte Van Til im Verlauf des Arguments die Bedeutung der Begriffe. Er verteidigte seine zirkuläre Argumentation mit der Begründung, jede Überlegung sei zirkulär, d. h. der Anfangspunkt und das Ergebnis seien ähnlich. Das wird im Allgemeinen aber nicht unter dem Begriff »Zirkelschluss« verstanden. Um als rational durchzugehen, muss ein Argument von vorne bis hinten rational sein. Warum sollte man es als kreisförmig bezeichnen, wo es doch vielmehr eine Linie ist?
Freilich sind Grundannahmen tatsächlich Teil jeglicher Argumentation: Man geht von der Vernunft aus, vom Satz des ausgeschlossenen Widerspruchs, von Kausalität, von der Zuverlässigkeit der Sinneswahrnehmung und von der Analogie der Sprache. Verfechter von Van Tils Theorie sagen, er habe etwas Tieferes als ein oberflächliches Gedankenexperiment in Sachen zirkulärer Argumentation im Sinn gehabt. Sie behaupten, er wollte darauf hinaus, dass auch die Annahme der Vernunft die Annahme von Gottes Existenz beinhaltet, da es ohne Gott keine Grundlage für eine rationale Argumentation gibt. Das heißt, wenn man von der Existenz der Vernunft ausgeht, argumentiert man automatisch für die Ursache der Vernunft, nämlich für Gott selbst — auch wenn man das vielleicht nicht zugibt.
Klassische Apologeten sind sich einig, dass die Existenz Gottes auf der Hand liegt, wenn Rationalität wirklich von Bedeutung sein soll und die Voraussetzungen der Erkenntnistheorie stimmen. Und genau das versucht die klassische Apologetik zu beweisen. Wir müssen den Menschen aufzeigen: Um rational zu sein, müssen sie die Existenz Gottes anerkennen, da die Vernunft, von der sie selbst ausgehen, die Existenz Gottes voraussetzt.
Neben diesen logischen Denkfehlern ist das größte Argument gegen den Präsuppositionalismus, dass niemand von Gott ausgeht, außer Gott. Niemand kann im eigenen Denken bei Gott und der Erkenntnis Gottes beginnen — es sei denn, er ist Gott. Menschen erkennen zuerst sich selbst und dann die Existenz Gottes. Sie fangen nicht mit dem Bewusstsein eines Gottes an und erkennen dann ihr eigenes Selbst. Da es nun mal nicht anders geht, müssen Menschen, die menschlich denken, bei sich selbst anfangen.