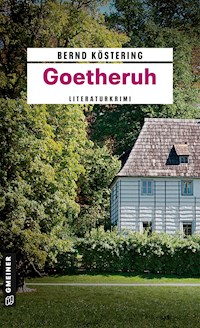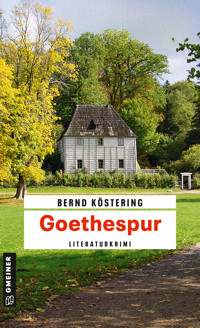Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Literaturdozent Wilmut
- Sprache: Deutsch
Weimar im Sommer 2004. In der Ilm wird ein Toter gefunden. Hendrik Wilmut, Literaturexperte aus Frankfurt am Main, gerät unter Mordverdacht. Seine Freunde ziehen sich zurück, nur sein Cousin Benno lässt ihn nicht im Stich. Mit seiner Hilfe vollzieht Wilmut eine erstaunliche Wandlung: Er wird vom Gejagten zum Jäger, vom Angeklagten zum Ermittler. So kommen sie dem Geheimnis des Kassibers sehr nahe. Doch dann verbrennt der vermutliche Beweis seiner Unschuld in der Herzogin Anna Amalia-Bibliothek. Jetzt gibt es nur noch eine Frau, die ihn retten kann …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernd Köstering
Goetheglut
Der zweite Fall für Hendrik Wilmut
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2011 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Sven Lang, Meßkirch
Herstellung: Christoph Neubert
Korrektur: Claudia Senghaas, Katja Ernst
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
Prolog
1. Kapitel
Montag, 23. August 2004. Der Tag, an dem wir Abschied nahmen.
Alles begann an einem heißen Sommertag im August des Jahres 2004. An solch einem Tag mit klarem Himmel und prallem Sonnenschein ist es fast unmöglich zu frieren. Doch ich fror. Rechts hielt ich Hannas Hand, auch die war kalt. Links hatte sich ihre Mutter bei mir eingehakt. Wir standen auf dem Weimarer Friedhof und sahen zu, wie Herrn Büchlers Sarg langsam in die Erde hinabgelassen wurde. Sehr langsam. Und sehr vorsichtig. Die Sargträger befürchteten wohl, dass ihnen die Gurte aus den schweißnassen Fingern gleiten würden. So blieb noch etwas Zeit, uns endgültig von ihm zu verabschieden – vom Ehemann, vom Vater, vom Mentor.
Herr Büchler hatte mir die Sinne geöffnet, in meiner Jugendzeit, in der ich die Sommerferien regelmäßig bei meinen Großeltern in Weimar verbrachte. Oft hatte ich Hanna und ihre Eltern besucht. Ihre Mutter hatte mich immer den ›Hendrik von nebenan‹ genannt. Und ihr Vater hatte meine Gedanken auf das vorbereitet, was kommen sollte: Literatur. Insbesondere Goethe. Ich hatte seinen Geist in mich aufgenommen, ohne es zu merken. Viel später erst, vor einigen Jahren, war mir das klar geworden. Aber da war es für Hannas Vater bereits zu spät. Er saß auf dem Planeten namens Alzheimer und hatte kein Raumschiff mehr, um zu uns zurückzukehren. Manchmal nur, einige wenige Male noch, konnte er uns durch den verspiegelten Astronautenhelm erkennen.
Der Sarg wurde aufgesetzt, die Sargträger zogen die Gurte heraus und traten beiseite. Zum Abschluss sagte der Pfarrer: »Der Tod ist nichts Endgültiges.«
Ich dachte an meinen Vater. Er starb, als ich 18 Jahre alt war. Oft stellte ich mir vor, er könne mir von ›oben‹ zusehen. Und ich tat dann Dinge, von denen ich meinte, sie könnten ihm gefallen. Selbst heute noch, mit Ende 40. Ist der Tod wirklich nichts Endgültiges?
Auch Kriminalhauptkommissar Siegfried ›Siggi‹ Dorst und seine Freundin Ella waren gekommen, obwohl er wegen eines ungeklärten Todesfalls in Denstedt alle Hände voll zu tun hatte und das gesamte vergangene Wochenende gearbeitet hatte. Siggi und ich waren seit einigen Jahren befreundet. Ich hatte ihn sofort an seinem leuchtenden Kahlkopf erkannt, er stand ruhig und in sich gekehrt hinter uns. Mein Cousin Benno Kessler und seine Frau Sophie standen neben ihm, dahinter Cindy und John, unsere amerikanischen Freunde. Viele Nachbarn aus der Humboldtstraße waren gekommen, auch einige frühere Arbeitskollegen des Verstorbenen.
Alle warteten darauf, dass Frau Büchler ein Schäufelchen Erde auf den Sarg werfen würde. Doch sie traute sich nicht. Es schien, als wäre sie nicht in der Lage, dies allein zu tun. Ich musste ihr und Hanna wohl unbewusst ein Zeichen gegeben haben, irgendeine Bewegung vielleicht. Gleichzeitig gingen wir alle drei zögerlich die wenigen Schritte bis zum Grab. Ich ergriff eine Schaufel voll Erde und reichte sie Frau Büchler. Hanna weinte, die Erde fiel hinab. Frau Büchler blickte versteinert in das Grab, und Hanna warf eine Rose hinunter zu ihrem Vater. Wir standen noch eine Weile neben dem Erdhügel, der darauf wartete, Herrn Büchler für immer zu bedecken. Blumen und Kränze wurden herbeigebracht. Wir schüttelten Hände, die Leute murmelten irgendwelche Standardformeln, leise, fast unverständlich. Angesichts des Todes fällt einem wenig Sinnvolles ein. Hanna merkte, dass ihrer Mutter diese Zeremonie sehr schwerfiel. Sie zog sie langsam vom Grab weg. Wir ließen die anderen stehen und gingen einen kleinen Weg zwischen hohen Bäumen entlang. Es war ein wunderschöner, heller Tag – rein äußerlich.
Hanna blieb stehen. Sie zeigte auf einen kleinen, efeubewachsenen Grabstein: ›Jens Werner Gensing 1979-1998‹. Wir blickten uns stumm an. Vor sechs Jahren waren wir beide an der Jagd nach dem Goethehausdieb beteiligt, waren Mitglieder der mit den Initialen von Goethe benannten Sonderkommission JWG. Damals hatte ich Siggi kennengelernt. Unweit von hier, in der Fürstengruft, war der Täter erschossen worden. Und hier lag er begraben.
Wir trafen uns im Café ›Christoph Martin‹ am Wielandplatz. Cindy und John waren bereits nach Hause gegangen, sie kannten die deutsche Gepflogenheit des Beerdigungskaffees nicht. Eigentlich kann ich Beerdigungskaffees auch nicht leiden. Oft genug wurde der Toten in keiner Weise gedacht, man freute sich zuweilen sogar, sich endlich einmal wiederzusehen, ist ja schon lange her seit der letzten Beerdigung, hoffentlich treffen wir uns bald mal wieder. Doch heute hatte ich das Gefühl, dass wir uns zusammensetzen mussten, um über das Leben und den Tod zu reden und uns zu wärmen. Mitten im August. Ist der Tod wirklich nichts Endgültiges?
Zunächst ging ich kurz zu Siggi, Ella, Benno und Sophie. Sie unterhielten sich gerade über Herrn Büchler und die Frage, ob ein Leben als Alzheimerpatient eigentlich noch lebenswert sei. Sophie, die als Ärztin im Weimarer Krankenhaus arbeitete, meinte, diese Frage könnten selbst hoch spezialisierte Wissenschaftler nicht beantworten. Benno brachte die These auf, dass Hannas Vater im Tod vielleicht mehr Freiheit vergönnt war als in seinem Alzheimerleben. Aber auch das konnte niemand bestätigen oder widerlegen.
Das Thema Tod führte uns zu dem Leichenfund an der Denstedter Mühle. Der leblose Körper war mit dem Wasser der Ilm aus Richtung Weimar angeschwemmt und im Sicherheitsgitter direkt vor der Wasserturbine eingeklemmt worden. Der Müller hatte den Toten am Samstag frühmorgens entdeckt – kein schöner Anblick. Bisher sah alles nach Selbstmord oder einem Unfall aus. Die Obduktion hatte jedenfalls keine Hinweise auf Fremdeinwirkung erbracht. Doch Siggi traute diesen Fakten nicht. Sein Spürsinn sagte etwas anderes. Und er hatte viel Erfahrung, fast zehn Jahre beim BKA in Wiesbaden und acht Jahre am Polizeipräsidium Weimar, davon inzwischen drei Jahre als Leiter des Kommissariats 1, das sich mit Straftaten gegen Leib und Leben befasste. Siggi war ein drahtiger, gebräunter Typ mit einem nicht zu überhörenden hessischen Dialekt. Seine Freundin Ella war deutlich jünger als er, sie arbeitete im Archiv des Polizeipräsidiums und fieberte immer mit, wenn Siggi einen großen Fall zu lösen hatte.
Nach einer Tasse Kaffee verabschiedeten sich die vier. Sophie hatte Spätdienst im Krankenhaus, Benno musste zu einer Sitzung des städtischen Kulturausschusses, und auf den Hauptkommissar warteten weitere Ermittlungen. Als die anderen schon an der Tür waren, drehte Siggi sich noch einmal um und fragte mich leise, ob er Hanna und ihrer Mutter kondolieren könne, er hätte am Grab keine Gelegenheit dazu gehabt. Ich nickte und begleitete ihn an den Nachbartisch. Siggi umarmte Hanna, gab ihrer Mutter die Hand und legte seine Linke auf ihre. Er sagte nichts. Als er ging, schienen seine Augen feucht und sein Kopf gerötet.
Wir waren etwa 20 Personen und saßen an zwei Tischen in der Mitte des Cafés, das an diesem normalen Montagmittag ansonsten leer war. Zum Glück gab es keinen Alkohol, nur Kaffee und Streuselkuchen. Ich setzte mich zu Hanna und legte den Arm um sie. Frau Büchler kauerte zusammengesunken neben ihr und stocherte in einem Stück Kuchen herum. Die schwarze Kleidung und ihr fahles Gesicht verliehen ihr einen alten, beinahe gebrechlichen Eindruck. Nach fast zehn Jahren an der Seite eines Alzheimerkranken war von ihrer sehr aktiven und politisch engagierten Art nicht mehr viel übrig geblieben. Hanna und ich hofften inständig, dass sie sich nach einer gewissen Zeit der Aufarbeitung und Erholung wieder aufrichten konnte.
Es war gerade ziemlich ruhig in dem Café, als die Tür aufgestoßen wurde. Eine klein gewachsene, schlanke Frau um die 50 erschien in der Tür, blonde Haare, so blond wie Hannas Haar, aber kurz geschnitten. Die knöcherne Hand der Frau lag immer noch auf dem Türgriff. Sie schaute sich prüfend im Raum um, bis ihr Blick den von Frau Büchler traf. Langsam stand diese auf. Ihr Rücken straffte sich. Ihr blasses Gesicht unter dem schwarzen Hut bekam eine strenge Note, die ich noch nie bei ihr gesehen hatte.
»Du kommst spät!«, stellte sie fest.
Hanna wurde blass. Ich sah sie fragend an. Keiner sagte etwas. Endlich beugte sich Hanna langsam zu mir herüber und flüsterte: »Das ist meine Schwester.«
Ich wusste, dass ich jetzt nichts sagen durfte. Die Worte klebten mir am Gaumen, Fragen formten sich zu einem Kloß in meinem Hals. Ich kannte Hanna seit unserer Jugendzeit, seit Mitte der 60er-Jahre. Zuerst war ich der ›Westbesuch‹ aus Offenbach, dann ein Freund, später mehr als das. Schließlich kam meine Abiturzeit, Lernen in den Sommerferien, danach die Bundeswehr – ein Bruch. Viele Jahre hatten wir uns nicht wiedergesehen. Bis wir dann vor sechs Jahren ein Paar wurden, seit dem JWG-Fall, der uns ironischerweise zusammengeführt hatte. Aber ich hatte bislang nie gehört, dass sie eine Schwester hatte.
Die Frau kam auf uns zu. Immer noch stand die Tür offen.
»Halbschwester!«, korrigierte sie laut und gab mir die Hand. Zögerlich begrüßte ich sie. Alle Leute im Café sahen zu uns herüber, keiner wagte, irgendetwas zu sagen. Nur ein Kaffeelöffel klirrte auf der Untertasse.
Erst jetzt begrüßte sie Hanna. Und danach ihre Mutter. Sie gab ihr die Hand mit weit ausgestrecktem Arm. »War ja auch nicht mein Vater!«, sagte sie. Daraufhin zog sie sich mit lautem Geräusch einen Stuhl heran und setzte sich genau mir gegenüber. Langsam begannen die anderen Leute wieder zu reden, die vertraute Geräuschkulisse legte sich um uns wie schützende Arme. Ich war froh darüber.
»Ich heiße Karola«, sagte sie, »aber mit K vorn, schließlich heißt es ja K-Rola und nicht C-Rola!«
Sie lachte kurz auf. Es dauerte eine Weile, bis ich den ›Scherz‹ verstanden hatte.
»Ich bin ihre Halbschwester aus Dresden.« Sie grinste. »Mein Vater war ein SED-Kader. Unsere Mutter hat das angeblich nicht gewusst, bevor sie mit ihm ins Bett stieg. Jedenfalls wollte sie ihn danach nicht mehr haben.«
Ich musste tief Luft holen und rutschte unruhig auf meinem Stuhl hin und her. Hanna legte mir beruhigend die Hand auf den Arm. Sie kannte die Wortwahl ihrer Schwester offensichtlich und schien sich nicht darüber aufzuregen. Aber ich konnte es kaum ertragen. Und Frau Büchler ebenso wenig.
»Karola ist in Dresden bei ihrem Vater aufgewachsen, deshalb habe ich dir nie von ihr erzählt«, erklärte Hanna.
»Natürlich nicht …«, ging Karola dazwischen, »was gibt es von mir auch schon zu erzählen, ich bin ja sicher nur peinlich.«
»Allerdings!«, entfuhr es mir.
»Ach, was weißt du denn schon, du …« Sie musterte mich. »Wie heißt du eigentlich?«
»Hendrik«, antwortete ich, »Hendrik Wilmut.«
»Will-mut«, wiederholte sie gedehnt, »so hieß doch dieser Schwachkopf, der das Klonschaf Dolly erfunden hat, oder?«
»Keine Ahnung«, antwortete ich steif. Ich hatte den Namen noch nie außerhalb unserer Familie gehört.
»Klar doch«, trötete sie, »davon hat der gute Hendrik natürlich keine Ahnung!«
»Karola, bitte!« Hannas Stimme war leise, aber bestimmt.
»Ja, ja. Gibt’s hier eigentlich keinen Schnaps?«, rief Karola.
»Nein, hier gibt es keinen Schnaps!«, entgegnete ihre Mutter.
Hanna winkte die Kellnerin zu sich und flüsterte ihr einige Worte ins Ohr. Kurz darauf brachte diese eine hohe Tasse mit einem Sahnehäubchen und stellte sie vor Karola ab.
»Bitte sehr!«, sagte die Bedienung höflich.
Karola antwortete nicht darauf, sondern stierte auf den Kaffee.
Frau Büchler wollte die Auseinandersetzung mit ihrer älteren Tochter offensichtlich nicht weiterführen und gab Hanna ein Zeichen.
Hanna erhob sich. »Ich bringe Mutter nach Hause. Das ist besser so.« Dabei sah sie zuerst mich an, dann ihre Schwester.
Karola zeigte auf ihren Irish Coffee: »Ich bleibe noch hier.«
»Könntest du Karola bitte noch etwas Gesellschaft leisten?«, fragte Hanna in meine Richtung. »Und sie dann bei uns in der Humboldtstraße absetzen?«
Ich nickte. Natürlich war ich alles andere als begeistert, mochte Hanna die Bitte aber nicht abschlagen. Ich verabschiedete mich von Frau Büchler, und während sie mit Hanna das Café verließ, überlegte ich fieberhaft, was ich mit dieser Person reden sollte. Die Person selbst schwieg. Also schwieg ich auch.
Sie schlürfte laut an ihrem Whiskey mit Kaffeegeschmack. »Du willst wohl nicht mit mir reden?«, sagte sie, wobei das Gesagte eher einer Feststellung denn einer Frage glich.
Ich dachte an Hanna und daran, dass Karola ihr offensichtlich wichtig war. »Na ja, so strikt würde ich das nicht …«
»Du sagst aber nichts.«
Ich überlegte, in der Hoffnung, ein halbwegs neutrales Gesprächsthema jenseits des Wetters zu finden.
»Was machen Sie eigentlich beruflich?«, fragte ich schließlich.
»Stütze!«
Es dauerte einen Moment, bis ich begriffen hatte, was sie meinte. »Ach so …«, antwortete ich zögernd, »na ja, Sie werden sicher bald wieder eine Arbeit finden.«
»Klar doch. Bin zwar schon seit vier Jahren auf Stütze, aber das wird schon.«
»Oh, wie kam es denn dazu?«
»Interessiert dich das wirklich, oder ist das nur so ’ne dämliche Frage?«
Ich zögerte einen Augenblick zu lang.
»Siehst du, es ist dir scheißegal!«, erwiderte sie.
»Na, hör mal …«
»Aha, wenigstens kommt da ein lockeres Du rüber, das ist ja schon mal was!«
Diese Frau zu duzen, war das Letzte, was ich jetzt wollte. »Also gut, von mir aus …«, murrte ich.
»Tja, ist schon ein schweres Schicksal, sich mit ’ner arbeitslosen Ossi-Tante duzen zu müssen.«
»Warum sind Sie eigentlich immer so sarkastisch?«, fragte ich.
»Na, was soll ich denn sonst sein? Erst bescheißt einen der eine Staat, dann der andere.«
»Moment mal, Sie können doch nicht die DDR und die Bundesrepublik in einen Topf werfen!«
»Ha, da hab ich den Wessi erwischt!«, rief sie triumphierend. »Hab ich die heilige Kuh Bundesrepublik angegriffen?«
»Jetzt rede doch nicht so ’n Mist!«, platzte ich heraus.
»Sieh da, langsam kommst du ja auf mein Sprachniveau runter!«, grinste sie.
Ich fühlte die Hitzewelle von meinem Hals immer höher steigen. Und ich wusste genau, was Benno in diesem Moment zu mir gesagt hätte: Wieder einmal dein Lieblingsthema. Beruhige dich und hör endlich damit auf, deine Kindheit aufzuarbeiten! Das hatte er mir schon mehrmals vorgehalten. Er, der weit mehr Gründe hätte als ich, seine Kindheit aufzuarbeiten. Wie war ich nur schon wieder in das Ost-West-Thema hineingeschlittert? Sogar auf einem Beerdigungskaffee … Ich musste einlenken.
»So war es auch nicht gemeint«, antwortete ich, »trotzdem war die DDR ein Unrechtsstaat, das sollten wir bei all den positiven Dingen, die es gab, nicht vergessen.«
»Ein Unrechtsstaat, sieh da! Was das wohl bedeutet? Wir haben gelebt, geliebt, gelernt und gelacht, was war daran wohl unrecht, Herr Klonschaf-Wilmut?«
Kein Gedanke mehr an Einlenken.
»Genauso habt ihr aber auch gehorcht und geguckt, gezwungen und eingeschränkt, hirngewaschen und – getötet. Allein an der Berliner Mauer 136 Mal!« Ich hatte so laut gesprochen, dass die Plauderanonymität wieder aufgehoben wurde und alle zu uns herübersahen. Karola schien es zu genießen.
»Wir?«, fragte sie provozierend. »Ich? Hanna?«
Ich schüttelte den Kopf über meine eigene Dummheit. Diese fürchterliche Verallgemeinerung, die ich bei anderen so hasste – jetzt war ich ihr selbst erlegen.
»Natürlich nicht alle«, sagte ich kleinlaut. »Der Begriff Unrechtsstaat ist vielleicht etwas unglücklich, aber trotzdem …«, ich hob meinen Kopf, »ist die DDR bestimmt kein Rechtsstaat gewesen!«
Sie schwieg. Gut, dass Frau Büchler das alles nicht mitbekam. Die Bedienung brachte frischen Kaffee, den ich auch dringend brauchte.
Nach ein paar Minuten hatte ich mich wieder gefangen. »Denk nur mal an den verstorbenen Herrn Büchler. Er wurde gezwungen, in die SED einzutreten, sonst hätte er seinen Beruf als Deutschlehrer nicht weiter ausüben dürfen. Und er hat es tatsächlich gemacht. Später hat er sich fürchterlich darüber geärgert, sich selbst angeklagt, sich Vorwürfe gemacht, konnte kaum noch schlafen. Zum Glück – so möchte man fast sagen – konnte er sich irgendwann nicht mehr daran erinnern.«
Sie nickte. »Kenne ich, war ja Alltag in der DDR, aber noch gar nichts gegen meinen Vater.«
Ich sah sie fragend an.
»War ein ganz scharfer SED-Kader – und heute?«
»Und heute?«
»CDU-Mitglied!«
Ich hob die Augenbrauen. »Wirklich?«
»Klar. Ein opportunistisches Arschloch!«
»Mit deiner Familie scheinst du ja einige Probleme zu haben.«
»Ja, mit allen. Außer mit Hanna. Sie hat immer versucht, zwischen mir und meiner Mutter zu vermitteln. Hat sie gut gemacht, aber wir beide wollten nicht. Und Hanna ist nicht feige. Sie kann Stellung beziehen.«
»Na, da hab ich ja Glück gehabt.«
»Stimmt. Und wie bist du? So wie Hanna?«
»Finde es doch heraus.«
»Mach ich. Auf jeden Fall hast du dir schon mal ein paar Gedanken gemacht. Das ist gut. Leider die falschen, ha, ha, ha!« Ein tiefes, raues Lachen quoll aus ihrem Mund.
*
Der hagere Mann saß in einem Eiscafé schräg gegenüber dem Weimarer Nationaltheater. Er trank einen Kaffee. Vor ihm lag ein kleines, schwarzes Notizbuch.
Er wusste, dass sein Leben an einem kritischen Punkt angekommen war. Keinen einzigen seiner Träume hatte er verwirklichen können. Und obwohl er noch relativ jung war, sah er keine Chance mehr, irgendeinen Traum wahr werden zu lassen. Sie hatten ihm alles genommen, seine Familie, seine Arbeit, seine Handlungsfreiheit. Kein leuchtendes Proletariat, keine blühenden Landschaften. Sein Gesicht erhielt Züge von Bitterkeit. Er wusste, dass er aus dem Gleichgewicht geraten war. Aber er wusste auch, wer daran Schuld hatte.
Das Notizbuch wurde mit einem eigens dazu angebrachten Spanngummi zusammengehalten. Er zog es zur Seite und öffnete das Büchlein an der Stelle, an der das Lesezeichen herausschaute. Regungslos sah er auf die Liste. Der erste Name war bereits durchgestrichen. Der zweite würde bald folgen. Der hagere Mann nickte zufrieden. Eigentlich brauchte er gar kein Notizbuch, denn er hatte ein hervorragendes Gedächtnis und eine gute Konzentrationsfähigkeit. Zusammen mit seiner körperlichen Fitness war dies sein größtes Kapital. Das Notizbuch diente lediglich seiner persönlichen Erbauung. Seinem inneren Gleichgewicht.
Er schob die leere Kaffeetasse beiseite. Ein Blick auf die Uhr signalisierte ihm, dass es Zeit war aufzubrechen. Er musste zum Training. Sein Sport war das Einzige, was ihm geblieben war. Er zahlte, kämpfte sich durch die Menge von Touristen, die vor dem Goethe- und Schillerdenkmal standen, und erreichte gerade noch rechtzeitig die Bushaltestelle am Goetheplatz.
*
Ich setzte Karola vor dem Haus ihrer Mutter ab, ging aber nicht mit hinein. Klug oder feige? Ich beschloss, mein Hirn heute nicht damit zu martern, der Tag war bisher schon anstrengend genug gewesen. Während ich wartete, bis Karola hineingegangen war, betrachtete ich Büchlers Haus. Ein großes verwinkeltes Gebäude, dabei aber von klarer Linie, ohne Schnörkel, schätzungsweise aus den 20er-Jahren, mit einem hohen Spitzdach, original mit Biberschwänzen gedeckt, innen ein riesiger Kachelofen, der über entsprechende Züge das ganze Haus erwärmen konnte. Im Vorgarten standen zwei Tannen – hoch und dunkel, wie seit Jahren schon. Es glich Großmutters Haus. Deswegen fühlte ich mich hier so wohl.
Ich startete meinen alten roten Volvo und lenkte ihn in Richtung Stadtmitte. Spontan entschloss ich mich, mir zum Abschluss dieses Tages etwas Schönes zu gönnen: eine neue Espressomaschine. Meine alte Gaggia hatte mir vor ein paar Tagen die Freundschaft gekündigt – nach 18 Jahren eiserner Treue. Manchmal treibe ich sinnlose Zahlenspiele. So hatte ich an dem traurigen Tag ihrer Verschrottung – der Kessel hatte einen Riss – ausgerechnet, wie viele Tassen Espresso die Gute wohl für mich ganz uneigennützig bereitgestellt hatte. Mit einem realistischen Schnitt von drei Tassen pro Tag kam ich auf eine Summe von knapp 20.000. Tolle Leistung. Und nun war ich schon seit Tagen auf Espressoentzug.
Ich durchkämmte die ganze Stadt. In der Schillerstraße gab es eine Kaffeebar, in der ich zunächst einen Espresso trank. Leider fand ich in der Fußgängerzone jedoch keine Siebträgermaschine, nur die üblichen Vollautomaten. Auch im Gewerbegebiet Nord wurde ich nicht fündig. Wahrscheinlich musste ich in den nächsten Tagen nach Erfurt fahren. So kehrte ich nach Hause zurück.
Seit zwei Jahren wohnte ich am Rollplatz, in einem alten, restaurierten Haus direkt neben der ›Brasserie Central‹. Meine Wohnung in Frankfurt am Main hatte ich komplett aufgegeben und die Zweitwohnung in der Hegelstraße in Weimar gegen diese größere und schönere Altbauwohnung getauscht. Meine Tätigkeit als Dozent am Institut für Literaturgeschichte der Universität Frankfurt hatte ich auf ein Minimum beschränkt und mich ansonsten einem Goethe-Forschungsprojekt im Umfeld der Herzogin Anna Amalia Bibliothek angeschlossen. Dank unseres Institutsleiters in Frankfurt konnte ich meine Vorlesungen alle 14 Tage, immer montags und dienstags, halten. Dafür bekam ich die Aufgabe, eine literarische Brücke zwischen der Uni Frankfurt und der berühmten Weimarer Bibliothek zu bilden, was mir viel Spaß bereitete.
Damals, vor zwei Jahren, hatte ich sogar überlegt, mit Hanna zusammenzuziehen, doch sie wollte zunächst bei ihren Eltern wohnen bleiben, insbesondere um ihre Mutter bei der Pflege des Vaters besser unterstützen zu können.
Wie immer schaffte ich es nicht, ins Haus zu gehen, ohne Thomas, dem Besitzer der Brasserie, einen kurzen Besuch abzustatten. Dieser ›Besuch‹ beinhaltete mindestens einen Espresso, meistens zwei, und einen zusätzlichen Averna mit Eis und Zitrone. Als ich ihm von meinem Problem mit der Espressomaschine berichtete, lachte er lauthals. Warum in die Ferne schweifen, sieh, das Gute liegt so nah! Ich solle nur hinüber in die Karlstraße gehen, da fände ich alles, was ich brauchte. Im ›Café-Laden‹.
Als Gastronom wusste Thomas natürlich Bescheid. Und er hatte recht. Der ›Café-Laden‹ war ein kleines, äußerst gemütliches Café mit integriertem Geschäft. Links etwa zehn Sitzplätze, in der Ecke eine Café-Bar, rechts Regale mit Kaffee, Espressomaschinen und dem entsprechenden Zubehör. Zwei nette Damen, die der Mär von der Servicewüste Deutschland endgültig den Garaus machen wollten, ergänzten das Bild. Ich war begeistert. Der Besitzer war ein echter Kaffee-Kenner, die Beratung hervorragend. Nach einer knappen Stunde – der Laden hatte eigentlich schon geschlossen – kam ich mit einer nagelneuen ECM-4 wieder heraus. Schnell passierte ich den Graben und überquerte den Rollplatz, das Paket stolz wie einen Pokal vor mir hertragend. Ich hatte es eilig, denn ich wollte die neue Maschine sofort ausprobieren. Den grün-weißen Streifenwagen, der mitten auf dem Rollplatz parkte, bemerkte ich nicht. Ich winkte Thomas durch die Fensterscheibe zu und stieg mit dem Paket in den dritten Stock hinauf. Das war der einzige Nachteil meiner Wohnung: kein Aufzug. Doch ich fühlte mich mit Ende 40 noch jung genug, um den Gedanken daran einfach zu verbannen.
Der Karton der ECM-4 war bereits geöffnet und ich hatte begonnen, die Installationsanleitung zu lesen. In diesem Moment klingelte es. Erstaunt schaute ich durch den Spion an der Wohnungstür. Das Gesicht war mir bekannt. Ich schob den mächtigen Riegel beiseite, den ich vor drei Monaten nach einem Einbruch hatte anbringen lassen, und öffnete die Wohnungstür. »Hallo, Siggi!«, rief ich erfreut. Sekunden später erstarben mir die Worte auf den Lippen.
Hinter Siggi erschienen zwei Uniformierte. Kriminalhauptkommissar Siegfried Dorst baute sich vor mir auf. »Hendrik Wilmut?«
»Aber Siggi …«, stotterte ich, »du weißt doch, wie ich heiße.«
»Sind Sie Dr. Hendrik Wilmut, Literaturwissenschaftler?«, fragte einer der Uniformierten streng.
»Ja, der bin ich.«
»Herr Wilmut«, übernahm Siggi wieder das Wort, »es tut mir leid, aber ich muss Sie vorläufig festnehmen wegen des dringenden Verdachts, den deutschen Staatsbürger Fedor Balow aus Tiefurt ermordet zu haben!«
2. Kapitel
Dienstag, 24. August 2004. Der Tag, der mir Angst machte.
Es war bereits kurz nach Mitternacht, als die Zellentür hinter mir ins Schloss fiel. Ich zuckte zusammen. Die mächtigen Riegel rasteten ein. Als Kind hatte ich mich oft gefragt, wie es wohl in einer Gefängniszelle aussehen mochte, wie man sich fühlte, so allein. Doch jetzt, als ich es erlebte, interessierte mich das überhaupt nicht mehr. Ich war so erschöpft, dass ich mich nur noch auf die Pritsche legen und schlafen wollte. Ich machte mir nicht einmal die Mühe, meine Kleidung auszuziehen. Als ich im Dunkeln dort lag, wollte die Müdigkeit jedoch nicht über mich kommen. Ein fremder Geruch störte mich, undefinierbare Geräusche ließen mich ein ums andere Mal aufhorchen. Ich drehte mich zur Wand und wieder zurück, meine Füße waren kalt und das Kissen zu dünn. Bilder zogen durch meinen Kopf: grüne Uniformjacken, ein lebloser Körper im Wasser, eine chromblitzende Espressomaschine, die mutterseelenallein mitten auf dem Rollplatz stand. Und dann kamen die Gedanken an den vergangenen Abend, an meine Festnahme und die Vernehmung.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!