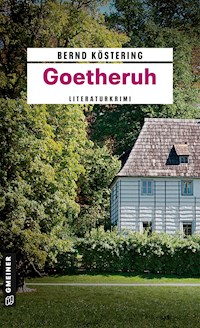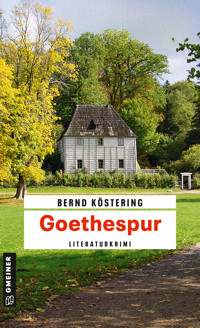Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Weimar-Saga
- Sprache: Deutsch
Weimar 1804: Der Tischlergeselle Wilhelm entdeckt einen geheimnisvollen Brief. Darin wird behauptet, zwei reiche Witwen seien kurz nach ihrer erneuten Vermählung ermordet worden. Wilhelm ist neugierig, er geht dem Verdacht nach. Als er erkennt, dass ihm der Standesdünkel Grenzen setzt, kommt er auf die waghalsige Idee, Louise von Göchhausen, die erste Hofdame der Fürstin Anna Amalia, als detektivische Partnerin zu gewinnen. Wird sie ihm helfen? Zugleich versucht Wilhelm, sich von seinem Elternhaus zu lösen. Und er lernt Annette kennen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernd Köstering
Die Witwen von Weimar
Historischer Roman
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Bilder von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Der_Musenhof_der_Herzogin_Amalie_1909_(149111073).jpg und https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meyer%E2%80%99s_Universum_Bd._7._1840_(139845875).jpg
ISBN 978-3-7349-3070-6
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
um Ihnen die Zeit von 1804 im Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach näherzubringen, wurden in diesem Roman einige Wörter in der damals üblichen Schreibweise belassen, zum Beispiel »Tieffurth«, »Geheimrath« und »Polizey«.
In historischen Romanen werden üblicherweise geschichtlich belegte Personen mit fiktiven Figuren gemischt. Im Anhang 2 ab Seite 362 finden Sie eine Auflistung der historischen Persönlichkeiten, die in dem Roman eine Rolle spielen. Alle in dieser Liste nicht erwähnten Namen gehören Figuren, die der Fantasie des Autors entsprungen sind.
Weiterhin enthält der Roman Begriffe, die heutzutage nicht mehr gebräuchlich sind oder zum thüringischen Sprachschatz zählen. Das Gleiche gilt für Orte, die nicht mehr existieren beziehungsweise inzwischen andere Namen tragen. Wenn Sie mögen, können Sie eine alphabetisch geordnete Erläuterung dazu im Anhang 3 ab Seite 371 nachlesen.
Bernd Köstering im Sommer 2023
1. Von Ratten und Kuhpocken
Freitag, 28. September 1804
Wilhelm Gansser ahnte, dass der Damensekretär, den er am Vortag im Schloss Tieffurth instandgesetzt hatte, ein Geheimnis barg. Die äußeren Maße des Möbelstücks stimmten nicht mit den Abmessungen der beiden Schubladen überein, das hatte er mit dem geübten Blick des Möbeltischlers sofort erkannt. Da musste ein zusätzlicher Stauraum sein, eine Art Geheimfach. Aber wie konnte Wilhelm das finden? Natürlich durfte er sich nicht erwischen lassen, das würde ihn seine Stellung kosten. Von den Holzhandwerkern, die für das Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach arbeiteten, verlangte man absolute Loyalität und Verschwiegenheit. Ein Wort von Herzog Carl August hätte genügt, die Tischlerei Frühauf aus dem Geschehen am Hofe zu verbannen.
Wilhelm war mit dem Pferdegespann unterwegs zur Walkmühle in Oberweimar, um Buchenholzbretter abzuholen. Er hielt die Zügel in der Hand und lenkte das Gespann über die Landstraße entlang der Ilm. Er trug die übliche Kleidung eines Tischlergesellen: schwarze Hose mit doppelter Knopfreihe und ausgestelltem Bein. Letzteres sollte verhindern, dass Sägespäne in die Schuhe gelangten. Dazu die typische schwarze Handwerkerweste, die er während seiner Zeit auf der Walz mit Perlmuttknöpfen hatte schmücken lassen, sowie einen Werkzeuggürtel. Ein Filzhut bändigte seine braunen Locken. Neben ihm auf dem Kutschbock saß sein Gehilfe Anton, ein junger Bursche, der Wilhelm oft bewunderte, besonders seiner Kleidung wegen. Anton selbst trug eine einfache Arbeitskluft, die mit der zünftigen Gesellentracht nicht vergleichbar war und auch nicht vergleichbar sein durfte.
Die Straße von Weimar in Richtung Süden war holprig und nicht komplett mit Steinen befestigt. Zum Glück herrschte trockenes Herbstwetter an diesem Freitag, sodass Wilhelm das Pferdegespann nicht durch Schlamm und Morast steuern musste. Er mochte die grobe Arbeit seines Berufsstandes nicht, auch wenn die Natur ihm die Voraussetzung dafür in Form eines großen, muskulösen Körpers mitgegeben hatte und er sich mit seinen sechsundzwanzig Jahren im besten Mannesalter befand. Das spätere feine Bearbeiten des Holzes, das vorsichtige Hobeln, Schleifen und Beizen, das wundervoll gemaserte Tischplatten und Schranktüren hervorbrachte – das war seine liebste Tätigkeit. Meister Frühauf wusste das und er schätzte es. Aber einmal im Monat, immer am letzten Freitag, musste Wilhelm die schwere Arbeit beim Auf- und Abladen der Bretter auf sich nehmen. Damit er nicht vergaß, welche Mühsal notwendig war, das Holz in die Tischlerei zu schaffen – so meinte der Meister.
Während Wilhelm die beiden Pferde laufen ließ, hing er seinen Gedanken nach. Eines der Beine des Sekretärs war von Ratten angefressen worden, er hatte es ersetzt. An der Nachbildung mit dem eleganten Schwung im unteren Drittel und dem kunstvollen Fuß hatte er drei Tage lang gearbeitet. Dazu war es notwendig gewesen, eine neue Formzeichnung anzufertigen, da der Sekretär eine Spezialanfertigung mit niedriger Sitzhöhe für die klein gewachsene Demoiselle von Göchhausen war. Während seiner Arbeit im Schloss Tieffurth hatte sich keine Gelegenheit geboten, nach dem Geheimfach zu suchen, denn Louise von Göchhausen war immer in seiner Nähe geblieben. Außerdem hatte er sich auf die Befestigung des ausgetauschten Beins mit Holzdübeln und Knochenleim konzentrieren müssen. Der Sekretär schien der Demoiselle wichtig zu sein. Vielleicht musste Wilhelm gerade deswegen noch einmal nachsehen, ob das Bein hielt. War er zu neugierig? Seine Mutter pflegte das jedenfalls zu behaupten – mit einem liebevollen Augenzwinkern.
Er steuerte das Pferdegespann von der Taubacher Landstraße hinunter zur Mühle. Anton legte sich mit seinem ganzen Körpergewicht auf die Druckbremse, um zu verhindern, dass der Wagen schneller wurde als die Pferde. Der Bremsklotz gab ein lautes, unangenehmes Geräusch von sich und schien fast zu glühen, als sie unten ankamen. Anton würde ihn mit dem Wasser der Ilm abkühlen müssen.
Wilhelm sprang vom Kutschbock und legte Hemmschuhe vor und hinter die Räder. Der Wagen durfte sich während des Ladens nicht bewegen. Meister Vent, der Mühlenbetreiber, kam auf ihn zu. Er zeigte auf einen mächtigen Bretterstapel, wohl an die drei Waldklafter groß. Wilhelm rückte seinen Filzhut zurecht. Es konnte losgehen.
*
Auf den ersten Blick konnte man Louise von Göchhausen für ein Kind halten. Beim näheren Hinschauen erkannte man eine kleinwüchsige Dame gehobenen Alters. Eine ihrer Schultern war von Geburt an verformt, wodurch sie über die Jahre ein schiefes Gangbild entwickelt hatte. Mit diesem äußeren Makel behaftet war sie jeglicher Chance beraubt, einen standesgemäßen Ehemann zu finden. Doch Fürstin Anna Amalia, die Mutter des regierenden Herzogs, schätzte sie wegen ihrer geistreichen, humorvollen Art, sodass sie zu ihrer ersten Hofdame aufgestiegen war. Louises vornehmliche Aufgabe bestand darin, die Herzoginmutter und deren Gäste zu unterhalten, und mit ihren zweiundfünfzig Jahren hatte sie genügend Übung in dieser Profession.
Das Tieffurther Schloss vor den Toren von Weimar diente als Sommersitz der Fürstin Anna Amalia, und auch Louise von Göchhausen hielt sich bis in den Oktober hinein hier auf. Sie saß an ihrem Damensekretär und betrachtete einen Brief. Schon zehn Mal hatte sie ihn gelesen. Wer mochte Dietrich Gottlieb Taupe sein, der ihr dieses ungeheuerliche Schreiben geschickt hatte? Und wer waren die beiden Witwen, von denen darin die Rede war?
Es klopfte an der Tür. »Herein!«
Ihre Kammerzofe trat ein. »Gnädigste, der Kutscher lässt ausrichten, es sei angespannt!«
Alle Bediensteten, Bekannten und Freunde hatten sich daran gewöhnt, Louise nicht mit »Gnädiges Fräulein« anzureden, wie es sich geziemt hätte. Sie konnte das nicht leiden.
»Danke, Rosine! Du kannst dich zurückziehen.«
Die Zofe verbeugte sich und entschwand.
Louise verstaute den Brief sorgfältig im Sekretär, legte ihr Fichu um die Schultern, steckte ein blütenweißes Taschentuch in ihren Pompadour und verließ ihr Privatgemach im Anbau des Tieffurther Schlosses.
Langsam, aber stolz schritt sie den Gang zum Hauptbau entlang. Seit ihrer Jugend hatte sie sich angewöhnt, gemächlichen Schrittes zu gehen. Beim ungezügelten Laufen oder gar Rennen geriet sie ins Wanken. Sie wollte nur noch durchs Leben schreiten.
Louise warf einen Blick über den rechter Hand in den Park ragenden Altan. Das Herbstwetter an diesem letzten Freitag im September schien mild und sonnig zu bleiben, und sie freute sich auf die Fahrt mit dem halboffenen Landauer nach Weimar. Louise würde die Herzoginmutter und einige andere kunstinteressierte Menschen zur Teegesellschaft im Witthumspalais treffen.
Während der Kutschfahrt überlegte Louise fieberhaft, wen sie nach Dietrich Taupe fragen konnte. Herder war leider im vergangenen Jahr verstorben, er hätte ihr zumindest eine der priesterlichen Verschwiegenheit unterlegene Andeutung machen können. Schiller? Nein, der kannte nicht viele Menschen, er vertiefte sich in seine Bühnenstücke, war kränklich und bekam wenig Besuch. Wieland war nach dem Tod seiner Frau gerade erst wieder von seinem Landgut in Oßmannstedt nach Weimar zurückgekehrt, ihn musste sie verschonen. Goethe? Ja, er, der allgegenwärtige Geheimrath, der konnte etwas wissen. Und er war es gewohnt, die standesübliche Zurückhaltung weitgehend fallen zu lassen. Aber würde er heute anwesend sein? Charlotte von Stein? Nein, sie würde solch unbedeutendem Gerede überhaupt keine Beachtung schenken. Was der Geheimrath an ihr fand, war Louise schleierhaft. Nun ja – alles eine Frage des Geschmacks.
Der Kutscher setzte sie vor dem Weimarer Hoftheater ab, da er wegen eines Erntezugs nicht direkt vor dem Witthumspalais halten konnte. Die Bauern transportierten Getreide, Futtermais und Rüben vom Erndtethor kommend in Richtung Jacobsvorstadt. Männer schrien, Ochsen brüllten, Wagenräder rumpelten über das Pflaster, der Geruch von Dung und Rauch hing in der Luft. Auf dem Weg zum Palais konnte Louise einem Bauern mit einem Leiterwagen gerade noch rechtzeitig ausweichen.
»Nu geh doch ma weg, du aale Heppe!«
Da ihr der bäuerliche Sprachduktus nicht geläufig war, wusste sie mit dem Ausdruck »aale Heppe« nichts anzufangen, konnte sich aber denken, dass es eine Beleidigung war. Sie würde später ihre Zofe fragen, die kannte sich mit solchen Schmähungen aus.
Schon im Vestibül traf sie auf den Geheimrath von Goethe.
»Luischen, wie schön, dich wiederzusehen!«
Ohne dass sie es jemals erlaubt hatte, duzte er sie – eigentlich ein Affront. Dennoch streckte sie ihre Hand aus, und Goethe beugte sich zu einem formvollendeten Handkuss hernieder. Dann sah er sie mit seinen großen dunkelbraunen Augen an.
»Du bist mir doch nicht gram, oder?«
Sie lächelte. »Nein, mein bestes Geheimräthchen. Sie sind unkonventionell wie immer!«
»Nun ja, Gnädigste, Konventionen sind dazu da, gebrochen zu werden.«
Sie schüttelte den Kopf. »So wie das Blümlein im Walde?«
»Oh nein, das bleibt einer anderen Dame vorbehalten!«
»Jaja, ich weiß, der Dame Vulpius. Immer noch nicht verheiratet?«
»Luischen, du weißt doch, dass mir an einem Trauschein nicht gelegen ist. Da müsste schon die Welt untergehen, bevor ich heirate!«
»Nun, mein lieber Goethe, da sollten wir aufpassen, dass der Weltuntergang nicht aus Frankreich heranzieht.«
»Du meinst den selbsternannten Kaiser?«
»Exactement, diesen Napoleon Bonaparte. Angeblich soll er in Bälde gekrönt werden, ich frage mich nur, von wem?«
Der Geheimrath kräuselte die Stirn. »Ich habe einen Brief empfangen, aus dem die Sorge spricht, er könnte sich selbst krönen.«
»Oh nein!« Louise von Göchhausen spürte einen Stich in ihrem Inneren. Wie konnte ein Mensch – ein Mensch! – nur so selbstherrlich sein.
»Kurz etwas anderes, liebster Geheimrath, bevor die Herzoginmutter erscheint: Kennen Sie einen Herrn namens Taupe, Dietrich Gottlieb Taupe?«
»Ja, der werte Herr ist mir bekannt.«
Louise von Göchhausen wartete.
»Was ist mit ihm?«, fragte Goethe.
»Nun, er ist im Begriffe, einer Freundin in Apolda den Hof zu machen«, log sie schamlos. »Und ich frage mich, ob er von zweifelsfreiem Ruf ist.«
»Absolut, bester Leumund! Er ist ein angesehener Kaufmann aus Jena, handelt mit Wein und Gewürzen. Meine Verbindung zu ihm liegt hauptsächlich im Weinhandel begründet.«
»Das kann ich mir denken!«, sagte Louise augenzwinkernd.
Goethe lachte. »Er liefert jeden Freitag zuverlässig in mein Haus. Seine Frau verstarb vor zwei Jahren im Kindbett und hinterließ ihm fünf Bälger.«
»Aber Herr Geheimrath!« Sie sah ihn strafend an, zugleich amüsierte sie sich köstlich. »Und wer kümmert sich um die Kinder?«
»Er ist gut situiert und kann sich zwei Kindermädchen leisten.«
Im selben Moment erschien Anna Amalia an der Treppe in der ersten Etage. »Nanu …«, rief sie von oben herab. »Findet hier eine zweite Versammlung statt?«
Die beiden Angesprochenen verbeugten sich.
»Keineswegs, Hoheit«, antwortete der Geheimrath. »Wir pflegten lediglich einen kleinen Austausch über die Weimarer Bürgerschaft.«
»Soso, schwadronieren? Geziemt sich das für einen bekannten Dichter in seinen Fünfzigerjahren?«
Louise war höchst erstaunt. Wie konnte die Herzoginmutter so unverblümt auf Goethes Alter anspielen?
»Eigentlich nicht«, entgegnete der Geheimrath, dem das gleichgültig zu sein schien. »Allerdings genießt es der mit literarischem Wortschatz Gesegnete manchmal, in die Niederungen der gemeinen Sprache hinabzusteigen.«
Die Herzogin nickte wohlwollend.
»Wenn Sie gestatten, Hoheit«, warf Louise ein. »Ich wollte mich gerade den Gästen widmen!«,
»Das wird auch Zeit, sie wird bereits erwartet!«
»Selbstverständlich, Eure Hoheit!« Damit erklomm Louise die Treppe.
Im Tafelrundenzimmer befanden sich vier Personen in lebhafter Unterhaltung, zwei Männer und zwei Frauen. Christoph Martin Wieland – wie immer ohne Perücke, dafür mit seiner typischen schwarzen Kalotte auf dem Kopf – und Friedrich von Schiller, er hatte es tatsächlich geschafft. Daneben Charlotte von Stein und eine Dame, die Louise nicht kannte. Sie begrüßte Schiller, Wieland und Frau von Stein, um dann mit einer leichten Verbeugung vor der Unbekannten stehen zu bleiben. Diese war schlicht, aber elegant und vollständig in Schwarz gekleidet. Frau von Stein stellte sie als Isabella von Zeiselburg vor, ihre Cousine zweiten Grades aus Eisenach. Vor einem Dreivierteljahr war deren Gatte verstorben, so erklärte die Stein, und nun halte sich Isabella zur Erholung in Schloss Kochberg auf, dem Landsitz derer von Stein. Heute war sie zwecks geistiger Auffrischung zur Teegesellschaft der Herzoginmutter geladen.
Louise begrüßte Frau von Zeiselburg, die außer einem leichten Kopfnicken und einem indignierten Blick auf Louises mohnrotes Kleid nichts für sie übrighatte. Louise trug fast ausschließlich rote Kleider, da sie meinte, auf diese Weise, trotz ihres Kleinwuchses, besser wahrgenommen zu werden. Alle anderen in der Runde kannten ihr Faible für diese Farbe.
Im Verlauf des Abends wurde über den »Zippelmarckt« gesprochen, der am übernächsten Wochenende zum hunderteinundfünfzigsten Mal stattfinden sollte. Herzog Carl August hatte im letzten Jahr, zum hundertfünfzigsten Jubiläum, im Hoftheater ein unterhaltsames Theaterstück für die Bevölkerung aufführen lassen, bei freiem Eintritt. Nun hatte er seine Mutter gebeten, mit ihrer kulturbeflissenen Runde über eine Wiederholung dieses Spektakels zu beraten. Da Goethe ein Liebhaber des Marktgeschehens war – er mochte die namensgebende Zwiebel und sprach ihr eine gesundheitsförderliche Wirkung zu –, sicherte er die Unterstützung durch das von ihm geleitete Hoftheater zu. Der kurze Vorlauf von zwei Wochen schien ihm keine Schwierigkeiten zu bereiten.
Auch Friedrich von Schiller liebte den Zwiebelmarkt. Man sagte ihm nach, er bevorzuge Äpfel, die er wochenlang in der Schublade seines Schreibpults aufbewahrte, bis sie anfingen zu faulen und zu riechen, denn das, so hieß es, fördere seinen Gedankenfluss.
Louise von Göchhausen war keine Freundin von Märkten. Sie konnte sich nicht gut in Menschenmengen bewegen, und mehrmals schon hatte man sie aufgrund ihrer körperlichen Statur als Kind angesehen und gefragt, wo ihre Mutter sei. Nein, das brauchte sie nicht. Aber sie freute sich, dass die Menschen sich dort mit Gemüse, Obst und Vieh für den Winter eindecken konnten und sich amüsierten. Im Laufe der Jahre hatte sich der »Zippelmarckt« zu einem halben Jahrmarkt entwickelt, mit Gauklern, Feuerschluckern, Zirkusvorführungen und Theatergruppen. Dass dabei auch mancher Halunke seinen Vorteil suchte, war ein unschöner Nebeneffekt.
*
Um den schweren, mit Buchenholzbrettern beladenen Wagen zur Straße hochziehen zu können, lieh sich Wilhelm zwei Kaltblüter vom Mühlenbesitzer. Oben angekommen, wurden die kräftigen Pferde wieder ausgespannt. Der Rückweg von der Sägemühle führte an einem Wiesengrund entlang, der sich bis zu den Weimarer Herrschaftswiesen hinzog. Unter einer einzeln stehenden Eiche hielt Wilhelm das Gespann mit einem lauten »Brrr!« an. Schnaubend und dampfend kamen die Tiere im Schatten des Blätterdachs zum Stehen, immer an der gleichen Stelle, jeden letzten Freitag im Monat. Die beiden jungen Männer nickten sich zu. Sie wussten, dass die Pferde sich vom Ziehen der schweren Last erholen mussten. Anton zog einen Holzeimer unter dem Kutschbock hervor und tränkte sie mit dem Wasser der Ilm. Wilhelm liebte die Natur. Ehrfürchtig betrachtete er die mächtige Eiche und sprach ein kurzes Gebet für all die Bäume, die zur Herstellung eines Möbelstücks gefällt worden waren.
Kaum hatten sie die Tischlerei in der Rittergasse erreicht, sprang Wilhelm vom Kutschbock und rannte in die Werkstatt. Er wollte wissen, was aus seiner Tischplatte geworden war, die er aus drei wunderschön gemaserten, rötlichen Kirschbaumbrettern zusammengeleimt hatte. Sie sollte zu einem BureauPlat, einem Schreibtisch ohne Aufsatz, werden. Die Schreiber der Canzley des Geheimen Conseils warteten schon sehnsüchtig darauf. Vorsichtig fuhr er mit der flachen Hand über die Platte. Der Leim war getrocknet. Er löste die Schrauben und entfernte den Leimknecht, der die drei Bretter zusammengehalten hatte. Wilhelm legte die Kirschholzplatte auf die Werkbank, fixierte sie mit vier Schraubzwingen und griff nach dem Schlichthobel. Langsam fuhr er damit über die aufgeraute Holzoberfläche, immer im Fünfundvierzig-Grad-Winkel zur Maserung. Diese Technik des Zwerchens hatte er auf seiner zweijährigen Wanderschaft von einem Schreiner in Krakau gelernt. Dadurch wurde eine gleichmäßige, glatte Oberfläche hergestellt, ohne unnötig viel Abtrag zu erzeugen.
»Wilhelm, wo bleibst du?«, rief Anton von draußen.
»Ich komme gleich!« Wilhelm konnte sich nicht von der beeindruckenden Maserung lösen.
»Wir müssen das Holz abladen, bevor es dunkel wird.«
»Ich weiß.«
Als Wilhelm nach einer Viertelstunde immer noch mit der Tischplatte beschäftigt war, betrat Anton die Werkstatt. »Was machst du?«
»Ich glätte die Oberfläche dieser Kirschholzplatte, erst mit dem Schlichthobel, danach mit der Raubank.«
»Was ist denn eine Raubank?«
Wilhelm freute sich über Antons Wissbegierde. »Da hinten.« Er deutete an die Wand. »Der lange, schmale Hobel, das ist eine Raubank. Die nimmt man zum feinen Glätten der Oberfläche, danach Sandpapier. Man muss gut aufpassen, nicht zu viel abzutragen. Ein kluger Mann hat einmal gesagt: ›In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister.‹«
»Das möchte ich auch mal können«, sagte Anton.
»Wirst du, wirst du. Aber um die Gesellenprüfung zu machen, musst du schreiben, lesen und rechnen können. Wie willst du sonst einen Schrank oder einen Tisch planen und aufzeichnen?«
»Wie hast du schreiben und lesen gelernt?«
»Nun, mein Vater hat mich die Buchstaben gelehrt. Alles andere habe ich mir mithilfe von Büchern selbst beigebracht. Später hat mir Meister Frühauf geholfen.«
»Sehr gut, Wilhelm. Nur … meine Eltern können selbst nicht lesen, sie sind arme Bauern.«
»Aha, dann musst du dich allein darum kümmern.«
»Hilfst du mir dabei?«
Wilhelm warf ihm einen erstaunten Blick zu und schwieg.
»Siehst du, es ist schwierig«, rief Anton. »Immer wenn ich denke, ich hätte eine Möglichkeit gefunden, platzt mein Traum wie eine Seifenblase.«
»Du sprichst gut, hast Talent, bist anstellig, du wirst auch lesen und schreiben lernen.«
»Hilfst du mir nun oder nicht?«
Wilhelm überlegte. »Gut, ich helfe dir. Dafür musst du mir aber einen Gefallen tun.«
Anton sprang vor Freude in die Luft. »Jeden Gefallen, Wilhelm, alles, was du willst!«
»Morgen früh muss ich nach Tieffurth zur Demoiselle von Göchhausen, ihren Damensekretär prüfen. Ich brauche dich dazu.«
»Oh, ins Tieffurther Schloss, wunderbar, ich begleite dich. Endlich geht es voran!«
»So ist’s recht. Doch fasse dich in Geduld. Du bist erst sechzehn Jahre alt. In fünf Monaten kannst du mit der Lehre beginnen. Danach gehst du auf die Walz. Das Ganze dauert fünf Jahre.«
Anton riss die Augen auf. »Fünf Jahre? Bis dahin kann ich ja schon tot sein!«
»Unsinn. In fünf Jahren bist du ein Mann.«
Anton nickte.
*
Nach dem Abendessen lenkte Louise von Göchhausen das Gespräch im Tafelrundenzimmer geschickt auf Sophie von La Roche. Sie fragte Christoph Martin Wieland, wie es seiner Base ginge. Der jedoch, immer noch mit dem Tode seiner Frau und dem Umzug von Oßmannstedt nach Weimar beschäftigt, auch gezeichnet vom hohen Alter, konnte nicht viel beitragen. Sophie wohne als Witwe weiterhin in Offenbach am Main, so berichtete er, sie kümmere sich dort um ihre Tochter Lulu und einen Teil der Kinder ihrer verstorbenen Tochter Maximiliane Brentano. Sie gehabe sich recht wohl, so wohl, wie es einer über Siebzigjährigen eben sein könne. Das reichte Louise, von dort schlug sie vorsichtig den Bogen zu Witwen im Allgemeinen und deren Lebensumständen. Insbesondere zu deren Vermögensverhältnissen nach dem Tode des Ehemanns, die oft – so meinte sie – eine gewisse Verzagtheit und Hoffnungslosigkeit zur Folge hatten. Schon in diesem Moment sah die Herzoginmutter sie verwundert an. Sie fragte sich wohl, so wie alle anderen im Raume, wohin diese Konversation führen sollte. Louise beeilte sich zu sagen, dass bei Sophie von La Roche dieser Kummer nicht eingetreten sei, denn sie könne von den Einnahmen ihrer Schriftstellerei leben. Doch bei anderen führe der Tod des Gatten mitunter zu unüberlegten Taten, zum Beispiel zur Verzweiflungsheirat mit einem zweiten Ehemann, der Sicherheit bot. Oder vorgab, selbige bieten zu können. Damit war Louise endlich an ihrem Zielpunkt angelangt.
»Man hört von zwei Witwen, die letztens im herzoglichen Regierungsbereich zu Tode gekommen sein sollen«, sagte sie.
Anna Amalia zögerte einen Moment, so als überlege sie, ob sie zu diesem Betreff überhaupt Stellung nehmen sollte. Dann schob sie ihren Fächer zusammen und sagte: »Nun ja, das ist korrekt, es handelt sich um Frau Meyerbeer und Frau von Bandewitz. Die Damen waren ernsthaft erkrankt, die Erstere an den Pocken, die Zweite erlitt einen Schlag.« Sie hob bedauernd die Schultern und fügte hinzu: »Dies ist umso tragischer, als beide kurz zuvor erneut den Bund der Ehe eingegangen waren.«
Es stimmt also, was dieser Taupe in seinem Brief geschrieben hatte, dachte Louise. Sehr zu ihrer Zufriedenheit nahm Goethe ihren eigenen Faden auf: »Darf ich fragen, Hoheit, wie deren Vermögensverhältnisse sich befanden? Fielen die Eheschließungen in die von Demoiselle von Göchhausen erwähnte Kategorie der Verzweiflungsheirat?«
Anna Amalia lächelte leicht amüsiert. »Keineswegs, lieber Geheimrath, Franziska Meyerbeer besaß eine blühende Tuchmanufaktur in Apolda mit mehr als hundert Arbeitern, Eleonore von Bandewitz ein ausgedehntes Landgut in Kleyn Kromstorff, dessen Ländereien sich hinziehen bis zur Burg Denstedt und nach Umpferstedt.«
»Nun ja …«, erklang eine fremde Stimme. Isabella von Zeiselburg. Die mit dem kühlen Blick. »Vielleicht ging es den beiden Frauen vornehmlich darum, eine kräftige Hand für die Bestandsführung ihrer Besitztümer zu finden.«
»Mag sein«, pflichtete Charlotte von Stein bei. »Doch dies kann durchaus auch von Frauenhand geschehen, nicht wahr?«
Wieland schüttelte zweifelnd den Kopf. »Eine Tuchmanufaktur mit hundert Arbeitern und dieses große Landgut?«
»Warum nicht?«, meinte Louise. »Es gibt Frauen, die über Jahre sogar ein ganzes Herzogtum geführt haben!«
Wieland bekam einen roten Kopf und entschuldigte sich mit einem devoten Nicken bei der Herzoginmutter. Louise hatte einen Pluspunkt bei Anna Amalia gesammelt, was nach dem Auftritt im Treppenhaus dringend notwendig war.
Nun schaltete sich Herr von Schiller ein. »Was mich nachdenklich stimmt, ist die Tatsache, dass die Pocken in Apolda und Umgebung seit einigen Monaten fast ausgemerzt schienen. Der dortige Bürgermeister achtet sehr auf Sauberkeit in seinen Straßen. Er entlohnt vier zusätzliche Wegmacher, die gute Arbeit leisten. Das fördert die Gesundheit der Menschen, mehr weiß die medizinische Wissenschaft noch nicht zu sagen über diese Plage der Menschheit. Aber vielleicht war Frau Meyerbeer … auf Reisen.«
Die Anwesenden hörten interessiert zu, denn als ausgebildeter Regimentsarzt genoss Schiller in den Kreisen der Teegesellschaft hohes Ansehen.
»Nun ja, in einigen Jahren werden die Pocken hoffentlich ausgerottet sein!«, fügte er an.
»Sie meinen mit dieser Kuhpockengeschichte?«, fragte Frau von Stein.
»Ja, richtig. Die Ärzte in England erzielen damit gute Erfolge. Alles hat vor einigen Jahren mit einem gewissen Edward Jenner begonnen, der an einem zehnjährigen Jungen eine sogenannte Vakzination vornahm.«
»Sie erklären uns medizinischen Laien sicher dieses Wort?«, fragte Anna Amalia.
»Selbstverständlich, Hoheit. Vielen Dank für die Gelegenheit. Der Begriff stammt vom lateinischen vacca …«
»Die Kuh?«, fragte Louise.
»Jawohl. Jenner gab den Eiter der Kuhpocken in eine kleine Wunde des Zehnjährigen, wodurch dieser an den harmlosen Kuhpocken erkrankte, aber nicht an den gefährlichen Pocken, die wir als todbringende Menschheitsbürde kennen.«
»Kuhpocken-Eiter?« Louise schüttelte sich vor Ekel.
Schiller hob die Schultern. »Alles ist besser als der Tod. Durch diese Maßnahme scheint eine Art Schutzmantel um den Jungen gelegt worden zu sein. Auch Soemmerring in Frankfurt am Main und Heim in Berlin haben damit erstaunliche Erfolge erzielt.«
Er wandte sich erneut an die Herzoginmutter: »Wie mit seiner Durchlaucht, dem Herzog, besprochen, hat der von Ihnen, Hoheit, eingesetzte Amtsphysikus Dr. Paul Johann Helmershausen hier in Weimar bereits eine Kampagne bei Kindern veranlasst. Leider wehren sich viele Eltern dagegen. Es ist schwer, Ihnen zu erklären, dass ihre Kinder zuerst krank werden sollen, um danach nicht sterben zu müssen.«
Anna Amalia nickte. Die Beschlüsse ihres Sohnes, des Regenten, kommentierte sie grundsätzlich nicht.
»Aber vielleicht ist Ihnen dieser Bericht unangenehm«, fuhr Schiller fort, »sodass ich anfrage, aus meinem neuesten Bühnenstück, dem Demetrius, einige Zeilen vortragen zu dürfen.«
Die Frauen klatschten begeistert in die Hände, die Herzoginmutter machte eine jovial zustimmende Handbewegung. Schiller zog einige dicht beschriebene Blätter hervor und begann zu lesen.
2. Von einem erzwungenen Kuss
Samstag, 29. September 1804
Kurz nach Sonnenaufgang liefen Wilhelm und Anton los. Wenn genug Zeit war, bevorzugte Wilhelm den Weg direkt an der Ilm entlang. Gerade jetzt, im Herbst, konnte er so das farbige Bild der Bäume genießen.
Doch heute wollte er den Weg schnell hinter sich bringen. Sie verließen die Stadt durch das Kegelthor, wandten sich nach links, erklommen die Anhöhe zum Büchsenschießhaus und marschierten entlang der Tieffurther Chaussee in Richtung Webicht. Am Waldrand ästen zwei Rehe, die den Kopf hoben, als die beiden Handwerksburschen näher kamen. Anton trug eine kleine Werkzeugtasche, mehr war heute nicht vonnöten.
Nach einer Stunde erreichten sie Tieffurth. Sie blieben neben dem Schloss stehen und blickten in den Park. Ein paar dünne Nebelschleier lagen noch auf den Wiesen. Der Rotahorn glänzte in der Morgensonne, zwei Bussarde kreisten über den Baumwipfeln. Ein wunderschöner Anblick.
Im Hof vor dem Eingang zur kalten Küche trafen sie auf die Zofe. Sie trug eine weiße Schürze, ihr Haare waren blond, ihr Mieder eng geschnürt, ihre üppigen Brüste kaum zu bändigen. Auch ein schöner Anblick.
»Guten Morgen, Rosine«, sagte Wilhelm. »Wir wollen den Damensekretär der Demoiselle von Göchhausen prüfen, das reparierte Bein, ob es perfekt sitzt.«
»Soso«, antwortete die Zofe. »Der schöne starke Schreinergeselle und so ein … Bübchen!« Sie grinste.
Anton holte tief Luft.
Wilhelm legte ihm beruhigend die Hand auf die Schulter. »Es dauert nur wenige Minuten«, sagte er.
»Meine Herrin ist nicht im Hause, sie übernachtet in ihrer Mansarde im Palais der Herzoginmutter. Das habe ich dir schon beim letzten Mal gesagt.«
»Oh … das muss ich wohl vergessen haben.«
»Zudem weiß ich nichts von dieser … Beinprüfung«, sagte sie.
»Na komm, Rosinchen, wir sind extra von Weimar hierhergelaufen, das soll doch nicht umsonst gewesen sein, oder?« Wilhelm lächelte.
Sie schien zu überlegen. »Na gut, aber ihr dürft nichts anderes berühren in ihrem Gemach, nur den Sekretär, und nichts verstellen oder gar zerstören!«
»Selbstverständlich!«
Rosine zog einen Schlüssel aus ihrer Schürzentasche und ging voraus ins Schloss. Erneut staunte Wilhelm über die vielen Spiegel und die teuren Tapeten, beides kannte er nicht aus seinem Elternhaus, das konnten sich Handwerkerfamilien nicht leisten. Sie stiegen die Treppe hinauf und bogen rechts ab in den Gang zum Nebengebäude. Dort angekommen, öffnete Rosine die Tür zum Gemach der Göchhausen.
»Wenn es nicht lange dauert, kann ich ja hier auf euch warten.«
»Oh, nein, liebste Rosine, das geht nicht, wenn mir jemand beim Arbeiten zusieht, kann ich nicht …«
»Soso.« Sie grinste.
»Und schon gar nicht, wenn eine Frau zugegen ist.«
»Ach, tatsächlich!«, rief Rosine verärgert, drehte sich um und stapfte den Gang zurück ins Haupthaus.
Anton wollte gerade in das Göchhausen-Gemach eintreten, da sagte Wilhelm: »Halt! Du wartest hier vor der Tür, wenn jemand kommt, klopfst du, klar?«
»Aber ich …«
»Keine Widerrede, es gibt nicht viel zu sehen, ich bin gleich zurück.« Damit schloss er die Tür von innen. Sofort ging er auf den Damensekretär zu. Das reparierte Bein hielt fest, es wackelte nicht und war kaum von den anderen zu unterscheiden. Genau das hatte er erwartet. Er legte sich auf den Boden und betrachtete die Unterseite des Schubladenkastens. Irgendwo musste eine Vorrichtung zum Öffnen und Schließen sein. Langsam fuhr er mit den Fingern an den Rändern entlang. Da: In der Mitte der vorderen Kante fühlte er etwas, jetzt konnte er es erkennen: ein kleiner Federmechanismus. Er drückte vorsichtig auf die metallene Lasche, und siehe da: Der gesamte Boden des Schubladenkastens klappte nach unten. Er kniete sich vor den Sekretär und konnte in das geheime Fach hineinsehen. Ein Brief. Absender: Dietrich Gottlieb Taupe. Ein Siegel, auf dem er die Buchstaben JEN erkennen konnte. Wahrscheinlich Jena. Sein Blick flog über die Zeilen:
Hochverehrte gnädige Demoiselle von Göchhausen,
hiermit wende ich mich an Sie in einer äußerst delikaten Angelegenheit. Ich hege den Verdacht, dass zwei angesehene Damen von hohem Stand, die in der letzten Zeit im Raum Weimar und Apolda dahinschieden, nicht aufgrund einer natürlichen Ursache ins Grab sanken. Beide waren Witwen mit beträchtlichen Besitztümern, welche nach ihrem Tode an den jeweiligen Ehemann fielen. Die Gatten, und das ist das Auffällige an dieser Causa, hatten die Damen erst kurze Zeit zuvor geehelicht. Bei der einen waren es drei Wochen, bei der anderen sechs Wochen. Ich weiß, dass dieser Verdacht ungeheuerlich ist, und wollte deswegen nicht Mitglieder des Geheimen Conseils oder gar den Ehrwürdigen Durchlauchtesten Herzog direkt ansprechen. Vielleicht haben Sie als einflussreiche Person bei Hofe eine Idee, wie wir hinter das Geheimnis kommen.
Mit Hochachtung und voller Ehrerbietung,
Dietrich Gottlieb Taupe
PS. Ich werde am folgenden Montag um den Mittag einen Boten zu Ihnen senden, dem Sie eine Antwort mitgeben können. Wir sollten uns nicht zu viel Zeit lassen, denn es könnte ein nächstes Opfer geben.
In diesem Moment flog die Tür auf. Rosine stand im Zimmer. Wilhelm spürte sein Gesicht schlagartig heiß werden.
»Dacht’ ich mir’s doch! Du willst rumspionieren!«
Geistesgegenwärtig legte er den Brief zurück in das Geheimfach und klappte es hoch, bis es einrastete.
»Was war das für ein Papier?«, fragte Rosine.
»Ein Brief, der zufällig herunterfiel.«
»Und wo ist der jetzt?«
»Kannst ihn sowieso nicht lesen, stimmt’s?«
Rosine sah ihn mit glühenden Augen an. »Du sicher auch nicht, oder?«
»Nein, ich auch nicht«. So konnte er das Ganze herunterspielen.
»Pass auf, schöner Schreinergeselle«, säuselte Rosine, »entweder ich verrate dich bei meiner Herrin oder …«
»Oder was?«
Ihr Mund kam näher, ihre Brust bebte, ihre Zunge schlängelte sich zwischen ihren Lippen hervor. Ihm wurde übel. Es blieb Wilhelm nichts anderes übrig, als sie zu küssen.
»Rosine, wo bist du?« Das war Antons Stimme.
Wilhelm schob das Mädchen von sich und wandte sich dem Sekretär zu.
»Rosine, du solltest Wilhelm doch in Ruhe arbeiten lassen!« Anton tauchte im Türrahmen auf.
Die junge Frau lachte laut. »Schon fertig mit dem Frühstück?«
Anton blickte Wilhelm unsicher an. »Entschuldige, sie hat mich nach unten in die kalte Küche gelockt.«
»Sorge dich nicht, ich bin fertig. Hier, sieh dir das reparierte Bein an, es sitzt hervorragend.«
Anton nickte, kam aber nicht näher.
»Lass uns gehen«, sagte Wilhelm.
Als sie die Treppe hinabstiegen, rief Rosine ihnen hinterher: »Schreinergeselle, falls du noch einmal eine Beinprüfung vornehmen möchtest, dann nimm ein richtiges Bein statt einem Holzbein!«
»Was meint sie damit?«, fragte Anton.
Wilhelm sah ihn ernst an. »Frauen sind eine schwierige Angelegenheit. Du bist noch jung, du musst nicht alles wissen.«
»Aber …« Anton zögerte.
»Komm, wir gehen, ich erzähle dir im Wald mehr, da hört uns niemand.«
»Gut, gut«, sagte Anton eifrig. Als er kurze Zeit später die Wahrheit über Rosines Ausspruch erfuhr, glühte sein Kopf wie eine Laterne. Wilhelm fühlte sich fast wie ein großer Bruder, der den Kleineren in die Welt der Erwachsenen einführte. Er mochte dieses Gefühl. Schon immer hatte er sich Geschwister gewünscht. Die meisten jungen Männer in Weimar hatten zwei oder drei Brüder und Schwestern, so wie Anton, viele hatten fünf oder mehr, so wie seine Nachbarn in der Winkelgasse. Wilhelm liebte den Trubel, die Lebendigkeit in den Häusern, das Tischgebet an einer langen Tafel. Doch er war ein Einzelkind und würde es auch bleiben.
Von dem erzwungenen Kuss berichtete Wilhelm nicht. »Ich kann dir nur eines sagen, Anton, nimm dich vor Rosine in Acht. Sie ist gefährlich!«
3. Von Theo, Annette und Graf von Truss
Sonntag, 30. September 1804
Der Pfarrer predigte über das Thema Heimat. Innere und äußere Heimat. Die innere Heimat der Menschen müsse bei Gott sein, so meinte er. Die äußere Heimat könne sich jeder selbst gestalten, sodass er damit während seines kurzen Erdendaseins zurechtkäme, Freude daran haben und den anderen Menschen dienen könne.
Wilhelms innere Heimat lag beim Allmächtigen, er war der Kompass seines Lebens, das Halteseil über den Abgründen des Alltags. Seine äußere Heimat war hier, in Weimar. Nie hätte er sich vorstellen können, in einer anderen Stadt zu leben. Während seiner Zeit auf der Walz hatte er große Städte kennengelernt, Leipzig, Krakau und Prag. Nein, das war nichts für ihn. Mehrere Zehntausend Einwohner, meine Güte, welch ein Gedränge! Dazu schmale, stinkende Gassen, wenig Grün, lange Fußmärsche, um Feld, Wald oder Wiese zu erreichen. In der Schule hatte er gelernt, dass Weimar etwa siebentausend Einwohner hatte und eigentlich eine Provinzstadt war, abseits der großen Handelsstraßen. Dennoch zeigte Weimar eine eigene Art von Stolz, nicht überheblich, ein gesunder Stolz, das gefiel Wilhelm. Er bewunderte Anna Amalia und ihren Sohn Carl August, die die Stadt vorangebracht und gemeinsam mit den großen vier – Wieland, Goethe, Herder und Schiller – ihren Geltungsbereich vergrößert hatten.
Dennoch spürte Wilhelm, dass ihm zwischen dieser inneren und äußeren Heimat etwas fehlte. Was war es? Was mochte diese Lücke füllen? Er konnte es nicht fassen.
Die Bauern und Handwerker verließen die Stadtkirche zuerst, bildeten draußen auf dem Töpfermarkt eine Art Spalier, durch das die Adligen stolzieren mussten, vielleicht auch durften. Dann erschien die Herzoginmutter mit ihrem Gefolge, Louise von Göchhausen war ebenfalls dabei. Zuletzt kam Herzog Carl August mit seiner Ehefrau, Herzogin Luise.
Wilhelm überragte die anderen um Haupteslänge, mit seinen 6 ½ Fuß war er unübersehbar. Die Demoiselle von Göchhausen warf ihm einen Blick zu, der ihm wie ein Messer in den Magen fuhr. Wusste sie von seinem Fauxpas?
Die Familie Gansser wohnte im Ilmbezirk. Heinrich Gansser hatte das kleine Fachwerkhaus in der Winkelgasse mit seinem Sohn in alter Handwerkstradition selbst errichtet. Unten bestand es aus einem Wohn- und Kochraum, oben aus einem Schlafraum, in dem drei einfache Betten standen, mit Strohsäcken gefüllt. Wilhelm hatte die Schlafstätten selbst gezimmert, und manches Mal hatte er sich gefragt, ob ihn sein Vater nur deswegen gedrängt hatte, den Beruf des Schreiners zu ergreifen. Aber am Ende war ihm die Antwort auf diese Frage gleichgültig, denn das Arbeiten mit Holz machte ihm Spaß und er konnte sich keinen anderen Beruf vorstellen. Sein Vater war Dachdecker und Spengler, er war dünn und wendig, sodass er leichtfüßig auf den Dächern umherlaufen konnte. Er hatte die Dachschindeln ihres Hauses mit in Teer getränkter Pappe unterlegt, was zu verbesserter Dichtigkeit und zu erhöhtem Brandschutz führte. Auch einen Blitzableiter hatte Heinrich Gansser montiert. Die Folgen des Schloss- und Stadtbrandes von 1774 waren immer noch gegenwärtig, Wilhelms Großeltern hatten damals ihr gesamtes Hab und Gut verloren. An der Straßenseite hatte sein Vater sogar einen Regenablauf aus Zinkblech errichtet, ein neuartiges Material, das er mithilfe seiner Zunftkollegen aus Belgien bekommen hatte – sein ganzer Stolz. Damit war es vor dem Haus immer trocken, nicht so wie bei vielen Nachbarhäusern, in die man bei Regen nur eintreten konnte, indem man durch Matsch und Pfützen watete. Zudem sammelte Agnes Gansser das Regenwasser in einer großen Tonne und benutzte es zum Wässern ihrer Pflanzen, zum Tränken der Ziege und zum Reinigen des Abtritts. Dadurch musste sie weit weniger zum Plumpborn laufen als manch andere Frau aus der Winkelgasse. Den Rest des Zinkblechs hatte Wilhelms Vater hinter dem Herd an der Wand befestigt, um zu verhindern, dass umherfliegende Glutreste das Gefach entzündeten, das mit Lehm und Weidengeflecht verfüllt war.
Manchmal musste Wilhelm mit seinem Strohsack unten am Herd schlafen, was er besonders gerne im Winter tat. Im Übrigen war er mit sechsundzwanzig Jahren in einem Alter, in dem man weiß, dass ein Ehepaar bisweilen ungestört sein möchte.
Es gab nicht jeden Sonntag Fleisch, aber am Vortag hatte seine Mutter von einem mit dem Drückkarren umherziehenden Bauern eine Schweineleber gekauft, dazu gab es Kartoffeln und Rübchen.
»Hast du immer noch kein Weib gefunden?«, fragte Heinrich Gansser seinen Sohn.
Wilhelm hob den Kopf. »Nein, Vater, bislang nicht. Wie soll ich mit siebzig Talern Lohn pro Jahr eine Familie ernähren?«
»Dann heirate eben eine reiche Madame!«
»Was wollen Sie mir sagen, Vater? Soll ich das Haus verlassen?«
»Nein, nein, Wilhelm«, ging seine Mutter dazwischen. »Ist schon gut, dein Vater meint das nicht so, er sorgt sich nur um dich. Du wirst sicher eine brave Frau finden.«
»Ja, das werde ich. Bisher fand ich keine, die ich liebhaben konnte.«
»Man muss ein Weib nicht unbedingt ›liebhaben‹!«, polterte sein Vater. »Hauptsache, sie hält Bett und Herd warm.«
Wilhelm sah seine Mutter an. Ihr stand das Wasser in den Augen. Er nickte ihr zu und sie verstand.
Der Vater beendete sein Essen. »Ich erwarte, dass du bis zu deinem nächsten Geburtstag einen eigenen Hausstand gründest, mit oder ohne Eheweib!« Damit stand er auf und erklomm die Stiege nach oben, um seinen sonntäglichen Mittagsschlaf zu halten.
»Ich kann doch nicht bis zum 2. April einen eigenen Hausstand gründen. Was meinen Sie, Mutter, wie soll ich das bewerkstelligen?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Agnes Gansser traurig. »Dein Vater ist manchmal schwierig, er hat eine spezielle Sorgenfalte, hier oben auf der Stirn.« Sie zeigte mit dem Finger zwischen ihre Augenbrauen.
»Ja, aber woher kommt die?«
»Das erkläre ich dir irgendwann einmal. So lange behalte die Suche nach der Liebe bei, mein Sohn, lass dich nicht davon abbringen. Von niemandem!« Damit legte sie zärtlich ihre Hand auf die seine. »Begleitest du mich zu Adelheid?«
»Natürlich, Mutter, ich begleite Sie gern!«
Der Sonntag war der einzige Tag im Wochenablauf, an dem die Familienmitglieder ihre Zeit nach freiem Willen einteilen konnten. Genau genommen betraf es nur den Sonntagnachmittag, denn Kirchgang und Mittagessen waren bindend.
Für eine Frau war es unüblich, ohne männliche Begleitung längere Wege in der Stadt zurückzulegen. Auch war es nicht ungefährlich, zumal es jetzt im Herbst früher dunkel wurde. Wilhelm hatte es sich angewöhnt, seine Mutter sonntags zu ihrer Cousine Adelheid in den Duck’schen Garten an der Ilm zu bringen und sie dort gegen Abend wieder abzuholen. In der Zwischenzeit spazierte er an der Stadtseite der Ilm entlang, saß am Flussufer, beobachtete die Schwäne und hing seinen Gedanken nach. Heute jedoch hoffte er, eine bestimmte Person anzutreffen.
Es war kühler geworden, obwohl die Sonne immer noch vom wolkenlosen Himmel schien. Wilhelms Mutter nahm eine Wolljacke und legte sie sich über den Arm. Sie passierten die Hauptwache. Von dort war zu erkennen, wie die Tüncher den Anstrich der Schlossfassade erneuerten. Man bereitete sich auf die Rückkehr des Erbprinzen Carl Friedrich aus Sankt Petersburg vor. Dort hatte er geheiratet, und die Weimarer Bevölkerung wartete gespannt auf die Ehefrau des zukünftigen Regenten, auf Großfürstin Maria Pawlowna Romanowa, die Schwester des Zaren.
»Haben Sie Neuigkeiten von Adelheid?«, fragte Wilhelm seine Mutter.
»Mein neugieriger Sohn!«, sagte Agnes Gansser lächelnd. »Ja, man hört, dass demnächst ein herzoglicher Physikus durch die Häuser gehen wird, um möglichst viele Kinder mit diesen Kuhpocken zu behandeln. Vorsorglich, wie man sagt. Angeblich sollen die Kleinen danach krank werden, jedoch nicht sterben. Seltsame Sache dies …«
»Ich werde mich mal erkundigen, was Theo davon hält, und Ihnen dann Bericht erstatten.«
»Danke, Wilhelm. Aber …« Sie zögerte.
»Sie meinen wegen Theo?«
»Ja, ich weiß nicht, ob er der richtige Umgang für dich ist.«
»Keine Angst, Mutter. Ich kenne ihn, wir waren fast zwei Jahre zusammen auf der Walz. Er ist ein guter Mensch.«
»Bitte pass auf, mein Sohn!«
»Ja, Mutter. Und wie sieht es in Apolda aus?«
»Besser, kaum noch Pockentote. Aber die Meyerbeer’sche Tuchmanufaktur soll verkauft werden. Komplett mit sämtlichen Webstühlen, den Lagerhäusern, der Färberei in Kitzelbach – einfach alles. Viele Weber fürchten um ihr Einkommen. Und erst recht all die Strumpfwirkerinnen!«
»Oh Gott, das ist ja furchtbar! Sie sagten verkauft? An wen denn?«
»Das weiß ich nicht. Jedenfalls wird gemunkelt, dass Graf von Truss kein Interesse an gutem Tuch habe, nur an blanken Talern.«
»Graf … wer?«
»Graf von Truss. Er hatte Frau Meyerbeer kürzlich geehelicht und ist jetzt der Besitzer ihrer gesamten Güter.«
»Aha, interessant …«
»Aber Wilhelm, seit wann interessierst du dich für solche Geschichten, für Gerede und Faselei? Das ist doch sonst nicht deine Sache, oder?«
»Nun ja, Mutter, ich bin eben neugierig, das wissen Sie doch!«
Agnes Gansser verabschiedete sich mit einer Umarmung, wobei sie sich strecken musste, denn sie war deutlich kleiner als ihr Sohn, dann lief sie über den Ilmsteg, der zum Duck’schen Garten führte.
Wilhelm hatte einen Plan. Er überquerte die große Wiese und erreichte nach wenigen Minuten die Floßbrücke. Hier zweigte der Floßgraben von der Ilm ab, der zum Holzplatz führte. Er hoffte, dass das Gatter an der Brücke nicht geschlossen war. Und er hatte Glück – es schwang auf. Eigentlich durfte kein Gemeiner die Floßbrücke überqueren, denn sie öffnete den Weg zum Stern, dem herzoglichen Lustgarten. Wilhelm wollte nicht direkt in den Stern hineinlaufen, das wäre zu auffällig gewesen, so blieb er auf dem schmalen Seitenpfad, der hinunter zu des Geheimrath Goethes Garten führte. Er schlich sich von einem Buschwerk zum nächsten, suchte Deckung und hoffte, dass seine Gebete erhört würden. Und tatsächlich, da saß sie auf einer Steinbank. Ein Geschöpf des Himmels, ein Engel ohne Flügel. Sie trug ein helles Sommerkleid, die dunklen Haare waren von einem weißen Häubchen bedeckt, ein kleiner Sonnenschirm spendete ihr Schatten. In Gedanken verloren starrte sie in Richtung Ilm, so als suchte sie im Fluss die Antwort auf die Frage, was die Welt im Inneren zusammenhält. Er rührte sich nicht. Sie durfte ihn hier und jetzt auf keinen Fall bemerken.
Vor einer Woche hatte sie ihn bemerkt. Beim Verlassen der Stadtkirche hatte sie ihm einen Blick zugeworfen, einen Blick, den er bis heute nicht wirklich deuten, aber auch nicht vergessen konnte. Würde er mutig denken, so wäre der Blick freundlich gewesen, vielleicht sogar liebevoll. Würde er das Ganze kleinmütig betrachten, wäre es reiner Zufall gewesen.
»Annette, kommst du?«, rief ein älterer Herr ihr zu. Wilhelm hatte ihn zuvor nicht wahrgenommen.
»Ja, Onkel!« Sie stand auf und lief vorsichtig in Richtung des großen Sterns. Ja, vorsichtig, so konnte man ihren Laufstil nennen, aber nicht nur das: auch eine fremdartige Bewegung war zu erkennen, eine Mischung aus Eleganz und gewagter Eigenwilligkeit, wie eine Tänzerin in übergroßen Schuhen. Wilhelm konnte sich von dem Anblick nicht lösen. Er stand hinter einer dünnblättrigen Hecke, bewegungslos, und er sah ihr nach, bis sie nur noch als ferner weißer Punkt zu erkennen war. Es kostete ihn enorme Überwindung, sich von der Szene zu lösen. Endlich ging er zurück zur Floßbrücke, ohne jemandem begegnet zu sein. Er griff unwillkürlich nach der kleinen blauen Holzfigur, die er ständig bei sich trug, meistens in der linken Hosentasche. Ein Glücksbringer. Eigentlich war die Figur geschlechtslos, ein amateurhaft geschnitztes Etwas. Aber sie gehörte zu ihm, seit er denken konnte, und ihr Name war Viola. Ein wenig Glück hatte sie ihm auch diesmal wieder gebracht. Denn immerhin wusste er jetzt, wie der Engel ohne Flügel hieß: Annette.
*
Louise von Göchhausen sah hinauf zum Himmel: weiterhin wolkenlos. Sie konnte einen kleinen Nachmittagsspaziergang durch den Tieffurther Park wagen, wenngleich es kühler geworden war. Ihre Schulter schmerzte heute nicht, was zu ihrem Wohlbefinden beitrug. Rosine lief hinter ihr und trug die Wolljacke ihrer Herrin über dem Arm. Am Ilmufer nahm Louise auf einer Bank Platz.
»Rosine, setz dich!«
Das war ungewöhnlich, normalerweise setzten sich die Angestellten nicht neben ihre Herrschaft.
»Gnädigste …?«
»Ja, du hast richtig gehört!«
Rosine nahm vorsichtig Platz.
»Pass auf, ich brauche jemanden, der sich mit der Meyerbeer’schen Manufaktur auskennt.« Im selben Moment erkannte Louise, dass sie ihr Anliegen ungeschickt in Worte gefasst hatte. Mit der Formulierung »ich brauche« hatte sie sich selbst in den Status einer Bittstellerin versetzt.
Rosine straffte ihren Rücken. »Was meinen Sie mit ›auskennen‹, Gnädigste?«
»Jemand, der dort arbeitet und weiß, was los ist nach dem Tode von Frau Meyerbeer.«
»Aha.«
»Was heißt denn aha?«
»Ich bin mir nicht sicher, ob …«
»Außerdem muss ich erfahren, ob sie wirklich an den Pocken starb.«
»Müssen Sie?«
Wieder hatte Louise sich mit ihrer Formulierung in einen Nachteil manövriert. »Ja«, sagte sie trotzig. Sie musste vorsichtig argumentieren. »Und außerdem könntest du mir erklären, was ›aale Heppe‹ zu bedeuten hat!«
»Schauen Sie, Gnädigste, ich habe ein paar Freundinnen in der Tuchmanufaktur, Strumpfwirkerinnen und eine Weberin. Die wissen genau, dass ich bei Ihnen arbeite. Die sagen mir nichts.«
Louise sah sie entsetzt an. »Ich bitte dich! Warum denn nicht?«
»Die sind nicht besonders gut zu sprechen auf Adelsleute und Großgrundbesitzer – Sie verstehen?«
»Nein, das verstehe ich nicht. Was soll das?«
»Die Mädchen arbeiten hart, den ganzen Tag bis acht am Abend, sechs Tage in der Woche, und verdienen gerade mal …«
»Wie viel denn?«
»Mögen Gnädigste schätzen?«
»Na ja, ungefähr zweihundert Taler im Jahr.«
»Ha!« Rosine lachte kurz und trocken. »So viel verdient ja nicht einmal ein Tischler!«
»Wie kommst du jetzt auf einen Tischler?«
»Wilhelm Gansser. Er war gestern im Schloss.«
»Warum?«
»Er behauptete, das neu angefertigte Bein an Ihrem Damensekretär prüfen zu müssen.«
»Aha!«
»Aber wenn Sie mich fragen, Gnädigste …«
Louise merkte, dass ihre Zofe ein gerissenes Weibsstück war. »Also gut, ich frage dich!«
»Ich denke, er hat was anderes gesucht. Möglicherweise einen Brief, der auf oder in Ihrem Sekretär lag.«
»Na, langsam, wie kannst du so etwas behaupten?«
»Er hatte ein Papier in der Hand, als ich hineinkam, dann hat er es schnell verschwinden lassen und behauptet, er sei sowieso des Lesens nicht mächtig.«
»Ach, du Dummerchen, natürlich kann er lesen, er muss ja Pläne zeichnen, beschriften und so weiter …«
Louise merkte, dass Wilhelm hier der faule Apfel war und nicht Rosine. Sie überlegte einen Moment. »Gut, ich danke dir für den Hinweis. Was ist nun mit deinen Freundinnen in Apolda?«
»Wie gesagt, Gnädigste, sie sind auf Leute von hohem Stand nicht gut zu sprechen, es sei denn …« Rosine schaute demonstrativ gen Himmel, so als würde sie angestrengt nachdenken. Diesmal baute Louise ihr keine Brücke.
»Es sei denn, Sie bezahlen sie dafür.«
»Wie bitte? Bezahlen? Ich soll für eine Auskunft zahlen, für Gerede, für Geschwätz?«
»Diese Auskunft ist Ihnen ja offensichtlich wichtig. Also kann es sich wohl kaum um Geschwätz handeln. Wir sind vier Frauen, für jede einen viertel Taler.«
»Nein, Rosine. Du solltest lediglich mal deine Ohren offen halten, und dafür werde ich nichts bezahlen, das ist eine Unverschämtheit!«
»Gut«, sagte Rosine, stand auf und stellte sich mit erhobenem Kinn neben die Bank. »Damit ist die Angelegenheit für mich erledigt.«
»Ich benötige wohl bald eine andere Zofe, die mehr Respekt zeigt!«
»Wie Sie meinen, Gnädigste. Dann fragen Sie doch die Herzoginmutter.«
Louise wusste, was das bedeutete. Anna Amalia hatte Rosine vor Jahren an den Hof geholt und hielt nach wie vor viel von ihr. Sie würde Rosine nicht so leicht gehen lassen.
»Nein, Anna Amalia frage ich nicht. Vielmehr werde ich den Herzog direkt ansprechen. Bei ihm liegt immer noch die endgültige Entscheidung das Personal betreffend.«
Sie würde das nie tun, denn Carl August hasste es, sich mit solchen Streitereien beschäftigen zu müssen. Aber das wusste Rosine nicht. Inzwischen war Louise von Göchhausen klar, dass sie es mit zwei faulen Äpfeln zu tun hatte. Langsam erhob sie sich und trat schwerfällig den Rückweg an.
Rosine hatte sich in kleinen Seitschritten immer mehr von der Bank entfernt. Unvermittelt sagte sie: »Falls es Gnädigste interessiert, eine Strumpfwirkerin verdient höchstens fünfzig Taler im Jahr. Bei diesem seltsamen Verlagssystem noch weniger.«
»Verlagssystem – was bedeutet dieses Wort?«
»Weiß ich doch nicht.«
Louise schüttelte den Kopf. Rosine hatte sich da wohl einiges zusammengereimt oder sogar ausgedacht.
»Und eine ›aale Heppe‹ ist übrigens eine alte Ziege«, rief die Zofe.
Louise blieb der Mund offen stehen.
»Und diese Auskunft bekommen Sie von mir ohne Bezahlung!« Damit trabte Rosine los, ohne auf ihre Herrin zu warten.
4. Von einem Rauswurf, einem Reiter und einem Runksen
Montag, 1. Oktober 1804
Als Wilhelm am Montag früh den Hof der Tischlerei betrat, lief ihm Meister Frühauf winkend entgegen.
»Hier ist ein Billett für dich. Es kam gestern Nachmittag. Hier, schau!«
»Danke, Meister. Gestern, am Sonntag? Da erreicht Weimar doch weder die fahrende noch die reitende Post.«
»Das stimmt. Der Brief wurde von einem herzoglichen Boten gebracht.«
»Oh!« Wilhelm musste tief durchatmen. »Sie haben, also ich meine, Sie haben ihn doch nicht geöffnet?«
»Natürlich nicht. Er ist ja an dich adressiert.«
In einer schwungvollen Handschrift stand dort: An den Tischlergesellen Wilhelm Gansser. Ein herzogliches Siegel. Wilhelm brach es auf. Frühauf blieb in gemessenem Abstand stehen.
Ich erwarte dich am Montag bis zum Mittag im Schloss Tieffurth.
Göchhausen
Kurz und bündig. Wilhelm ahnte, um was es ging. Rosine, dieses Aas. Er steckte den Zettel ein und erklärt dem Meister, dass etwas mit dem Damensekretär zu klären sei. Frühauf machte sich Sorgen, fragte, was schiefgelaufen sei. Wilhelm beruhigte ihn, es gehe lediglich um eine Kontrolle des ersetzten Beins, er werde das erledigen und gegen Mittag wieder zurück sein. Ach, meinte der Meister daraufhin, da sei Wilhelm ja schon auf dem halben Weg nach Kleyn Kromstorff, dort sei in dem Herrenhaus des großen Gutshofs noch eine Kleinigkeit zu erledigen, eine Schranktür müsse gerichtet werden. Wilhelm war nicht begeistert, denn das bedeutete einen zusätzlichen Fußmarsch von einer Landmeile. Natürlich konnte er sich gegen diesen Auftrag nicht wehren, und Frühauf hatte recht: Tieffurth lag auf dem Weg nach Kleyn Kromstorff. Wilhelm bestückte seinen Werkzeuggürtel und lief los. Anton hatte von alledem nichts mitbekommen, er säuberte das Holzlager, wie jeden Morgen.
Während des einstündigen Fußwegs hatte Wilhelm genug Zeit, sich zu überlegen, wie er reagieren sollte. So wie er die Demoiselle von Göchhausen einschätzte, hatte es wenig Sinn zu leugnen, zu lügen oder fadenscheinige Ausreden anzubringen. Sie würde wissen oder zumindest ahnen, dass er den Inhalt des Briefs kannte. Er entschloss sich, mutig zu sein, das hatte ihm schon oft geholfen.
Als er schließlich vor ihr stand, verbeugte er sich. »Gnädigste, ich bedaure zutiefst, dass mir dieser Fehler unterlaufen ist. Bei der Kontrolle des Sekretärs hat sich versehentlich dieses … Fach geöffnet, und ein Brief fiel heraus.«
»Kannst du lesen?«, fragte Fräulein von Göchhausen.
»Ja, Gnädigste, sonst könnte ich ja nicht …«
»Rede nicht so viel! Hast du den Brief gelesen?«
»Ich bin untröstlich, Gnädigste, meine Mutter schilt mich oft einen Neugierigen …«
»Ja oder nein?«
»Ja, Gnädigste!« Wilhelm verbeugte sich demütig.
»Unfassbar!«
»Der Brief lag geöffnet vor mir auf dem Boden, ich konnte nicht anders.«
»Unsinn! Wer ist deine Mutter?«
»Oh, Gnädigste, bitte …«
»Wie heißt sie und wo wohnt sie?«
»Gansser, Agnes. Im Ilmbezirk.«
Sie hob die Augenbrauen.
»Winkelgasse.«
»Ich werde mit ihr reden müssen, sie hat wohl bei deiner Erziehung einige Lücken gelassen.«
Wilhelm wurde es heiß in seinem Wams. »Bitte, Gnädigste, ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie das nicht täten. Meine Mutter ist eine rechtschaffene Frau, sie sorgt sich um mich, besonders …«
»Was?«
»… weil ich noch kein Eheweib gefunden habe.«
»Du kannst ja meine störrische Zofe heiraten, dann bin ich sie wenigstens los!«
»Oh, Gott bewahre!«
Der strenge Blick der Demoiselle traf Wilhelm bis ins Mark. Sie war zwar klein und krumm gewachsen, konnte aber eine Autorität ausstrahlen, die einem Respekt einflößte.
»Darf ich einen Vorschlag machen?«, fragte Wilhelm. »Ich kann Ihnen helfen, die Mörder zu finden, ich weiß etwas über Frau Meyerbeer und die Tuchmanufaktur in Apolda.«
»Was untersteht Er sich?«, schrie Louise von Göchhausen. »Kein Wort zu irgendjemandem über den Inhalt des Briefs! Hat Er das verstanden?«
Wilhelm nickte.
»Und jetzt hinaus mit Ihm!«
Die Demoiselle klingelte nach ihrer Zofe.
»Rosine!«, rief sie schrill.
Die Angesprochene öffnete umgehend die Tür, als hätte sie davorgestanden und gelauscht. Sie nahm Wilhelm am Arm und zog ihn in den Flur. Dabei grinste sie so unverschämt, dass es ihm zuwider war, das Wort an sie zu richten. Bevor er solch ein Mädchen heiratete, würde er sich freiwillig den Kopf abschlagen lassen.
Als er das Schloss verließ, die Augen zu Boden gerichtet, hörte er einen Reiter heranpreschen. Wilhelm hob den Blick. Ein Mann in der typischen Uniform der Lohnboten, er kam aus Richtung Jena. Das musste der im Brief erwähnte Bote von Herrn Taupe sein. Was würde die Demoiselle von Göchhausen ihm wohl mitteilen?
Wilhelm lief die wenigen Schritte bis zur Ilm, setzte sich auf einen Baumstamm und dachte nach. Während der Fluss vor sich hin plätscherte, rauschten die Gedanken, Stromschnellen gleich, durch seinen Kopf. Vielleicht war die Idee, zwei Mörder zu suchen, völliger Wahnsinn. Er, Wilhelm, ein gemeiner Tischlergeselle, der noch bei seinen Eltern wohnte, kein Pferd sein Eigen nannte, mit dem er dort hingelangen konnte, wo es Geheimnisse zu klären galt, der kaum Geld und keinerlei Einfluss besaß – er wollte zwei heimtückische Schurken finden? Nein, das konnte nicht gut gehen. Im nächsten Moment drehten sich seine Überlegungen in die entgegengesetzte Richtung. Seine Neugier bewässerte das müde Pflänzchen der Mördersuche in seinem Kopf, brachte es zum Wachsen und Blühen, sehr schnell, als seien Frühling und Sommer nur ein paar Minuten lang. Er erhob sich und trottete langsam am Fluss entlang, zurück in Richtung Weimar.
*
Als Wilhelm am Abend schlecht gelaunt nach Hause zurückkehrte, stand ein zimtig duftender Haferbrei auf dem Tisch und seine Mutter war dabei, ein dickes Stück Brot abzuschneiden.
»Hier hast du ’nen ordentlichen Runksen«, sagte sie.
»Ich danke Ihnen, Mutter.« Er nahm Platz und wunderte sich insgeheim, dass der Vater nicht anwesend war.
Agnes Gansser antwortete auf die nicht gestellte Frage: »Heinrich ist noch auf der Baustelle in Oßmannstedt, in der Mühle. Das Dach muss diese Woche fertig werden, er übernachtet dort in der Scheune.«
»Hm«, machte Wilhelm, »ist das dieser Cämmerer … oder wie heißt der?«
»Ja, Johann Philipp Cämmerer.«