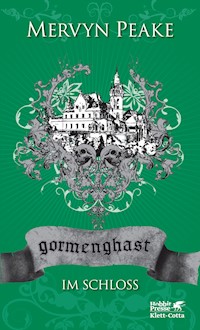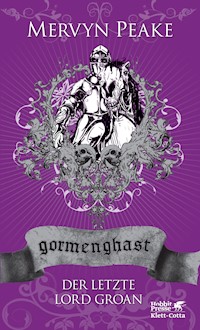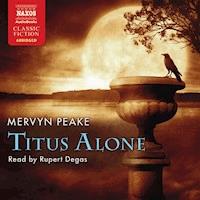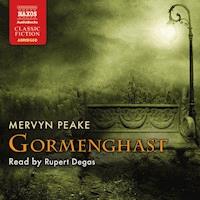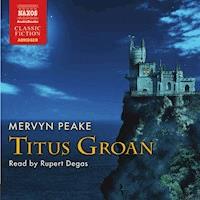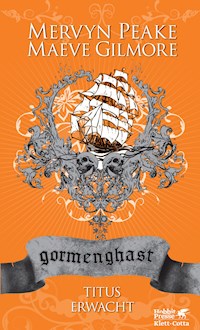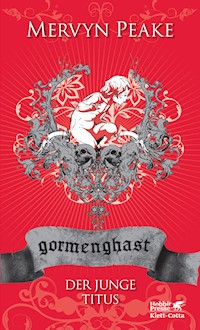
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Gormenghast
- Sprache: Deutsch
Gormenghast - das mächtige, labyrinthische Schloß, der Stammsitz der Grafen Groan, gehört zwar keiner Zeit an und keinem bestimmten Ort, doch so, wie Mervyn Peake seine phantastische Geschichte erzählt, bleibt weiter nichts unbestimmt ... Im Gegenteil: jede Szene wird grell ausgeleuchtet, wird geradezu furchterregend nahegerückt. Bewohnt wird das Schloß von erstaunlichen Figuren mit ausgesprochenen Mittelstandsallüren, die der Autor so dicht heranführt, daß man sie beinahe berühren könnte. Und den fetten Swelter zu berühren, die massige Lady Gertrude oder den spinnenhaften Mister Flay, das wäre in der Tat ein Schock. Ein Fantasyroman voll schillernder Figuren und einem labyrinthischen Schauplatz, der skurriler nicht sein könnte. Mervyn Peakes zeitloses Meisterwerk ist das Vorbild für viele moderne Fantasyautoren. »Gormenghast« ist von der Hand eines Zauberers geschrieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 871
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Besuchen Sie uns im Internet: www.klett-cotta.de/hobbitpresse
Hobbit Presse
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel "Titus Groan" im Verlag Eyre & Spottiswoode, London
© 1946 by Mervyn Peake
Für die deutsche Ausgabe
© 1982/2010 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: HildenDesign
Artwork: Birgit Gitschier, HildenDesign
unter Verwendung mehrere Motive von Shutterstock
Printausgabe: ISBN 978-3-608-93921-7
E-Book: ISBN 978-3-608-10165-2
Liebst Du es, Fleisch zu picken? Willst Du erblicken Den Mann im Wolkenkleid, auf dass er mit Dir spricht?
Bunynan
Inhalt
Vorwort von Kai Meyer
Die Halle der Edlen Schnitzwerke
Die Große Küche
Swelter
Die Steinwege
»Das Guckloch«
Fuchsia
»Talg und Vogelfutter«
Ein Goldring für Titus
Sepulchrave
Prunesquallors Kniescheibe
Der Dachboden
»Mrs. Slagg im Mondenschein«
Keda
»Erstes Blut«
»Zusammenkunft«
»Titus wird getauft«
Fluchtwege
»Ein Feld aus Steinplatten«
»Über die Dachlandschaft«
»Nah und fern«
»Staub und Efeu«
»Der Körper am Fenster«
»Sonnenblumentod«
Seife als Bühnenschminke
Bei den Prunesquallors
Die Gabe der Glattzüngigkeit
Und die alte Kinderfrau schlummert
Flay bringt eine Botschaft
Die Bibliothek
Im grünlichen Licht
Noch einmal die Zwillinge
»Die Tannenzapfen«
Keda und Rantel
Das Wurzelzimmer
»Eine Ahnung von Ruhm«
»Vorbereitungen für eine Brandstiftung«
Die Grotte
Messer im Mond
»Wieder sinkt die Sonne«
»Inzwischen«
»Der Brand«
Und Pferde brachten sie heim
Swelter hinterlässt seine Visitenkarte
Die Ausgrabung Barquentines
Erste Nachwirkungen
Sourdusts Beerdigung
Die Zwillinge sind unruhig
»Halbdunkel«
Ein Dach aus Binsen
»Fieber«
Lebwohl
An einem frühen Morgen
Farbenwechsel
Ein blutiger Wangenknochen
Wieder die Zwillinge
Das dunkle Frühstück
Die Träumereien
Hier und dort
Omen
Vorbereitung zur Gewalt
Blut zur Mitternacht
Fort
Die Rosen waren Steine
»Barquentine und Steerpike«
Am Gormensee
Gräfin Gertrude
Die Erscheinung
Der Gräfling
Und wieder Mister Rottcodd
Vorwortvon Kai Meyer
Jemand hat einmal die Frage gestellt, wie sich die phantastische Literatur entwickelt hätte, wäre nicht Tolkiens Herr der Ringe, sondern Mervyn Peakes Gormenghast zur Blaupause des modernen Fantasy-Genres geworden.
Sicher ist, es gäbe mehr Bücher wie jene Handvoll, die sich ganz offen zu Peake bekennt: Gloriana von Michael Moorcock, China Mievilles Perdido Street Station, Die Spur des goldenen Opfers von Lucius Shepard, natürlich die Viriconium-Trilogie von M. John Harrison, Gene Wolfes Buch der Neuen Sonne und Jeff VanderMeers Stadt der Heiligen & Verrückten. Es mag noch weitere geben, aber alles in allem ist die Liste nicht lang.
Warum also gilt Gormenghast bis heute als einer der Eckpfeiler der Fantasy?
Vielleicht, weil es abseits von Tolkien das erste Werk war, das voll und ganz auf Visualisierung setzt. Die Geschichte – gut und schön. Die Charaktere – ein Panoptikum aus wandelnden Grotesken. Aber was da vor unserem inneren Auge entsteht, schon in den allerersten Sätzen, ist ein ausgefeiltes optisches Panorama. So wundert es nicht, dass Peake sich, wie Tolkien, erst zu einem Erfolgsautor entwickelte, als auch das Medium Film am Ende der Sechzigerjahre durch breitere Streuung und Verfügbarkeit einen neuen Stellenwert erlangte. Die protestierenden Studenten, die die Welten von Mittelerde und Gormenghast nahezu zeitgleich für sich entdeckten, waren – anders als ihre Eltern – bereits an Leinwand und Bildschirm geschult, sie wollten Geschichten und Welten nicht nur lesen, sondern sehen. Die Grenze zwischen den Wahrnehmungen beider Medien, zuvor vom Literaturbetrieb unumstösslich aufrecht erhalten, fiel gemeinsam mit vielen anderen Schranken in jenen Jahren. Und so verwundert es nicht, dass zwei Romane, die auf den ersten Blick wenig verbindet, aufgrund der atemberaubenden Visualität ihrer Beschreibungen so häufig in einem Atemzug genannt werden.
Man mag sich für den Plot der Gormenghast-Romane begeistern oder nicht, ihrer Atmosphäre kann man sich kaum entziehen. Und es sind jene Stimmungen, heraufbeschworen durch die sprachgewaltige Beschreibung der Schauplätze, die bis heute Generationen von Autoren geprägt haben. Nicht allen Geschichten mag man es auf den ersten Blick ansehen, aber Gormenghasts Einfluss ist in der aktuellen Phantastik allgegenwärtig. Seine Steine wurden abgetragen wie die der alten englischen Landhäuser, die man auf der anderen Seite des Ozeans wieder aufgebaut hat. Das Gestein von Schloss Gormenghast steckt in George R. R. Martins voluminösen Fantasyepen ebenso wie in den Pixeln zahlreicher Videospiele, Neil Gaimans Sandman-Comics und den Filmen von Tim Burton. Ich selbst habe in meinen Romanen wieder und wieder mit dem Mörtel der Groans gemauert; ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft ich meine Heldinnen und Helden über weitläufige Dächer und enge Treppenfluchten, durch endlose Hallen und verwinkelte Steinkorridore gejagt habe.
Vieles, das wir heute »gotisch« nennen, geht mindestens so sehr auf Gormenghasts Fundamente zurück wie auf die häufiger genannten Klassiker von Walpole und Radcliffe. So scheint es auf den ersten Blick verwunderlich, dass wir die Wurzeln seiner Entstehung ausgerechnet in China suchen müssen.
Mervyn Peake wurde 1911 in Guling geboren, einem beliebten Urlaubsort europäischer Kolonialherren im Osten Chinas. Vor allem Briten errichteten hier hunderte von Villen, in die sie sich vor der Sommerhitze des Tieflandes zurückzogen. Peakes Vater arbeitete als Arzt und Missionar, seine Mutter als Krankenschwester. Als die Familie 1923 nach England zurückkehrte, hatten die Jahre in Guling und später in Peking den Zwölfjährigen bereits tief geprägt. Die strengen Rituale des chinesischen Alltags sollten auch das Leben der Bewohner Gormenghasts beherrschen: Das Schloss ist durchdrungen von Peakes Kindheitseindrücken. Die archaischen Statuen, die er als Junge auf der Straße nach Peking passierte, dienten ihm als Vorbilder für Gormenghasts Bildhauereien; chinesische Jadeschnitzer finden ihre Entsprechung in den armseligen Dorfbewohnern, deren Schnitzwerke um die Gunst der Herrscherfamilie konkurrieren. So wie Peake die Lehmhütten der Bergbewohner rund um Guling »wie Napfschnecken« an die Hänge seines Schlossberges versetzte, übernahm er auch die labyrinthische Architektur von Pekings Verbotener Stadt als imaginären Bauplan für das Setting seiner Romane – und potenzierte seine Dimensionen ins Maßlose. Gormenghast mag vordergründig den Anschein europäischer Historie erwecken, aber selbst sein verkrustetes Feudalsystem hat mehr mit den Gegebenheiten am chinesischen Kaiserhof gemein als mit dem britischen Königshaus.
Daheim in England besuchte Mervyn Peake das Internat Eltham School, und die dortigen Zustände verarbeitete er mit satirischer Feder im zweiten Band seines Werks, in den Spielen von Titus’ Mitschülern, und mehr noch im Gebaren der skurrilen Lehrerschaft.
Nach zweijähriger Ausbildung an einer Kunsthochschule zog es den begabten Illustrator auf die Kanalinsel Sark. Obgleich er sich gelegentlich mit den eigenbrötlerischen Bewohnern anlegte, scheint er dort eine glückliche Zeit verbracht zu haben. Seine Vermieterin Miss Renouf liebte Federvieh und führte mit Vorliebe einen weißen Vogel auf ihrer Schulter spazieren; sie mag die Inspiration für manche Eigenheiten der zukünftigen Lady Groan geliefert haben.
Peakes Ruf als Zeichner und Maler wuchs, er ging zurück aufs Festland, heiratete, zeugte mehrere Kinder. Während des Zweiten Weltkriegs wurde er eingezogen, langweilte sich in verschiedenen Kasernen und Garnsionen und schrieb währenddessen am ersten Gormenghast-Roman. 1940 ließ er während eines Heimaturlaubs bei seiner Frau Maeve den Beginn jenes Manuskripts zurück, das bald zu Der junge Titus heranwachsen sollte; bald folgten weitere Kapitel. Maeve bewahrte die Teile des Romans unter ihrem Bett auf. Wenn sie für längere Zeit das Haus verließ, trug sie die Seiten bei sich – aus Angst, dass sie während eines Luftangriffs verloren gehen könnten.
Peake hasste den Alltag in der Armee und verarbeitete seine Ablehnung im rigid geregelten Tagesablauf der Bewohner Gormenghasts. Nach zwei Jahren und einem Nervenzusammenbruch wurde er aus dem Dienst entlassen und kehrte zu seiner Familie zurück. Er vollendete den ersten Band im Garten-Cottage seines Elternhauses, wo er nun mit Maeve und den beiden Kindern lebte.
Ausgerechnet Graham Greene war es, der dafür sorgte, dass Titus Groan veröffentlicht wurde. Es heißt, Peake sei ihm zufällig in einem Londoner Café begegnet und habe ihm dort zum ersten Mal von Gormenghast erzählt. Greene, damals bereits ein erfolgreicher Schriftsteller, las das Manuskript – und sein erstes Urteil war niederschmetternd. »Sehr enttäuscht« sei er, schrieb er Peake in einem Brief. Er habe ihm »gelegentlich den Hals umdrehen wollen«, weil er »ein erstklassiges Buch durch Nachlässigkeit verdorben« habe. Zuletzt bot er ihm an, das Ganze bei einem Whiskey in einer Bar zu besprechen. Das muss geholfen haben, denn nach gründlicher Überarbeitung wurde das Buch 1946 vom Verlag Eyre & Spottiswoode publiziert.
Im selben Jahr kehrte die Familie zurück auf die Insel Sark, wo der zweite Roman entstand. Nebenbei schuf Peake zahllose Zeichnungen seiner Figuren, weil er sich nicht damit zufrieden gab, die Welt von Gormenghast allein durch Worte zum Leben zu erwecken. Örtlichkeiten auf Sark flossen namentlich in die Geschichte ein, wurden zu Teilen des Schlosses und seiner Umgebung. Als er zehn Jahre später am dritten Buch saß und mit Frau und Kindern längst wieder auf dem Festland lebte, zog es ihn noch einmal in die Abgeschiedenheit der Insel; diesmal fuhr er allein, um dort in Ruhe den Roman zu vollenden.
Mervyn Peake ist niemals zu Reichtum gekommen, auch nicht zu seinen erfolgreichsten Zeiten als Illustrator. Die Gormenghast-Romane wurden von der Kritik überwiegend wohlwollend aufgenommen, waren aber alles andere als Bestseller. Peake begann, Theaterstücke zu schreiben, in der Hoffnung, damit mehr Geld zu verdienen. Doch als sein Drama The Wit to Woo 1957 in London uraufgeführt wurde, entpuppte es sich als katastrophaler Misserfolg – ganze siebzehn Pfund habe es eingespielt, wird behauptet, bevor es überstürzt wieder abgesetzt wurde. Am selben Tag erkrankte Peake und erholte sich nie wieder.
Offenbar war es eine Kombination verschiedener Krankheiten, die im Laufe der kommenden Jahre sein Gehirn angriff, darunter Symptome von Parkinson und Enzephalitis. Er lebte noch ein ganzes Jahrzehnt, verlor aber die Fähigkeit zu zeichnen, und ein vierter Gormenghast-Roman – eine von mehreren geplanten Fortsetzungen – blieb Fragment. Mervyn Peake starb 1968 im Alter von 57 Jahren, körperlich und geistig ein alter Mann, der den späten Erfolg seiner Bücher nicht mehr miterlebt hat.
Wie schon im Fall von Tolkiens Herr der Ringe war es die Jugend zur Zeit der Studentenrevolten, die Gormenghast wiederentdeckte und zu anhaltender Popularität verhalf. Titus und Steerpike haben nie die Berühmtheit von Frodo und Sauron erreicht, aber Peakes Protagonisten besitzen etwas, das Tolkiens Helden vollkommen abgeht: unbändigen Drang zur Rebellion. Sie stellen sich gegen die eingerostete Obrigkeit und ihre Traditionen, persönliche Freiheit wird ihnen zum höchsten Gut. Dass sie dies zu Feinden macht statt zu Verbündeten, ist die große Tragik ihrer Geschichte. Peake führt beide nicht als Sympathieträger im modernen Sinne, und es ist entlarvend, dass einem ausgerechnet Steerpike in all seiner Verschlagenheit ans Herz wächst: Er ist radikal und gnadenlos, zugleich aber wendet er das verhasste System geschickt gegen sich selbst. Und Steerpike ist es auch, durch dessen Augen wir Gormenghast erstmals kennenlernen – am eindrucksvollsten während seiner Kletterpartie über die Dachlandschaft des Schlosses, als er die verrottenden Strukturen aus der Vogelperspektive betrachtet. Es ist der Blickwinkel des ewigen Rebellen, den Peake hier einnimmt, die Sicht von einem, der glaubt zu durchschauen, was falsch läuft in seiner Gesellschaft.
Steerpike und Titus sind Gormenghasts ganz eigene Jugendbewegung, und wir teilen ihre Enttäuschung und ihre Wut, so als wären wir es, die den maroden Mikrokosmos einer ganzen Welt zu unseren Füßen sehen.
Kai Meyer,
Mai 2010
Die Halle der Edlen Schnitzwerke
Gormenghast – oder genauer: Der größte Teil des alten Mauerwerks – hätte, für sich gesehen, eine bestimmte, eindrucksvolle Bauweise repräsentiert, wäre es nur möglich gewesen, jene umliegenden schäbigen Behausungen zu ignorieren, die sich wie eine krankhafte Wucherung um die Außenmauern legten. Sie breiteten sich über den Hang aus, eine jede halb über dem Nachbargebäude aufragend, bis die oberen Hütten, aufgehalten durch die Befestigungen der Burg, wie Napfschnecken am Felsen klebten. Aufgrund eines alten Gesetzes war diesen armseligen Behausungen die fröstelnde Nähe der über ihnen drohenden Festung gewährt. Zu allen Jahreszeiten fielen über die unregelmäßigen Dächer die Schatten der von der Zeit angenagten Zinnen, der zerfallenen und der hochaufragenden Türmchen und, am gewaltigsten, der Schatten des Pulverturms. Dieser Turm, ungleichmäßig mit Efeu bewachsen, erhob sich wie ein verstümmelter Finger aus einer Faust von knöchelartigem Mauerwerk und wies blasphemisch gen Himmel. Des Nachts verwandelten ihn die Eulen in einen hallenden Schlund; tagsüber ragte er stumm auf und warf seinen langen Schatten.
Zwischen den Bewohnern jener äußeren Hütten und denen, die innerhalb der Mauern lebten, gab es kaum Umgang, außer wenn am ersten Junimorgen eines jeden Jahres sämtliche Bewohner der Lehmhütten Erlaubnis erhielten, den Besitz zu betreten und die Holzschnitzereien vorzustellen, an denen sie das ganze Jahr gearbeitet hatten. Diese Schnitzwerke, mit sonderbaren Farben bemalt, stellten gewöhnlich Tiere oder Menschen dar und waren in höchst einzigartiger Weise gestaltet. Der Wettbewerb um die besten Werke eines Jahres war hart und erbittert. Wenn die Tage der Liebe verronnen waren, galt die einzige Leidenschaft der dort lebenden Menschen der Herstellung jener Holzskulpturen, und in dem Durcheinander von Hütten am Fuß der Außenmauer lebten ein paar begabte Kunsthandwerker, deren Stellung als beste Schnitzer ihnen den Ehrenplatz unter den Schatten vergönnte.
An einer Stelle innerhalb der Großen Mauer, ein paar Fuß über dem Erdboden, bildeten die gewaltigen Quader, aus denen die Mauer erbaut war, einen riesigen Vorsprung, der sich von Ost nach West etwa zwei- bis dreihundert Fuß entlangzog. Diese vorspringenden Steine waren weiß bemalt, und auf eben diesem Mauervorsprung wurden am ersten Junimorgen eines jeden Jahres die Schnitzwerke aufgestellt, um vom Grafen Groan beurteilt zu werden. Die Werke, die man für die vollendetsten hielt – und das waren niemals mehr als drei –, wurden daraufhin in der Halle der Edlen Schnitzwerke aufgestellt.
Jene lebensvollen Objekte standen also reglos dort den ganzen Tag über, warfen an die dahinterliegende Mauer ihre phantastischen Schatten, die sich mit dem Sonnenlauf Stunde für Stunde bewegten und verlängerten, und strahlten trotz ihrer bunten Farben Düsternis aus. Die Luft zwischen ihnen war aufgeladen mit Verachtung und Hass. Die Künstler standen wie Bettler umher, um sich die schweigenden Familien geschart. Alle wirkten sie grob und frühzeitig gealtert. Jeglicher strahlende Glanz war verschwunden.
Die Schnitzwerke, die nicht erwählt worden waren, wurden noch am gleichen Abend im Hof unter dem Westbalkon des Grafen Groan verbrannt, und es herrschte der Brauch, dass der Graf während der Verbrennung dort stand und den Kopf wie im Schmerz gesenkt hielt; wenn dann von innen der Gong dreimal ertönte, wurden die drei von den Flammen verschonten Skulpturen hinaus ins Mondlicht getragen. Man stellte sie auf die Balustrade des Balkons, wo die unten versammelte Menge sie deutlich sehen konnte, woraufhin Graf Groan ihre Schöpfer aufrief. Nachdem sich diese sogleich unter ihm aufgestellt hatten, warf der Graf die traditionellen Pergamentrollen hinab, die, wie ihr Inhalt besagte, den Künstlern die Erlaubnis gaben, den Wehrgang über ihren Behausungen bei Vollmond eines jeden zweiten Monats zu betreten. In diesen festgelegten Nächten konnte ein Beobachter aus einem Fenster der Südfassade jene mondbeschienenen Gestalten betrachten, denen ihre Kunstfertigkeit diese so ersehnte Ehre verschafft hatte, wie sie auf der Festungsmauer auf- und abgingen.
Abgesehen von dieser Ausnahme am Tag der Schnitzwerke und der Freizügigkeit, die man den Hervorragendsten gewährte, gab es für diejenigen innerhalb der Mauern keine Gelegenheit, das Volk draußen kennenzulernen, noch waren die in den Schatten der Mauern Hausenden von irgendwelchem Interesse für die Welt dahinter.
Es war ein nahezu vergessenes Volk: ein Stamm, an den man sich mit Erstaunen erinnerte oder mit dem unwirklichen Gefühl eines wieder aufflackernden Traumes. Nur der Tag der Schnitzwerke brachte es ans Sonnenlicht und ließ die Erinnerung an frühere Zeiten wieder aufleben. Denn soweit sich selbst Nettel, der Achtzigjährige aus dem Turm oberhalb der vor sich hinrostenden Waffenkammer, erinnern konnte, hatte man diese Zeremonie immer schon abgehalten. Unzählige Holzskulpturen waren dem Gesetz getreu zu Asche vergangen, doch die ausgewählten standen immer noch in der Halle der Edlen Schnitzwerke.
Diese Halle im Obergeschoss des Nordflügels unterstand dem Kurator Rottcodd, der den Großteil seines Lebens in einer Hängematte am Ende der Halle verbrachte, da niemals irgendjemand diesen Raum aufsuchte. Wenn er auch ständig vor sich hindöste, soll er doch den Staubwedel nie aus den Händen gegeben haben, den Staubwedel, mit dem er die eine der beiden notwendig erscheinenden regelmäßigen Aufgaben in jener langen und stillen Halle vollzog, nämlich die Edlen Schnitzwerke vom Staub zu befreien.
Als Kunstgegenstände interessierten ihn die Arbeiten wenig, und dennoch hatte er gegenüber einigen der Schnitzwerke eine Art verwandtschaftlichen Gefühls entwickelt. Er arbeitete mehr als sorgfältig, wenn er das Smaragdpferd abstaubte. Auch dem schwarz-olivfarbenen Kopf gegenüber und dem Gescheckten Hai widmete er seine besondere Aufmerksamkeit. Was aber nicht bedeutete, dass sich vielleicht sonst irgendwo Staub niederlassen durfte.
Rottcodd betrat die Halle, jahraus, jahrein, winters und sommers, um sieben Uhr, schlüpfte aus seinem Jackett und zog sich einen langen grauen Kittel über, der formlos bis auf die Knöchel niederfiel. Es war seine Gewohnheit, den Staubwedel aus Federn fest unter den Arm geklemmt, einen scharfen Blick über den Rand seiner Brille die Halle entlang zu werfen. Rottcodds Schädel war dunkel und klein, wie eine verwitterte Musketenkugel, und die Augen hinter den blitzenden Gläsern zwei verkleinerte Versionen des Kopfes. Alle drei befanden sich ständig in Bewegung, als wollten sie die schlafend verbrachte Zeit wettmachen. Der Kopf wackelte mechanisch von einer Seite auf die andere, wenn Rottcodd ging, und die Augen spähten hierhin und dorthin und überallhin, wenn auch auf nichts Bestimmtes, als erhielten sie ihre Anweisungen von der Mutterkugel, in der sie saßen. Nachdem er beim Eintritt rasch über den Brillenrand geblickt und, nach dem Überstreifen des Kittels, das Gleiche den gesamten Nordflügel entlang wiederholt hatte, befreite Rottcodd gewöhnlich seine linke Achselhöhle von dem Staubwedel und ging ohne weiteres Unterfangen auf die erste Skulptur rechter Hand zu. Die Halle, im obersten Stockwerk des Nordflügels gelegen, war eigentlich keine richtige Halle, eher eine Art Dachboden. Das einzige Fenster lag am entgegengesetzten Ende, gegenüber der Tür, durch die Rottcodd, aus dem höher liegenden Teil des Gebäudes kommend, trat. Es ließ nur wenig Licht ein. Die Läden waren fast ständig geschlossen. Tag und Nacht wurde die Halle der Edlen Schnitzwerke durch sieben Kandelaber beleuchtet, die im Abstand von neun Fuß von der Decke hingen. Niemals durften die Kerzen ausgehen oder auch nur herabbrennen, und Rottcodd sah selbst nach ihnen, ehe er sich um neun Uhr abends zurückzog.
In einem kleinen, dunklen Vorraum der Halle befand sich ein Vorrat an weißen Wachskerzen. Ebenfalls dort warteten Rottcodds Kittel, ein riesiges, vor Staub weißes Gästebuch und eine Trittleiter auf ihren Gebrauch. Es gab ansonsten weder Tische noch Stühle, keinerlei Möbel außer der Hängematte an der Fensterwand, in der Rottcodd schlief. Der Dielenboden war mit weißem Staub bedeckt, welcher, nachdem er so fleißig von den Skulpturen entfernt worden war, keinen anderen Platz fand und sich tief und aschegleich besonders in den vier Ecken aufhäufte.
Wenn Rottcodd die erste Skulptur zur Rechten abgestaubt hatte, bewegte er sich mechanisch an der langen bunten Phalanx entlang, blieb vor jeder Statue einen Moment stehen, wobei seine Augen an ihr auf- und abglitten und sein Kopf wissend hin- und herwackelte, ehe er den Staubwedel ansetzte. Rottcodd war unverheiratet. Wenn man ihm zum ersten Mal begegnete, wirkte er entrückt und sogar nervös, und die Damen empfanden ihm gegenüber ein gewisses Entsetzen. Er war also wunschlos zufrieden damit, so allein Tag und Nacht auf dem riesigen Dachboden zu leben. Doch zuweilen tauchte unerwartet aus dem einen oder anderen Grund ein Diener oder ein anderes Mitglied des Haushalts auf, um ihn mit einer dem Ritual entsprechenden Frage zu erstaunen – und darauf senkte sich wieder Staub auf die Halle und auf Rottcodds Seele.
Wie sahen seine Träume aus, wenn er in der Hängematte lag und den dunklen Kopf in die Armbeuge gesteckt hatte? Wovon träumte er wohl, Stunde um Stunde, Jahr um Jahr? Es fällt schwer, zu glauben, irgendwelche großartigen Gedanken suchten seinen Kopf heim, noch – trotz der Skulpturen, deren farbenprächtige Reihen sich in schmaler werdender Perspektive über den Gang erhoben wie ein Bogengang für einen Herrscher – dass Rottcodd irgendeinen Versuch unternahm, sich aus seiner Isolierung zu befreien, sondern eher diese Einsamkeit um ihrer selbst willen genoss, jedoch ständig in Furcht vor einem Eindringling lebte.
An einem schwülen Nachmittag kam wirklich ein Besucher und störte Rottcodd, als er gerade tief in seiner Hängematte lag, denn seine Siesta wurde abrupt durch ein Rütteln an der Türklinke unterbrochen, welches offensichtlich anstelle der üblicheren Praxis des Klopfens an das Holz vollzogen wurde. Das Geräusch warf ein Echo durch den langgestreckten Raum und setzte sich daraufhin in den feinen Staub auf den Dielen. Sonnenlicht zwängte sich durch die dünnen Risse der Fensterläden. Selbst an einem heißen, stickigen, ungesunden Nachmittag wie diesem waren die Läden geschlossen, und Kerzenlicht beleuchtete den Raum mit ungleichmäßigen hellen Strahlen. Als das Rütteln an der Klinke ertönte, richtete sich Rottcodd abrupt auf. Die dünnen Streifen gedämpften Lichtes bemalten seinen Kopf mit der Helligkeit der Außenwelt. Als er sich von der Hängematte herabließ, tanzte es um seine Schultern; die Augen flogen an der Tür auf und ab und kehrten nach diesen raschen, zuckenden Abschweifungen wieder und wieder zu der aufgeregten Türklinke zurück. Rottcodd umklammerte den Staubwedel fest mit der rechten Hand und begann, die helle Prachtstraße hinabzuschreiten. Dabei wirbelten seine Füße mit jedem Schritt eine kleine Staubwolke auf. Als er schließlich bei der Tür ankam, hatte die Klinke aufgehört, sich zu bewegen. Er ließ sich unvermittelt auf die Knie fallen, legte das rechte Auge an das Schlüsselloch, und indem er den hin- und herpendelnden Kopf sowie das wandernde linke Auge zu kontrollieren suchte (welches sich ständig bemühte, an der senkrechten Oberfläche der Tür auf- und abzugleiten), konnte er nach gehöriger Konzentration in sechs Zentimeter Entfernung seines Schlüssellochauges ein Auge erkennen, das nicht das seine war, nicht nur eine andere Farbe als sein Eisenmarmor besaß, sondern auch, was überzeugender war, sich auf der anderen Seite der Tür befand. Dieses dritte Auge, welches sich ebenso verhielt wie das eine Rottcodds, gehörte Flay, dem schweigsamen Diener Sepulchraves, Graf von Gormenghast. Es galt als absolute Seltenheit, dass Flay sich vier Zimmer in der Horizontalen oder gar ein Stockwerk von Seiner Lordschaft entfernte. Gänzlich fern der Seite seines Herrn zu sein war unnormal, doch hier war offensichtlich an diesem schwülen Sommernachmittag ein Auge Flays vor dem Schlüsselloch der Tür zur Halle der Edlen Schnitzwerke, und vermutlich steckte auch der Rest Flays dahinter. Als sich beide Augen gegenseitig erkannten, zogen sie sich gleichzeitig zurück, und wieder rasselte der Messingknopf der Tür unter der Hand des Besuchers. Rottcodd drehte den Schlüssel und öffnete langsam die Tür.
Flay schien den gesamten Türrahmen auszufüllen, als er derart sichtbar wurde, und er betrachtete mit recht ausdrucksloser Miene den kleineren Mann vor sich. Es sah nicht so aus, als ob ein so knöchernes Gesicht wie das seine eine normale menschliche Äußerung von sich geben könnte, sondern, anstelle von Lauten, eher etwas Brüchigeres, Älteres, Trockeneres, vielleicht wie Splitter oder Teilchen eines Steins. Dennoch öffneten sich die ausgedörrten Lippen. »Ich bin’s«, sagte er und tat einen Schritt in den Raum. Dabei knackten seine Kniegelenke. Sein Gang durch die Halle – wie auch sein Gang durchs Leben – wurde von diesen Knacklauten, einem pro Schritt, begleitet, welche ähnlich dem Knacken dürrer Zweige klangen.
Rottcodd, der sah, dass es sich in der Tat um Flay handelte, bedeutete ihm mit einer irritierten Handbewegung, näherzutreten, und schloss hinter ihm die Tür.
Flay war nie ein flüssiger und gewandter Unterhalter gewesen, und so starrte er eine Weile freudlos vor sich hin, und dann, nach – wie es Rottcodd schien – einer Ewigkeit, hob er eine knochige Hand und kratzte sich hinter dem Ohr. Daraufhin gab er eine zweite Bemerkung von sich. »Immer noch hier, eh?«, fragte er, wobei sich die Stimme ihren Weg aus dem Gesicht kämpfte.
Rottcodd, vermutlich der Meinung, auf eine solche Frage bedürfe es kaum einer Antwort, zuckte die Achseln und ließ die Augen an der Decke umherschweifen.
Flay riss sich zusammen und fuhr fort: »Ich sagte: Immer noch hier, eh?« Bitter starrte er das Smaragdpferd an. »Immer noch da, eh, Rottcodd?«
»Ich bin immer hier«, erwiderte Rottcodd, senkte die blitzenden Brillengläser und ließ die Augen über Flays Gesicht gleiten. »Tagaus, tagein. Immer. Sehr heiß heute. Ungewöhnlich schwül. Wollten Sie irgendetwas?«
»Nichts«, entgegnete Flay und blickte Rottcodd mit leicht bedrohlich wirkender Miene an. »Ich will nichts.« Er wischte sich die Handflächen an den Hüften ab, wo das schwarze Tuch wie Seide glänzte.
Rottcodd schnippte mit dem Staubwedel Asche von seinem Schuh und neigte den Kugelkopf. »Ah«, meinte er unverbindlich.
»Sie sagen ›Ah‹«, meinte Flay, drehte Rottcodd den Rücken zu und begann, die farbenprächtige Galerie hinabzuwandern. »Aber ich sage Ihnen, es ist mehr als nur ›ah‹.«
»Natürlich«, erwiderte Rottcodd. »Viel mehr, möchte ich meinen. Aber ich vermag es nicht zu begreifen. Ich bin Kurator.« Dabei reckte er sich zu voller Größe und stand auf den Zehenspitzen im Staub.
»Was?«, fragte Flay und schwankte über ihm, denn er war wieder zurückgekehrt. »Ein Kurator?«
»Das ist richtig«, sagte Rottcodd und wackelte mit dem Kopf.
Flay schnaubte trocken. Rottcodd hielt dies für ein Zeichen absoluter Verständnislosigkeit, und es ärgerte ihn, dass dieser Mann sein Reich betreten hatte.
»Kurator«, sagte Flay nach einem ungemütlichen Schweigen. »Ich werde Ihnen etwas erzählen. Ich weiß etwas, eh?«
»Nun?«, fragte Rottcodd.
»Ich sag es Ihnen«, begann Flay. »Aber zuerst: Welchen Tag haben wir? Welchen Monat und welches Jahr? Antworten Sie!«
Rottcodd erstaunte diese Frage, aber er wurde langsam neugierig. Es war zu offensichtlich, dass dieser knochige Mann irgendetwas vorhatte, und er antwortete: »Es ist der achte Tag im achten Monat. Über das Jahr bin ich mir etwas unsicher. Aber warum?«
Mit fast unhörbarer Stimme wiederholte Flay: »Der achte Tag im achten Monat.« Seine Augen wirkten fast durchsichtig; und es war, wie wenn man in einem Land mit hässlichen Hügeln plötzlich zwischen den harten Felsen zwei den Himmel widerspiegelnde Seen findet. »Kommen Sie«, sagte er. »Kommen Sie näher, Rottcodd. Ich werde es Ihnen erzählen. Sie verstehen Gormenghast nicht – was in Gormenghast geschieht – die Dinge, die vor sich gehen – nein, nein. Unter Ihnen, da spielt es sich ab, unter diesem Nordflügel. Was bedeuten diese Dinge hier oben? Diese hölzernen Gegenstände? Zu nichts mehr nütze. Aufbewahren, ja. Aber zu nichts mehr nütze. Alles in Bewegung. Das Schloss ist in Bewegung. Heute, zum ersten Mal seit Jahren, ist er allein, mein Herr. Nicht unter meinen Augen.« Flay biss sich auf die Knöchel. »Schlafzimmer der Gräfin: Dort ist er. Lordschaft außer sich: Will mich nicht um sich haben, lässt mich nicht das Neue sehen. Den Neuen. Er ist da. Er ist unten, und ich habe ihn nicht gesehen.« Flay biss sich auf den entsprechenden Knöchel der anderen Hand, als wollte er die Empfindung ausgleichen. »Niemand drin gewesen. Natürlich nicht. Ich bin der Nächste. Die Vögel sitzen aufgereiht auf dem Bett. Raben, Spatzen, diese Lumpen, und die weiße Krähe. Auch ein Turmfalke ist da, Klauen ins Kissen gekrallt. Die Herrin füttert sie mit Brotkrusten. Körnern und Brotkrusten. Hat ihr Neugeborenes kaum angesehen. Erbe von Gormenghast. Sieht ihn gar nicht an. Aber der Herr starrt ihn an. Hab ihn durch das Gitter gesehen. Braucht mich. Lässt mich nicht hinein. Hören Sie zu?«
Gewiss hörte Rottcodd zu. Zunächst einmal hatte er Flay noch niemals in seinem Leben so viel reden hören, und dann war die Nachricht, dass schließlich und endlich dem alten, traditionsreichen Haus Groan ein Erbe geboren war, immerhin ein interessanter Leckerbissen für einen Kurator, der allein im oberen Stockwerk des verlassenen Nordflügels lebte. Hier war etwas, mit dem er sich noch einige Zeit in Gedanken beschäftigen konnte. Es stimmte zwar, wie Flay gemeint hatte, dass der Pulsschlag des Schlosses ihn in seiner Hängematte nicht erreichte, denn um genau zu sein, hatte Rottcodd nicht einmal die Tatsache vermutet, dass ein Erbe unterwegs war. Seine Mahlzeiten kamen in einem Aufzug aus der Dunkelheit der Dienstbotenquartiere viele Stockwerke unter ihm, und in der Nacht schlief er in dem Vorraum und war daher vollständig von der Welt und ihren Geschehnissen abgeschnitten. Flay hatte ihm eine echte Neuigkeit mitgeteilt. Dennoch ließ er sich nicht gern stören, selbst wenn ihm eine Nachricht von solcher Gewichtigkeit überbracht wurde. Durch den kugelförmigen Kopf schoss eine Frage, die Flays Eindringen betraf. Warum hatte Flay, der normalerweise nicht einmal eine Braue hochgezogen hätte, um seine Gegenwart zur Kenntnis zu nehmen – warum hatte er sich nun der Mühe unterzogen, in einen ihm so unbekannten Teil des Schlosses hinaufzusteigen? Und einer Person, so wenig mitteilungsfreudig wie er selbst, eine Unterhaltung aufzuzwingen? Er ließ in der ihm eigenen merkwürdigen Weise die Augen an Flay auf- und abgleiten und überraschte sich selbst durch die plötzlichen Worte: »Und wem oder was verdanke ich Ihre Anwesenheit, Mister Flay?«
»Was?«, fragte Flay. »Was war das?« Er blickte auf Rottcodd herab, und seine Augen wurden glasig.
Mister Flay hatte sich in der Tat selbst überrascht. Warum nur, dachte er, hatte er sich die Mühe gemacht, Rottcodd die Neuigkeit zu überbringen, die ihm so wichtig war? Warum ausgerechnet Rottcodd? Er starrte den Kurator eine Weile an, und je länger er dort stand und nachdachte, desto klarer wurde ihm, dass die eben gestellte Frage gelinde gesagt unangenehm angemessen war.
Der kleine Mann vor ihm hatte ihm eine direkte und einfache Frage gestellt. Eigentlich eine schwierige Frage. Er stakste ein paar Schritte auf Rottcodd zu, zwängte die Hände in die Hosentaschen und drehte sich sehr langsam auf dem Absatz um.
»Ah«, sagte er schließlich. »Ich verstehe, was Sie meinen, Rottcodd – ich verstehe, was Sie meinen.«
Rottcodd sehnte sich zurück in seine Hängematte, um den Luxus des Alleinseins zu genießen, doch seine Augen wanderten noch rascher über das Gesicht des Besuchers, als er diese Bemerkung hörte. Flay hatte gesagt, er verstehe, was er, Rottcodd, gemeint habe. Hatte er das wirklich? Sehr interessant. Was hatte er eigentlich gemeint? Was genau war es, was Flay verstand? Er schnippte ein imaginäres Staubkörnchen von dem vergoldeten Kopf einer Dryade.
»Sie interessieren sich für die Geburt da unten?«, fragte er.
Flay stand eine Weile, als habe er die Frage nicht gehört, aber nach ein paar Minuten wurde deutlich, dass er wie vom Donner gerührt war. »Interessieren?«, schrie er mit tiefer, rauher Stimme. »Interessieren? Das Kind ist ein Groan! Ein echter, männlicher Groan. Eine Herausforderung an die Zukunft! Keine Veränderung, Rottcodd, keine Veränderung!«
»Ah«, sagte Rottcodd. »Ich verstehe, was Sie meinen, Mister Flay. Aber Seine Lordschaft lagen doch nicht etwa im Sterben?«
»Nein«, erwiderte Flay. »Er lag nicht im Sterben. Aber: Zähne werden länger«, und damit stolzierte er wie ein Fischreiher mit langen Schritten zu den hölzernen Fensterläden, und der Staub wirbelte hinter ihm auf. Als dieser sich wieder gesetzt hatte, sah Rottcodd, dass Flay den kantigen, pergamentfarbenen Kopf an das Fensterkreuz gelehnt hielt.
Flay war nicht gänzlich von seiner Antwort auf Rottcodds Frage bezüglich seiner Anwesenheit in der Halle der Edlen Schnitzwerke befriedigt. Als er dort am Fenster stand, wiederholte er für sich diese Frage immer und immer wieder. Warum gerade Rottcodd? Warum in aller Welt Rottcodd? Und dennoch wusste er, sobald er von der Geburt erfahren hatte und seine zähe Natur so heftig aufgestört worden war, dass es ihn gedrängt hatte, seine Begeisterung einem anderen Wesen mitzuteilen – da war ihm Rottcodd eingefallen. Er war nie sehr mitteilsam oder enthusiastisch gewesen und hatte es daher unter dem emotionalen Druck des Ereignisses als schwierig empfunden, Rottcodd die Tatsachen mitzuteilen. Und, wie bereits erwähnt, kam es ihm nicht nur eigenartig vor, dass er sich derart entlastet hatte, sondern auch, dass dies in so kurzer Zeit geschehen war.
Er drehte sich um und sah, wie der Kurator müde neben dem Gescheckten Hai stand; sein kleiner, kurzgeschorener, runder Kopf bewegte sich wie der eines Vogels hin und her; die Hände hielt er, den Staubwedel zwischen den Fingern, gefaltet. Es war offensichtlich, dass Rottcodd höflich darauf wartete, dass er ging. Dennoch befand sich Flay in einem merkwürdigen Zustand. Es überraschte ihn, dass die Nachricht Rottcodd so unbeeindruckt ließ, und es überraschte ihn, dass er selbst die Nachricht überbracht hatte. Er nahm eine riesige silberne Uhr aus der Tasche und hielt sie waagerecht auf der Handfläche. »Muss gehen«, sagte er unbeholfen. »Hören Sie, Rottcodd, ich muss gehen.«
»Nett von Ihnen, dass Sie vorbeigeschaut haben«, meinte Rottcodd. »Würden Sie sich beim Hinausgehen ins Gästebuch eintragen?«
»Nein! Kein Gast!« Flay zog die Schultern bis an die Ohren hoch. »Bin siebenunddreißig Jahre bei Seiner Lordschaft. Gästebuch«, fügte er verächtlich hinzu und spuckte in eine entfernte Ecke des Raumes.
»Wie Sie wollen«, erwiderte Rottcodd. »Ich habe die Personalspalte des Gästebuchs gemeint.«
»Nein«, sagte Flay.
Als er auf dem Weg zur Tür an dem Kurator vorbeikam, sah er ihn, als er auf gleicher Höhe mit ihm war, vorsichtig an, und die Frage drängte sich wieder auf. Warum? Das Schloss pulste vor Aufregung über die Geburt. Alles schwirrte vor Vermutungen. Keine Kontrolle mehr. Gerüchte schoben sich über die Schwelle. Überall, auf den Gängen, in den Hallen, der Kapelle, in Speiseraum, Küche, Schlafsaal und Eingangshalle war es das Gleiche. Warum hatte er sich den begeisterungsunfähigen Rottcodd ausgesucht? Und dann, auf einen Schlag, wusste er es. Er musste sich unbewusst klar darüber gewesen sein, dass für niemanden sonst diese Nachricht neu gewesen wäre; dass Rottcodd für seine Botschaft jungfräulicher Boden war; Rottcodd, der Kurator, der allein unter den Edlen Schnitzwerken lebte, war der Einzige, dem er die Neuigkeit überbringen konnte, ohne seine mürrische Würde infrage zu stellen, und für den, wenn es ihn auch nur zu geringer Begeisterung hinreißen würde, es letztendlich doch etwas Neues bedeutete.
Nachdem er das Problem gedanklich gelöst hatte und schwerfällig merkte, dass die Lösung recht banal und unoriginell war und es sich nicht um seine wandernde Seele handelte, die über Gänge und Treppen hinweg nach der Rottcodds rief, schritt Flay mit ungelenken Bewegungen durch die Gänge des Nordflügels und die gewundenen Steintreppen hinab, die auf den Steinplatz führten, und er verspürte eine sonderbare Ernüchterung, ein Gefühl, als habe er an Würde verloren, und Dankbarkeit, dass sein Besuch bei Rottcodd von niemandem beobachtet worden war und dass Rottcodd selbst vor der Welt wohlversteckt in der Halle der Edlen Schnitzwerke lebte.
Die Große Küche
Als Flay den Bogengang für die Dienerschaft durchschritt und die zwölf Stufen hinabstieg, die zum Hauptgang des Küchentraktes führten, bemerkte er, wie sich seine Stimmung unvermittelt änderte. Die Abgeschiedenheit von Rottcodds Heiligtum, die in ihm nachklang, wurde entweiht. Hier in den steinernen Fluren herrschten alle Symptome heller Aufregung. Flay steckte die Hände in die Jackentaschen und schob die knochigen Schultern nach vorn, so dass nur noch das schwarze Tuch die geballten Fäuste trennte. Der Stoff wurde so gespannt, als wolle er in der Kreuzgegend fast zerreißen. Freudlos starrte er nach rechts und nach links und ging dann weiter. Die langen Spinnenbeine knackten, während er sich durch eine wogende Gruppe Untergebener schob. Sie schnitten einander grobe Grimassen, und einer von ihnen, offensichtlich ihr Anführer, zog ein Gesicht, weich wie Kitt, zu Formen, die unabhängig vom Schädelknochen zu existieren schienen – wenn er überhaupt unter der dehnbaren Haut einen Schädel besaß. Flay schob sich vorbei.
Der Flur war voller Leben. Beschürzte Gestalten liefen zusammen und entfernten sich wieder. Einige stritten, andere lehnten stumm vor Erschöpfung an der Wand, und ihre Hände hingen entweder schlaff herab oder schlugen dumpf den Takt irgendeines Küchenliedes. Der Lärm war erbarmungslos. Eigentlich entsprach dies mehr der Stimmung, die Flay zu sehen wünschte oder jedenfalls der Situation angemessener fand. Rottcodds mangelnde Begeisterung hatte ihn schockiert, und hier konnte man zumindest den traditionellen Ausbruch von Fröhlichkeit bei der Geburt eines Erben für Schloss Gormenghast beobachten. Doch wäre es ihm sogar unmöglich gewesen, einen Anflug von Begeisterung zu zeigen, wenn alle anderen davon beherrscht wurden. Als er durch die überfüllten Gänge schritt und nacheinander an den dunklen Passagen vorbeikam, die zum Schlachthaus mit dem frischen Blutgeruch, zu der Bäckerei mit den süßduftenden Laiben und die Treppe hinab zum Weinkeller und in das unterirdische Netzwerk der Schlosskeller abzweigten, verspürte er eine gewisse Befriedigung beim Anblick der vielen Krakeeler, die beiseite stolperten, um ihm den Weg freizugeben, denn als Oberkammerdiener Seiner Lordschaft hatte er Befehlsgewalt, und sein säuerlicher Mund und die Runzeln, die in seine Stirn ein bleibendes Nest gegraben hatten, wirkten wie eine Warnung.
Es geschah nicht oft, dass Flay Fröhlichkeit bei anderen begrüßte. In Fröhlichkeit sah er die Wurzeln der Unabhängigkeit und in Unabhängigkeit die Saat für Revolution. Aber bei einem solchen Anlass war es anders, denn man entsprach nur streng dem Geist der Konvention, und Flay verspürte ein angenehmes Kitzeln zwischen den Rippen.
Er war an die Stelle gelangt, wo in der Mitte des Dienerflurs zu seiner Linken die schweren Holztüren zur Großen Küche offenstanden. Vor ihm erstreckte sich, nach hinten zu dunkler und schmaler werdend, denn es gab keine Fenster, der Rest des Flures. Dieser Teil war türenlos und wurde durch eine Steinmauer abgeschlossen. Dieser nutzlose, tote Gang war, wie man leicht vermuten kann, meist leer, doch heute bemerkte Flay einige ausgestreckte Gestalten in den Schatten. Zugleich fühlte er sich wie betäubt von einem mächtigen Gebrüll, einem Rasseln und Stampfen.
Als Flay die Große Küche betrat, schlug ihm ein dampfender, stickiger Schwall, eine entsetzliche Hitze entgegen. Es war, als habe ihm jemand einen Schlag versetzt. Die normalerweise schon erstickende Luft in der Küche wurde nicht nur durch die Sonnenstrahlen verstärkt, die an verschiedenen Stellen durch hohe Fenster in den Raum drangen, sondern auch dadurch, dass man in dem festlichen Aufruhr die Feuer gefährlich hoch geschürt hatte. Aber Flay fand es nur angemessen, dass es hier so unerträglich war. Er fand sogar, dass die vier Ofenburschen mit ihren schweren Stiefeln, die Fleisch Stück um Stück zwischen die Metalltüren zwängten, bis der Ofen unter der ungewöhnlichen Belastung nachzugeben schien, sich in Übereinstimmung mit der allgemein erhitzten Lage befanden. Die Tatsache, dass sie keine Ahnung hatten, was sie taten oder warum sie es taten, war unwichtig. Die Gräfin hatte ein Kind geboren; war das vielleicht der Moment für vernünftiges Verhalten?
Die mit klebriger Feuchtigkeit überzogenen Wände dieses riesigen Raumes bestanden aus grauen Steinplatten und waren ständig der Fürsorge einer Gruppe von achtzehn Männern ausgesetzt, die man als die »Grauen Putzer« kannte. Deren Privileg war es, beim Erwachsenwerden zu entdecken, dass für sie als die Söhne ihrer Väter die Karriere vorausgeplant war und vor ihnen das gleiche Leben lag, das aus der phantasielosen, wenn auch lobenswerten Pflicht bestand, jeden Morgen den hohen Wänden der Küche ein makelloses Aussehen zu verleihen. An jedem Tag des Jahres, von drei Uhr morgens bis gegen elf Uhr, wenn die Gerüste und Leitern den Köchen zum Hindernis wurden, gingen die Grauen Putzer ihrem erblichen Gewerbe nach. Durch die Art der Arbeit waren ihre Muskeln ungewöhnlich stark entwickelt, und wenn sie die Arme locker an den Seiten herabhängen ließen, ähnelten sie mehr als nur entfernt Menschenaffen. So grob diese Männer auch wirkten, so waren sie doch ein wesentlicher Bestandteil der Großen Küche. Ohne die Grauen Putzer würde jedem Soziologen, der diesen Dampfraum erforschen wollte, etwas sehr Erdverbundenes, sehr Schweres, sehr Handfestes als letztes Glied im Kreis der Temperamente fehlen, die tiefste Note auf der Skala der niederen menschlichen Werte.
Wegen der täglichen Nähe zu den großen Steinplatten waren die Gesichter der Grauen Putzer ebenfalls wie Stein geworden. Auf den achtzehn Gesichtern lag so gut wie kein Ausdruck, es sei denn, die Ausdruckslosigkeit an sich gälte als Miene. Sie waren einfach wie die Steinquader selbst, von denen die Grauen Putzer gelegentlich herabredeten, von denen sie unverwandt herabstarrten, kaum jemals aber etwas hörten. Traditionellerweise waren sie taub. Sie besaßen sehr wohl Augen, klein und flach wie Münzen, und die Farbe dieser Wände spiegelte sich, wohl wegen des unverwandten Starrens auf die grauen Steine, schließlich unveränderlich und für alle Zeit in ihnen wider. Ja, Augen besaßen sie, insgesamt sechsunddreißig, wie auch achtzehn Nasen, und die Mundlinien ähnelten den groben Ritzen, die die Steinquader trennten. Wenn auch nichts in diesen achtzehn Gesichtern fehlte, so war es doch unmöglich, auch nur die zarteste Andeutung von Leben in ihnen zu finden, und selbst wenn man ihre Gesichtszüge in einem Gefäß mischen und irgendeinen herausgreifen und auf einem Wachskopf anbringen würde, egal wo und wie, würde dies nichts verändern, denn nicht einmal die phantastischste, die genialste Anordnung könnte einen Entwurf zum Leben wecken, dessen einzelne Teile leblos waren. Wenn man also die Ohren mitzählte, die gelegentlich ungeheuer ausdrucksstark sein können, waren die einhundertundacht Gesichtszüge auch unter besten Bedingungen unfähig, ob einzeln betrachtet oder als Ganzes, die leiseste Andeutung dessen zu verraten, was hinter ihnen vor sich ging.
Die Grauen Putzer hatten die zunehmende Aufregung in der Küche unter sich beobachtet, und da sie mangels Hörvermögen nicht in der Lage waren, deren Ursprung zu begreifen, hatten sie sich bis vor ein oder zwei Stunden unfähig gesehen, an den Festlichkeiten teilzunehmen, welche von Herz und Hand des Küchenpersonals Besitz ergriffen hatte. Doch hier und jetzt, am Tag der Tage, der endlich die Ankunft eines neuen Grafen sehen durfte, lagen die Grauen Putzer Seite an Seite sturzbetrunken auf den Steinfliesen unter einem großen Tisch. Sie hatten dem Ereignis alle Ehre angetan und waren von der Bildfläche verschwunden, weil man sie einen nach dem anderen wie Bierfässer, denen sie in der Tat ähnelten, unter einen Tisch gerollt hatte.
In dem allgemeinen Getöse der Großen Küche, welches an- und abschwoll, die Tempi wechselte und andauerte, bis ein schriller Ausbruch oder ein Schnaufen eine neuerliche Pause herbeiführte, aber nur, um durch ein schrecklich krächzendes Gelächter, aufgeregtes Geflüster oder ein rauhes Räuspern unterbrochen zu werden – in diesem wogenden, verwirrenden Irrenhaus hatte das schwerfällige Schnarchen der Grauen Putzer wie ein Kontrapunkt von schmerzhafter Hartnäckigkeit unverändert angedauert.
Man muss zugunsten der Grauen Putzer erwähnen, dass sie erst, als Wände und Boden der Küche durch ihre Bemühungen glänzten, die Spundlöcher in Angriff nahmen, obgleich sie nicht daran gewöhnt waren. Doch sie waren nicht die Einzigen, die kapitulieren mussten. Man konnte jenen gleichen selbstverständlichen Loyalitätsbeweis bei nicht weniger als vierzig Mitgliedern der Küche beobachten, die, wie die Grauen Putzer, Visionen erblickten und Träume träumten, nachdem sie die Flasche als das beste Mittel erkannt hatten, durch das sie ihrer Zuneigung zur Familie der Groan Ausdruck verleihen konnten.
Flay wischte sich mit dem Rücken der klauenartigen Hand die Schweißtropfen fort, die sich bereits auf seiner Stirn angesammelt hatten, und erlaubte seinen Augen, einen Moment lang auf den starren und verkürzten Körpern der berauschten Grauen Putzer zu verweilen. Ihre Köpfe lagen ihm zugewandt und waren geschoren bis auf pulvergraue Borsten. Unter dem Tisch hatte sich ein Schatten breitgemacht, und ihre parallel zueinander liegenden Körper wurden bald vom Dunkel verschluckt. Auf den ersten Blick hatte es ihn nur an eine Reihe zusammengerollter Igel erinnert, und es dauerte eine Zeitlang, ehe er merkte, dass er eine Kette stachliger Schädel betrachtete. Als er sich zufriedenstellend vergewissert hatte, wanderten die Augen mürrisch durch die Küche. Alles befand sich in Aufruhr, aber hinter dem Strom sich bewegender Körper, dem zeitweiligen Chaos, wenn Arbeitstische umstürzten, und über dem mit Soßenschüsseln, Backformen, zerbrochenen Töpfen und Tiegeln und Essensresten übersäten Boden konnte Flay die Hauptmerkmale des Raumes erkennen und als Orientierungspunkte im Kopf behalten, denn vor seinen Augen verschwamm die Küche in feuchten Dünsten. Geteilt durch eine schwere Steinmauer, in der sich eine von dicken Balken gerahmte Öffnung befand, stand der gare-de-manger mit Bergen kalten Fleisches und herabhängenden Karkassen. In dieser Öffnung drehte sich der Bratspieß. Auf einem unverrückbaren Tisch, der die gesamte Wandlänge einnahm, standen riesige Schüsseln, die fünfzig Portionen fassen konnten. Die Soßentöpfe brodelten vor sich hin, nachdem sie übergekocht waren, und der Boden um sie herum war mit einer dunklen Flüssigkeit und Eierschalen bedeckt, die man zwecks Klärung der Brühe mitgekocht hatte. Das Sägemehl, das man jeden Morgen fein säuberlich auf dem Boden auszustreuen pflegte, war nun zu Klumpen getreten und mit Wein vollgesogen. Und wo immer auf dem Boden ein Fetttröpfchen aufgespritzt und zertreten worden war, hatte es sich mit dem Sägemehl verklumpt, so dass es wie ein Pastetchen aussah. An den tropfenden Wänden hingen reihenweise Messer und Schärfer, Auslösemesser, Schälmesser und zweischneidige Beile. Unter ihnen stand ein sechs mal neun Fuß großer Hackklotz mit vielfach gekreuzten Linien und einer Mulde, Ergebnis einer Dekaden dauernden Verwundung.
Auf der anderen Seite des Raumes, zur Linken Flays, befanden sich als Orientierungspunkte ein riesiger Kupferkessel, eine Reihe Öfen und eine schmale Tür. Die Ofentüren standen weit offen, und spitze Flammen leckten gefährlich hoch heraus, während das ins Feuer geworfene Fett blubberte und stank.
Flay kämpfte mit zwei verschiedenen Regungen. Was er sah, hasste er, denn von allen Räumen des Schlosses verachtete er die Küche am meisten, und das aus einem sehr handfesten Grund; und doch verriet ihm ein Zucken seines knochigen Körpers, wie richtig dies alles war. Natürlich konnte er seine Gefühle nicht analysieren, noch wäre ihm überhaupt die Idee dazu gekommen, doch war er so sehr Teil Gormenghasts geworden, dass er instinktiv wusste, wann die Essenz der Tradition in den rechten Kanälen lief, und zwar machtvoll und ohne Abweichung.
Doch die Tatsache, dass Flay aus tief verborgenen Gründen die Vulgarität der Großen Küche durchaus schätzte, beeinträchtigte in keiner Weise seine Verachtung für die dort hausenden Gestalten, die er einzeln vor sich sah. Als er von einer zur anderen blickte, wich die Befriedigung, die er beim Anblick des Ensembles genossen hatte, einer Verachtung dem Einzelnen gegenüber.
Ein gewaltiger, zu einer Spirale gebogener und verdrehter Balken schwamm – so schien es in dem Dunst zumindest – über der gesamten Breite der Großen Küche. Hier und dort waren an seiner Unterseite Eisenhaken in das Mark geschraubt. Darüber hingen wie halb mit Sägemehl gefüllte Säcke – so leblos wirkten sie – zwei Pastetenbäcker, ein alter Poissonier, ein Rôtier mit so krummen Beinen, dass sie fast einen Kreis bildeten, ein rotgesichtiger Légumier und fünf Sauciers mit ihren grünen Halstüchern. Einer von ihnen zuckte ein wenig, doch abgesehen davon herrschte hier Stille. Sie waren sehr glücklich.
Flay trat ein paar Schritte vor, und die Atmosphäre der Küche umfing ihn. Er hatte bislang unbeobachtet an der Tür gestanden, doch als er nun hereintrat, sprang einer der Krakeeler plötzlich vor ihm in die Luft und erwischte einen Haken an dem dunklen Balken direkt über ihnen. Er hing dort an einem Arm, ein hässlicher kleiner Mann mit einem Gesicht voll konzentrierter Unverschämtheit. Er musste über eine seiner Größe unangemessene Kraft verfügen, denn er zog sich trotz des an einem Arm hängenden Körpergewichts hinauf, so dass sein Kopf auf eine Ebene mit dem eisernen Haken geriet. Als Flay unter ihm herging, wand sich der Zwerg mit unglaublicher Schnelligkeit hinauf auf den Balken, schlang die Beine um ihn und ließ den Körper so herabfallen, dass sein Gesicht wenige Zentimeter vor dem Flays pendelte; grotesk grinste die umgedrehte Fratze Flay an, ehe dieser etwas anderes tun konnte, als einfach unvermittelt stehenzubleiben. Aber da hatte sich der Zwerg bereits wieder auf den Balken geschwungen und lief auf allen vieren mit einer Behändigkeit an ihm entlang, die man eher in Dschungeln findet als in Küchen.
Ein gewaltiges Brüllen, das die Kakophonie übertönte, ließ ihn sich von dem Zwerg abwenden. Zur Linken, im Schatten einer Säule, konnte er die verschwommene, aber nicht zu verkennende Gestalt dessen ausmachen, was seit dem Betreten der Großen Küche wie eine Geschwulst in seinem Hinterkopf gelauert hatte.
Swelter
Der Küchenmeister von Gormenghast balancierte unter Schwierigkeiten auf einem Weinfass und sprach zu einer Gruppe von Lehrlingen in bekleckerten gestreiften Jacken und kleinen weißen Kappen. Sie drängten sich mit den Schultern aneinander, um sich gegenseitig zu stützen. Die jugendlichen, von der Hitze der nahen Öfen dampfenden Gesichter blickten recht einfältig, und wenn sie lachten oder der Monstrosität über ihnen Beifall klatschten, dann geschah es mit wilder, kriecherischer Inbrunst. Als sich Flay dem Gedränge näherte, erhob sich wieder ein Gebrüll, wie er es bereits ein oder zweimal vernommen hatte, in die heiße Luft über dem Weinfass.
Die jungen Küchenburschen hatten ähnliches Gebrüll schon viele Male vorher vernommen, es aber niemals mit etwas anderem als Wut in Verbindung gebracht. Zuerst hatte es sie daher entsetzt, aber sie hatten bald gemerkt, dass heute der Tonfall nichts Beunruhigendes enthielt.
Der Küchenmeister, so wie er über ihnen drohte, betrunken, arrogant und pedantisch, war vergnügt.
Die Lehrlinge schwankten berauscht um das Weinfass. In den Gesichtern fingen sich die durch ein hohes Fenster eindringenden Lichtstrahlen, und auf eine benommene Art waren auch sie – vergnügt. Das Echo des offensichtlich sinnlos brüllenden Küchenmeisters verebbte, und der taumelnde Zirkel stampfte fiebrig um das Fass herum und stieß schrille Entzückensschreie aus, denn sie hatten auf dem verschwommenen Gesicht über sich ein irres Lächeln entdeckt. Niemals zuvor hatten sie in Gegenwart ihres Meisters solche Großzügigkeit erfahren. Sie gaben sich jede Mühe, einander im Herausnehmen von bislang nie gehörten Freiheiten auszustechen. Sie heischten um seine Gunst, indem sie mit vollster Lautstärke seinen Namen schrien. Sie versuchten, seinen Blick zu erhaschen. Sie waren sehr müde, schwer und schwindlig vom Trinken und von der Hitze, zehrten aber wild und lebhaft von ihren letzten Kraftreserven. Alle außer einem mit knochigen Schultern, der die ganze Zeit in mürrischem Stillschweigen verharrt hatte. Er hasste die Gestalt über sich und verachtete seine Lehrlingskollegen. Er lehnte im Schatten der Säule, außerhalb des Gesichtsfeldes seines Meisters.
Flay war über den Anblick verärgert, selbst an diesem Tag. War er auch theoretisch dafür, so schien ihm doch in der Praxis ein solches Spektakel sehr unangenehm. Er dachte daran, wie Swelter und er bei der ersten Begegnung sofort eine gegenseitige Abneigung gefasst hatten und wie sich diese Antipathie entwickelt hatte. Swelter ärgerte es, die knochige Gestalt von Lord Sepulchraves Erstem Kammerdiener überhaupt in seiner Küche zu sehen, wobei das einzige Tröstliche darin bestand, dass er durch dessen Anwesenheit die Gelegenheit bekam, seinen überlegenen Witz auf Flays Kosten zu demonstrieren.
Flay betrat nur aus einem einzigen Grund Swelters dunstige Provinz: um sich und anderen zu beweisen, dass er, als Lord Groans persönlicher Diener, in keinem Fall von irgendeinem anderen Bediensteten eingeschüchtert werden konnte.
Um sein Gesicht vor sich selbst zu wahren, machte er recht häufig einen Rundgang durch die Quartiere der Dienerschaft, betrat jedoch die Küche niemals ohne ein unangenehmes Gefühl in der Magengegend; ging niemals hier heraus, ohne dass seine Abneigung bestätigt worden wäre.
Die langen Sonnenstrahlen, die mit schimmerndem Glanz von den feuchten Wänden zurückgeworfen wurden, sprenkelten den Körper des Küchenmeisters mit Flecken gespenstischen Lichts. Von unten wirkte es wie eine fleckige Masse aus warmer, vager Weiße und einem Grau, das sich in mitternächtliche Sümpfe auflöste – ein Körper, hochragend und sich in den Deckenbalken verlierend. Wie es der Situation entsprach, lehnte er sich seitlich an eine Steinsäule, und dabei glitten die Lichtflecken über die schäbige Weißheit seiner prallsitzenden Uniform. Als Flay ihn zuerst zu Gesicht bekam, lag der Kopf des Kochs vollkommen im Schatten. Auf diesem Kopf türmte sich kalt die hohe Berufsmütze, ein vages Großsegel, halb in einem stürmischen Himmel verloren. Der Gesamteindruck erinnerte tatsächlich vage an eine Galeone.
Einer der reflektierten Sonnenflecken tanzte über den Bauch. Genau dieser Lichtfleck bewegte sich auf mesmerisierende Weise hin und her und machte gelegentlich eine langgestreckte Insel verschütteten Weines sichtbar. Diese schien, wenn sie das Licht erfasste, in einem erstaunlichen Kontrast zu dem Helldunkel, förmlich aus dem fleckigen Stoff hervorzuspringen und die Gesetze der Farbenlehre völlig zu missachten. Das unverhohlene Zeichen von Swelters Ausschweifung auf dem gewölbten Leinen besaß zu Mister Flays Überraschung eine gewisse Faszination. Eine Minute lang beobachtete er, wie es auftauchte, verschwand und erneut auftauchte – eine scharlachrote Wappenraute –, während der Körper dahinter schwankte.
Ein erneuter Ausbruch mit Füßestampfen und Schreien zerriss den Bann, und Mister Flay hob stirnrunzelnd den Blick. Einen Augenblick stahl sich die Erinnerung an Rottcodd und seine staubige, verlassene Halle in seine Gedanken, und er war schockiert, wie sehr er – im Gegensatz zu diesem Inferno einer durch den Anlass geheiligten Orgie – die lahme und scheinbar illoyale Selbstgenügsamkeit des Kurators vorzog. Er stakste zu einer Stelle, wo er beobachten konnte, ohne selbst gesehen zu werden; und von dort bemerkte er, wie Swelter sich auf unsicheren Beinen um Haltung bemühte und mit seiner riesigen, weichen Hand den Jugendlichen unten bedeutete, den Mund zu halten. Flay bemerkte, dass sich seine gewohnte Rohheit in Ton und Miene heute zur Sanftzüngigkeit verändert hatte, zu einer aus Blei und Zucker vermischten Fröhlichkeit, einer unheimlichen Vertraulichkeit, die fürchterlicher war als die schlimmsten seiner gefürchteten Wutausbrüche. Seine Stimme drang in gewaltigen Stößen aus den Schatten oder wie warme, ekelerregende Töne aus einer gewaltigen, modernden Filzglocke.
Die weiche Hand hatte den Übermut der Lehrlinge zum Schweigen gebracht, und nun ließ er seine schwere Stimme aus dem Mund triefen.
»Gallensteine!«, und er breitete in der Dunkelheit die Arme auseinander, dass die Knöpfe seiner Weste absprangen, und einer von ihnen zischte durch den Raum und traf eine Kakerlake auf der gegenüberliegenden Wand. »Rückt näher, rückt näher und lauscht mir höchscht aufmerksam. Komm näher, kleines Meer aus Geschichtern, kommt näher, meine kleinen Herzchen!«
Die Lehrlinge schoben sich weiter nach vorn, traten einander auf die Zehen, und der vorderste wurde gegen das Weinfass gestoßen.
»Scho is es gut. Scho is es gut«, meinte Swelter, der auf sie herabäugte. »Jetzt schind wir wie eine einzige große Familie. Gansch für unsch, und schwer vornehm.«
Dann glitt seine feiste Hand durch einen Schlitz seines weißen Berufsgewandes und fischte aus einer tiefen Tasche eine Flasche. Er zog den Korken mit den Lippen heraus, die mit ungewöhnlicher Muskelkraft zugegriffen hatten, und goss sich einen Viertelliter in die Kehle, ohne dass er den Korken vorher entfernt hätte, denn er legte einen Finger über den Flaschenhals und teilte so den Wein in zwei Ströme, die ihm beiderseits in die Backen schossen, weiter hinten im Munde zueinander fanden und mit einem einzigen trägen Gurgeln die Kehle in jene unaussprechlichen Abgründe hinabrannen.
Die Lehrlinge schrien vor Entzücken und Bewunderung auf, stampften mit den Füßen und stießen einander an.
Der Küchenmeister nahm den Korken aus dem Mund, drehte ihn zwischen Daumen und Zeigefinger und war zufrieden, dass er während dieses Vorgangs absolut trocken geblieben war, verkorkte die Flasche wieder und steckte sie zurück durch den Schlitz in die Tasche.
Wieder hob er die Hand, und es herrschte, abgesehen von den schweren, aufgeregten Atemgeräuschen, Stille.
»Nun schagt mir mal, meine schtinkenden Cherubim. Schagt mir, und zwar rasch, wer bin ich? Schnell!«
»Swelter!«, schrien sie. »Swelter, Sir. Swelter!«
»Und das soll alles sein?«, ertönte die Stimme. »Dasch scholl allesch schein, mein Geschichtermeer? Schtill. Hört mir gut schu, dem Küchenmeischter von Gormenghast. Vierzig Jahr, als Junge und Mann, in Wut und Wonne, in Regen und Sonne, Sack und Asche, Topf und Hasche und den geschamten Rest zusammengemanscht, mit einer Sauce aus Aloe und einer Prise scharfen Pfeffer.«
»Mit einer Prise scharfen Pfeffer!«, brüllten die Lehrlinge und fielen sich in die Arme. »Sollen wir das kochen, Sir? Das tun wir sofort, und wir werfen es in den Kupferkessel und rühren gut um. Oh, was für eine leckere Speise, Sir. Was für ein leckeres Gericht!«
»Schtill!«, dröhnte der Koch. »Schtill, meine kleinen Elfenkinder. Schtill, meine rülpsenden Engelchen. Kommt näher, kommt näher mit euren kleinen weißen Geschichtern, und dann sag ich euch, wer ich bin!«
Der Junge mit den hochgezogenen knochigen Schultern, der sich an dem Tumult nicht beteiligte, zog eine kleine wurmstichige Pfeife hervor und stopfte sie sorgfältig. Sein Mund verriet keinerlei Gefühlsregung, die Winkel zeigten weder nach oben noch nach unten, doch in seinen Augen stand heißer, heftiger Hass. Er hielt sie halbgeschlossen, doch der Blick sengte sich durch die Lider, als er beobachtete, wie sich die Gestalt auf dem Fass gefährlich vornüber beugte.
»Nu hört mir mal gut schu«, fuhr die Stimme fort, »un’ dann schage ich euch genau, wer ich bin, und dann schinge ich für euch ein Lied, und dann wischt ihr, wer euch das vorschingt, meine kleinen, grässlichen Taugenichtse.«
»Ja, ein Lied, ein Lied«, ertönte schrill der Chor.
»Zunächscht«, meinte der Koch, beugte sich nach vorn und ließ jedes Wort fallen wie eine mit Sirup beschmierte Kanonenkugel. »Zunächscht mal bin ich niemand andersch als Abiatha Swelter, und für jene, die dasch noch nicht wischen, bedeutet diesch ein Schymbol für Ruhm und Reichtum. Ich bin der Vater von Ruhm und Reichtum. Wer bin ich gleich noch?«
»Abafer Swelter«, schrie es.
Der Koch schwankte auf den geschwollenen Beinen nach hinten und zog die Mundwinkel so weit herab, bis sie sich in den Schatten seiner heißen Wammen verloren.
»Abiatha«, wiederholte er langsam, wobei die Betonung auf dem mittleren »a« lag. »Abiatha. Wie heiße ich noch gleich?«
»Abiatha«, ertönte wieder das Gebrüll.
»Das ist richtig. Stimmt genau. Abiatha. Hört ihr auch schu, ihr kleinen Ungeheuer? Hört ihr auch schu?«
Die Lehrlinge machten ihm verständlich, dass sie genau zuhörten.
Ehe der Küchenmeister fortfuhr, widmete er sich noch einmal der Flasche. Diesmal hielt er den gläsernen Hals zwischen den Zähnen und legte den Kopf zurück, bis die Flasche vertikal stand, leerte sie und warf sie über die Köpfe der faszinierten Menge. Das Geräusch, als das schwarze Glas auf den Steinfliesen zersprang, wurde von Begeisterungsschreien übertönt.
»Essen«, sagte Swelter, »isch was Himmlisches, und Trinken was ganz Bezauberndes – die Blüten der Flatulenz. Diesche Gaschblaschen. Kommt doch näher, stehlt euch heran, und ich werde singen. Ich werde mein süßes Herz in die Lüfte schweben lassen und euch ein Lied schingen. Ein altes, trauriges Lied, ein herzzerreißendes Stück. Kommt nur näher.«
Es war den Lehrlingen unmöglich, noch näher an den Koch heranzurücken, doch sie drängelten sich, riefen nach dem Lied und richteten die glänzenden Gesichter nach oben.
»Oh, wasch scheid ihr doch für eine reizende kleine Meute«, sagte Swelter, beäugte sie und fuhr mit den Händen an den feisten Hüften auf und ab. »Was für ein paar schöne saftige Fleischstückchen. Oh, dasch scheid ihr, aber noch gar nicht gar. Hört zu, meine Hähnchen. Eure Großmütter werden schich im Grabe herumdrehen. Wir schorgen schon dafür, meine Schätzchen, wir sorgen schon dafür – und wie schie schich drehen werden, und mit ihnen die Würmer. Wo ischt Steerpike?«
»Steerpike! Steerpike!«, brüllten die Jungen, wobei die vorne Stehenden auf den Zehenspitzen die Hälse verdrehten und die hinten Stehenden sich nach vorn reckten und sich umsahen. »Steerpike! Steerpike! Irgendwo muss er sein, Sir! Oh, da ist er ja, Sir. Da ist er ja! Hinter der Säule, Sir!«
»Schtill«, bellte der Koch und drehte den Kürbis von einem Kopf in die Richtung, auf die die Hände wiesen und aus der der Junge mit den knochigen Schultern hervorgestoßen wurde.
»Hier ist er, Sir! Hier ist er!«
Der Junge Steerpike sah unglaublich klein aus, als er vor dem riesigen Monument stand.
»Für dich werde ich schingen, Steerpike, für dich«, flüsterte der Koch, taumelte und stützte sich mit einer Hand gegen die Steinsäule, die von kondensierten Hitzeschwaden glitzerte und an deren Kannelierungen kleine feuchte Bäche herabrannen. »Dir, dem Neuen, dem blauen Jeck, der Sommerschneck – dir, dem Grässlichen und Unverschämten, dem ekelerregenden, verkrüppelten Ziegenbock im Hause des Gestanks.«
Die Lehrlinge bogen sich vor Lachen.
»Für dich und nur für dich, mein kugelrunder Haufen Katzenkacke. Nur für dich, also hör gut schu. Hörscht du? Hört ihr alle schu? Hört alle schu, wie es geht. Mein hundert Jahre altes Lied, mein melancholisches, ach so trauriges Lied.«
Swelter schien zu vergessen, dass er singen wollte, und nachdem er den Schweiß von der Stirn auf einen der Jungen hinuntergewischt hatte, spähte er wiederum nach Steerpike.
»Und warum gerade für dich, mein verirrter Sonnenstrahl? Warum nur für dich? Sei gewiss, mein lieber kleiner Steerpike, sei dir nur ganz gewiss, dass du, ein Wesen von weniger Einfluss als Wieselblut, dass du weit entfernt bist, jegliche Ähnlichkeit mit einem natürlichen Wesen zu haben – aber sag mir lieber, oder besser, sag mir nicht, warum deine Ohren, die wohl ursprünglich als Fliegenpatschen entworfen wurden, aus irgendeinem, wohl nur dir bekannten Grund so unverschämt glatt geblieben sind? Was hascht du als nächschtes vor? Auf deinen kleinen, pickeligen Beinen gehst du hierhin und dorthin. Ich hab dich beobachtet. Dein Atem ist überall in der Küche. Mit deinen unverschämten Tieraugen starrst du alles an. Ich habe dich dabei beobachtet. Jetzt siehst du mich an. Steerpike, mein ungeduldiger Schatten, wasch bedeutet dasch alles, und warum schollte ich wohl für dich schingen?«
Swelter lehnte sich zurück und schien seine Frage einen Augenblick lang zu überdenken, während er sich mit dem Ärmel über die Stirn wischte. Aber er wartete nicht auf eine Antwort, schwang die schlaffen Arme seitlich, dann nach oben, und irgendwo auf dieser Kreisbahn gab etwas nach.
Steerpike war nicht betrunken. Als er dort unterhalb von Swelter stand, fühlte er nichts als Verachtung für diesen Mann, der ihn erst gestern auf den Kopf geschlagen hatte. Doch er konnte nichts tun, als bleiben, wo er stand, von hinten durch die aufgeregte Küchenhorde bedrängt und gestoßen, und abzuwarten.