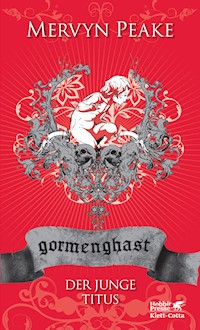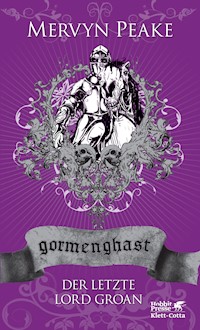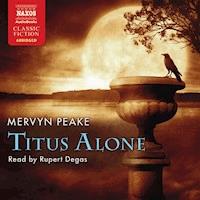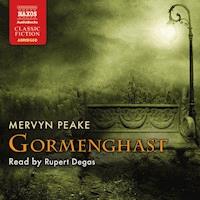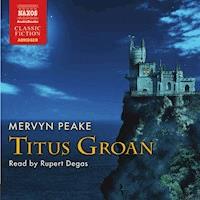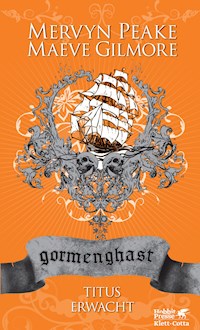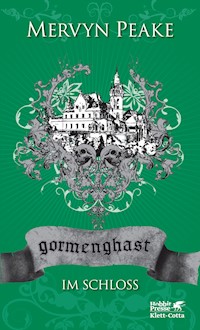
17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Gormenghast
- Sprache: Deutsch
Gewalt und Gesetzlosigkeit breiten sich aus wie die Pest in den finsteren Kammern, den babylonischen Gängen, den kahlen, verlassenen Steinhöfen, den spinnwebverschleierten Dachböden Gormenghasts. Beunruhigende Ereignisse, unerklärliche Vorkommnisse tragen sich zu, verdichten sich und werden zu einer tödlichen Bedrohung für Titus, den jungen Grafen Groan, Herr über die geheimnisvollen Provinzen des Schlosses und ihre Bewohner. In einem grauenvollen Finale fällt schließlich die unerwartete Entscheidung. Ein Fantasyroman voll schillernder Figuren und einem labyrinthischen Schauplatz, der skurriler nicht sein könnte. Mervyn Peakes zeitloses Meisterwerk ist das Vorbild für viele moderne Fantasyautoren. »Gormenghast« ist von der Hand eines Zauberers geschrieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 898
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Besuchen Sie uns im Internet: www.klett-cotta.de/hobbitpresse
Hobbit Presse
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Gormenghast« im Verlag Eyre & Spottiswoode, London
© 1950 by Mervyn Peake
Für die deutsche Ausgabe
© 1982/2010 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: HildenDesign
Artwork: Birgit Gitschier, HildenDesign
unter Verwendung mehrere Motive von Shutterstock
Printausgabe: ISBN 978-3-608-93922-4
E-Book: ISBN 978-3-608-10166-9
Inhalt
Vorwort von Tad Williams
Gormenghast Zweites Buch Im Schloss
Vorwortvon Tad Williams
Zuallererst: Wenn Sie diesem Vorwort gegenüber skeptisch sind, und überlegen, ob Sie dieses Buch überhaupt lesen sollen oder nicht, überspringen Sie das Vorwort und lesen Sie statt dessen das Buch. Sie können später immer noch zurückblättern und schauen, was in der Einleitung steht. Auf geht’s! Los! Immer noch unsicher? Also schön, hier ist ein Abschnitt von der ersten Seite:
Titus der Siebenundsiebzigste. Erbe eines zerfallenden Gipfels, eines Meeres aus Nesseln, eines Reiches aus rotem Rost, der knöcheltiefen Fußspuren des Rituals in Stein.
Gormenghast.
Zurückgezogen und zerfallend brütet es in den Umbraschatten: das unsterbliche Mauerwerk, die Türme, die Trakte. Verrottet alles? Nein. Ein Zephir streicht durch eine Allee aus Türmen, ein Vogel zwitschert, eine Flutwelle reißt den Damm eines gestauten Flusses fort. Tief verborgen in einer Steinfaust windet sich eine Puppenhand warm und rebellisch auf der erstarrten Handfläche. Ein Schatten verändert seine Länge. Eine Spinne regt sich …
Und Dunkelheit breitet sich zwischen den Gestalten aus.
Nun, wie können Sie jetzt noch widerstehen, jene Treppen hinaufzusteigen, die von so vielen anderen so oft erklommen wurden, bis die Stufen in der Mitte derart abgenutzt waren, dass Ihr Fuß darin wie in Schlamm versinkt? Würden Sie nicht gern zwischen den Schatten jener brütenden Türme dahinschleichen und deren Geheimnisse ergründen? Und reizt es Sie nicht endlich zu erfahren, wer solch einen uralten, bedrohlichen, geheimnisumwitterten Ort bewohnt?
Titus, zu Beginn dieses Bandes immer noch ein Kind, ist der siebenundsiebzigste seines Geschlechts – ein Stammbaum, um den ihn sogar die ägyptischen Pharaonen beneiden würden. Und trotz all ihrer Macht und ihres Ruhms, hatte kein Pharao je ein Heim wie Titus und die anderen Groans.
Ehrlich – lesen Sie einfach das Buch. Wir haben später noch Zeit zum Reden. Wenn es um Gormenghast geht, um das monströse Schloss und um Peakes Bücher, die sich ebenso in die Phantasie von Generationen von Lesern eingeschlichen haben, wie die Nesseln und der Rost in die uralte Festung eindrangen, ist immer Zeit genug.
Hier eine Frage: Kann ein Schloss eine Romanfigur sein?
Viele Leser und Kritiker haben auf die Tatsache hingewiesen, dass es zumindest in den ersten beiden Bänden von Mervyn Peakes eigenartigem, verstörendem, doch gleichzeitig auch seltsam bezauberndem Meisterwerk niemanden gibt, den man als Held bezeichnen könnte. Titus, der siebenundsiebzigste Graf von Groan, kommt dem natürlich am nächsten, und er nimmt auf etlichen Seiten von Gormenghast einen Platz ein, der ihn mit anderen Helden von Abenteuergeschichten vergleichbar macht: vom hitzigen Blut der Jugend durchströmt und doch von den Menschen seiner Umgebung getrennt, verwirrt, sehnsuchtsvoll und rebellisch. Im dritten Band, Der letzte Lord Groan, wagt er sich weit über die Grenzen des ungeheuren alten Schlosses hinaus, was ihn wohl zweifellos zum Helden der Geschichte macht. Doch in der ersten Folge, Der junge Titus, existiert er kaum als handelnder Protagonist – auf den letzten Seiten ist er immer noch ein daumenlutschendes Kind, während er im größten Teil des zweiten Bandes jünger als zehn Jahre ist und am Geschehen eher passiv als aktiv teilnimmt. Gewiss kein gewöhnlicher Romanheld.
Steerpike, Titus’ Gegenspieler, ist die Hauptfigur in jenem ersten Band, und sein Aufstieg zur Spitze Gormenghasts, im übertragenen und wörtlichen Sinn (denn Steerpike ist ein geschickter Kletterer, und viel von dem Unheil, das er anrichtet, ergibt sich aus seiner Fähigkeit, rasch und heimlich durch die verfallene, labyrinthische Festung zu streifen), steht im Mittelpunkt der ersten beiden Romane. Doch im dritten Band ist er verschwunden und wird von niemandem außer dem Leser vermisst. Kein guter Kandidat für eine Hauptfigur.
Peake verwendet viele andere Figuren wegen ihrer ungewöhnlichen Perspektiven und teilt ihre Gedanken mit uns – Doktor Prunesquallor, der Schuldirektor Bellgrove, Titus’ leidenschaftlich verwirrte Schwester Fuchsia, um nur einige wenige zu nennen –, doch obwohl sie alle in der Geschichte wichtig sind, tragen ihre eigenen Geschichten nicht die Haupthandlung der ersten beiden Bücher, sondern ranken sich um die wichtigsten Ereignisse, um ihr Profil zu vertiefen und zu verdichten, so wie der schwarze Efeu und die Hirschzunge Gormenghasts tausendjährige Steine überziehen.
Ist es also das Schloss? Ist Gormenghast selbst, wie viele Leser behauptet haben, die Hauptfigur? Falls nicht, ist es jedenfalls unmöglich, einen anderen Handlungsort in der gesamten Literatur zu benennen, der dieser Bezeichnung näher käme. Zweifellos gibt es Stellen, an denen Peake die Karten auf den Tisch zu legen scheint und von dem Ort spricht, als sei er und alle seine Bewohner, so seltsam selbständig sie auch sein mögen, Teile eines einzigen Ganzen:
Das Gefühl von Unwirklichkeit, das sich im ganzen Schloss verbreitet hatte wie eine sonderbare Krankheit, hatte Bellgroves Ehe einen Dämpfer versetzt, so dass, wenn man sich auch nicht über einen Mangel an Ereignissen beklagen konnte und kein Zweifel an deren Wichtigkeit herrschte, doch eine gewisse Schärfe, eine besondere Wahrnehmung fehlte, und niemand wirklich daran glaubte, dass etwas geschah. Es war, als erhole sich das Schloss von einer Seuche oder war dabei, ihr unmittelbar zu verfallen. Es war entweder verloren in einem Schleier unscharfer Erinnerung oder in der Unwirklichkeit beunruhigender Vorahnungen. Dem Schlossleben fehlte die Unmittelbarkeit. Es gab keine scharfen Kanten. Keine knackigen Laute. Über allem lag ein Schleier, ein Schleier, den niemand fortreißen konnte.
Man kann sich kaum vorstellen, dass jemand den Gefühlszustand einer Person besser beschreiben könnte als Peake die Stimmungen eines Ortes. Aber in Wirklichkeit ist Gormenghast mehr als ein Ort, da es viele wundervolle Handlungsorte umfasst – die Halle der edlen Schnitzwerke, die infernalische Küche, das altehrwürdige, pfeifenrauchvernebelte Professorenzimmer, der von Eulen behauste Pulverturm, wo Graf Sepulchrave, Titus’ Vater, dem Wahnsinn verfällt – das Schloss ist viel mehr als die Summe seiner Teile. Es ist nicht nur ein Schloss, es ist ein bewohntes Schloss. Die Hauptfigur der ersten beiden Bände ist weder eine Einzelperson noch ist sie Gormenghast allein, ein Ding aus Stein und Staub und flüsternder Zugluft, vielmehr dreht sich alles um Gormenghast als einen lebendigen Organismus, der alle seine Bewohner mit einschließt. Alle zusammen bilden, sogar inmitten von etwas, das wie allgegenwärtiger Tod und Verfall wirkt, ein pulsierendes Ganzes.
Trotz der schweigenden Schatten, die wie ein Leichentuch über Gormenghast liegen, gibt es stets Geräusche, blitzartige Bewegungen, kleine Gefühlsausbrüche wie jene Flutwelle, die dem gestauten Fluss entströmt. Tod und Leben sind derart miteinander verflochten, dass sie offensichtlich als Teil eines größeren Prozesses untrennbar verbunden werden. Die Spiele der gelangweilten Schüler – eine Gruppe Gefangener in diesem Buch, zu der auch der junge Graf Titus eindeutig und zu seinem großen Kummer gehört – führen zu den schrecklichen (aber auch schwarzhumorigen) Todesfällen zweier Lehrmeister. Die erste romantische Liebe von Titus’ Schwester Fuchsia führt direkt zu ihrem Sturz. Selbst Steerpike, der fast gefühllose Erzschurke, spürt einen Hauch menschlicher Empfindung, als einer seiner Mordanschläge grässlich misslingt. Er hat keine Schuldgefühle, sondern ist entsetzt über seine eigene Fehlbarkeit – etwas, an das er früher nie geglaubt hatte, und dies macht ihn menschlicher (und verletzlicher, wie wir sehen werden).
Nicht jede Komödie führt zur Tragödie oder geht daraus hervor, es sei denn, man betrachtet jedes menschliche Streben als letztlich vergeblich. Doch das ist es, worum es in Gormenghast am Ende geht: das Streben und was daraus entsteht. Denn die zwillingshaften Rollen von Titus und Steerpike machen beide zu Dienern des Lebens, und ihre sehr unterschiedlichen Beweggründe führen jeweils dazu, das Leben Gormenghasts als Wesen – als einen lebendigen Ort, vergleichbar mit einem Bienenstock – fortzusetzen.
Steerpike hat ein Messer, ein scharfes Messer, und kann sehr gut damit umgehen – nicht wenige Romanfiguren fallen seiner tödlichen Klinge zum Opfer – doch seine wichtigste Waffe ist das Feuer. Man kann den Symbolgehalt hiervon kaum übersehen, an einem Ort, der so oft mit einem alten Wald verglichen wird, wo Gewächse einander wild überwuchern, sowohl hinsichtlich der Art wie das ganze Schloss von Kletterpflanzen und Ranken bedeckt ist, als auch der Art wie Räume auf anderen Räumen gebaut wurden, so dass die alten Zimmer außer Gebrauch kommen und schließlich vergessen werden. Sogar die wackeligen Behausungen der Bauern von Gormenghast, der Lehmhüttenbewohner, kleben an den Außenmauern des Schlosses wie Schwämme an einem verrottenden Baumstamm. Was in der Natur außer Feuer (oder einer Flut, und auch davon gibt es eine in dem Buch, sogar eine verdammt große) kann dieses erstickende Wachstum hinwegfegen und neues Wachsen ermöglichen – mit anderen Worten, dem Leben gestatten, sich selbst zu erneuern? Genauso wie der Blitzschlag in der Wildnis den Waldbrand entfachen kann, der es irgendwann ermöglicht, dass neue Samen keimen, scheint Steerpikes Karriere durch mörderische Selbsterhöhung einen Zweck für Gormenghast als Ganzes zu erfüllen, indem sie einige der am tiefsten verwurzelten und sinnlosesten Traditionen und Traditionalisten beseitigt.
Auf dieselbe Weise macht der jugendliche Widerwille gegen diese Rituale, der Titus dazu bringt, immer wieder aus dem Schloss zu fliehen, ihn zu einem weiteren wichtigen Urheber von Veränderungen, unter denen die Rückführung des loyalen Dieners Flay ins Schloss, wo der alte Mann es sich zur Gewohnheit macht, dem verräterischen Steerpike heimlich zu folgen, nicht die unbedeutendste ist. Schließlich wird Titus aus Gormenghast entkommen, und wir können nur spekulieren, was am Ende der fünf Bände, die Peake angeblich geplant hatte, geschehen wäre, wenn er in das Heim seiner Ahnen mit Sporen eines Lebens zurückkehrt, das seinen Bewohnern gänzlich unbekannt ist.
Doch gehen die Freuden Gormenghasts, wie bei den meisten wirklich originellen Werken der Literatur, weit darüber hinaus, die großen Themen der abendländischen Philosophie auf neue und interessante Weise durchzuspielen. Man kann sich kaum eine Geschichte vorstellen, die reicher an lebendigen Details wäre als diese. Zur Feier von Titus’ zehntem Geburtstag wird er (mit verbundenen Augen und auf einem Tragesessel) zu einem Maskenspiel gebracht, welches auf einem seichten See aufgeführt wird. Schauspieler auf Stelzen präsentieren das heilige Drama von dem Wolf mit seinen Giftflaschen, dem Löwen, dem poetischen Pferd und dem goldenen Lamm, und obwohl wir nie mehr darüber hören und erst recht keine Erklärung des Mythos oder seiner Bedeutung in der Folklore Gormenghasts erhalten, spüren wir danach den heftigen Wunsch, mehr zu erfahren.
(Titus erscheint in einer Erzählung Peakes, Boy in Darkness, die wohl einige dieser Themen berührt – zumindest enthält sie eine erstaunlich frostige Figur namens »Das Lamm«. Aber auch wenn die beiden Lämmer nichts miteinander zu tun haben, was zweifelhaft scheint, ist die Geschichte wirklich lesenswert.)
Gormenghast enthält auch wunderbar komische Szenen, unter denen vor allem jene mit den Professoren hervorstechen. Man muss nur ihre Namen lesen, um eine Parade trübsinniger, gescheiterter Persönlichkeiten vor sich zu sehen – Perch-Prisma, Fluke, Shred, Shrivell, Splint, Throd, Spiregrain und Flannelcat, Cutflower (der Dandy), Crust und der griesgrämige Mulefire, ebenso wie ihr fast dahinvegetierender Direktor Deadyawn. Ihnen in ihrem von gelblichem Qualm vernebelten Sanktum beim Fluchen und Quasseln zuzuhören ist wie eine Farce in extremer Zeitlupe zu beobachten – ein Marx-Brother-Film in sich härtendem Bernstein. Und es gibt nur weniges in der gesamten Literatur, das komischer (und bizarrerweise herzzerreißender) ist, als die blühende Liebesaffäre zwischen Deadyawns Nachfolger, dem neuen Schuldirektor Bellgrove, und Irma Prunesquallor, der alten Jungfer – der Super- und Über-Jungfer – und Schwester von Doktor Prunesquallor. Ihre Sehnsucht, sich trotz der Schwäche und Albernheit ihrer eigentlichen Persönlichkeiten einer großen Liebe hinzugeben, ist eine jener Zutaten, die die Geschichte zu etwas Besonderem machen.
Doktor Prunesquallor steht innerhalb der Geschichte der intelligenten Aufmerksamkeit des Lesers am nächsten. In Besitz eines »unbeschädigten Verstandes« (wie die klobige, unergründliche Gräfin, Titus’ Mutter, einmal über ihn bemerkt), ist er gleichzeitig ein Teil Gormenghasts und davon getrennt – er kann Wälder erkennen, wo andere nur Bäume sehen – und sein Treffen mit der Gräfin, bei dem beide ihre Furcht davor, dass im Schloss etwas falsch läuft, eingestehen können, ist einer der wenigen Augenblicke, da Prunesquallor, ein freundlicher, liebenswerter Mann, der mit einer hohen, gellenden Stimme und der fast gleichförmigen Gesellschaft von Narren gestraft ist, sich verstanden fühlt.
Während Titus und Steerpike ihren getrennten, aber verschlungenen Pfaden umeinander und um das Schloss folgen wie Bänder um einen Maibaum, gehören diese verbindenden Momente der anderen Figuren, Momente, in denen sie erkennen, dass die Außenwelt noch launenhafter ist als die Welt in ihren eigenen Köpfen, zu den Aspekten, die Gormenghast weit über die Art von Gruselkomödie hinausheben, mit der einige Leute den Roman verwechseln, und ihn in die Regionen des Erhabenen einziehen lassen. Wenn die Gräfin und Prunesquallor als aktive Intelligenzen zusammenfinden, wenn der knirschende Bellgrove sich auf den Boden kauert, um mit dem siebenundsiebzigsten Grafen Murmeln zu spielen, wenn Fuchsia ihre große Liebe zu ihrem Bruder entdeckt oder wenn Titus Flay trifft und der alte Mann merkt, wie der Zweck seines ganzen Lebens wieder in den Mittelpunkt rückt, hebt sich das Herz des Lesers.
Wenn Titus und Steerpike ihr letztes, schreckliches Duell im tropfnassen Efeu ausfechten, mit dem Steinskelett des halbversunkenen Schlosses im Hintergrund, die mörderischen Fluten zu ihren Füßen, dann halten wir nicht den Atem an, um zu erfahren, was ihnen als Symbolen oder Fußnoten in der abendländischen Literaturgeschichte widerfährt, sondern als Menschen. Wir wollen wissen, was als Nächstes geschieht, weil es eine Geschichte ist – eine großartige Geschichte.
Tad Williams,
Woodside, Kalifornien, August 2007
Eins
I
Titus ist sieben. Sein Gefängnis: Gormenghast. Gesäugt von Schatten; aufgezogen in einem Gewebe von Riten: Echos für seine Ohren –, für seine Augen ein Labyrinth aus Stein, und dennoch lebt in seinem Körper etwas anderes – etwas anderes als dieses schattenreiche Erbe. Denn zunächst einmal ist er ein Kind.
Ein Ritual, bezwingender als alle, die je von Menschen ersonnen wurden, kämpft in tief verwurzelter Dunkelheit. Ein Ritual des Blutes, des pulsierenden Blutes. Dieses lebendige Empfindungsvermögen verdankt er nicht seinen Vorvätern, sondern jenen hilflosen Heerscharen, eine Trillion Mann stark, aus den Kindheitstagen der Welt.
Die Gabe des hitzigen Blutes. Blut, das lacht, wenn die Lehrer »Weine!« murmeln. Blut, das trauert, wenn die ehernen Gesetze »Freu dich!« krächzen. Oh, du kleine Revolution unter großen Schatten!
Titus der Siebenundsiebzigste. Erbe eines zerfallenden Gipfels, eines Meeres aus Nesseln, eines Reiches aus rotem Rost, der knöcheltiefen Fußspuren des Rituals in Stein.
Gormenghast.
Zurückgezogen und zerfallend brütet es in den Umbraschatten: das unsterbliche Mauerwerk, die Türme, die Trakte. Verrottet alles? Nein. Ein Zephir streicht durch eine Allee aus Türmen, ein Vogel zwitschert, eine Flutwelle reißt den Damm eines gestauten Flusses fort. Tief verborgen in einer Steinfaust windet sich eine Puppenhand warm und rebellisch auf der erstarrten Handfläche. Ein Schatten verändert seine Länge. Eine Spinne regt sich …
Und Dunkelheit breitet sich zwischen den Gestalten aus.
II
Wer sind diese Gestalten? Und was hat er über sie und seine Heimstatt erfahren, seit jenem fernen Tag, als er von der Gräfin Groan in einem vogelschwirrenden Zimmer geboren wurde?
Er hat das Alphabet aus Gewölben und Grotten gelernt, die Sprache dämmriger Treppen und mottenflügelbestaubter Dachbalken. Riesige Hallen sind seine dunklen Spielplätze, seine Arenen sind die Steinhöfe, seine Bäume Säulen.
Und er hat gelernt, dass immer Augen um ihn sind. Beobachtende Augen. Füße, die ihm folgen, und Hände, die ihn halten, wenn er zappelt, ihn aufheben, wenn er fällt. Wieder auf den Beinen starrt er freudlos vor sich hin. Hochgewachsene Gestalten verbeugen sich. Einige in Edelsteinen, andere in Lumpen.
Die Gestalten.
Die Lebenden und die Toten. Die Schemen, die Stimmen, die sich in seinen Kopf drängen, denn es gibt Tage, an denen die Lebenden keine Substanz besitzen und die Toten lebendig werden.
Wer sind diese Toten – jene Opfer der Gewalt, die die Stimmung Gormenghasts nicht mehr beeinflussen, außer durch unsterblichen Widerhall? Denn immer noch verlaufen Kräuselwellen in dunklen Ringen, und eine Bewegung läuft wie Gänsehaut über die Wasseroberfläche, wenn auch die ertrunkenen Steine völlig reglos bleiben. Die Gestalten, die für Titus nur Namen sind, wenn auch die eine sein Vater ist und alle zum Zeitpunkt seiner Geburt noch lebten. Wer sind sie? Denn das Kind möchte von ihnen hören.
III
Lassen wir sie für einen raschen, unirdischen Augenblick als Geister auftauchen, einzeln, deutlich unterschieden und vollständig. Sie bewegen sich nun sogar wie vor dem Tode auf eigenem Grund und Boden. Entrollen sich die kalten Schriftrollen der Zeit von selbst, bis die toten Jahre zu reden beginnen, oder erwachen die Erscheinungen im Puls des Jetzt und treten durch die Mauern?
Es gab eine Bibliothek, und sie liegt in Asche. Lassen wir die langen Wände wiederauferstehen. Dicker als die Steinwände noch sind ihre Papierwände; gerüstet mit Bildung, mit Philosophie, mit Dichtkunst, welche zusammengeballt einhertreibt oder tanzt, wenn auch schon Mitternacht herrscht. Geschützt von Leinen und Kalbleder und dem kalten Gewicht von Tinte – dort brütet der Geist von Sepulchrave, dem melancholischen Grafen, dem sechsundsiebzigsten Herrn des Halblichts.
Es ist fünf Jahre früher. Nicht ahnend, dass sich sein Tod durch die Eulen nähert, trauert er in jeder zögernden Geste, jedem feingeschnittenen Zug, als sei sein Körper aus Glas und in seiner Mitte das verwandelte Herz wie eine tropfende Träne.
Jeder Atemzug von ihm wie ein Verebben, das ihn weiter von sich entfremdet; er treibt eher als dass er auf die Insel des Wahnsinns zusteuert – jenseits aller Handelswege, in einem aufgewühlten Meer, und die turmhohen Brecher brennen.
Titus weiß nicht, wie er zu Tode gekommen ist. Denn er hat bislang nicht einmal den großen Mann aus den Wäldern gesehen, geschweige denn gesprochen; Flay, den ehemaligen Diener seines Vaters und einzigen Zeugen von Sepulchraves Tod, als der Graf im Zustand des Wahnsinns in den Pulverturm stieg und sich dem Hunger der Eulen ergab.
Flay, der schweigsame Kadaver, dessen Kniegelenke von jedem spinnengleichen Schritt Kunde geben, er allein unter den herbeizitierten Geistern ist noch am Leben, wenn auch aus dem Schloss verbannt. Aber Flay war so untrennbar ins Gewebe des Schlosslebens verwoben: wenn jemals ein Mensch seine eigene Lücke mit seinem Geist hat füllen müssen, dann er.
Denn die Exkommunikation ist eine bestimmte Art des Sterbens, und es handelt sich nun um einen anderen Menschen, der durch die Wälder zieht, als es der Erste Diener des Grafen vor sieben Jahren war. Also sitzt sein Geist zur gleichen Zeit, wenn er zerlumpt und bärtig in Farnbüschen seine Kaninchenfallen legt, bartlos in den hohen Fluren oder, wie vor langer Zeit, vor der Tür seines Herrn. Wie kann er wissen, dass er über kurzem mit eigener Hand einen Namen auf die Rolle der Gemordeten eintragen wird? Er weiß lediglich, dass sein Leben unmittelbar bedroht ist, dass jeder Nerv in seinem langen, angespannten, eckigen Körper nach einem Ende dieser unerträglichen Rivalität, dieses Hasses und dieser Angst schreit. Und er weiß, dass dies nicht sein kann, es sei denn, er oder eben dieses riesig über ihm schwebende Entsetzen wird zerstört.
Und so geschah es. Der drohende Schrecken, der Küchenmeister von Gormenghast, schwamm wie eine mondüberflutete Seekuh, und ein langes Schwert ragte wie ein Mast aus seiner riesigen Brust, nur eine Stunde vor dem Tod des Grafen hineingestoßen. Und hier erscheint er aufs Neue, in einer Provinz, die er auf sanfte und rücksichtslose Art und Weise zu der seinen gemacht hat. Von all den voluminösen Gestalten sicher die beeindruckendste, da ein Geist nicht über Gewicht oder Substanz verfügt, ist Abiatha Swelter, der wie eine Nacktschnecke auf üblem Fettschleim durch die feuchten Dünste der Großen Küche gleitet. Aus unidentifizierbaren Fressalien und schwimmenden Fleischtöpfen, aus Schüsseln groß wie Badewannen steigt wie eine miasmatische Flut der kaum genießbare Dunst des täglichen Magenfutters. Swelters Geist segelt mit geblähtem und aufgespanntem Leinen durch die heißen Nebel und wird durch die verschleiernden Dämpfe nur mehr verhüllt; er ist zum Geist eines Geistes geworden, nur sein plüschiger Kopf behielt die Festigkeit seiner wahren Natur. Die Arroganz seines fetten Kopfes schwitzt sich in üblen Tropfen heraus.
So bösartig und eitel dieser Geist auch ist, tritt er doch einen Schritt zurück, um dem Phantom Sourdust auf seinem Inspektionsgang Platz zu machen. Er war der Wahrer des Rituals, vielleicht die unentbehrlichste Gestalt von allen, Eckpfeiler und Bewahrer des Gesetzes der Groan. Seine schwachen und schwieligen Hände bearbeiten die Knoten seines verfilzten Bartes. Während er sich vorbeischleppt, fallen die roten Lumpen seines Amtes in schmutzigen Falten um den dürren, alten Körper. Mit seiner Gesundheit steht es am schlechtesten, auch für einen Geist, denn er hustet unaufhörlich auf trockene, furchterregende Weise, wobei die schwarzen und weißen Strähnen seines Bartes hin und her zucken. Theoretisch freut er sich, dass in Titus dem Haus ein Erbe geboren wurde, doch seine Verantwortlichkeiten sind ihm zu schwer geworden, um seinem Herzen eine leichte Regung zu erlauben, wenn man einmal annimmt, dass er ein so triviales Gefühl überhaupt in jenes stotternde Organ hineingelockt haben könnte. Er trottet von einer Zeremonie zur nächsten, wobei sich sein alter Kopf entgegen dem natürlichen Wunsch herabzufallen erhebt; mit so vielen Runzeln und Falten geädert wie ein alter Käse personifiziert er die Altehrwürdigkeit seines Amtes.
Sein wirklicher Körper kam in der gleichen, schicksalbeladenen Bibliothek zu Tode, die nun in Geistergestalt die Erscheinung Sepulchraves beherbergt. Während sich der alte Herr des Rituals durch die fiebrige Luft von Swelters Küche bewegt und sich auflöst, kann er weder voraussehen noch sich daran erinnern (denn wer weiß schon, in welche Richtung sich die Gedanken von Geistern bewegen), dass er, den faltigen Mund voll mit beißendem Rauch, sterben wird oder bereits durch Feuer und Ersticken starb und die hohen Flammen mit rotgoldenen Zungen an seiner runzligen Haut lecken.
Er kann nicht wissen, dass Steerpike ihn verbrannte, dass die Schwestern Seiner Lordschaft, Lady Cora und Lady Clarice, die Lunte anzündeten und von dieser Stunde an sein Oberherr, der sakrosankte Graf, die Straße des Wahnsinns so deutlich vor sich hingestreckt sah.
Und schließlich Keda, Titus’ Amme, die ruhig über einen licht- und perlgrau beschatteten Korridor geht. Dass sie ein Geist ist, scheint nur natürlich, denn selbst als sie noch am Leben war, umgab sie etwas Unberührbares, Fernes, Okkultes. Dass sie durch einen Sprung in einen Zwielichtbrunnen starb, war gnadenlos genug, doch weniger grausam als die letzten Augenblicke des Grafen, des Küchenmeisters und des hinfälligen Ritualienmeisters – und ein rascheres Ende für die gallebitteren Stunden des Lebens als die Verbannung des langen Mannes in den Wald.
Wie in jenen Tagen, ehe sie aus dem Schloss in ihren Tod floh, sorgt sie sich um Titus, als rieten alle Mütter, die jemals gelebt haben, dies ihrem Blut. Dunkel, fast leuchtend wie ein Topas, ist sie immer noch jung; die einzige Entstellung: der allgegenwärtige Fluch der Lehmhüttenbewohner, der frühzeitige Verfall einer ungewöhnlichen Schönheit – ein Zerfall von gnadenloser Geschwindigkeit einer fast unwirklich schönen Jugend. Sie allein von jenen schicksalsgeschlagenen Gestalten entstammt jenem ärmlichen und unerträglichen Reich der Abgeschiedenen, deren triste Behausungen sich wie eine Wucherung aus Schlamm und Napfschnecken über die Außenmauern Gormenghasts legen.
Sonnenstrahlen sengen durch einen Wolkenschwarm, brennen mit ungehinderter Kraft durch hundert Fenster der Südmauer. Ein zu heftiges Licht für Geister, und Keda, Sourdust, Flay, Swelter und Sepulchrave lösen sich in Sonnenflecken auf.
Das waren also in Kürze die Verlorenen Gestalten. Die Ersten, die sterbend das Gesumm des Schlosslebens verließen, noch ehe Titus drei wurde. Die Zukunft hing von ihren Aktivitäten ab. Titus ist ohne sie bedeutungslos, denn in seinen frühen Jahren ernährte er sich von den Schritten, von den Mustern, die Gestalten an die hohe Decke warfen, ihren verschwommenen Umrissen, von langsamen oder raschen Bewegungen, von verschiedenen Gerüchen und Stimmen.
Alles, was sich regt, erzeugt einen Nachhall, und es kann gut sein, dass Titus die Echos, die damals geflüstert wurden, hören wird, wenn er ein erwachsener Mann ist. Denn Titus wurde nicht in eine statische Versammlung von Personen entlassen – kein bloßes Muster, sondern in eine lebende Arabeske, deren Gedanken Handlungen waren oder wie Fledermäuse von einem Dachbalken hingen oder auf blattgleichen Schwingen zwischen den Türen hindurchglitten.
Zwei
Was aber ist mit den Lebenden? Seine Mutter, halbwach und halbbewusst, mit dem Bewusstsein von Wut, der Entrücktheit von Trance. Sie hat ihn in sieben Jahren sieben Mal gesehen. Dann vergaß sie die Hallen, die ihn beherbergten. Aber nun beobachtet sie ihn von versteckten Fenstern aus. Ihre Liebe zu ihm ist so schwer und gestaltlos wie Lehm. Eine Schleppe weißer Katzen zieht sich hinter ihr her. Ein Gimpel nistet in ihrem roten Haar. Sie ist die Gräfin Gertrude von den riesigen Lehmmassen.
Weniger beeindruckend, doch so mürrisch wie die Mutter und ebenso unberechenbar ist Titus’ Schwester. Empfindsam wie der Vater, ohne dessen Intellekt, wirft Fuchsia die schwarze Flagge ihres Haares nach hinten, beißt sich auf die kindische Unterlippe, runzelt die Stirn, lacht, brütet, ist zärtlich, unbändig, misstrauisch und leichtgläubig in einem. Ihr scharlachrotes Gewand setzt graue Gänge in Flammen oder, durch hohe Äste in einem Sonnenstrahl aufflackernd, lässt es die tiefgrünen Schatten noch einen Ton dunkler erscheinen, die Grünheit dunkler, die Dunkelheit grüner.
Wen sonst gibt es noch in der direkten Blutslinie? Nur die geistlosen Tanten, Lady Cora und Lady Clarice, die identischen Zwillinge und Schwestern Sepulchraves. Ihre Gehirne sind so schlaff, dass die Bildung eines Gedankens für sie das Risiko des Schlagflusses birgt. Von so schlaffen Körpern, dass die lila Kleider nicht länger Nerven und Sehnen zu beherbergen, sondern von Bügeln herabzuhängen scheinen.
Und die anderen? Die von geringerer Geburt? In der Reihenfolge der gesellschaftlichen Stellung wahrscheinlich zunächst einmal die Prunesquallors, das heißt, der Doktor und seine engverhüllte und knochige Schwester. Der Doktor mit seinem Hyänenlachen, seinem bizarr-eleganten Körper, seinem Zelluloidgesicht.
Seine Hauptfehler? Seine unerträgliche Stimmlage, sein wahnsinniges Lachen und die affektierten Gesten. Seine Haupttugend? Ein unbeschädigtes Hirn.
Seine Schwester Irma. Eitel wie ein Kind, dünn wie ein Storchenbein und mit ihrer dunklen Brille so blind wie eine Eule bei Tage. Mindestens dreimal wöchentlich verpasst sie den Aufstieg auf die erste Sprosse der gesellschaftlichen Leiter, doch nur, um aufs Neue zu beginnen und die Hüfte schwingen zu lassen. Sie faltet die toten, weißen Hände unter dem Kinn, in der eitlen Hoffnung, die Flachheit ihrer Brust zu verbergen.
Wer noch? Vom gesellschaftlichen Standpunkt aus gesehen niemand. Das heißt, niemand, der in den ersten Jahren von Titus’ Leben eine Rolle spielte, die sich in der Zukunft des Kindes niederschlägt, es sei denn, wir nehmen den Dichter, eine keilgesichtige und unangenehme Gestalt, unter den Hierophanten Gormenghasts wenig bekannt, wenn es auch von ihm heißt, dass er als Einziger die Aufmerksamkeit des Grafen in einer Unterhaltung fesseln konnte. Eine fast vergessene Gestalt in seinem Zimmer über einem Abgrund aus Stein. Niemand liest seine Gedichte, doch sein Status blieb erhalten – ein Gentleman, wie man dem Gerücht zufolge weiß.
Vergessen wir jedoch das blaue Blut, und ein Schwarm von Namen flutet auf uns zu. Der Ausbund von einem Sohn des toten Sourdust mit Namen Barquentine, Meister des Rituals, ist ein verkrüppelter und streitsüchtiger Pedant von siebzig Jahren, der in die Fußstapfen seines Vaters trat (oder besser: in den Fußstapfen, denn dieser Barquentine ist einbeinig und schlägt sich seinen Weg auf einer grimmigen und hallenden Krücke durch die schlecht beleuchteten Gänge).
Flay, der bereits als sein eigener Geist erschien, ist im Gormenwald sehr lebendig. Schweigsam und leichenartig, ist er nicht weniger als Barquentine ein Traditionalist der alten Schule. Aber seine Wutanfälle sind anders als bei Barquentine, wenn das Gesetz untergraben wird; es sind Aufwallungen einer heißen Loyalität, die ihn blind werden lassen, und nicht die gnadenlose und steinharte Intoleranz des Krüppels.
Von Mrs. Slagg an dieser späten Stelle zu sprechen scheint unfair. Dass Titus selbst, der Erbe Gormenghasts, ebenso wie seine Schwester unter ihrer Obhut stehen, reicht sicher aus, um sie an die Spitze eines jeden Registers zu setzen. Aber sie ist so winzig, so verschreckt, so alt, so eigensinnig, dass sie keine Prozession, nicht einmal auf dem Papier, anführen könnte noch dies wollte. Sie schreit immer nur schwächlich: »Oh, mein armes Herz! Wie können sie nur!« und eilt zu Fuchsia, entweder, um dem geistesabwesenden Mädchen einen Klaps zu geben und sich selbst Erleichterung zu verschaffen, oder die runzlige Pflaume von einem Gesichtchen an deren Seite zu vergraben. Wenn sie wieder in ihrem kleinen Zimmer ist, legt sie sich auf das Bett und beißt auf die winzigen Fingerknöchel.
Der junge Steerpike hingegen hat nichts Verschrecktes oder Eigensinniges. Wenn in seiner schmalen Brust jemals so etwas wie ein Gewissen ruhte, hat er es jetzt ausgegraben und fortgeschleudert – so ein unbequemes Ding – so weit fortgeschleudert, dass er es nie wiederfände, sollte er es jemals suchen.
Der Tag von Titus’ Geburt hatte den Beginn seines Aufstiegs über die Dächer von Gormenghast und das Ende seines Dienstes in Swelters Küche gesehen – jener dampfenden Provinz, die sowohl zu unangenehm als auch zu klein war für sein vielseitiges Talent und seinen ausufernden Ehrgeiz.
Mit hohen Schultern, die fast wie eine Fehlbildung wirken, schlank und adrett von Figur und Statur, mit dicht nebeneinanderstehenden Augen von der Farbe getrockneten Blutes, steigt er immer noch nach oben, nun nicht mehr über den Rücken von Gormenghast, sondern die Wendeltreppe um dessen Seele, auf dem Weg zu dem Krähennest seiner unruhigen Phantasie – einem wilden, unverletzlichen Adlerhorst, den er selbst am besten kennt, wo man die Welt unter sich ausgebreitet liegen sehen und seine verklebten Flügel ausgiebig schütteln kann. Rottcodd schläft tief und fest in seiner Hängematte am Ende der Halle der Edlen Schnitzwerke, jenem langen dachbodenartigen Raum, der die hervorragendsten Beispiele der Kunst der Lehmhüttenbewohner beherbergt. Es ist sieben Jahre her, seit er aus dem Dachfenster die Prozession weit unter sich beobachtete, die sich zurück vom Gormensee wand, wo Titus in Besitz seiner Grafschaft gelangte, doch in diesen langen Jahren ist hier nichts geschehen, außer der jährlichen Ankunft neuer Kunstwerke, die man in dem langen Raum zu den anderen bunten Schnitzwerken stellte.
Seine kleine Kanonenkugel von einem Kopf schläft auf seinem Arm, und die Hängematte schaukelt leise zum Summen einer Essigfliege.
Drei
Außerhalb der grob umrissenen Grenzen des Schlosslebens – Grenzen, so unregelmäßig wie die Uferlinie einer windzerzausten Insel – gab es Gestalten, die entweder bereitstanden oder sich allmählich zum zentralen Angelpunkt bewegten. Sie wateten aus den Fluten grenzenloser Negation – den zeitlosen, undurchsichtigen Wassern. Doch wer sind jene, die ihren Fuß auf den kalten Strand setzen? Sicher würden sich einem so bedrohlichen Gebiet zumindest Götter ausliefern, schuppige Könige oder Wesen, deren ausgestreckte Flügel zwei Horizonte überdecken könnten. Oder der gefleckte Satan mit der Messingbraue.
Aber nein. Weder Schuppen noch Flügel.
Es war zu dunkel, um zu erkennen, wo sie wateten, wenn auch ein Schattenfleck, zu groß für eine einzelne Gestalt, das Herannahen jener Gruppe altersgrauer Professoren ankündigte, durch deren Hände sich Titus eine Zeit lang wird winden müssen.
Aber über dem jungen Mann mit den mageren Schultern lag kein Schleier aus Halblicht, als er einen kleinen Raum betrat, eher eine Zelle, die sich von einem Steingang eröffnete, so trocken und grau und rauh wie Elefantenhaut. Als er sich im Türeingang umdrehte, um den Gang entlangzublicken, glänzte kaltes Licht auf der hohen weißen Fläche seiner Stirn.
Sogleich nach dem Eintreten schloss er die Tür hinter sich und ließ den Riegel zuschnappen. Umgeben von den weißen Wänden erschien er, als er durch den Raum ging, sonderbar von der kleinen, ihn umgebenden Welt abgelöst. Er war eher der Schatten eines jungen Mannes, ein Schatten mit hochgezogenen Schultern, der sich durch etwas Weißes bewegte, als ein echter Körper im Raum.
In der Zimmermitte stand ein schlichter Steintisch. Darauf, etwa in der Mitte, befanden sich eine Karaffe Wein mit geschwungenem Hals, ein paar Blatt Papier, eine Feder, Bücher, eine aufgespießte Motte auf einem Korken und ein halber Apfel.
Während er am Tisch vorbeiging, nahm er einen Biss vom Apfel und legte die Frucht zurück, ohne den Schritt zu verzögern, und dann sah es plötzlich für einen neutralen Betrachter so aus, als schrumpften seine Beine zusammen, doch es war der Boden des Zimmers, der sonderbar abfiel, und er befand sich auf dem Weg zu einer Senke im Fußboden, die vor einer vorhangverkleideten Tür endete.
Einen Moment später war er hindurchgeglitten, und die darunterliegende Dunkelheit umhüllte ihn, dämpfte die scharfen Konturen seines knochigen Körpers.
Er hatte einen unbenutzten Kamin auf der untersten Ebene betreten. Es war sehr dunkel, und diese Dunkelheit wurde durch eine Reihe kleiner, glänzender Spiegel nicht gemildert, sondern verstärkt, die wiedergaben, was sich in jenen Zimmern abspielte, die, eines über dem anderen, an jenem hohen, schornsteinförmigen Trichter lagen, der sich von jener Stelle erhob, wo der junge Mann in Dunkelheit stand, bis dorthin, wo sich frische Luft über den wettergegerbten Dächern hinzog, welche, grob und rissig wie altes Brot, unter den stechenden Strahlen des Sonnenunterganges schrecklich erröteten.
Im Verlauf des letzten Jahres war es ihm gelungen, sich den Eintritt in diese Räume und Hallen zu verschaffen, eine über der anderen, welche den Kamin säumten, und er hatte Löcher durch Stein, Holz und Putz gebohrt – keine leichte Arbeit, wenn Knie und Rücken gegen die Wände eines lichtlosen Schachtes gepresst werden –, so dass Licht aus münzgroßen Öffnungen in die Dunkelheit des Trichters drang. Diese Bohroperationen hatten natürlich zu sorgfältig geplanten Zeitpunkten ausgeführt werden müssen, damit sich kein Verdacht regte. Darüber hinaus mussten die Löcher so dicht wie möglich an ausgesuchten Stellen gebohrt werden, um mit dem übereinzustimmen, was der Raum an natürlichen Vorteilen bot.
Er hatte nicht allein die Räume sorgfältig ausgewählt, die seinem Gefühl nach von Zeit zu Zeit der Beobachtung wert waren, entweder aus reinem Vergnügen an der Lauscherei oder um seine eigenen Pläne weiter zu verfolgen.
Seine Methoden, diese Löcher zu verbergen, die man so leicht hätte entdecken können, wären sie schlecht angebracht gewesen, waren unterschiedlich und genial, wie zum Beispiel im Zimmer des uralten Barquentine, dem Meister des Rituals. In diesem Zimmer, so schmutzig wie ein Fuchsbau, hing zur Rechten das blasenwerfende Ölportrait eines Reiters auf einem Schecken, und der junge Mann hatte die paar Löcher nicht nur direkt unterhalb des Rahmens gebohrt, wo der Schatten wie ein Lineal lag, sondern auch die Knöpfe des Reiters ausgeschnitten, seine Pupillen sowie die des Pferdes. Diese runden Öffnungen in unterschiedlichen Höhen und Größen ermöglichten ihm verschiedene Blicke ins Zimmer, je nachdem, wo Barquentine seinen elenden Körper auf der gefürchteten Krücke zu drehen pflegte. Das Pferdeauge, die am häufigsten benutzte Öffnung, bot einen prächtigen Blick auf die Matratze am Boden, auf der Barquentine einen Großteil seiner Freizeit verbrachte, seinen Bart aufdröselte und wieder verknotete oder Staubwolken aufwirbelte, jedes Mal wenn er in Wutanfällen sein einziges Bein, das verkümmerte, hob oder fallen ließ. Im Kamin und direkt hinter den Löchern reflektierte eine komplizierte Serie von Drähten und Spiegeln die Bewohner der entprivatisierten Zimmer und schickte sie den Schacht hinab, Spiegel in Spiegel blickend und das Geheimnis jeder Handlung weitertragend, das in ihren tödlichen Kreis fiel – sie wurden von einem zum anderen weitergegeben, bis am Fuß jener Konstellation aus Glas der junge Mann mit beständiger Information und Unterhaltung versorgt wurde.
In der Dunkelheit pflegte er den Blick zuweilen für einen Sekundenbruchteil von Craggmire abzuwenden, dem Akrobaten, der häufig sein Zimmer auf Händen durchquerte und zuweilen dabei ein kleines Schwein in grünem Nachthemd von einer Sohle auf die andere hob – pflegte den Blick von dieser Ablenkung zum nächsten Spiegel zu richten, welcher vielleicht den Dichter freigab, der mit seinem kleinen Mund einen Laib Brot zerfetzte und den langen Keil von einem Kopf dabei geneigt hielt und unter der Anstrengung errötete, denn er konnte nicht beide Hände dazu benutzen, weil eine mit Schreiben beschäftigt war; derweil seine Augen (dermaßen unzentriert, dass sie nie zusammenzufinden schienen) mehr Geist als Körperliches verrieten.
Aber vom Standpunkt des jungen Mannes aus gab es größere Fische als diese, die – mit Ausnahme Barquentines – nur die Krabben Gormenghasts darstellten, und er wandte sich zu den Spiegeln tödlicher, aufregender: Spiegel, die die Tochter der Groans zeigten; die sonderbare, rabenhaarige Fuchsia und ihre Mutter, die Gräfin, deren Schultern mit Vögeln besetzt waren.
Vier
I
An einem Sommermorgen mit fahler Luft lag das verrottende glockenförmige Herz von Gormenghast im Halbschlaf, und sein gedämpftes Pulsieren schien keinen Widerhall zu finden. In einer Halle mit Gipswänden gähnte die Stille.
Über dem Eingang zu dieser Halle hing an einem Nagel ein Helm, rot von Rost, der in die Stille ein rauhes und flatterndes Geräusch abgab, und einen Moment später schob sich der Schnabel einer Dohle durch einen Augenschlitz und verschwand wieder. Die Gipswände erhoben sich auf allen Seiten in staubige, scheinbar deckenlose Düsternis, beleuchtet nur durch ein einziges hohes Fenster. Das warme Licht, das seinen Weg durch das spinnweberstickte Glas dieses Fensters fand, deutete auf weitere, darüber liegende Gänge, gab jedoch keinen Hinweis, wie jene erreicht werden konnten. Aus diesem hohen Fenster spannten sich ein paar Sonnenstrahlen wie Kupferdrähte steil und diagonal durch die Halle, ein jeder in einem bernsteinfarbenen Teich aus Staub auf den Dielen endend. Eine Spinne senkte sich Faden auf Faden an einem gefährlich langen Strang und verharrte plötzlich auf dem Pfad eines Sonnenstrahls wie gelähmt, wurde für einen Sekundenbruchteil zu einem Ding aus strahlendem Gold.
Man vernahm keinen Laut, und dann – wie abgesprochen, um die Spannung zu brechen – wurde das hohe Fenster aufgestoßen und die Sonnenstrahlen verdeckt, denn eine Hand schob sich hindurch, und eine Glocke ertönte. Fast zugleich hörte man Schritte, und einen Moment später öffneten und schlossen sich ein Dutzend Türen, und die Halle bevölkerte ein Kreuz und Quer verschiedener Gestalten.
Die Glocke verstummte. Die Hand wurde zurückgezogen, und die Gestalten waren verschwunden. Es gab keinen Hinweis darauf, dass zwischen jenen Gipswänden jemals ein lebendiges Wesen sich bewegt oder geatmet oder sich die vielen Türen jemals geöffnet hatten, außer dass im Staub unter dem rostigen Helm eine weiße Blume lag und eine Tür sanft hin- und herschwang.
II
Während sie schwang, erkannte man gebrochen die Perspektive eines gekalkten Ganges, der sich zu einer so weiten, sanften Biegung wand, dass zu jenem Zeitpunkt, als die rechte Wand aus dem Blickfeld verschwand, die Decke des Ganges kaum mehr knöchelhoch vom Boden schien.
Diese lange, schmaler werdende, aschweiße Perspektive, die mit der mühelosen Leichtigkeit einer schwebenden Möwe einen Bogen beschrieb, wurde plötzlich zum Schauplatz einer Bewegung. Denn irgendetwas, das man erst nach einem vollen Drittel der langen Kurve auf die verlassene Halle zu als trabendes Pferd und Reiter erkannte, näherte sich eilig. Das scharfe Klacken der Hufe ertönte ganz plötzlich hinter der schwingenden Tür, die von der Nase eines kleinen grauen Ponys aufgestubst wurde.
Titus saß zu Pferd.
Er trug die groben, lockeren Gewänder, die alle Schlosskinder zu tragen pflegten. In den ersten neun Jahren seines Lebens hieß man den Erben der Grafenwürde sich mit den niederen Schichten mischen und versuchen, sie zu verstehen. An seinem fünfzehnten Geburtstag hatten eventuell entstandene Freundschaften aufzuhören. Seine Haltung würde sich ändern müssen und eine abgehobenere und ausgesuchtere Beziehung zum Personal des Schlosses beginnen. Aber die Tradition besagte, dass das Kind der hohen Familie in seinen frühen Jahren jeden Tag, zumindest zu bestimmten Stunden, leben sollte wie die weniger bevorzugten Kinder, mit ihnen essen, mit ihnen in deren Schlafsälen nächtigen, mit ihnen die Klassen der Professoren besuchen und an den verschiedenen, gerade in Mode gekommenen Spielen und Ritualen teilnehmen wie jeder andere Jüngere. Doch trotz alledem war sich Titus bewusst, ständig beobachtet zu werden; er spürte die Unstimmigkeit in der Haltung der Beamten und zuweilen der Jungen. Er war zu jung, die Implikationen seines Standes zu begreifen, jedoch alt genug, seine Einzigartigkeit zu erahnen.
Einmal in der Woche, vor der morgendlichen Lektion, war ihm gestattet, sein graues Pferd eine Stunde am Fuß der Südmauer zu reiten, wo die frühe Sonne seinen phantastischen Schatten über die hohen Steine an seiner Seite schickte. Und wenn er mit dem Arm winkte, winkte sein Schattenselbst auf dem Schattenpferd mit einem riesigen Schattenarm, während sie gemeinsam weitergaloppierten.
Aber heute hatte er, anstatt zu seiner geliebten Südmauer zu traben, in einem Anfall von Teufelei das Pferd durch einen moosschwarzen Torbogen ins Schloss hinein gelenkt. In der reglosen Stille schlug sein Herz rascher, während er durch Steingänge klapperte, die er nie zuvor erblickt hatte.
Er wusste, es war nicht der Mühe wert, sich vom morgendlichen Unterricht sozusagen auf Französisch zu verabschieden, denn öfter als einmal war er während der langen Sommerabende für solche Akte des Ungehorsams eingeschlossen worden. Aber er schmeckte die scharfen Früchte des schnellen Zügelrisses, der ihn vom Stallburschen befreit hatte. Er war nur wenige Minuten allein, aber als er in der hohen Halle zum Stehen kam, mit dem rostigen Helm über sich und weit über dem Helm die dämmrig-geheimnisvollen Balkone, hatte er sein plötzliches Verlangen nach Rebellion bereits befriedigt.
Wenn er auch klein aussah auf dem Grauen, lag doch etwas Gebieterisches in der selbstbewussten Art, mit der er im Sattel saß – etwas Beeindruckendes in der kindlichen Gestalt, als gebe es eine Art Gewicht, eine Kraft – zusammengesetzt aus Geist und Materie, etwas Festes unterhalb der Launen, Ängste, Tränen und Lachen und der Lebhaftigkeit seiner sieben Jahre.
Er sah zwar nicht wirklich gut aus und verfügte dennoch über die entsprechende Wirkung. Wie seine Mutter umgab ihn eine gewisses Eigenmaß, als stünden seine Höhe und Breite in keinerlei Verhältnis zu der Logik von Meter und Zentimeter.
Der Pferdebursche betrat die Halle, langsam, schlurfend, leise zischend – nach seiner Gewohnheit, ob er nun ein Pferd striegelte oder nicht –, und das graue Pony wurde sogleich in Richtung der Schulräume nach Westen geführt.
Titus betrachtete den Hinterkopf des Stallburschen, als er fortgeführt wurde, sagte aber nichts. Es war, als sei das gerade Geschehene viele Male zuvor geprobt gewesen und bedürfe keines Kommentars. Das Kind kannte diesen Mann und sein Zischen, welches von ihm so untrennbar war wie das Grollen einer stürmischen See, seit wenig mehr als einem Jahr, als man ihm den Grauen in der sogenannten ›Ponygabezeremonie‹ geschenkt hatte, eine Zeremonie, die ohne Ausnahme am dritten Freitag nach dem sechsten Geburtstag von jedem Sohn in direkter Linie stattfand, welcher ebenfalls aufgrund des Todes seines Vaters bereits in der Kindheit die Grafenwürde trug. Doch trotz dieser langen Zeitspanne – und fünfzehn Monate bedeuten viel für ein Kind, das sich nur an vier Jahre einigermaßen deutlich erinnern kann – hatten der Stallbursche und Titus kaum mehr als ein Dutzend Sätze ausgetauscht. Nicht, dass sie einander nicht mochten. Der Stallbursche zog es nur einfach vor, dem Jungen Stücke von gestohlenen Kümmelkuchen zu geben, anstatt sich um eine Unterhaltung zu bemühen, und Titus war damit recht zufrieden, denn der Stallbursche war für ihn lediglich die schlurfende Gestalt, die sich um sein Pony kümmerte, und es reichte, seine Gewohnheiten zu kennen, wie seine Füße schlurften, die weiße Narbe oberhalb des Auges und ihn zischen zu hören.
Innerhalb einer Stunde nahmen die Morgenlektionen ihren Verlauf. Titus saß an einem tintenfleckigen Pult und betrachtete nachdenklich und traumversunken, das Kinn in die Hand gestützt, die Kreidezeichen auf der Tafel. Sie stellten eine einfache Bruchrechnung dar, hätten aber ebenso die hieroglyphische Botschaft eines mondsüchtigen Propheten an seinen verlorenen Stamm vor tausend Jahren bedeuten können. Seine Gedanken und die der kleinen Gefährten im lederwandigen Schulzimmer waren weit fort, in einer anderen Welt, nicht der von Propheten, aber von getauschten Murmeln, Vogeleiern, hölzernen Dolchen, Geheimnissen und Schleudern, mitternächtlichen Festen, Helden, tödlichen Kämpfen und verzweifelten Freundschaften.
Fünf
Fuchsia beugte sich über die Fensterbank und starrte über die rauhen Dächer unter sich. Ihr scharlachrotes Kleid brannte in jenem sonderbaren Rot, welches man öfter auf Gemälden als in der Natur findet. Der Fensterrahmen, der nicht nur sie, sondern auch die undurchdringliche Dämmerung um sie her umschloss, umgab ein Meisterwerk. Ihre Reglosigkeit betonte die halluzinatorische Wirkung, aber selbst wenn sie sich bewegt hätte, dann hätte es eher geschienen, als sei ein Bild zum Leben erwacht, und nicht, als habe sich die Bewegung in der Natur ereignet. Aber das Bild änderte sich nicht. Ihr pechschwarzes Haar fiel reglos herab und verlieh dem porösen Schattenland unter ihr unendliche Feinheit, zeigte es, wie es war, nicht so sehr Dunkelheit an sich, sondern etwas, das nach Sonnenlicht hungert. Ihr Gesicht, Hals und Arme waren warm und gebräunt, schienen jedoch blass im Vergleich zu dem roten Kleid. Sie starrte hinab aus diesem Bild auf die Welt darunter – zu den nördlichen Steinhöfen, auf Barquentine, der seinen bösartigen, elenden Körper an der Krücke weiterschleppte und die ihm folgenden Fliegen verfluchte, während er eine Lücke zwischen zwei Dächern überquerte und aus dem Sichtfeld verschwand.
Dann bewegte sie sich, drehte sich plötzlich auf einen Laut hin um und stand Mrs. Slagg gegenüber, die zu ihr auf blickte. In ihren Händen hielt die Mücke ein Tablett mit einem Krug Milch und Weintrauben.
Sie war gereizt und verärgert, denn die letzte Stunde hatte sie mit der Suche nach Titus verbracht, der ihrer hysterischen Liebe entwachsen war. »Wo ist er? Oh, wo ist er nur?«, hatte sie gejammert, das Gesicht vor Angst zusammengekniffen, und die schwachen Beine, wie Zweiglein, die auf immer von einer Pflicht zur anderen tapsten, schmerzten. »Wo ist dieser Ungezogene, dieser böse kleine Graf? Oh, mein armes, schwaches Herz! Wo kann er nur sein?«
Die gereizte Stimme löste weit über ihr dünne Echos aus, als habe sie in Halle über Halle Nester voller Vogelkinder aus dem Schlaf gerissen.
»Oh, du bist es«, sagte Fuchsia und warf mit einer raschen Handbewegung eine Haarlocke aus dem Gesicht. »Ich wusste nicht, wer es war.«
»Natürlich bin ich es! Wer sonst hätte es sein können, du Dumme!? Wer sonst kommt jemals in dein Zimmer? Das solltest du doch inzwischen wissen, oder? Nicht wahr?«
»Ich hatte dich nicht gesehen«, sagte Fuchsia.
»Aber ich habe dich gesehen – hast dich aus dem Fenster gelehnt wie ein großes schweres Ding – und hast nichts gehört, wenn ich dich auch durch die offene Tür immer wieder gerufen habe. Oh, mein schwaches Herz! Immer das Gleiche – ich rufe, rufe, rufe, und nie bekomme ich eine Antwort. Warum lebe ich überhaupt noch?« Sie spähte zu Fuchsia hoch. »Warum lebe ich noch für dich? Vielleicht werde ich heute Nacht sterben«, fügte sie bösartig hinzu und blinzelte wiederum Fuchsia an. »Warum trinkst du deine Milch nicht?«
»Stell sie auf den Stuhl«, gab Fuchsia zurück. »Ich trinke sie später – auch die Weintrauben. Danke. Wiedersehen.«
Auf Fuchsias befehlsmäßige Verabschiedung hin, die nicht unfreundlich gemeint war, wenn sie auch abrupt geklungen hatte, füllten sich Mrs. Slaggs Augen mit Tränen. Aber uralt, winzig und gekränkt wie sie war, stieg doch die Wut wieder in ihr auf wie ein Miniatursturm, und anstelle ihres vertrauten gereizten Schreis »Oh, mein schwaches Herz, wie kannst du nur!«, schnappte sie nach Fuchsias Hand und versuchte, die Finger zurückzubiegen, und als ihr dies nicht gelang, wollte sie gerade Ihre Ladyschaft in den Arm beißen, als sie hochgehoben und zum Bett getragen wurde. Da man sie ihrer kleinen Rache beraubt hatte, schloss sie für wenige Momente die Augen, wobei sich die Hühnerbrust mit unglaublicher Schnelligkeit hob und senkte. Als sie die Augen wieder öffnete, sah sie als erstes Fuchsias Hand gespreizt vor sich, und sie stützte sich auf einen Ellenbogen und schlug sie wieder und wieder, bis sie erschöpft war und das runzlige Gesicht an Fuchsias Seite vergrub.
»Tut mir leid«, sagte das Mädchen. »Ich habe das mit dem Wiedersehen nicht so gemeint. Ich meinte ja nur, dass ich gern allein sein wollte.«
»Warum?« (Mrs. Slaggs Stimme war kaum vernehmbar, so dicht presste sie das Gesicht in Fuchsias Kleider.) »Warum? Warum? Warum? Jeder würde denken, ich sei dir im Weg. Jeder würde denken, ich kenne dich nicht in- und auswendig. Habe ich dir nicht alles beigebracht, seit du ein Baby warst? Habe ich dich nicht in den Schlaf gewiegt, du biestiges Ding? Stimmt das etwa nicht?« Sie erhob das alte, tränenüberströmte Gesicht zu Fuchsia. »Stimmt das etwa nicht?«
»Doch«, sagte Fuchsia.
»Also dann!«, sagte Nannie Slagg, »also dann …« Und sie krabbelte vom Bett und begann den Abstieg zum Boden.
»Geh sofort von der Bettdecke und starr mich nicht so an, du Ding! Vielleicht komme ich dich heute Nacht besuchen. Vielleicht. Ich weiß nicht. Ich will vielleicht nicht.« Sie ging auf die Tür zu, griff nach der Klinke und war in wenigen Augenblicken allein in ihrem kleinen Zimmer, wo sie mit rotgeränderten Augen auf dem Bett lag wie eine zerrupfte Puppe.
Fuchsia, wieder allein in ihrem Zimmer, setzte sich vor einen Spiegel, der in der Mitte so von Pocken heimgesucht wurde, dass sie, um sich ordentlich sehen zu können, gezwungen war, in eine verhältnismäßig unbefleckte Ecke zu spähen. Ihr Kamm, dem eine Reihe von Zinken fehlte, fand sich schließlich in einer Schublade unter dem Spiegel, als sich, gerade als sie begann, sich zu kämmen – eine Prozedur, die sie erst kürzlich für sich entdeckt hatte –, der Raum verdunkelte, denn das Halblicht vom Fenster wurde durch das wunderbare Auftauchen des jungen Mannes mit den knochigen Schultern ausgelöscht.
Ehe Fuchsia nur einen Moment darüber nachdenken konnte, wie ein menschliches Wesen auf ihrer Fensterbank hundert Fuß über dem Boden erscheinen konnte – noch ehe sie auch nur die Silhouette erkennen konnte –, schnappte sie die Haarbürste vom Tisch und schwang sie über den Kopf, bereit – zu was sie bereit war, wusste sie nicht. In einem Moment, in dem andere geschrien hätten oder zusammengezuckt wären, hatte sie Kampflust gezeigt – gegenüber dem, was sie in diesem erstaunlichen Augenblick als Fledermausmonster hätte erkennen können. Aber im Sekundenbruchteil, ehe sie die Bürste fortschleuderte, erkannte sie Steerpike.
Er pochte mit dem Knöchel an den Fensterbalken.
»Guten Nachmittag, Madame«, sagte er. »Darf ich Ihnen meine Visitenkarte überreichen?« Und er reichte Fuchsia einen Papierstreifen mit den Worten:
»Seine Infernalische Schlauheit, der Erzschurke Steerpike.«
Doch ehe Fuchsia sie lesen konnte, hatte sie auf ihre kurze, atemlose Art zu lachen begonnen über den spöttisch-ernsthaften Ton seines »Guten Nachmittag, Madame«. Es hatte so vollkommen vornehm geklungen.
Aber ehe sie ihm bedeutete, auf den Boden des Zimmers zu steigen – und sie hatte keine andere Wahl –, hatte er sich nicht einen Millimeter geregt, sondern war mit gefalteten Händen und geneigtem Kopf stehengeblieben. Auf ihre Geste hin erwachte er plötzlich wieder zum Leben, als habe man einen Abzugshebel gelöst, und innerhalb eines Augenblicks hatte er ein Seil von seinem Gürtel geknotet und das lose Ende aus dem Fenster geworfen, wo es baumelte. Fuchsia lehnte sich aus dem Fenster, starrte nach oben und sah, wie der Rest des Seils über sieben weitere Stockwerke zu einem zernagten Dach führte, wo es vermutlich an einem Türmchen oder Schornstein angebunden war.
»Alles bereit für meine Rückkehr«, sagte Steerpike. »Nur ein Seil, Madame. Ist besser als ein Pferd. Steigt Wände hinab, wenn man es bittet, und braucht kein Futter.«
»Sie können mit der Madame aufhören«, sagte Fuchsia, etwas zu laut und für Steerpike überraschend. »Sie kennen doch meinen Namen.«
Steerpike schluckte, verdaute und entledigte sich rasch seiner Irritation, denn er vergeudete niemals Zeit damit, seine Überraschungen in Worte zu fassen, setzte sich rittlings auf einen Stuhl und legte das Kinn auf die Lehne.
»Ich werde niemals vergessen«, sagte er, »Sie immer mit Ihrem richtigen Namen und in angemessenem Ton anzureden, Lady Fuchsia.«
Fuchsia lächelte vage, dachte aber an etwas anderes.
»Sie sind sicher ein guter Bergsteiger«, sagte sie schließlich. »Sie sind doch auf meinen Dachboden gestiegen. Erinnern Sie sich?«
Steerpike nickte.
»Und über die Mauer in die Bibliothek, als sie brannte. Das scheint sehr lange her.«
»Und dann noch, wenn ich dies erwähnen darf, Lady Fuchsia, als ich in dem Gewitter mit Ihnen in den Armen über die Felsen kletterte.«
Es war, als sei plötzlich alle Luft aus dem Raum gesaugt worden, so tödlich dünn und still war die Atmosphäre geworden. Steerpike vermeinte einen schwachen Hauch von Farbe auf Fuchsias Wangenknochen zu entdecken.
Schließlich sagte er: »Würden Sie, Lady Fuchsia, eines Tages mit mir zusammen die Dächer dieses großen Hauses erforschen? Ich möchte Ihnen gern zeigen, was ich gefunden habe, dort im Süden, Euer Ladyschaft, wo die Granitkuppeln ellenbogentief in Moos stehen.«
»Ja«, erwiderte sie, »ja …« Sein scharfgeschnittenes, bleiches Gesicht ekelte sie an, aber seine Vitalität und seine geheimnisvolle Art zogen sie an.
Sie wollte ihn gerade bitten zu gehen, aber er war schon auf den Beinen, ehe sie sprechen konnte, war ohne den Rahmen zu berühren durch das Fenster gesprungen und schwang an dem tanzenden Seil hin und her, ehe er sich daran hochhangelte, Hand über Hand, bei dem langen Aufstieg zu dem gezackten Dach über ihnen.
Als Fuchsia sich vom Fenster abwandte, fand sie auf ihrem schlichten Frisiertisch eine einzelne Rosenknospe.
Während Steerpike hinauf kletterte, erinnerte er sich, wie der Tag von Titus’ Geburt vor sieben Jahren seinen Aufstieg über die Dächer von Gormenghast und das Ende seines Dienstes in Swelters Küche gesehen hatte. Die notwendige Muskelbelastung betonte das Hervorstehen seiner knochigen Schultern. Aber er war übernatürlich geschickt und ergötzte sich nicht weniger in körperlicher als geistiger Hartnäckigkeit und Kühnheit. Seine durchdringenden, eng beieinanderstehenden Augen starrten auf jenen Punkt, an dem das Seil befestigt war, als handele es sich um den Zenit seiner Phantasie.
Der Himmel hatte sich verdunkelt, und mit einem starken Wind folgte gepeitschter Regen. Er zischte und sprudelte im Mauerwerk. Er fand hundert natürliche Rinnen, durch die er glitt. Luftschächte, Leitungen und Löcher husteten von Echos, und riesige Klammen murmelten. Auf den Dächern bildeten sich Seen, die den Himmel reflektierten, als seien sie seit jeher Bergseen gewesen.
Steerpike hatte das Seil sorgfältig um die Taille gebunden und glitt wie ein Schatten über einen Morgen aus schrägen Schieferplatten. Den Kragen hatte er hochgeschlagen. Das weiße Gesicht regenbärtig.
Hohe, düstere Mauern, wie Kaimauern oder die Kerkermauern der Verdammten, erhoben sich in die wassergetränkte Luft oder schwangen in erstaunlichen Bögen rücksichtslosen Steins. Verloren in jagenden Wolken verwilderten die schroffen Gipfel Gormenghasts mit strähnigem Haar – wie Stränge durchweichten Tangs. Zinnen und Vorsprünge unerkennbaren Mauerwerks drohten über Steerpikes Kopf wie die Rümpfe verrottender Schiffe oder gestrandeter Monster, deren triefende Mäuler und Brauen die sardonische Arbeit Tausender von Stürmen waren. Dach auf Dach jeglicher Schräge erhob sich oder glitt vor seinen Augen vorbei: Terrasse auf Terrasse glänzte schwach unter ihm durch den Regen, und die lange vergessenen Steinplatten tanzten und zischten unter dem Guss.
Eine Welt von Schemen flog an ihm vorbei, denn er war flink wie eine Katze und rannte ohne Unterlass, wandte sich nun in diese, mal in jene Richtung und verlangsamte seine Schritte nur dann, wenn ein schmaler, noch gefährlicherer Pfad ihn dazu zwang. Von Zeit zu Zeit sprang er in die Luft wie aus einem Überschuss an Lebenskraft. Plötzlich, als er einen Schornstein umrundete, der schwarz war von tropfnassem Efeu, ging er nur noch, duckte den Kopf unter einem Bogen, fiel auf die Knie und schwang ein lange vergessenes Dachfenster in knirschenden Angeln auf. In einer Sekunde war er hindurch und in einen kleinen, leeren Raum zwölf Fuß tiefer gefallen. Es war sehr dunkel. Steerpike löste sich von dem Seil und hängte es über einen kurzen Nagel an der Wand. Dann blickte er sich in dem dunklen Zimmer um. Die Wände waren bedeckt mit gläsernen Vitrinen, in denen alle Arten von Motten ausgestellt lagen. Lange dünne Nadeln spießten die Insekten auf die Korkeinsätze jedes Kastens, doch so sorgfältig, wie der ursprüngliche Sammler wohl gewesen war, als er die zarten Wesen befestigte, war doch die Zeit nicht spurlos an ihnen vorübergegangen, und es gab keinen Kasten ohne eine beschädigte Motte, und die Böden der meisten der kleinen Schachteln schwelten von herabgefallenen Flügeln.
Steerpike wandte sich zur Tür, lauschte einen Moment und öffnete sie kurz darauf. Vor ihm lag ein staubiger Treppenabsatz und direkt links von ihm führte eine Leiter hinab in einen weiteren leeren Raum, so verloren wie der, den er gerade verlassen hatte. Hier lag nichts weiter als ein großer, pyramidenförmiger Stapel angefressener Bücher, deren dunkle Rücken vor Mäusenestern wimmelten. Dieser Raum hatte keine Tür; statt dessen hing ein Streifen Sackleinen schlaff über einem Spalt in der Mauer, breit genug, um Steerpike seitlich durchzulassen. Wieder folgten Treppen und wieder ein Raum, diesmal länger, eine Art Gang. An dessen Ende stand ein ausgestopfter Hirsch, die Schultern weiß vor Staub.
Als er den Raum durchquerte, sah er aus den Augenwinkeln, gerahmt durch ein glasloses Fenster, den Umriss des Gormenbergs, dessen hohe Zinnen vor einem stürmischen Himmel leuchteten. Regen strömte durch das Fenster und spritzte auf die Dielen, so dass kleine Staubkügelchen wie Quecksilberteilchen hin- und herrollten.
Er erreichte die Doppeltür, ließ die Finger durch das tropfnasse Haar gleiten und legte den Kragen um. Dann schritt er hindurch, spähte nach links und folgte einige Zeit lang einem Gang, ehe er am Kopf einer Treppe anlangte.
Er spähte über das Geländer und zuckte im selben Augenblick zurück, denn Gräfin Groan schritt durch den lampenerhellten Raum unter ihm. Sie watete augenscheinlich in weißem Schaum, und die hohlen Zimmer hinter Steerpike schienen unter einem dumpfen Pochen zu dröhnen, einem vielfachen Laut, dem Echo des ursprünglichen Klagens, das er nicht hören konnte, dem Schnurren der Katzen. Sie zogen aus der Halle unten wie die Nachwellen einer weißen Flut durch einen Höhleneingang, in ihrer Mitte ein mit ihnen schreitender Felsen, gekrönt von rotem Seetang.
Die Echos erstarben. Stille dehnte sich aus wie ein Laken. Steerpike stieg rasch in das Zimmer hinab und wandte sich nach Osten.
Die Gräfin ging mit gesenktem Kopf und in die Seiten gestemmten Armen. Die Stirn war gerunzelt. Sie war nicht zufrieden damit, dass das unsterbliche Gefühl von Pflicht und Ritualerfüllung überall im weiten Netzwerk des Schlosses heilig gehalten wurde. So schwerfällig und geistesabwesend sie auch wirkte, war sie doch schnell wie eine Schlange, wenn es darum ging, Gefahr aufzuspüren, und wenn sie auch nicht den Finger auf die exakte Stelle ihres Zweifels legen konnte, war sie doch misstrauisch, vorsichtig und rachsüchtig, wenn sie auch nicht genau wusste, weshalb.
Sie bedachte bei sich alle Bruchstücke von Erkenntnis, die mit dem geheimnisvollen Brand der Bibliothek ihres seligen Mannes zusammenhingen, seinem Verschwinden und dem Verschwinden seines Küchenmeisters. Sie benutzte, fast zum ersten Mal, ihr auf natürliche Weise kraftvolles Gehirn, ein Gehirn, das so lange schon durch die weißen Katzen eingelullt worden war, dass es zunächst schwierig war, es zu wecken.
Sie befand sich auf dem Weg zum Haus des Doktors. Sie hatte die beiden seit mehreren Jahren nicht mehr besucht, und beim letzten Mal auch nur, damit er sich um den gebrochenen Flügel eines wilden Schwans kümmerte. Er hatte sie immer irritiert, doch gegen ihren Willen hatte sie ihm gegenüber auch immer ein bestimmtes merkwürdiges Vertrauen gehegt.
Als sie die langen Steintreppen hinabstieg, war die wogende Masse zu ihren Füßen zu einer langsamen Kaskade geworden. Am Fuß der Treppe blieb sie stehen.
»Bleibt … dicht … dicht … zusammen …«, sagte sie laut, setzte die Worte wie Trittsteine ein – eine hörbare Pause zwischen einem jeden, was trotz der Tiefe und Rauheit ihrer Stimme fast ein wenig kindlich wirkte.
Die Katzen waren verschwunden. Sie stand wieder auf festem Boden. Regen trommelte gegen ein Bleiglasfenster. Langsam schritt sie zu einer Tür, die zu einer Reihe von Innenhöfen führte. Durch die Arkaden hindurch sah sie das Haus des Doktors auf der anderen Seite des Steinhofes. Sie ging hinaus in den Regen, als existiere dieser nicht, bewegte sich durch den Sturm mit einer monumentalen und gemächlichen Gemessenheit, den großen Kopf emporgehoben.
Sechs
I
Prunesquallor befand sich in seinem Arbeitszimmer. Er nannte es sein ›Arbeitszimmer‹. Für seine Schwester Irma war es hingegen ein Zimmer, in dem sich ihr Bruder verbarrikadierte, wann immer sie etwas Wichtiges mit ihm bereden wollte. Wenn er einmal drinnen war, die Tür verschlossen und die Kette vorgelegt, die Fenster verriegelt, konnte sie kaum noch etwas unternehmen außer an die Tür hämmern.
An diesem Abend war Irma noch lästiger gewesen als gewöhnlich. Was, hatte sie immer wieder gefragt, hielt sie davon ab, jemanden kennenzulernen, der sie schätzen und bewundern würde? Sie wollte nicht, dass dieser hypothetische Bewunderer ihr notwendigerweise sein ganzes Leben widmete, denn ein Mann brauchte ja seine Arbeit (solange diese nicht zu viel Zeit in Anspruch nahm) – nicht wahr? Aber wenn er wohlhabend wäre und sich wünschte, ihr sein Leben zu widmen – nun sie würde nichts versprechen, aber den Antrag gern überdenken. Sie hatte schließlich einen langen makellosen Hals. Gewiss, ihr Busen war flach, ebenso ihre Füße, aber eine Frau kann eben nicht alles haben. »Ich bewege mich doch anmutig, nicht wahr, Alfred?«, hatte sie in plötzlicher Leidenschaft aufgeschrien. »Ich bewege mich doch anmutig?«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!