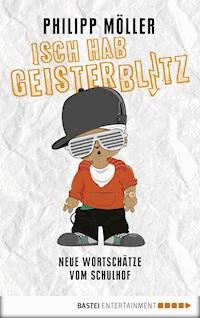12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
»Bei Phillip Möller wäre selbst Jesus zum Atheisten geworden.« Vince Ebert, Physiker und Kabarettist Das neue Buch von Philipp Möller, Autor des SPIEGEL-Bestsellers ›Isch geh Schulhof‹ – ein Plädoyer für ein erfülltes ohne Gott Bestsellerautor Philipp Möller glaubt nicht an Gott – und ist damit nicht allein. Knapp 40 Prozent aller Deutschen fühlen sich keiner Religion zugehörig. Umso erstaunlicher findet es Möller, wie sehr die Religionen dennoch unsere Gesellschaft beeinflussen. Vom Kirchengeläut bis zum Kopftuch der Kindergärtnerin, das Religiöse behelligt auch die, die nicht an Gott glauben. Dabei sind sich heute die meisten Deutschen einig: Religion ist vor allem Privatsache. Zudem: Alle kostspieligen Großbaustellen der Religionen müssen auch von den Atheisten mitbezahlt werden – oder wussten Sie zum Beispiel, dass Bischöfe ihr Gehalt aus allgemeinen Steuern erhalten? Fünf Millionen Menschen haben Möllers religionskritischen Debattenclip im Netz mittlerweile aufgerufen. In ›Gottlos glücklich‹ führt Möller aus, warum Religion und Glauben Privatsache sein sollten. »Ich möchte zeigen, dass ein Leben ohne Gott für extrem viele Menschen absolut selbstverständlich und wunderschön ist, und ein Gegengewicht bieten zu religiöser Werbung, so wie sie heute – im Verborgenen wie im Öffentlichen – absolut wieder üblich ist.« Provokant, unterhaltsam und unkonventionell trifft Philipp Möller mit seinen Fragen und Thesen einen Nerv. In ›Gottlos glücklich‹ nimmt er uns mit auf eine unglaubliche Reise hinter die Kulissen der »Kirchenrepublik« Deutschland.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Philipp Möller
Gottlos glücklich
Warum wir ohne Religion besser dran wären
Über dieses Buch
»Bei Philipp Möller wäre selbst Jesus zum Atheisten geworden.« Vince Ebert, Physiker und Kabarettist
Ein Plädoyer für ein erfülltes Leben ohne Gott.
Auch wenn es uns nicht immer gleich auffällt, unser Alltag ist durchdrungen von Religion. Vom Kirchengeläut bis zum Kopftuch der Kindergärtnerin, das Religiöse behelligt auch die, die nicht an Gott glauben. Dabei sind sich heute die meisten Deutschen einig: Religion ist vor allem Privatsache. Zudem: Alle kostspieligen Großbaustellen der Religionen müssen auch von den Atheisten mitbezahlt werden - oder wussten Sie zum Beispiel, dass Bischöfe ihr Gehalt aus allgemeinen Steuern erhalten? Wie schafft man es als weltlicher Mensch, sich mit Religion höchst kritisch auseinanderzusetzen, aber auf eine Art und Weise, die zum Beispiel mit der Islamophobie oder dem Antisemitismus rein gar nichts zu tun hat? Philipp Möller, überzeugter Atheist, steht als Berliner Familienvater mitten im Leben. Er zeigt uns streitlustig, unverkrampft und anhand vieler Fakten, wie es geht: Sich von den Zumutungen des Religiösen nicht einschüchtern zu lassen - und gleichzeitig die Menschen gelten zu lassen, ob sie nun an einen Gott glauben oder nicht.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Vorab
Jesus, die Bibel und ein Edelpuff
»Die BVG glaubt noch an Gott«
Heidenspaß statt Höllenqual
Christenverfolgung 2.0
Die geistliche Aspirin
Gottes Comeback
Mein erstes Mal
Danke für die Kirchensteuer, Adolf
Anna glaubt sehr gut an den lieben Gott – Einsplus
Aloffi
O du fröhliche
Mein Körper gehört mir!
Außen Kopftuch, innen Allah?
Nach dem Leben ist vor dem Leben
Mein Ende gehört mir!
Danke
Vorab
Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,
Vielen Dank, dass Sie sich für den Erwerb meines Buches entschieden haben. Um ein größtmögliches Lesevergnügen zu erzielen, empfehle ich Ihnen freundlichst die Beachtung der folgenden Punkte des gottlosen Glücks:
GG#1: Dieses Buch ist thematisch aufgebaut und nur innerhalb der Kapitel chronologisch.
GG#2: Vorsicht, einige der hier abgedruckten Texte könnten religiöse Gefühle verletzen. Sorry.
GG#3: Postfaktische Argumente gehören nicht zu meinem Repertoire, daher untermauere ich meine ganz persönlichen Erfahrungen und Haltungen mit Quellen im Anhang. Zum Beispiel so: In einer repräsentativen Umfrage geben 79 Prozent der rund 180000 Befragten Deutschen im Alter zwischen 18 und 34 Jahren an, gottlos glücklich zu sein.[1]
GG#4: Religion ist ein verflucht komplexes Thema. Wenn Sie auf den folgenden Seiten Aspekte vermissen, dann geht es Ihnen wie mir.
GG#5: Es ist einfacher, die Menschen zu täuschen, als sie davon zu überzeugen, dass sie getäuscht worden sind, hat Mark Twain gesagt – genau deshalb habe ich es erst gar nicht versucht.
Und nun wünsche ich Ihnen ein ungetrübtes Lesevergnügen und freue mich auf Ihre Rückmeldung und auf sachliche Kritik unter facebook.com/moellerberlin.
Herzlichst, Ihr Philipp Möller (im Spätsommer 2017)
Jesus, die Bibel und ein Edelpuff
Es könnte glatt ein Bild für die Götter sein: In einem Kreuzberger Hinterhof sitzen sieben Leute im Konferenzraum einer Werbeagentur und starren gebannt auf einen Laptop. Es ist spät, die restlichen Mitarbeiter der Agentur sind längst im Feierabend, das Büroloft ist dunkel. Einzig die sieben Gesichter werden vom fahlen Schein des Displays beleuchtet. Ihre Münder stehen offen, ihre Augen blinzeln so selten wie möglich.
»Zwanzigtausend Euro brauchen wir«, sagt der Älteste von ihnen leise, ohne den Blick vom Monitor zu wenden, »dann können wir die ersten Busse losschicken!«
Er schluckt, dann herrscht wieder Stille. Ein leises und freundliches »Bing« ertönt aus dem Laptop, die sieben reißen ihre Augen auf, lächeln, ballen ihre Fäuste – und starren dann wieder auf ihre Homepage.
Auf ihr befindet sich ein Spendenbalken, dessen Anzeige jeweils mit einem freundlichen Ton darüber informiert, dass Geld eingetrudelt ist. Er ist fast komplett grün.
Und wieder: Bing, der Balken steht bei 19815 Euro.
Ich beiße auf meinen linken Daumen, beobachte gebannt den Fortschritt und halte in der rechten Hand mein Pressehandy. Mein ältester Mitstreiter sitzt neben mir und heißt Carsten Frerk. Mit 65 Jahren, einem Doktortitel, mehreren Buchveröffentlichungen zur finanziellen Verflechtung von Staat und Kirche sowie Talkshowauftritten und Verbindungen zu sämtlichen potentiellen Partnerverbänden ist der Politologe der mit Abstand erfahrenste Aktivist in unseren Reihen. Er hat unsere Pressemeldung schon fertig und den Mauszeiger auf »veröffentlichen«. Peder Iblher ist Inhaber und Geschäftsführer der Werbeagentur, Graphiker und derjenige, der die Kampagne nach Deutschland holen will – unser Initiator. Nervös dreht er sein Telefon in der Hand, die Nummer der Berliner Verkehrsbetriebe ist bereits eingetippt. Unsere Fotografin Evelin Frerk hat die Fotos unserer Truppe, den »Gottlosen Sieben« am Start, mit denen wir in wenigen Momenten live gehen werden. Melanie dreht am Draht der Sektflasche. Ralf bringt sieben Gläser herein. Und Robert bloggt, facebookt und twittert simultan alles, was wir hier tun.
Wenn die 20000 Euro erreicht sind, haben wir den ersten, riesigen Schritt geschafft – die vielen Wochen Arbeit könnten sich dann gelohnt haben. Und während sich der Spendenbalken langsam aber sicher füllt, führe ich mir noch einmal vor Augen, dass all das nicht hier begann, sondern in London.
Dort steht einige Monate vorher eine Frau namens Ariane Sherine an der Bushaltestelle und ist guter Dinge, bis zwei Londoner Busse vor ihr stehen, auf denen das Lukasevangelium eine heikle Frage stellt:
When the son of man comes, will he find faith on the earth?
Und die Antwort auf die nicht ganz neutrale Frage, ob Jesus bei seiner Landung auf der Erde auch Glauben vorfinden werde, geben die Jesus-Fans, die die Werbung geschaltet haben, schließlich auf ihrer Homepage, die ebenfalls groß auf dem Bus steht – und zwar in Form des Matthäusevangeliums: You will be condemned to everlasting separation from God and then you spend all eternity in torment in hell. Jesus spoke about this as a lake of fire which was prepared for the devil and all his angels and demonic spirits.[1]
Für alle Ewigkeit beim Teufel im Feuersee gequält werden, weil sie nicht religiös ist – wtf?! Diese so grausame wie leere Drohung will die junge Journalistin nicht hinnehmen und ruft die weltweit erste atheistische Buskampagne ins Leben: Sie will Werbung für ein religionsfreies Leben auf die berühmten roten Londoner Busse drucken lassen. Die erste Hälfte des nötigen Geldes kommt durch einen Spendenaufruf im Internet zusammen, die zweite übernimmt Richard Dawkins, Professor für Biologie und prominenter Autor und Aktivist für Aufklärung. Und weil die Begeisterung der Briten für diese Kampagne statt der geplanten 15000 Pfund das Zehnfache in die Kassen der britischen Atheisten spült, ist ihre Message wenig später auf zahlreichen Londoner Bussen zu lesen:
There’s probably no god, now stop worrying and enjoy your life!
Bing: 19835 Euro.
Internationale Nachahmer der Kampagne finden sich schnell, und so tuckern schon bald italienische, spanische, kroatische, aber auch kanadische, australische und US-amerikanische Linienbusse mit der Nachricht durch die Gegend, dass es wahrscheinlich keinen Gott gibt und die Menschen sich daher entspannen und ihr Leben genießen können. Aber auch andere Slogans sind unterwegs und machen deutlich, dass konfessionsfreie Menschen den weltumspannenden religiösen Hochmut nicht länger kommentarlos hinnehmen.
Ariane Sherines Geschichte findet ihren Weg auch in meine Facebook-Timeline – und gefällt mir. Ich persönlich bin trotz Religionsunterricht und Kommunion nie religiös geworden, aber genau deshalb war mir Religion auch immer schnurzpiepegal … Was geht es mich schließlich an, was andere glauben?! Und mal abgesehen davon, dass in meinem gesamten Umfeld ohnehin kaum jemand religiös ist, konnte der Glaube eines Menschen noch so sonderbar sein – mich amüsierte er eher, scherte mich aber nicht weiter, zumal Religion in Deutschland schließlich reine Privatsache und strengstens vom Staat getrennt ist:
Kirchliche Angelegenheiten werden von der Kirchensteuer bezahlt, in der Politik unseres demokratischen Rechtsstaates spielen religiöse Überzeugungen auch keine Rolle, und immerhin sind aus dem Christentum ja auch die zentralen Werte unserer Gesellschaft hervorgegangen. Und wo wären wir heute ohne die sozialen Dienste, die die Kirche ermöglicht – nicht wahr?
Bing: 19850 Euro.
Doch die internationalen Atheistenbusse, die damals durch meine sozialen Netzwerke fuhren, hatten nicht nur coole Sprüche an Bord, sondern auch knallharte Fakten. Innerhalb weniger Tage brach eine wahre Sturzflut an Informationen über mich herein und riss alles mit sich, was ich bis dato noch über Religion und den Glauben geglaubt hatte.
Meine Diplomarbeit war gerade eingereicht, und ich bewarb mich um Jobs, während ich auf das Gutachten zu meiner Arbeit und auf die Note wartete. Und so saß ich nun fast permanent vorm Rechner, las religionskritische Zeitungsartikel und Forenbeiträge, schaute Videos und verschlang Bücher und Zeitschriften – stets kopfschüttelnd und mit offenem Mund. Am besten erinnere ich mich an die Aussagen eines mir bis dahin unbekannten Politologen, der mit wenigen Sätzen endgültig dafür sorgte, dass ich vom Glauben abfiel:
»Zusammengerechnet ziehen die evangelische und katholische Kirche jährlich etwa zehn Milliarden Euro Kirchensteuern ein, erhalten darüber hinaus aber noch einmal über 19 Milliarden Euro direkte und indirekte Subventionen – aus allgemeinen Steuergeldern.«[2]
Wie bitte?!, dachte ich damals, aber die fließen doch sicherlich in die soziale Arbeit der Kirchen, oder?!
»Und die fließen nicht in die sozialen Dienste«, fuhr der freundliche Mann mit dem silbernen Haar und dem Tweetjackett fort, »sondern einzig in kircheninterne Aufgaben, zum Beispiel in die Gehälter der Pfarrer und Priester und deren Ausbildung.«
Aber wie finanzieren die Kirchen dann ihre Krankenhäuser und Pflegeheime, fragte ich mich, doch auf darauf hatte der Mann eine Antwort:
»Diese sozialen Einrichtungen kosten etwa 42 Milliarden Euro im Jahr und werden zu 98,2 Prozent aus öffentlichen Geldern finanziert, die restlichen 1,8 Prozent tragen die Kirchen.«[3]
Wie eine Salzsäule saß ich damals vor meinen Computer, schaute mir seine verschiedenen Auftritte auf YouTube an und hoffte, dieser Dr. Carsten Frerk mochte falsch recherchiert haben.
In einem der Beiträge war jedoch Peter Beer, Generalvikar des Bistums Freising zu sehen, der mit weißem Band im Kragen in einem holzvertäfelten Büro saß und diese Zusammenhänge keineswegs abstritt, sondern eine spannende Rechtfertigung für die staatlichen Subventionen der Kirchen hatte:
»Sie zahlen ja auch für einen Abgeordneten, den sie nicht gewählt haben.«[4]
»Von einem säkularen Staat, in dem Religion und Regierung voneinander getrennt sind, kann hier keine Rede sein!«, bestätigte Frerk schließlich meinen neugewonnenen Eindruck. »Wir leben in der Kirchenrepublik Deutschland.«
Ich lachte laut auf und rannte danach wie verrückt durch meine WG und erzählte allen, was ich gerade gelernt hatte, googelte dann diesen Politologen, und fand noch unzählige weitere Fakten, noch mehr abstruse, himmelschreiend aberwitzige und zugleich bitterernste Tatsachen aus dem Reich der Götter und der Päpste, der Hirten und der Schäfchen, der unheiligen Allianz aus gewählten Volksvertretern und dem selbsternannten Bodenpersonal eines angeblich allmächtigen Schöpfergottes.
Ich griff damals nach meinem Telefon und rief meinen Vater an. Seit ich denken kann, ist er Kirchenmusiker in einer katholischen Gemeinde im gutbürgerlichen West-Berlin, ist aber keineswegs hardcore fromm – sondern in erster Linie Musiker.
»Tja, Philipp, so sehr ich die Kirchenmusik auch liebe und …« Mein Vater ließ eine längere Pause. »… und so sehr ich auch an eine höhere Kraft glaube, die man Gott nennen könnte – so sehr muss man die Institution Kirche auch kritisch betrachten. Deswegen haben wir auch immer großen Wert darauf gelegt, dass ihr Kinder später selbst entscheiden könnt, wie ihr zur Religion stehen wollt.« Er lachte leise durch die Nase. »Diese Entscheidung war bei dir ja recht früh abzusehen, und jetzt hast du sie offensichtlich endgültig getroffen.«
Aber hallo! Der Glaube an Gott ist mir und meinen Geschwistern tatsächlich nie gezielt anerzogen worden, aber: Mein diffuser Glaube an einen weltanschaulich neutralen Staat und an die Kirche als soziale Einrichtung ist in diesen Tagen mit Karacho an der Realität zerschellt.
Bing: 19855 Euro.
Selbstverständlich machte ich aus meinen neugewonnen Erkenntnissen kein Geheimnis, und auch nicht aus meiner damit verbundenen Haltung: Religiösem Hochmut muss die Stirn geboten und die Verflechtung von Staat und Kirche aufgelöst werden!
Mit dieser Überzeugung war ich in meinem Umfeld zwar keineswegs der Einzige – ganz im Gegenteil –, aber sehr wohl der Einzige, der die Angelegenheit für wichtig genug hielt, um großen Worten politische Aktivitäten folgen zu lassen. Also kontaktierte ich übers Internet erstmalig Menschen, die genau das in verschiedenen Verbänden taten, und traf eine erste Verabredung mit professionell Gottlosen.
Und hätte es vor diesem Treffen noch den berühmten Tropfen gebraucht, der mein Fass zum Überlaufen bringen würde, wäre es wohl dieser Moment gewesen: Ich betrete einen U-Bahnhof und stehe vor einem großen Werbeplakat, auf dem in weißer Schreibschrift auf einer linierten Schultafel zu lesen ist:
Werte brauchen Gott!
Bitte?! Zuerst fand ich diesen Satz zwar nicht so grausam wie sein britisches Pendant, denn immerhin wurde hier keine brutzelnde Hölle angedroht. Aber je länger ich auf der folgenden U-Bahnfahrt darüber nachdachte, desto grausamer fand ich auch die deutsche Version des religiösen Hochmuts – unterstellt er Menschen doch, aus sich heraus keine Werte entwickeln zu können, und damit Ungläubigen wie mir, überhaupt keine Werte zu haben. Und als wäre dies nicht schon frech genug, stammt der Satz auch noch aus der Feder einer Organisation, die eine blutrote Spur des Terrors in unseren Geschichtsbüchern hinterlassen hat und bis heute ein extrem erfolgreiches Geschäftsmodell fährt:
Die Kirche redet Menschen ihren Glauben zuerst ein und nutzt ihn dann schamlos aus.
Erschüttert von der Tatsache, dass ich als Passagier der öffentlichen Verkehrsmittel meiner Heimatstadt mit einer derart bodenlosen Frechheit konfrontiert wurde, las ich zu Hause nach, worum es bei der Werte-brauchen-Gott-Kampagne überhaupt ging – und kippte fast vom Stuhl.
Bing: 19860 Euro.
Etwa zwei Jahre nachdem Hatun Sürücü für ihren »westlichen Lebensstil« von ihrem Bruder auf offener Straße erstochen wurde und dort elendig verblutete, entschied die Berliner Landesregierung, in einer kulturell und weltanschaulich vielfältigen Stadt wie Berlin in den Oberschulen einen staatlichen Ethikunterricht einzuführen. Dieser Ethikunterricht sollte zusätzlich zum konfessionell getrennten und in Berlin freiwilligen Religionsunterricht etabliert werden. Er sollte die Kinder, deren Eltern an verschiedene Götter glauben, lieber miteinander reden lassen, statt übereinander. Hier sollten sie lernen, dass es verschiedene Weltanschauungen und Religionen gibt, die verschiedene Regeln von ihren Anhängern fordern – aber eben auch, dass himmlische Regeln nicht über dem weltlichen Gesetz stehen, auch wenn dieser Eindruck rein sprachlich natürlich erweckt wird.
Das schmeckte kirchlichen Lobbygruppen und Parteien offenbar gar nicht, zumal der Religionsunterricht in Berlin ihrer Meinung nach sowieso nicht ernst genug genommen würde. Also gründeten sie die Initiative »Pro Reli«, fanden dafür einflussreiche Unterstützer in Politik und Medien und behaupteten rotzfrech, der Berliner Senat wolle – Achtung: den Religionsunterricht abschaffen!
Das war natürlich überhaupt nicht der Fall, aber mit dieser lupenreinen Lüge wollte die Gotteslobby nicht nur die Einführung eines verpflichtenden konfessionsfreien Ethikunterrichts verhindern, sondern gleichzeitig den konfessionellen Religionsunterricht zum Regelfach erklären. Das ist er in Berlin nämlich bis dahin nicht: Die Teilnahme daran ist freiwillig, die Noten werden auf einem separaten Zeugnis aufgelistet und sind für die Versetzung in die nächste Klassenstufe absolut irrelevant. Statt also einen gemeinsamen Ethikunterricht einzuführen, forderte »Pro Reli« nun, dass Schülerinnen und Schüler sich entscheiden müssen zwischen Religion und Ethik – und zugleich, dass Religion ein Regelfach werden sollte, also benotet und versetzungsrelevant wie etwa Mathe, Deutsch oder Englisch.
Vordergründig forderte »Pro Reli« also Wahlfreiheit, wollte aber Wahlzwang einführen und damit die Freiheit einschränken. Und weil einer Organisation, die von sich behauptet, die Nächstenliebe erfunden zu haben, in Wirklichkeit aber für 1000 Jahre Finsternis und Verderben verantwortlich ist, schließlich alles zuzutrauen war, läuteten bei mir die Alarmglocken.
»Pro Reli« wollte also per Volksentscheid durchsetzen, dass Schülerinnen und Schüler nun auch in Berlin nicht nur mit Erkenntnissen, sondern auch mit Bekenntnissen schulische Erfolge erzielen konnten.
Angesichts finanzstarker Partner konnte die Kampagne offenbar alle Register ziehen, und so hingen schon bald Plakate in der ganzen Stadt, vorrangig auf U- und S-Bahnhöfen, auf denen die bewussten und gezielten Falschdarstellungen in verschiedener Form wiederholt wurden: Der Berliner Senat wolle den Religionsunterricht abschaffen, und das, obwohl doch die Vermittlung von Werten ausschließlich über Gott funktioniere. Selbiges wurde in Radiospots behauptet, in zahlreichen »Zeitungsartikeln« und Interviews und in sehr persönlichen Stellungnahmen: Angela Merkel, Frank-Walter Steinmeier, Wolfgang Thierse, Andrea Nahles, aber auch Günther Jauch und sogar schlaue Menschen wie Eckart von Hirschhausen waren sich nicht zu schade dafür, die Pippi-Langstrumpf-Kampagne der Gottesanbeter mitzutragen: Wie eh und je machten sie sich die Welt, widde-widde-wie sie ihnen gefällt.[5]
Mit derart gezinkten Assen im Ärmel strömten Pro-Reli-Aktivisten daraufhin nicht nur in Kirchen, sondern auch auf die Straßen und sammelten Unterschriften, um den Volksentscheid herbeizuführen – mit mäßigem Erfolg: Die Frist neigte sich ihrem Ende, die Unterschriften waren längst nicht genug, den Berlinern ging es offenbar wie mir früher: Reljohn? S’mirdochejaal!
Und als dem HERRN und seinem Bodenpersonal wohl nur noch ein Wunder hätte helfen können, da trat es ein – und zwar in Form der Berliner Verkehrsbetriebe.
Die lassen nämlich grundsätzlich keinerlei Unterschriftensammlungen in ihrem Geschäftsgebiet zu, machten aber für »Pro Reli« die erste und letzte Ausnahme in der Geschichte des öffentlichen Nahverkehrs. Ganze Horden von Klemmbrettchristen stürzten sich nun in die Bahnen und Busse, erzählten den Leuten, was sie selber glaubten – dass der Berliner Senat den Religionsunterricht abschaffen wolle, sie hingegen würden sich für die Freiheit einsetzen – und hatten so zum Ablauf der Frist genug Namen von Menschen zusammen, die entweder tatsächlich glaubten, getrennter Religionsunterricht verbessere den Dialog der Religionen, oder aber lieber einfach unterschrieben als hinterfragten.
Ich verfolgte den ganzen Zirkus Tag für Tag und verstand nun beim besten Willen nicht mehr, wie mir Religion jemals hatte egal sein können – so entrüstet war ich.
Bing: 19900 Euro.
Auf dem Höhepunkt dieser Entrüstung schrieb ich meine ersten Beiträge auf einschlägigen Facebook-Seiten, befand mich auf einmal im virtuellen Planungsteam einer Kampagne, die Atheistenbusse auch durch Deutschland schicken wollte, und wurde schon bald zum ersten ganz realen Treffen eingeladen.
So spazierte ich also eines Nachmittags durch einen Kreuzberger Hinterhof in das Büroloft der Werbeagentur, wo sechs weitere Aktivisten sich bereits zum zweiten Mal trafen – und einer von ihnen war der Politologe Carsten Frerk. Erstmalig befand ich mich nun also in der Gesellschaft von Menschen, die mir zwar wildfremd waren, aber genauso angefressen wie ich von der Arroganz der Gotteslobby und ihren dreisten Lügen. Und weil ich meiner Entrüstung hier endlich mal Luft machen konnte, muss ich wohl so lange gesprochen haben, bis mich einer der Kampagneros unterbrach.
»Du scheinst ja ganz gern zu reden, was?« Lächelnd schob er mir ein Prepaid-Handy zu. »Ich würde dich ganz gern zum Pressesprecher unserer Kampagne ernennen. Hast du schon mal Interviews gegeben?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Dann üben wir das heute noch. Was meinen die anderen?«
Die restlichen fünf Köpfe nickten, und nach einem ausführlichen Briefing war ich schließlich offizieller Pressesprecher der Buskampagne.
»Was machst du eigentlich beruflich?«, fragte der Initiator Peder mich schließlich, als die Gottlosen Sieben an diesem Tag ihre Sachen packten und ihre Arbeit beendeten.
»Na ja …«, antwortete ich wahrheitsgemäß. »Ich bin unser Pressesprecher.«
Die anderen lachten und schauten sich dabei etwas irritiert an.
»Mal im Ernst«, wollte Evelin, die Fotografin, nun wissen, »womit verdienst du deinen Lebensunterhalt?«
»Gute Frage!«, ich kratzte mich am Kinn. »Ich hab’ vor zwei Wochen mein Pädagogik-Studium abgeschlossen, warte jetzt auf die Diplomnote und bewerbe mich währenddessen. Am liebsten würde ich natürlich etwas machen, das mir noch Zeit für unsere Kampagne lässt.«
»Dann werd doch Lehrer!«, schlug Evelins Mann Carsten vor. »Der Senat sucht doch händeringend welche, und das passt bestimmt gut zu dir. Zeit für die Gottlosigkeit hättest du außerdem noch.«
»Theoretisch schon, ja, aber ich …« Beim Gedanken, vor einer Klasse zu stehen, wurde mir heiß und kalt. »Ich will echt nicht in die Fußstapfen meiner Eltern treten!«
Bing: 19915 Euro.
Zwei Wochen später nehme ich eine Stelle als Assistent eines Grundschulleiters an, verdiene mir dabei ein paar Euro, und frage mich während meiner Arbeit in der Hausaufgabenbetreuung, wer heutzutage so verrückt ist, Lehrer zu werden – so crazy sind die Kids, so aggressiv und vielfach meilenweit hinter dem Lernstand ihres Alters.
Und während ich vormittags meinem Nebenjob in der Schule nachgehe, verbringe ich meine Nachmittage im Kreise der Gottlosen Sieben. Vor allem von Carsten Frerk kann ich dort lernen, wie lange er und verschiedene Verbände und Stiftungen sich schon für die Trennung von Staat und Kirche einsetzen, und wie heftig der Widerstand der Christenlobby in den Parteien und Amtskirchen ist – obwohl es sich beim sogenannten Säkularismus um einen Verfassungsgrundsatz handelt.[6]
Welche Rolle der Islam in diesem Zusammenhang bald spielen würde, deutet sich damals, im Jahre 2009, schon vorsichtig an.
Parallel dazu übersetzen wir den englischen Slogan – vielleicht typisch deutsch – etwas steif in:
Es gibt (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) keinen Gott
und basteln unsere Homepage. Hier können Befürworter der Aktion nicht nur spenden, sondern mit jeder einzelnen Spende abstimmen, welchen der fünf Untertitel sie auf den ersten Bussen sehen wollen. Die Nase vorn hat momentan:
Ein erfülltes Leben braucht keinen Glauben, unser aller Lieblingsuntertitel.
Und auch die Frage, wo wir die Aktion starten, ist unstrittig: natürlich in der Hauptstadt der Diaspora, in der satte 63 Prozent konfessionsfrei sind und weniger als zehn Prozent regelmäßig einen Gottesdienst besuchen – in Berlin![7]
Ein Telefonat mit dem zuständigen Büro der Berliner Verkehrsbetriebe ist ein kleiner Meilenstein der Aktion: Der Slogan geht locker klar, heißt es von dort, denn solange wir keinen Verfassungsgrundsatz brechen, können wir für alles werben!
Bing: 19920 Euro.
So erklärt sich auch, wie so manch andere Werbung auf oder in den Fahrzeugen und auf den Berliner Bahnhöfen landen kann: »Jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird das ewige Leben haben – Johannes 3:36«, zitiert etwa ein christlicher Jugendverband per U-Bahn-Plakat aus der Bibel. Auch die Rosenkreuzer, die eine so phantasievolle wie krude Mischung aus östlichen und westlichen Geheimlehren anbieten, dürfen hier werben. Und von fragwürdigen Sofortkrediten – »Keine Schufa-Prüfung!« –, die Konsumenten auch gern mal in die Privatinsolvenz locken, mal ganz zu schweigen, fahren sogar Doppeldeckerbusse durch unsere Hauptstadt, die ganzflächig mit Werbung für Berlins größten Edelpuff bedruckt sind: das »Artemis, Berlins erotischer Höhepunkt!«
Weltanschauliche Vielfalt scheint im Bereich der Werbung also gegeben zu sein, ethische Standards hingegen sind … sagen wir einmal: recht weit gefasst – dagegen ist die Feststellung, dass es im Universum mit rechten Dingen zugeht, dass also weder Heilige noch Geister oder eben heilige Geister in die Naturgesetze eingreifen, ja beinahe banal.
Bing: 19950 Euro.
Als unsere Website veröffentlicht wird und die Pressemeldung mit unserem Slogan und ersten Fotomontagen rausgeht, weiß ich schlagartig, warum ich ein zweites Handy dafür habe: weil es schon jetzt kaum noch stillsteht. Mein Chef im Nebenjob, der Schulleiter, hat inzwischen festgestellt, dass ich rechnen kann, und hat mich von null auf hundert zum Mathelehrer befördert. »Sie unterrichten vorerst die 5a und die 6b, hier sind die Bücher, da sind die Klassen – noch Fragen?«
In jeder kleinen Pause verkrümele ich mich in eine stille Ecke, höre die Mailbox ab, rufe Journalisten zurück und beantworte immer wieder diese eine Frage:
»Warum machen Sie das?«
… um Himmels willen!, sagt zwar niemand, aber die Fragen sind gelegentlich alles andere als neutral: Warum beleidigen Sie religiöse Menschen? Wie können Sie behaupten, es gäbe keinen Gott? Das ist doch Blasphemie! Und warum müssen Sie in einem Staat, in dem die Regierung von der Religion getrennt ist, Werbung für ein Leben ohne Gott machen?!
Unser Plan geht also auf, denn jetzt kann ich den Journalisten in die Feder diktieren, was sonst nur furchtbar schwer in Zeitungen zu bekommen ist:
Unser Staat ist nur auf dem Papier weltanschaulich neutral, in der Realität ist er mit den Kirchen an unzähligen Stellen verflochten – wir leben in der Kirchenrepublik Deutschland, wie Carsten gern zu sagen pflegt.
Bing: 19980 Euro.
Noch bevor also auch nur ein einziger Bus mit unserem Slogan unterwegs ist, verursacht unsere Kampagne schon einen kleinen Sturm im Wasserglas der Republik – von dem wir allerdings auch befürchten müssen, dass er darüber nicht weit hinausgehen wird. Denn mal ganz ehrlich: ein paar Ungläubige, die 20000 Euro sammeln und auf ein paar Busse schreiben lassen, dass sie nicht an Gott glauben – na und? Da bellt doch im Deutschland des 21. Jahrhunderts kein Hund nach, vor allem nicht in Berlin!
Doch Toni J. (21) aus Düsseldorf ändert alles. Er spendet 20 Euro.
»Die BVG glaubt noch an Gott«
Wir tanzen und hüpfen, wir fallen uns in die Arme und stoßen mit Sekt an, doch dann klingelt mein Pressehandy – Stille kehrt ein, als ich rangehe.
»Die Buskampagne, Philipp Möller, hallo?« Ich lasse mich vom Freudestrahlen meiner gottlosen Kollegen anstecken. »Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Mira Bach von der taz, hallo!« Ich schalte den Lautsprecher an und schreibe die drei großen Buchstaben T-A-Z an unser Whiteboard. »Glückwunsch erst mal zum erreichten Spendenziel«, sagt sie, »wie geht’s jetzt weiter?«
»Danke! Wir rufen jetzt bei der BVG an und …«
»Den Berliner Verkehrsbetrieben?«
»Genau, und da buchen wir die ersten Busse!«
»Und die gestatten das auch, ja?«
»Haben sie gesagt, ja.« Ich grinse über beide Ohren. »Dort geben wir jetzt die ersten drei Busse in Auftrag und starten dann fahrplanmäßig unsere Buskampagne!«
»Wann wird das sein?«
Peder hält zwei Finger hoch und wackelt mit einem dritten.
»Morgen«, sage ich schnell und zwinkere Peder zu. »Spätestens übermorgen!«
Während die Dame von der taz weitere Fragen stellt, klopft es im Hintergrund fast permanent auf der zweiten Leitung an, dann klingelt auch Peders Telefon. Ich schalte den Lautsprecher also wieder aus und nehme die Journalistin ans Ohr, werde aber schnell von Peder unterbrochen.
»Wie bitte?!«, ruft er durch unsere Kampagnenzentrale. »Aber Sie hatten uns das doch zugesagt!«
»Was ist da los?!«, will Mira von der taz wissen.
»Gute Frage, bleiben Sie mal dran!«
»Sie machen Werbung für Jesus, die Bibel und für Berlins größten Puff«, schreit Peder fast ins Telefon, »wollen aber unsere Werbung nicht zulassen?!«
Ich nehme ihm das Telefon aus der Hand, schalte den Lautsprecher ein und halte mein Handy daneben.
»… bitten wir Sie wirklich um Verständnis dafür«, hören wir eine Frauenstimme sagen. »Aber die BVG ist kein Ort für weltanschaulich gefärbte Werbung!«
»Aber das ist doch Unsinn!«, hält Peder dagegen. »Bei Ihnen ist alles voll mit weltansch …«
»Tut mir leid, die Entscheidung ist getroffen.« Die Dame seufzt. »Wir werden Ihren Slogan keinesfalls im Geschäftsbereich der Berliner Verkehrsbetriebe zulassen. Auf Wiederhören.« Es klickt und tutet in der Leitung. Wir starren uns an. Die Sektlaune ist zerstört. Lange Gesichter. Peder pfeffert das Telefon auf den Tisch und reibt sich die Augen.
»Hallo?!«, tönt es plötzlich aus dem Pressehandy, »Herr Möller?«
»Ja!«, ich schalte den Lautsprecher wieder ein. »Haben Sie das mitgehört?«
»Klar!« Mira Bach lacht überschwänglich. »Und noch mal meinen herzlichen Glückwunsch!«
»Glückwunsch?!« Verdutzt schauen wir Kampagneros uns an. »Aber wir …«
»Ihnen dürfte ja wohl klar sein, was diese Ablehnung bedeutet – oder?!«
In einem Kreuzberger Hinterhof stehen jetzt sieben Leute im Büro einer Werbeagentur und starren gebannt auf ein Handy. Dann ruft die Reporterin:
»Das ist DER Skandal, das ist DIE STORY! Jetzt erzählen Sie mir bloß nicht, dass Sie es nicht darauf angelegt haben!«
»Ääähhh …«
Lautes Rascheln ist zu hören, im Hintergrund des Telefonats klappen Türen, forsch spricht die taz-Frau mit irgendwem, gibt Anweisungen und ist außer Atem. Dann wendet sie sich wieder an mich.
»Passen Sie auf: Ich rufe jetzt die BVG an und hol mir den O-Ton. Sie schreiben derweil die Pressemitteilung um, dann gehen wir damit gleichzeitig raus, okay?!«
»Klar …« Die anderen nicken. »Wann?«
»Wo sitzen Sie?«
»Kreuzberg, Südstern!«
»Ich bin in fünfzehn Minuten bei Ihnen!« Es raschelt wieder. »Dreizehn!«, dann tutet es.
Heidenspaß statt Höllenqual
Drei Tage nachdem unsere Werbung für ein Leben ohne Gott von der BVG mit der Begründung abgelehnt wurde, man wolle sich dort weltanschaulich neutral halten, stehe ich an einem U-Bahnhof und blicke dem überlebensgroßen Günther Jauch in die Augen.
»In Berlin geht’s um die Freiheit!«, steht neben seinem freundlichen Gesicht auf dem fast neun Quadratmeter großen Werbeplakat von »Pro Reli«. Und »Freie Wahl zwischen Ethik und Religion« steht daneben.
Das Design: perfekt, die Slogans: ausgeklügelt, die Plakate: in der ganzen verdammten Stadt – und der Wahrheitsgehalt der Kampagne: genauso hoch wie die weltanschauliche Neutralität der BVG, nämlich gleich null.
Denn was hier als »freie Wahl« angepriesen wird – »Machen Sie die Freiheit stark« und »Gleiche Freiheit für Berlin!« –, ist in Wahrheit eine Wahlpflicht: Setzt die Kampagne ihre Forderung durch, können Schüler in Zukunft entweder den Religionsunterricht oder den Ethikunterricht besuchen. Die »freie Wahl« hingegen, Religionsunterricht zu besuchen oder eben nicht, besteht schon lange und soll auch nicht angerührt werden.
Vertieft in die perfekt-perfide Täuschung, die diese Kampagne betreibt, bekomme ich einen Heidenschreck, als die orangefarbene U-Bahn an mir vorbeidonnert. Dann nutze ich die Fahrt für ein kleines Nickerchen, denn mein Nebenjob als Lehrer kostet mich unfassbar viel Energie. Am Südstern steige ich schließlich aus und gebe auf dem Fußweg in die Agentur noch telefonische Interviews für Lokalzeitungen in Frankfurt am Main, Hannover und Hamburg – von wo wir inzwischen Absagen für unsere Gottlos-glücklich-Slogans bekommen haben.
»Was stört Sie an der Absage?«, will der Reporter aus der Hansestadt wissen.
»Dass religiöse Werbung auf den Hamburger Verkehrsmitteln zugelassen, aber unsere Werbung mit der Begründung abgelehnt wird, weltanschaulich neutral sein zu wollen.« Ein Feuerwehrauto rast mit Martinshorn an mir vorbei, dann spreche ich weiter. »Das ist Doppelmoral, das ist eindeutig weltanschauliche Diskriminierung.«
Zwei Dinge habe ich in den vergangenen Tagen gelernt: Die allermeisten Journalisten lieben kurze, knackige Statements – und unsere Kampagne! »Weiter so«, höre ich inzwischen oft nach den Interviews, »gut, dass das mal jemand macht«, oder »ich bin zwar noch in der Kirche, aber es ist unfassbar, dass Sie überall abgelehnt werden!«.
Überall? Gibt es nicht vielleicht doch noch die eine Stadt, die unsere Kampagne zulässt? Das kleine germanische Dorf, das sich dem langen Arm der Kirchen entziehen kann?
»Stuttgart, München, Fulda!«, schmeißt Peder mir sofort an den Kopf, als ich das Hauptquartier der Gottlosen Sieben betrete. »Alle mit der gleichen Begründung abgelehnt.«
Und schon klingelt mein Handy wieder, diesmal werde ich von einem Lokaljournalisten aus der Heimatstadt meines Vaters angerufen – dem erzkatholischen Fulda.
Bing: 22050 Euro.
So kehrt in mein sonderbares berufliches Dasein nun fast so etwas wie Alltag ein: Um halb sieben klingelt mein Wecker, auf dem Weg zur Schule beantworte ich die ersten Mails, ab acht Uhr schlage ich mich im Mathe- und inzwischen auch im Musik- und Englischunterricht mit meinen Schülern herum – teilweise im wahrsten Wortsinne! –, verlasse den heruntergekommenen Plattenbau dann um halb zwei mit dröhnendem Schädel und Pressehandy am Ohr, und fahre in die Gottlosen-Zentrale. Nach einigen Wochen stehen zwei Dinge fest:
Die Ablehnung der städtischen Verkehrsbetriebe – Berlin, Bremen, Dortmund, Dresden, Essen, Frankfurt am Main, Fulda, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Münster, Nürnberg, Potsdam, Regensburg und Stuttgart – ist quasi flächendeckend. Was also in anderen, vermeintlich konservativeren Ländern möglich ist, lässt sich im nur scheinbar aufgeklärten Deutschland nicht realisieren: Werbung für ein Leben ohne Gott.
Zugleich ist die Zustimmung aus der Bevölkerung nahezu überwältigend. Unsere Pressemeldung hat Redaktionen im ganzen Land dazu bewegt, weitestgehend positiv über uns zu berichten, die Überschrift der taz – Die BVG glaubt noch an Gott[1] – hat uns zahlreiche Unterstützer eingebracht, und die Spenden fließen und fließen und fließen.
Heute jedoch ist ein besonders spannender Tag: Spiegel Online hat sich nun zum zweiten Mal gemeldet, der Reporter kann kaum glauben, dass unsere Slogans landesweit abgelehnt werden. Für ihn steht sogar die Einschränkung der Meinungsfreiheit im Mittelpunkt der Ablehnung, und sein Artikel geht jeden Moment online.
»Los, aktualisier’ die Seite noch einmal!« Ungeduldig stupse ich Peder an. »Der Artikel muss jeden Moment da sein …«
»Ist ja gut, Philipp – ganz ruhig!« Peder lächelt mich sanft an. »Wichtiger als der Artikel wäre jetzt mal eine Stadt, die uns zulässt … Ah!« Peder schiebt den Artikel auf den Beamer, dreht sich zur Leinwand um und liest vor: »Deutsche Städte wollen keine gottlosen Botschaften auf Bussen«[2]
Und es dauert keine halbe Minute, da ertönt der schöne Klang wieder: Bing! Und noch einmal: Bing! Dann wieder: Bing! Jetzt zweimal: Bing, Bing, dann dreimal: Bing, Bing, Bing, und während wir alle wieder wie gebannt auf die Leinwand starren und dem grünen Spendenbalken beim Wachsen zuschauen, will das Bingen gar nicht mehr aufhören. Parallel dazu meldet Peder nun schlagartig steigende Zugriffszahlen auf unserer Homepage, Carstens Handy klingelt Sturm, Robert twittert und facebookt sich die Daumen wund, ich hänge ebenso permanent am Telefon, dazu Bing, Bing, Bing, Bing, die Spendenfrequenz steigt jetzt sekündlich, plötzlich haben wir die 25000-Euro-Marke geknackt, Bing, Bing, Bing, immer schneller trudelt das Geld ein, Melanie kommt kaum hinterher damit, das Spendenziel immer weiter zu erhöhen, 28000 Euro, 29000 Euro, dann sind die Dreißig geknackt, Bing, Bing, Bing, plötzlich habe ich »Die Zeit« am Telefon, Roger Willemsen will ein Interview mit mir[3], ich vertröste auf später, gern morgen früh, bleiben Sie mal eben dran, Bing, Bing, Bing, wir können es kaum fassen, 32000 Euro, Robert starrt in sein Handy und lacht verrückt, Peder ebenso – und dann plötzlich: Stille.
Kein Bing mehr.
»Hallo?«, sagt die Mitarbeiterin der ZEIT aus dem Telefon, »Herr Möller?!«
»Moment bitte!« Ich nehme mein Handy vom Ohr und schaue Peder fragend an, der erfolglos versucht, unsere Seite zu aktualisieren und mit den Schultern zuckt. »Ich rufe Sie gleich zurück, ja?«
Noch immer kein Bing, kein Cent kommt mehr rein.
»Was ist denn los?!« Carsten beendet ebenfalls sein Gespräch. »Vielleicht Internet down?«
»Nee!« Robert schüttelt den Kopf. »Ich bin online.«
Einen Moment lang schauen wir uns sehr irritiert an, dann kann ich mir den Blick aus dem Fenster nicht verkneifen – gen Himmel.
»Meinst du … er war’s?«, fragt Peder, der daraufhin schallend lacht und uns alle damit ansteckt. »Nein, dafür gibt es sicher eine ganz rationale Erklärung.«
Wieder kehrt Stille ein, die plötzlich unterbrochen wird vom Festnetztelefon der Agentur.
»Wer kann das denn jetzt sein?!« Peder runzelt die Stirn und geht ran. »Hallo?! Ja! Ja, genau, wir sind von der Buskampagne.«
Peder schaltet den Lautsprecher ein und legt das Telefon auf den Tisch.
»… von Helpedia, Sie haben bei uns diese Spendenkampagne für die Atheistenbusse geschaltet, oder?«
»Ja, was ist denn plötzlich los?!«
»Der Server ist eben abgestürzt!«, ruft die Stimme aus dem Telefon. »Wir hatten in den letzten Minuten mehr Zugriffe auf unsere Homepage als in den gesamten zwei Jahren, seitdem sie existiert!«
»Krass, die Leute fragen alle schon!«, schaltet Robert sich ein. »Dann geb’ ich jetzt auf allen Kanälen raus, dass wir gleich wieder online sind?«
»Ja, auf jeden Fall!«, sagt der Mann von Helpedia, bei dem nun schnelles Tastaturgeklicker im Hintergrund zu hören ist. »Wir sind in zwei Minuten wieder am Start!«
Eine gefühlte Ewigkeit blicken wir wieder auf den Laptop und aktualisieren andauernd unsere Homepage, bis der Spendenbalken auf einmal wieder zu sehen ist und das schöne und vertraute Klingeln wieder einsetzt:
Bing, Bing, Bing.
Wir atmen auf, gehen dann wieder unseren Aufgaben nach und setzen uns am Abend zusammen.
»Also, Leute, wir haben ein ernsthaftes Problem!« Peder schiebt unsere Homepage auf den Beamer, wir alle blicken kopfschüttelnd auf die Leinwand. »Keine größere deutsche Stadt lässt unsere Kampagne zu, aber …« Er grinst. »Irgendwie müssen wir jetzt knapp vierzigtausend Euro loswerden. Vorschläge?«
Wir spinnen ein bisschen herum: eine Flugzeugkampagne? Ein Himmelsschreiber mit den Worten: »Hier oben ist auch kein Gott«? Affig und viel zu schnell verflogen. Vielleicht eine klassische Plakatkampagne?
»Hab ich gerade schon bei Ströer angefragt.« Peder schüttelt den Kopf. »Keine Chance!«
»Und das sind die Einzigen?«, will Melanie wissen.
»So ziemlich.« Peder wirft die Homepage mit deren Geschäftsnetz auf den Beamer. »Wenn du in Deutschland Plakatwerbung schalten willst, kommst du an denen quasi nicht vorbei.«
Also brainstormen wir weiter: eine Fahrradkampagne? Wirkungslos. Radiospots? Nicht nachhaltig genug, wir müssen Bilder erzeugen. Eine einzige Seite im Spiegel-Magazin? Dafür reicht unser Budget nicht.
»Sorry, aber das ist doch alles scheiße!« Carsten, der sich bis eben rausgehalten hat, haut auf den Tisch. »Wir haben den Leuten eine Buskampagne versprochen, also sollen sie auch eine bekommen! Evelin und ich haben da zufällig etwas entdeckt.«
Er gibt seiner Frau ein Zeichen, sie schließt ihren Laptop an den Beamer an und wirft eine Fotomontage auf die Leinwand, bei der uns allen sofort die Münder offen stehenbleiben.
»Das ist der Rote Riese«, erklärt Evelin uns. »Ein klassischer Berliner Doppeldecker, zufällig so rot wie die Londoner Busse.« Sie geht auf die Zehenspitzen und fährt mit den Fingern über die Flanke des Busses. »Der hat viel Platz für unsere frohe Botschaft!«
»Geil!«, rutscht es mir heraus. »Ist das etwa ein Cabrio?!«
»Exakt!« Carsten nickt. »Wir haben schon mit der Firma gesprochen. Den könnten wir im Frühling mieten, inklusive Fahrer und Sprit, und damit durch Deutschland fahren – unsere ganz eigene Buskampagne!«
»Unsere ganz eigene Buskampagne!«, flüstere ich und grinse über beide Ohren, doch Carsten hebt mahnend die Hand. »Wieso denn?«, will ich wissen, »Was spricht dagegen?«
»Der gigantische Organisationsaufwand!« Er tritt ans Whiteboard und zeichnet die Umrisse unseres Landes darauf. »Wenn wir das medienwirksam umsetzen wollen, dann müssen wir jede größere deutsche Stadt anfahren.« Wild setzt er Punkte in die Skizze und verbindet sie. »Die ganze Nummer dauert mindestens zwei Wochen, eher drei.«
»Und was kostet der Bus?«, fragt Peder.
»Ungefähr tausend Euro pro Tag, inklusive sämtlicher Nebenkosten.« Carsten nickt. »Finanziell passt das, und es ist eine Riesenchance – aber!« Er lässt sich in seinen Stuhl fallen und schaut mich an. »Das wird eine Heidenarbeit, auch für unseren Pressesprecher!«
»Eine Heidenarbeit, sagst du?«, ich grinse ihn an. »Aber sicher auch ein Heidenspaß!
Christenverfolgung 2.0
»Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf dem Sonnendeck des roten Riesen!« In der linken Hand halte ich ein Mikrophon, mit der rechten zeige ich nach oben. »Wir haben extra ein Cabrio gemietet, damit Sie freien Ausblick in den Himmel haben – und sehen Sie da oben auch, was ich sehe?« Die meisten unserer Fahrgäste haben Diktiergeräte in der Hand und schreiben parallel dazu lachend mit. »Genau, blauen Himmel, damit wir die allererste rollende Pressekonferenz in der Geschichte unserer Buskampagne bei strahlendem Sonnenschein abhalten können! Herzlich willkommen also zur Premiere«, rufe ich feierlich, »und zum ganz offiziellen Start – der Buskampagne!«
Applaus bricht los, denn ganz offensichtlich sind nicht nur Reporter an Bord unseres vollbesetzten Busses, sondern auch jede Menge Unterstützer. Ich bitte Carsten, Peder und Evelin zu mir nach vorne. Der Rest der Gottlosen Sieben hat sich im Laufe der Wochen eher wieder seinem beruflichen Leben gewidmet –, und so finden wir uns nach langer Planungsarbeit auf dem Oberdeck des Busses wieder, mit dem wir heute unsere dreiwöchige Tour durch Deutschland starten, und als Endhaltestelle haben wir eingegeben:
GOTTLOS GLÜCKLICH
Startpunkt ist vorm Roten Rathaus am Berliner Alexanderplatz, wohin wir zum heutigen Tourbeginn alle eingeladen haben, die sich für unsere Aktion interessieren: Spenderinnen und Spender, Journalistinnen und Journalisten, sicherlich auch eine Handvoll streitlustiger Christinnen und Christen, aber so wie es aussieht hauptsächlich Gleichgesinnte. Sie alle tummeln sich im und vor allem auf dem Oberdeck unseres roten Riesen herum.
»Hinsetzen!«, tönt plötzlich eine schroffe Stimme aus den Lautsprechern. »Et jeht los!«
»Oh, das muss wohl Björn sein, unser Busfahrer!«, sage ich, während ich mich mit dem Hintern auf die Stange setze, die hinter der Frontscheibe ist, so dass mein Kopf nicht mehr aus dem Cabrio schaut. »Möchtest du unsere Gäste kurz begrüßen, Björn?«, frage ich ins Mikro.
»Nee!«, antwortet Björn. »Ick fahr Bus, du laberst – okee?«
»Na jut!« Wieder lachen die Leute an Bord. »Björn ist Berliner Busfahrer, der muss so sein, sonst ist das nicht authentisch. Können wir los, Björn?«
»Nee«, ruft er jetzt wieder.
»Wieso nicht?« Ich grinse das Publikum an, und gemeinsam erwarten wir den nächsten flapsigen Kommentar.
»Ick werd von ’nem Jesus-Bus blockiert. Wenn de ma rauskicken willst …«
Irritiert stehe ich wieder auf, drehe mich um und erblicke einen weißen Bus, der quer vor unserem parkt. Und während auf unserem Bus steht:
Es gibt (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) keinen Gott – ein erfülltes Leben braucht keinen Glauben
steht auf dem Reisebus:
Und wenn es ihn doch gibt … Gottkennen.de
Vor dem Bus steht eine kleine Gruppe freundlich lächelnder Menschen und winkt uns zu. Auf all ihren T-Shirts steht der gleiche Satz, wie auf ihrem Bus.
»Was soll der Mist?« Carsten steht inzwischen neben mir an der Frontscheibe des Sonnendecks und schüttelt den Kopf. »Weg da«, ruft er unwirsch, »wir haben einen straffen Zeitplan!«
»Nun mal nicht so unfreundlich!«, antwortet ein Mann, der tatsächlich Sandalen trägt und seine Hände vorm Mund zu einem Trichter formt. »Wir möchten uns Ihrer Tour gern anschließen.«
»Wie bitte?!« Carsten zeigt dem Mann einen Vogel. »Sie spinnen wohl! Wir haben unsere Kampagne fast drei Monate lang vorbereitet, und jetzt lassen wir uns von Ihnen ganz sicher nicht die Tour vermiesen – also: hopphopp!«
»Das war keine Frage!«, antwortet der Mann. »Wir leben in einem freien Land und können mit unserem Bus hinfahren, wo wir wollen!«
»Und das ist zufällig dort, wo wir hinwollen?«
»Genau!« Er wedelt mit unserem Tourplan und lächelt. »Drei Wochen lang.«
»Wissen Sie, was das ist?« Carsten dreht sich zu unseren Fahrgästen um und grinst. »Das ist Christenverfolgung, jawohl!«
Unser Publikum lacht laut. Sie sind inzwischen alle aufgestanden, einige haben Kameras in der Hand, andere schreiben mit.
»Wussten Sie von dem zweiten Bus?«, ruft ein Mann rein und hält uns seinen Recorder entgegen.
»Nein!«, antwortet Carsten lachend. »Wir sehen den zum ersten Mal!«
»Können Sie das mit der Christenverfolgung noch einmal hier in die Kamera sagen?«, ruft ein anderer.
»Klar!« Carsten überlegt kurz. »Wenn uns wirklich drei Wochen lang ein Bus folgen sollte, auf dem steht: Und wenn es ihn doch gibt, dann ist das Christenverfolgung!«
Aufgebracht steigen wir die Treppe unseres Roten Riesen herunter, verlassen ihn und finden uns auf einmal zwischen Kameras vor dem Christenbus wieder – und mitten im Gespräch mit dessen Birkenstock-Sprecher. Der Mann jedoch, der von oben sehr friedlich wirkte, macht von Angesicht zu Angesicht keinen so gechillten Eindruck mehr. Mit verschränkten Armen steht er vor mir, größer als ich, ziemlich breitschultrig, die Haut vernarbt, den Blick zwar lächelnd, aber die stahlblauen Augen weit aufgerissen, seine Miene unbewegt.
»Haben Sie etwa ein Problem damit«, fragt er leise und geht noch einen kleinen Schritt auf mich zu, »dass wir fragen, ob es ihn vielleicht doch gibt?«
Drei große Kameras sind nun auf uns beide gerichtet, dazu jede Menge Handys der umstehenden Menschen.
»An sich nicht.« Ich lächele, weiche aber nicht zurück. »Klingt aber ein bisschen nach einer Drohung.«
»Keineswegs, das ist ein Angebot!«
»Das wir dankend ablehnen.« Ich schaue an ihm vorbei nach dem Bus. »Was passiert denn mit uns, wenn es ihn doch gibt?«
»Gott liebt alle Menschen«, sagt er und faltet seine Hände, »auch die, die glauben, dass es ihn nicht gibt!«
»Ich glaube aber gar nicht, dass es Gott nicht gibt!«
»Aber das steht doch auf Ihrem Bus.« Er lächelt noch immer. »So ist das eben mit uns Theisten und Atheisten: Wir beide glauben etwas. Wir, dass es Gott gibt, und Sie, dass es ihn nicht gibt. Die Chance ist eins zu eins!«
»Wenn es nur einen Gott gäbe, wäre die Chance eins zu eins.« Die Kameras schwenken wieder zu mir. »Aber die Menschheit hat sich schon tausende Götter ausgedacht, und an die allermeisten dieser Götter glauben Sie ja schließlich auch nicht! Wir sind halt bloß einen Schritt weiter gegangen als Sie und glauben eben an keinen Gott – so einfach ist das.«
»Aber das ist doch das Glei…«
»Schluss jetzt mit dem Geschwafel!« Carsten geht forsch auf den Mann zu, der nun erstmalig seine Fassade verliert. »Das hier ist ’ne politische Aktion, kein Bibelkreis! Wenn Sie uns verfolgen wollen, bitte, aber dann jetzt – wir haben Termine!« Er lässt den verdatterten Typen stehen und zieht mich mit sich. »Lass dich bloß nicht auf das Gottes-Gewäsch ein!« Carsten schiebt mich in den Bus. »Mit der unsinnigen Frage nach Gott hat die Menschheit schon ganze Jahrhunderte verschwendet, das bringt doch nix!«
»Aber, na ja …« Ich halte mich fest, als wir losfahren. »Es steht ja immerhin auf unserem Bus!«
»Na und!« Carsten schüttelt den Kopf. »Aber doch nur, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ob jemand an Gott glaubt oder nicht, ist doch scheißegal! Die Trennung von Staat und Kirche ist wichtig, Religion als Privatsache, das Hinterfragen der Privilegien – haben wir doch alles schon besprochen!«
»Stimmt.«
»Na also!« Er zeigt auf die Treppe. »Und jetzt ab auf die Bühne, du Rampensau, wir haben heute fünf Touren durch Berlin vor und müssen abends noch mit achtzig Sachen bis Rostock tuckern – let’s rock!«
Und genauso machen wir es: Wir rocken die Veranstaltung. Sechs vollbesetzte Doppeldecker-Touren sind es am Ende, bei denen Carsten und Peder die Journalisten koordinieren, Evelin Fotos schießt und ich Interviews gebe und die Fahrten moderiere. Und dabei wiederhole ich sechsmal das ungefähr Gleiche:
Mit unserer Kampagne wollen wir darauf aufmerksam machen, dass Konfessionsfreie mit 33 Prozent neben 30 Prozent Katholiken, 29 Prozent Protestanten, 4,9 Prozent Muslimen und 0,2 Prozent Juden die größte weltanschauliche Gruppierung darstellen.[1] Dass die Zahlen im Jahr 2015 schon bei 36 Prozent Konfessionsfreien, 29 Prozent Katholiken, 27 Prozent Protestanten, 4,4 Prozent Muslimen und 0,1 Prozent Juden liegen werden, können wir damals natürlich nur vermuten. Dass wir formal Ungläubigen aber in weniger als 20 Jahren die 50 Prozent Hürde geknackt haben sollten, zeichnet sich schon recht deutlich ab – denn noch im Jahr 1990, als die Ossis die Quote der Konfessionsfreien schon dramatisch erhöht hatten, waren noch 72 Prozent Mitglied in einer der beiden Kirchen.[2]
Zudem wollen wir zeigen, dass ein Leben ohne Gott für extrem viele Menschen absolut selbstverständlich und alles andere als traurig und unmoralisch ist, wie so oft von Kirchenfunktionären behauptet wird. Und wir wollen ein Gegengewicht bieten zu religiöser Werbung, die den Menschen das Blaue vom Himmel verspricht.
Wir widersprechen ganz entschieden der immer wieder vorgetragenen Behauptung, Konfessionsfreie seien moralisch minderbemittelt, wie es Bischof Mixa kürzlich zur Osterpredigt wieder behauptet hat: »Eine Gesellschaft ohne Gott ist die Hölle auf Erden!«[3]