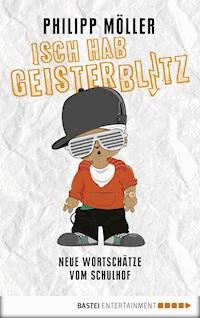12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mietwahnsinn, marode Schulen, Klimawandel und Rechtsnationalismus … Wer löst endlich unsere Probleme? »Der Auftrag meiner Tochter ist eindeutig: mit den Politikern schimpfen, weil die Toiletten auf ihrer Schule ekelhaft sind und trotzdem nicht saniert werden. Und wenn Super-Daddy schonmal im Bundestag unterwegs ist, könnte er doch gleich noch ein paar andere Dinge ansprechen: etwa, dass wir Jahr für Jahr einen unfassbaren Reichtum erwirtschaften, aber nur die allerwenigsten Menschen daran teilhaben lassen. Oder dass wir ganz genau wissen, wie krass der Klimawandel unser Leben verändern wird, und trotzdem jede politische Chance verpassen, ihn zu bremsen. Und was das Leben unter einer rechten Regierung bedeutet, weiß meine Tochter auch - und zwar von ihrer Uroma, die live dabei war.« Wie die Welt seiner Kinder wohl aussehen wird, wenn sich am momentanen Regierungsstil nichts ändert, fragt sich der dreifache Vater, Philipp Möller, schon lange - und will auf Antworten nicht länger warten. Stattdessen krempelt er die Ärmel hoch und will selbst mit anpacken … doch ins Zentrum der Macht zu gelangen, ist gar nicht mal so einfach. Und als er es geschafft hat, kommt alles anders als erwartet. Ein unterhaltsamer und erkenntnisreicher Selbstversuch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Philipp Möller
Isch geh Bundestag
Wie ich meiner Tochter versprach, die Welt zu retten
Über dieses Buch
»Der Auftrag meiner Tochter ist eindeutig: mit den Politikern schimpfen, weil die Toiletten auf ihrer Schule ekelhaft sind und trotzdem nicht saniert werden. Und wenn ihr Super-Daddy schonmal am Rednerpult des Bundestags steht, könnte er doch gleich noch ein paar andere Dinge ansprechen: etwa, dass wir Jahr für Jahr einen unfassbaren Reichtum erwirtschaften, aber nur die allerwenigsten Menschen daran teilhaben lassen. Oder dass wir ganz genau wissen, wie krass der Klimawandel unser Leben verändern wird, und trotzdem jede politische Chance verpassen, ihn zu bremsen. Und was das Leben unter einer rechten Regierung bedeutet, weiß meine Tochter auch - und zwar von ihrer Uroma, die live dabei war.«
Wie die Welt seiner Kinder wohl aussehen wird, wenn sich am momentanen Regierungsstil nichts ändert, fragt sich der dreifache Vater schon lange - und will auf Antworten nicht mehr warten. Stattdessen krempelt er die Ärmel hoch und packt selbst mit an - doch ans Rednerpult des Bundestags zu gelangen, ist gar nicht mal so einfach …
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Philipp Möller, Jahrgang 1980, ist Diplompädagoge, Bestsellerautor (»Isch geh Schulhof«) und überzeugter Atheist. Er setzt sich für ein säkularisiertes Weltbild ein, für Werte des Humanismus und der Aufklärung. Er war Pressereferent der »gottlosen« Buskampagne und arbeitet heute für die Giordano-Bruno-Stiftung. Mit seiner Familie lebt er in Berlin.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: bürosüd GmbH, München
Coverabbildung: Andreas Labes und www.buerosued.de
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490448-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Na, das geht ja gut los
Wie alles begann
Kinder, wie die Zeit vergeht
Alle schlechten Dinge sind 12,6
Der Super-GAU
Wenn’s weiter nichts ist …
Nix zu lachen
Wer macht das Spiel?
Eiskalt erwischt
Should I stay or should go?
Die Heißzeit kommt
Das Ende ist Nahles
Das Schicksal unseres Landes in den Händen von Workaholics
Die Faschos kommen
Mein erster echter Bundestag
Tschüs, Fritz!
#unfassbar
Ein Weihnachtsengel namens Greta
Erster Tag bei Lukas
Die Bienchen und die Blümchen
Reingefallen
FDP AK 6
Umweltausschuss FDP
Im Lampenladen
Die organisierte Weltrettung
Lukas’ Rede
Mittag mit der AfD
Der FDP fehlt die Emoción!
Die Uhr tickt
Eine grenzwertige Debatte
Willkommen in St. Bundestag
Auch Meinungen können waffenscheinpflichtig sein
Stachelmann
Johannes’ Rede
Fitness für Fakten
Rosling in der Bibliothek
Auf zu neuen Ufern
Wozu noch rechnen lernen?
Grüner wird’s nicht!
Die Gretchenfrage mal anders
Lukas nervt
Todesangst im Bundestag
FFF-Demo
Der Abschied von den Grünen
Sahra Wagenknecht
Für meine Kinder
Na, das geht ja gut los
»Manchmal komm’ ich mir hier vor wie im Irrenhaus!« Der junge Mann betritt vor mir eine Treppe im Jakob-Kaiser-Haus, also dem Gebäude, in dem ein Großteil der Abgeordnetenbüros des Bundestages untergebracht ist. Er hat eine tiefe Stimme und ein junges Gesicht und ist 1986 geboren. Ich folge ihm, denn ab heute bin ich sein Weltrettungspraktikant.
»Echt – ist es so schlimm?«, frage ich. Zugegeben, das ist kein Satz, den ich von einem Abgeordneten erwartet hätte, vor allem nicht, weil ich ihn erst seit etwa fünfzehn Minuten kenne. »Meinst du jetzt innerhalb deiner eigenen Partei oder im Gespräch mit den anderen Fraktionen?«
»Alter, nein!« Er lacht schallend durch das ganze Treppenhaus. »Wobei auch das manchmal vorkommt. Mir geht es eher um die Architektur – schau doch mal …« Er zeigt auf die Stahlgeländer, hinter denen auf allen Etagen rechts und links die Bürotüren liegen. Von der Treppe aus können wir sie gut einsehen. »Stell dir einfach vor, in jeder Tür wär so ein kleines Schiebefensterchen …«
»… und dann kommen die Wärter«, setze ich seinen Satz nickend fort, »und bringen das Essen!«
»Exakt, kluger Praktikant!« Er lacht wieder, zieht eine Augenbraue hoch und zeigt auf ein Poster mit einer blauweißen bayerischen Fahne, das im fünften Stock an einer Bürotür hängt.
»CSU?«, frage ich ihn, doch er schüttelt den Kopf und zeigt auf das Türschild, auf dem drei ganz andere Buchstaben stehen. Mein Lächeln fällt mir aus dem Gesicht. »Ach du Sch…«
»Sch!«, unterbricht er mich und zeigt dezent auf einen hageren, jungen Mann mit grauem Anzug und blondem Seitenscheitel, der gerade aus einem gläsernen Fahrstuhl steigt und uns entgegenkommt.
Und weil der Typ höchstwahrscheinlich zu der Partei gehört, deren Einzug in den Bundestag mich unter anderem zu der Erkenntnis gebracht hat, diese Welt müsse vor ihm und seinesgleichen gerettet werden, senke ich lieber meinen finsteren Blick und beiße mir auf die Unterlippe, als wir an ihm vorbeigehen. Er hingegen nickt uns zu.
»Hey!«, sagt er im Vorbeigehen – und bleibt dann stehen. »Philipp Möller?« Er lächelt mich aus blauen Augen an und streckt mir seine Hand entgegen. »Wir haben uns ja ewig nicht gesehen.«
Fuck. Woher kenne ich den Kerl doch gleich? Doch nicht etwa privat? Und was soll jetzt mein vorübergehender Vorgesetzter von mir denken?!
»J … Ja.« Mehr fällt mir erst mal nicht ein. »Der bin ich.«
»Wir kennen uns doch«, sagt er freundlich und schaut dann meinen Begleiter an. »Ich bin Felix Thiessen von der AfD, hallo.«
»Ich bin Lukas«, sagt mein vorübergehender Vorgesetzter mit Bariton-Stimme. Auf den Zusatz, dass er hier Abgeordneter ist, verzichtet er genauso wie auf die drei Buchstaben, die seine Zugehörigkeit zu einem der Bundestags-Teams verraten würden. »Ich geh schon mal vor, bis gleich!«
»Äh … Wo muss ich denn genau hin?«
»Ist ganz easy«, sagt Lukas. »Du gehst hier bis zum Fahrstuhl, fährst ins UG, nimmst den Tunnel durchs JKH Nord, und bevor’s zum RTG geht, biegst du zu, PLH …« Er blinzelt. »Frag einfach jemanden oder ruf mich an.«
So kommt es, dass ich ungefähr in meiner siebzehnten Minute als Weltrettungspraktikant allein mit einem AfD-Mann auf dem Flur des Bundestags stehe und ein Pläuschchen halte. Und keinen blassen Schimmer habe, wer er ist.
»Wir sind uns vor zehn Jahren mal begegnet«, erkennt er wohl meine Ratlosigkeit, »damals wollte ich mich auch in Sachen Atheismus engagieren …«
»Aha.« Ich schaue auf den kleinen Schwarzrotgold-Button an seinem Revers und grinse ihn frech an. »Und dann bist du versehentlich rechts abgebogen, ja?«
»So hätte ich das jetzt nicht gesagt …« Er rollt lächelnd mit den Augen. »Ich bin dann zur Jungen Alternative gegangen, und damit war ich nicht mehr so gern gesehen in euren Kreisen.«
»Ach, du warst das!« Jetzt erinnere mich an ihn. Wollte bei unserer saugeilen Buskampagne mitmachen, der Typ, weil er sich so über den Islam aufgeregt hat. Ich hatte aber schon damals den Eindruck, es gehe ihm nicht nur um die Ideologie des Islam, sondern auch um Muslime – was den gravierenden Unterschied ausmacht. Daher war ich ganz froh, dass er auf einmal von meiner Bildfläche verschwunden war. »Aber dir ist schon klar, warum du damit bei uns nicht mehr gern gesehen warst, oder?«
»Ja. Na ja.« Er schaut nach oben und nickt langsam. »Aber sag mal: Was machst du denn hier im Bundestag?«
»Ach du, das ist eine lange Geschichte.«
»Für lange Geschichten ist im Bundestag keine Zeit«, sagt er grinsend.
»Na gut: Ich habe meiner achtjährigen Tochter versprochen, die Welt zu retten.«
»Die Welt retten?« Er lacht laut, was ich bei allen anderen ja auch provozieren will, bei ihm und seinen Kollegen aber irgendwie gar nicht witzig finde. »Wovor denn genau?«
»Wovor genau?« Ich raufe mir die Haare. »Klimawandel, massive Jobverluste durch Digitalisierung, Vertrauensverlust in die Demokratie, Lobbyismus, soziale Spaltung, explodierende Mieten, Rechtsnationa…« Ich stocke. »Also …«
»Schon klar.« Er zieht eine Augenbraue hoch. »Wir werden natürlich als Bedrohung wahrgenommen.«
»Wahrgenommen?« Jetzt muss ich lachen. »Was sagte eurer Chefpopulist doch gleich am Wahlabend: Wir werden sie jagen?!«
»Ach komm!« Felix schüttelt den Kopf. »Das war politisch gemeint.«
»Schon klar.« Jetzt ziehe ich eine Augenbraue hoch, und an der Stelle merken wir wohl beide, dass diese Debatte zwischen Tür und Angel wenig Sinn ergibt.
»Und wie willst du hier die Welt retten?«, fragt er.
»Erst einmal will ich herausfinden, welche Parteien sich daran beteiligen«, beginne ich, woraufhin Felix nickt.
»Wir auf jeden Fall«, sagt er mit fester Stimme. »Das wissen die anderen nur nicht.«
Stille.
»Ich hab mir jedenfalls das Ziel gesetzt«, fahre ich fort, »eine Rede vorm Bundestag zu halten!«
»Aha.« Er lacht wieder. »Also wenn ich das mal zusammenfassen darf: Du versprichst deiner Tochter, die Welt zu retten, heuerst hier als Praktikant an …«
»Als Weltrettungspraktikant, bitte sehr – so viel Zeit muss sein!«
»Okay, sorry. Und dann willst du eine Rede vor dem Plenum halten und damit die Welt retten?«
»… und am Ende noch ein Buch darüber schreiben, genau.« So gesagt klingt es natürlich vollkommen unrealistisch, aber das werde ich gegenüber jemandem von der AfD ganz sicher nicht zugeben – schon aus Prinzip nicht! »Genau so werde ich das machen.«
»Klingt spannend«, sagt er. »Und warst du schon bei jemandem von uns?«
»Nee.«
»Haste aber sicher vor, oder?«
»Klar!« Meine Nase juckt. »Voll gerne!«
»Na dann …« Er greift in die Innentasche und zückt sein Kärtchen. »Meld dich gern bei mir! Für Weltrettungspraktikanten haben wir immer Platz – und zu verbergen haben wir bei der AfD schließlich auch nichts.« Dann streckt er mir wieder seine Hand entgegen.
»Abgemacht!« Ich schlage ein. »Demnächst komme ich zum Kaffee rum, und dann schauen wir nach einem Termin, ja?«
»Gerne – aber nur wenn du mir dann erzählst«, sagt er winkend, »wie du auf diese verrückte Idee gekommen bist.«
Ich drehe mich um und gehe mit gerunzelter Stirn weiter. Habe ich mich da gerade wirklich mit der AfD verabredet, heilige Scheiße?! Und von welcher verrückten Idee spricht der Kerl eigentlich – etwa von der Weltrettung?
Was soll denn daran verrückt sein? Ich dachte, genau darum geht es hier, und daher wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wie ich meine Lebenszeit besser verbringen könnte. Wie kann ich denn schließlich als junger Vater, als Vollblutdemokrat und bekennender Friedens- und Freiheitsfanatiker tatenlos dabei zusehen, wie das System, in dem wir weltweit leben, mit zunehmender Geschwindigkeit auf den Abgrund zurast? Weil wir Menschen uns wie nimmersatte Raupen durch den Planeten fressen, haben wir den Klimawandel auf ein nie dagewesenes Tempo beschleunigt, haben das Artensterben mit unserem Raubbau an der Natur auf ein trauriges Rekordmaß gebracht und sehen mit einem Schulterzucken dabei zu, wie Naturkatastrophen immer mehr Opfer fordern? Armut, Hunger und Pandemien breiten sich aus, und zusätzlich sorgen Krieg und religiöser Terror für humanitäre Krisen und ganze Völkerwanderungen. Doch auch das luxuriöse System des Westens, in dem wir Klospülungen mit Trinkwasser bedienen, ist so ausgehöhlt, dass nur noch seine Fassaden stehen, wie der Philosoph Philipp Blom[1] bemerkt. Längst hat das katastrophal schlechte Migrationsmanagement unserer Regierung die tatsächlichen Herausforderungen schöngeredet und damit das Einfallstor für die Rechtsnationalisten geöffnet. Seit langem hat der moralbefreite Immobilienmarkt die Wohnungspreise auf ein perverses Niveau geschraubt und lässt einen Großteil der Gesellschaft abstürzen. Rentenkassen werden geplündert, soziale Sicherungssysteme marodieren langsam, aber sicher, und Kommunen, Städte und ganze Länder sind so heillos überschuldet, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann sie vor dem Kapitalismus kapitulieren. Und nicht zuletzt hat unser Bildungssystem seinen Namen kaum noch verdient. Das musste nicht nur ich am eigenen Leib erfahren, sondern inzwischen auch meine Tochter, die exakt jene Schule besuchen muss, über die ich mein erstes Buch[2] geschrieben habe, weil wir keine bezahlbare Wohnung mehr in einem anderen Einzugsgebiet gefunden haben. Das ist also die globale Situation am Ende des zweiten Jahrzehnts des dritten Jahrtausends:
Die Raffgier der westlichen Welt verursacht die Armut der restlichen Welt, und es bedarf erst des Muts einer schwedischen Teenagerin Namens Greta Thunberg, diese unangenehme Wahrheit auszusprechen. Ich finde, in dieser Situation kann man schon mal die Welt retten wollen.
Dennoch ist meine Geschichte bis in den Bundestag natürlich ein bisschen komplizierter …
Wie alles begann
Sie beginnt mehr als ein Jahr vor meinem Flur-Schwätzchen mit dem AfD-Mitglied, und zwar mit einer Szene, die im Leben eines jungen Vaters eigentlich ganz normal sein könnte:
Dieser junger Vater – das bin ich – steht mit seiner Frau Sarah, seiner sechsjährigen Tochter Klara an der Hand und seinem dreijährigen Sohn Anton auf den Schultern an einer roten Fußgängerampel. Zwei Meter vor ihnen brettern Autos vorbei, Fahrradfahrer brüllen Autofahrer an, Autofahrer hupen und brüllen zurück, es stinkt. Alles ganz normal also – wäre da nicht die Tatsache, dass es sich bei der Kreuzung, an der wir stehen, nicht um irgendeine Kreuzung handelt, sondern um einen von Berlins knackigsten Unfallschwerpunkten mit zwei Autospuren, einer Busspur und einem Fahrradweg in alle vier Richtungen, dazu Autobahnauf- und -abfahrten, die S-Bahn über uns, die Autobahn unter uns, ein Supermarkt mit Open-Air-Kneipe davor, mehrere Bushaltestellen, ein kombinierter Ampel- und Geschwindigkeitsblitzer, umgefahrene Laternen mit Scheinwerfersplittern und diesem weißen Pulver davor, dazu die Ein- und Ausgänge der Bahnhöfe sowie Taxistände und Park-and-Ride-Stellplätze … Willkommen im urbanen Verkehrsparadies, Feinstaub, Stickoxid und totem Winkel inklusive, was vor allem jetzt, an diesem eigentlich sehr schönen Morgen im September, bedeutet: Car Wars in der Rushhour.
»Papa?«
Klara hält meine Hand und blinzelt mich von unten gegen die Morgensonne an. Ihre braunen Augen sind groß, ihr Stupsnäschen klein und ihr dunkelblondes Haar zu zwei Zöpfen geflochten. Sie ist für ihr Alter eher groß und trägt heute nicht nur ein Kleid, das ihre Oma selbst genäht hat, sondern auch eine Schultüte, die Sarah und ich heute Nacht noch gebastelt haben.
»Was denn, meine Süße?«
»Darf ich später eigentlich auch alleine zur Schule gehen?«
»Na ja«, sagt Sarah. »Irgendwann vielleicht mal …«
Wir beobachten die Autos, Busse, Fahrräder, Lastwagen und Transporter, die sich vor uns entlangschlängeln. Nach der Ampel passieren wir einen riesigen LIDL-Markt, dann eine Shisha-Bar, ein Sportwettbüro und einen Spätkauf, die offenbar alle zusammengehören, und laufen dann am Bezirksrathaus vorbei. Auf dessen Vorplatz tummeln sich unzählige Menschen in abgetragener Kleidung; ihre Kinder sitzen in alten Buggys, die größeren spielen fröhlich miteinander, wohingegen im Gesicht der Eltern wenig Fröhlichkeit zu sehen ist. Kein Wunder, denn wenige Monate nach dem historischen Spätsommer 2015 wurde das gesamte Rathaus zu einer Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert.
»Schon krass«, sagt Sarah leise, »was die alles erlebt haben müssen – furchtbar.«
»Tja, die Welt wird immer ungemütlicher, und Deutschland ist eben ein Teil davon.« Ich seufze. »Bin mal gespannt mit wie viel Prozent die AfD in zwei Wochen in den Bundestag einziehen wird …«
Und dann kommt etwas, das fühlt sich wirklich komisch an.
Kinder, wie die Zeit vergeht
»Papa, warst du wirklich mal Lehrer hier?«
»Ja, Süße.«
Ich seufze wieder, und als Sarah mich ebenso traurig anschaut, geht mir noch einmal durch den Kopf, wie es dazu kommen konnte, dass wir unsere Tochter heute tatsächlich auf exakt jener Schule einschulen müssen, die ich vor über fünf Jahren in meinem ersten Buch beschrieben habe. Denn als wir unsere heutige Wohnung damals mit viel Glück bekommen haben, war die Freude natürlich groß: drei Zimmer, 110 Quadratmeter Stuckaltbau mit Südbalkon und Wannenbad für 700 Euro Warmmiete – das klingt heute wie ein Märchen. Dass die Wohnung im Einzugsgebiet dieser Katastrophenschule liegt, war uns damals natürlich egal, denn auch als unsere zuckersüße Klara das Licht der Welt erblickte, wussten wir ja, dass wir noch sechs Jahre Zeit haben, eine neue Wohnung zu finden. Vielleicht hätten wir wissen müssen, dass der Berliner Immobilienmarkt so explodiert; dass wir es in fast drei Jahren Wohnungssuche nicht geschafft haben, in die Nähe einer besseren Schule zu ziehen; und dass intakte Schulen in unserer Gegend so restlos überlaufen sind, dass uns einfach nichts anderes übrigblieb. Tja, Berlin wollte ja immer Weltstadt werden – jetzt haben wir den Salat.
»Aber, Papa?« Klara schaut sich auf dem Hof um, auf dem sich die Eltern ihrer neuen Schulkameraden jetzt sammeln. Viele mit Kopftüchern und Kinderwagen, andere mit großflächigen Tattoos, getönten Haaren und E-Zigaretten, und eine Familie hat ihren gar nicht mal so putzigen Maulkorb-Köter mitgebracht. »Hier ist es irgendwie hässlich, finde ich.«
»Aber immerhin kommt deine beste Freundin in deine Klasse«, versucht Sarah sie aufzumuntern.
»Stimmt.« Klara zuckt mit einer Schulter. »Ich freu mich ja auch. Irgendwie.«
Okay, das fühlt sich nicht komisch an, sondern einfach nur scheiße. Denn beim Anblick des Schulhofs erinnere ich mich an die Zeilen, die ich damals ins Nachwort meines ersten Buchs geschrieben habe: »Ich stelle mir vor, wie das kleine Wesen, um das sich Sarah und ich mehrere Jahre sorgsam gekümmert haben, in sechs Jahren durch die schmutzigen Hallen eines trostlosen Schulgebäudes läuft. Wie es versiffte Toiletten benutzen muss, von frustrierten und ausgebrannten Lehrern unterrichtet und von dissozialen Mitschülern beschimpft und geschlagen wird … Alles, denke ich mir, alles nur, damit mein Kind nicht einer solchen Welt ausgesetzt ist, mit der ich mich hier täglich herumschlage.«[1]
Aber alles hat nicht funktioniert. Der Wohnungsmarkt ist inzwischen geisteskrank, und die einzige Schule im Kiez, die einen alternativen Platz für Klara gehabt hätte, gilt als noch schlimmer. Das schöne Schöneberg hingegen, wo eine Wohnung wie unsere heute mehr als das doppelte kostet, ist nicht weit. Dort sind unsere Freunde, unsere Lieblingscafés, Spielplätze, Restaurants und nette Bars. Und weil ich von damals außerdem noch den Schulleiter und die Kollegen kenne – so reden wir uns das zumindest schön –, besteht hier noch eine gewisse Chance, dass Klara nicht vollends unter die Räder gelangt, die sich hier munter drehen – zumindest, bis wir endlich eine andere Wohnung gefunden haben.
»Ich komme mir richtig schlecht vor«, sagt Sarah, als Klara ihre Freundin entdeckt hat und sich mit ihr über ihre Schultüte unterhält.
»Wobei?« Wir schauen gemeinsam über den Schulhof.
»Ich fühle mich schlecht dabei, mich beim Anblick der Klientel schlecht zu fühlen.«
»Da bist du nicht die Einzige«, beruhige ich sie. »Das will natürlich niemand zugeben, aber über Multikulti lesen die meisten doch lieber in der Zeitung als im Klassenbuch ihrer Kinder.«
»Vielleicht schauen wir ja doch mal am Stadtrand nach einer Wohnung …«
»Jetzt machen wir erst mal gute Miene zum bösen Spiel, okay?« Ich winke meinen Eltern, die natürlich auch zur Einschulung gekommen sind. »Immerhin ist das ein wichtiger Tag in Klaras Leben.«
Alle schlechten Dinge sind 12,6
»Papa, Papa, Papa!« Als ich am Freitag der ersten Schulwoche im Hort ankomme, hüpft Klara mir freudestrahlend in den Arm. »Ich hab ganz viel Skippo gespielt heute.«
»Toll!« Mein Blick schweift durch den riesigen Raum, in dem alle Kinder durcheinanderplappern, die meisten allerdings eher schreien. Dann nutze ich meinen patentierten Flugzeugtrick: Bei beunruhigenden Turbulenzen schaue ich immer die Stewardessen an. Sind sie entspannt, bin ich es auch. Da wir wegen des Klimawandels kaum noch fliegen, ist das eigentlich egal – aber hier funktioniert der Trick auch, wobei die Erzieher eher nach Absturz aussehen. Und dabei hatte mein alter Chef mir bei der Anmeldung noch vorgeschwärmt, was sich hier alles verbessert habe … Da war wohl der Wunsch Vater des Gedanken. »Und wie war’s im Unterricht?«, frage ich Klara.
»Gut.« Sie spitzt die Lippen. »Aber Frau Kleine hat ganz schön viel geschimpft.«
»Mit dir?«
»Nee, mit den Jungs.« Sie fängt an zu zappeln und hüpft von meinem Arm. »Können wir jetzt endlich gehen?!«
In der zweiten Woche bin ich wiederum total zappelig, denn die Bundestagswahl steht uns am Sonntag bevor, und die AfD liegt in den Prognosen bei unfassbaren zwölf Prozent[1] – womit sie bei Fortsetzung der GroKo die stärkste Oppositionspartei im Bundestag wäre. Und wenn der Aufwärtstrend dieser Partei so weitergeht … wenn die nächste Flüchtlingswelle kommt … wenn erst die Klimaflüchtlinge kommen, die das Milliönchen von 2015 locker in den Schatten stellen werden … und wenn die etablierten Parteien weiterhin so sträflich schlechte Politik machen, dann … Das Einzige, was mir in dieser Situation noch hilft, ist ausblenden – aber das wird nicht mehr lange funktionieren.
Klara ist eher still, als ich sie morgens zur Schule bringe.
»Freust du dich auf die Schule?«
»Joa.« Sie schaut auf den Boden und schießt ein Steinchen vor sich her. »Ich freu mich auf Vicki.«
»Wie sind denn die anderen Kinder in deiner Klasse?«
»Nett. Also die meisten. Manche. Manche Mädchen sind nett.« Sie schaut mich kurz an. »Aber die reden immer so komisch. Und die Jungs sind gemein. Und immer laut. Immer.«
Klaras zweite Schulwoche vergeht ohne weitere Vorkommnisse – was sich für die politische Landschaft unseres Landes nicht sagen lässt: Die Straßen sind mit Wahlplakaten gepflastert, die Zeitungen online und offline von Wahlprognosen überschwemmt, und nach dem politischen Flirt zwischen Angela Merkel und dem gehypten Martin Schulz, das der Öffentlichkeit als TV-Duell verkauft wurde, sitzen Sarah und ich am Sonntagabend mit steinerner Miene vorm Fernseher und verfolgen die Hochrechnungen.
»Das gibt’s doch alles gar nicht«, raune ich beim Anblick des wachsenden blauen Balkens. »Das ist ja der absolute Albtraum!«
Als das vorläufige amtliche Ergebnis bekanntgegeben wird, gefriert mir das Blut in den Adern: Meine ehemalige Lieblingspartei stürzt von zuletzt 25 auf 20 Prozent ab – das Ende ist Nahles! Die Union der Kanzlerin verliert – dank Flüchtlings- und Demokratiekrise – sogar fast neun Prozentpunkte, bekommt aber immerhin noch ein Drittel aller Sitze im Bundestag. Linke und Grüne bleiben unverändert bei knapp zehn Prozent – da waren meine Stimmen diesmal doch gut angelegt – und die FDP zieht nach vier Jahren außerparlamentarischer Opposition wieder in den Bundestag ein, was mir allerdings mit Hochgeschwindigkeit am politischen Hintern vorbeigeht. Nur beim letzten Ergebnis schnürt sich mir die Kehle zu: Noch nicht einmal drei Generationen sind seit Hitler vergangen, und heute setzen unfassbare 12,6 Prozent, also fast sechs Millionen Menschen, ihr Kreuz bei der AfD! Aber das ist eben die grausame globalpolitische Wahrheit des frühen 21. Jahrhunderts: Ein herrschsüchtiger Irrer regiert die USA, ein herrschsüchtiger Patriarch Russland und ein herrschsüchtiger Despot die Türkei. Die Karikatur eines Diktators hat Nordkorea in der Hand, was in Afrika politisch los ist, will ich gar nicht wissen, die arabische Welt ist ohnehin im Würgegriff der Gotteskrieger, der Iran mit seinem Mullah-Regime allen voran. In China stecken 1,5 Milliarden Menschen in einer kommunistischen Diktatur und bauen ein Kohlekraftwerk nach dem anderen, noch einmal 1,3 Milliarden Inder … ach, keine Ahnung, was in Indien abgeht, aber der Hinduismus und das immer noch in der Gesellschaft bestehende Kastendenken ist doch auch komplett balla-balla. In Südamerika regiert das Koks, Europa kippt nach rechts, und jetzt sitzt auch noch die braune Gefahr im deutschen Parlament. Und angesichts der Entwicklung dieser Welt wird eine Frage immer lauter: Wie werden meine Kinder wohl mal leben – und wie meine Enkel?
Als die Wahlergebnisse nahezu sicher sind, schaltet die ARD in die Parteizentralen, wo weitgehend lange Gesichter zu sehen sind – nicht so bei der AfD, dort herrscht Pogromstimmung, und drei Personen stehen vor der jubelnden Menge: ein Mann in einem dunklen Anzug und mit einem falschen Lächeln, eine Frau mit Kurzhaarfrisur, die aussieht, als hätte sie in ihrem Leben noch nicht ein einziges Mal gelächelt, und am Mikrophon steht ein Typ, der ein Tweetjackett trägt und eine Krawatte, auf der Jagdhunde abgebildet sind. So wie ihn stelle ich mir den bösartigen Nachbar vor, der Kindern Backpfeifen für Klingelstreiche gibt, seinen alten Opel mit Lenkradfell besser pflegt als sich selbst und umgehend das Ordnungsamt ruft, wenn jemand vor seiner Einfahrt parkt.
»Widerliche Typen«, sage ich zu Sarah.
»Da wir ja nun offensichtlich drittstärkste Kraft sind«, sagt der böse Nachbar jetzt mit kratziger Stimme, »kann sich die Bundesregierung warm anziehen.« Und als die Menge anfängt zu jubeln, ruft er ins Mikrophon: »Wir werden sie jagen!« Ich erstarre. Hat er das jetzt wirklich gesagt?! »Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen«, wiederholt er nun, »und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen!«[2]
»Mach bloß aus, die Scheiße!«, sage ich zu Sarah, gehe Zähne putzen und verkrieche mich unter meiner Decke. Es ist so weit: Die Nazis sind wieder da! Erst als Pegida auf den Straßen, dann als AfD in den Landtagen, und jetzt auch im Bundestag. Mit pochendem Herzen liege ich im Bett und entdecke ein Buch des Philosophen Philipp Blom auf meinem Nachttisch, vor dem ich mich bisher gedrückt habe: Was auf dem Spiel steht,[3] heißt es, und netterweise hat der Verlag schon aufs Cover geschrieben, worum es geht: Klima, Demokratie, Freiheit, Menschenrechte, Arbeit, Wohlstand, Toleranz.
»Wir leben in Gesellschaften, in denen die Zukunft keine Verheißung mehr ist, sondern eine Bedrohung«, steht im Einband, »Kein Planet B« ist die Überschrift des Vorworts, und schon im ersten Teil haut der Philosoph seinen Leserinnen und Lesern um die Ohren, was meiner Generation mit viel Glück vielleicht noch erspart bleibt, aber spätestens Klara und Anton erwartet: »Millionenfache Migration, Klimawandel, kollabierende Sozialsysteme, explodierende Kosten, Bomben in Nachtklubs, Umweltgifte, ausbleichende Korallenriffe, massenhaftes Artensterben, versagende Antibiotika, Überbevölkerung, Islamisierung, Bürgerkrieg.«[4]
Alter Schalter – endlich erkennt es mal einer und bringt in so wenigen Worten auf den Punkt, was ich schon lange spüre: »Eine vage Panik kursiert in unseren Adern«, und mit jeder der folgenden Zeilen spüre ich ganz genau, dass er recht hat: »Kaum jemand in der reichen Welt glaubt noch ernsthaft, dass es den eigenen Kindern bessergehen wird, dass harte Arbeit belohnt wird, dass Politiker im Interesse ihrer Wähler handeln wollen oder können …«[5] In klaren Worten arbeitet sich Blom an zunehmendem Hunger, an der Abholzung der Regenwälder und dem dramatischsten unserer Probleme ab: dem Klimawandel. Und wenn der Golfstrom aufgrund der Erderwärmung nicht kollabiert, dann tue ich es gleich – so alarmierend sind die Details. Auf den folgenden 200 Seiten zerpflückt Blom die Unsäglichkeiten unserer Zeit, insbesondere den entarteten Konsum, der sich in der Religion des Kapitalismus manifestiert und uns per Digitalisierung und Automatisierung geradezu unweigerlich zu nutzlosem Vieh degradiert. Und weil er mir damit aus dem tiefsten Herzen spricht, verschlinge ich in dieser Wahlnacht das ganze Buch. An Müdigkeit ist nicht zu denken, denn seine Analyse ist so erschreckend präzise, dass ich beim letzten Satz eine Ganzkörpergänsehaut bekomme: »Was auf dem Spiel steht?«, fragt er, und gibt darauf die einzig wahre Antwort: »Alles.«[6]
Alles steht auf dem Spiel. Mit diesem Gedanken falle ich in einen traumlosen Schlaf.
Der Super-GAU
»Aber ich will nicht in die Schule!«, brüllt Klara und schmeißt am nächsten Morgen heulend ihren Ranzen in die Ecke. »Da isses immer so laut, und die Klos sind eklig, und die Jungs sind immer so fies und …«
Den Rest verstehe ich nicht mehr, weil sie schluchzend ins Kinderzimmer stampft. Auf dem Schulweg bin ich von ihrer Trauer, aber auch von den Ergebnissen der Bundestagswahl und der grausamen Blom’schen Realität total zermürbt, dazu müde und abwesend, und male mir aus, wie Klara erst reagieren würde, wenn sie wüsste, was noch auf sie zukommt. Die Unfallschwerpunktkreuzung, die Shisha-Bar und das Flüchtlingsrathaus ziehen unbemerkt an mir vorbei, denn das Schlimmste an allem, was Blom beschrieben hat, ist ja: Die gigantischen Probleme, die auf die Generation meiner Kinder warten, müssten doch eigentlich von meiner Generation gelöst werden. Aber was sollen wir von diesem Politikstil denn noch erwarten? Von einem GroKo-Mikado – wer zuerst etwas bewegt, hat verloren – und von einer Regierung, die es nicht einmal schafft, die Diesel-Mafia zu zerschlagen? Ich könnte kotzen, und ausgerechnet heute habe ich um elf Uhr einen Termin, für den ich bis zum Tipi am Kanzleramt fahren muss. Dort findet nämlich die Vorbesprechung für eine Satire-Show statt, in der ich mein aktuelles Buch vorstellen soll.
»Papa?«, nölt Klara, als wir die Schule betreten. »Ich hab Bauchschmerzen.«
»Möchtest du etwas trinken?«
»Nein!« Sie stampft mit dem Fuß auf, woraufhin ich einmal tief durchatme. »Ich will auf deinen Arm!«
»Na gut.« Ich hebe sie hoch und drücke sie. »Aber dann muss ich auch los.«
»Nein, Papa – bitte!« Sie klammert sich an mir fest. »Bringst du mich noch in die Klasse?«
Ich schaue in ihre großen Augen und seufze.
Nach einem Gang durch das ranzige Gebäude erreichen wir die Klasse, wo die Lehrerin schon mit gerunzelter Stirn am Tisch sitzt und aus dem Fenster starrt – Stewardess-Test: durchgefallen. Als ich Klara verabschieden will, klammert sie sich heulend an mich, und als die Lehrerin mich leicht genervt anschaut, mache ich die harte Tour, reiße mich von ihr los und gehe einfach. Ihre weinenden Papa-Rufe verfolgen mich bis ins Erdgeschoss.
Auf der Straße angekommen, atme ich so lange tief durch, bis der Kloß in meinem Hals und die Tränen in meinen Augen verschwunden sind. Das wäre an der Schule im Nachbarbezirk wohl kaum passiert – aber die Wohnung, die wir uns dort zwei Wochen vor der Einschulung angeschaut haben, hätte knapp 1700 Euro Warmmiete gekostet.
Zerknirscht setze ich mich in die S-Bahn und steige am Brandenburger Tor aus. Tausend Touris, die sicherlich alle mit CO2-Bombern eingeflogen sind, tummeln sich auf dem Pariser Platz, grinsen für den Selfie-Stick und trinken Kaffee aus Einwegbechern. Nach ein paar Metern durchschreite ich die ehemalige Grenze zwischen der westlichen Welt, die heute von dem orangen Freak regiert wird, und der östlichen, die in den Händen eines Zaren ist, der sich gern oben ohne auf einem Pferd ablichten und von orthodoxen Hasspredigern beraten lässt. Auf dem Weg Richtung Kanzleramt laufe ich über den Platz der Republik, wo ein Mann auf einer Bierkiste steht und eine Rede schwingt – als würde es auch nur das kleinste bisschen an dieser verkorksten Welt ändern. Die wirklich wichtigen Entscheidungen werden doch nicht hier draußen getroffen – sondern einzig und allein da drinnen. Ich bleibe einen Moment stehen und lasse den Bundestag auf mich wirken. Wie eine Festung steht er hier vor mir, uneinnehmbar, unverwüstlich. Ob die da drinnen eigentlich auch mal Bücher lesen? Ist denen eigentlich klar, in welches Debakel dieses System die globale Gesellschaft gerade führt? Oder denken die, hier draußen sei Friede, Freude, Eierkuchen?
Mein Telefon klingelt, ich kenne die Nummer auf dem Display nicht.
»Hallo?«
»Ist da Klaras Vater?«, fragt eine Frauenstimme. »Hier ist das Sekretariat ihrer Schule.«
»Ja.« Ich halte mir das andere Ohr zu. »Was ist denn los?«
»Sie müssten Klara bitte abholen«, sagt die Frau. »Jetzt gleich.«
»Jetzt gleich?! Aber …« Ich reibe mir die Augen und versuche so verständnisvoll wie möglich zu klingen. »Weint sie immer noch?«
»Nein, ähm …« Die Stimme wird leiser. »Sie hat sich in die Hosen gemacht.«
Wenn’s weiter nichts ist …
Als ich die Tür zum Sekretariat öffne, sitzt Klara wie ein Häufchen Elend auf der Krankenliege, die Beine angezogen, die Nase zwischen ihren Knien, die Augenbrauen schwer gerunzelt. Ihr Kleid steckt in einem zugeknoteten Müllbeutel, der neben ihr liegt, und sie trägt eine alte Jeans und ein T-Shirt.
»Hey!« Ich setze mich neben sie und lege meinen Arm um ihre Schultern, aber sie würdigt mich keines Blickes. »Wie … Was …« Ich seufze. »Komm, wir gehen!«
»Gerne – am liebsten für immer!«
»Jetzt erzähl doch mal«, sage ich auf dem Flur, »wie das passieren konnte.«
Wortlos greift sie nach meiner Hand, führt mich zu den Toiletten in der Nähe ihres Klassenraums und öffnet die Tür für mich.
»Aber, ich darf …«
»Doch!«
Ich schaue mich prüfend um, gehe einen Schritt durch die Tür und sofort rückwärts wieder raus, so stechend ist der Geruch, der mir entgegenschlägt.
»Ach du Sch…«
»Geh ruhig rein«, sagt sie mit verschränkten Armen, also ziehe ich mein Shirt über die Nase und gehe hinein. »Würdest du da raufgehen?«, ruft sie von draußen.
Kaputte Fliesen, lose Trennwände, keine Klobrillen, kein Toilettenpapier, dafür aber Bremsspuren im Abgang.
»So sehen hier alle Toiletten aus, Papa!« Sie verschränkt die Arme. »Und jetzt will ich nach Hause.«
»Ich habe eine bessere Idee«, sage ich zwinkernd. »Komm mal mit!«
Etwa hundert Meter von der Schule entfernt erreichen wir eine Unterführung. Darin stinkt es auf den ersten Metern genauso wie in den Schulklos, und lieblose Graffiti zieren die Betonwände. Ab der Hälfte des Tunnels sind die Wände jedoch gefliest, und der Gestank weicht dem Geruch des Blumenladens, dessen Verkäuferin uns freundlich anschaut – und dann tauchen wir im schönen Schöneberg wieder auf: Herrschaftliche Altbauen, allesamt saniert, säumen hier den breiten Gehweg mit historischen Gaslaternen und Straßenschildern. Eine Frau mit Hut und Dalmatiner kommt uns entgegen, dann betreten wir ein Café.
Zwei antike Sessel stehen dort auf einem Teppich vor einem Bücherregal, dazu ein kleiner Tisch mit der handgeschriebenen Kuchenkarte. Wir nehmen Platz, und als die Kellnerin kommt, sehe ich Klara heute zum ersten Mal lächeln.
»Kakao für dich, Kaffee für Sie?«, fragt sie direkt. »Und zwei Stück frisch gebackenen Apfelkuchen?«
Wir nicken synchron, und als ich Klara so anschaue, wie sie in fremden Jeans in dem großen Sessel sitzt, da macht sich eine traurige Erkenntnis in mir breit: Ich habe versagt. Der Immobilienmarkt hat uns abgehängt, und damit auch das Bildungssystem – du hast verkackt, Möller.
»Haben die Toiletten auf deiner Schule früher auch so gestunken?«, fragt Klara.
»Nee«, sage ich und denke an meine beschauliche Stadtrandschule der 1980er Jahre zurück. »Ein bisschen vielleicht, aber nicht so doll.«
»Warum ist das so?«
»Tja, eure Toiletten sind lange nicht repariert worden und werden wohl selten geputzt.«
»Warum?«
»Weil …« Ich schüttele langsam den Kopf. »Ich weiß es nicht.« Lange schaue ich Klara an. »Schon damals, als ich noch Lehrer auf deiner Schule war, sollten die Toiletten repariert werden.«
»Wer hat das gesagt?«
»Die Politiker.«
»Was sind Potilika?«
»Politiker sind Frauen und Männer, die dazu gewählt wurden, sich hier um alles zu kümmern.«
»Die Bestimmer?«
»… und Bestimmerinnen, ja, so ähnlich.«
»Dann musst du mal mit denen schimpfen, Papa!«
»Ich?!« Müde lächelnd nehme ich unsere Getränke und den Kuchen entgegen, von dem wir uns sofort ein Stück gönnen. »Wieso denn ich?«, frage ich mit vollem Mund.
»Dings, kumma«, sagt Klara und schluckt runter. »Wenn ich immer sage, dass ich mein Zimmer aufräume, aber ich mache es nicht – dann schimpfst du doch auch mit mir.«
»Na ja …« Ich nippe am Kaffee.
»Außerdem hast du mal gesagt, du kannst alles.«
»Das hab ich gesagt?!«
»Schon oft, ja.« Sie steckt mich mit ihrem Schmunzeln an. »Also?« Klara legt den Kopf schief.
»Weißt du …« Ich setze mich aufrechter hin. »Wenn ich das machen würde, dann müsste ich ganz schön viel mit denen schimpfen.«
»Wieso?«
»Weil …« Ich schaue einen Moment aus dem Fenster. »Weil es eine Menge Dinge gibt, die eigentlich gemacht werden müssten.«
»Zum Ballspiel?«
»O je, das kann ich gar nicht alles aufzählen.«
»Wieso?« Sie zuckt mit der Schulter und greift nach ihrem Kakao. »Wir hamm doch Zeit.«
»Na gut, also …« Ich räuspere mich – wo fange ich denn jetzt an? »Es gibt leider immer mehr Menschen auf der Welt, die sehr, sehr arm sind.«
»Hundert?« Klara lässt ihre Beine baumeln.
»Viel, viel mehr.«
»Tausendhundert?«
»Noch mehr, aber das Problem ist: Es werden immer mehr, jeden Tag, weil jeden Tag ganz, ganz viele Babys geboren werden, vor allem bei den armen Menschen. Und die haben dann kein Essen und keine Wohnung und keinen Arzt und …«
»Aber warum geben wir denen nichts von uns ab?« Sie schaut auf ihren Kuchen. »Wir haben doch genug, oder?«
»Ja, eigentlich schon.«
Wir schweigen einen Moment lang. Klara schaut aus dem Fenster, an den Nachbartischen werden leise Gespräche geführt.
»Und was ist noch?«, fragt sie nach einer Weile.
»Okay, das wird jetzt ein bisschen komplizierter: Auf der Erde wird es immer wärmer, weißt du?«
»Ist doch schön«, sagt sie lächelnd. »Ich mag den Sommer.«
»Aber nicht, wenn er zu heiß wird. Dann regnet es nicht mehr, und die Leute können kein Gemüse mehr ernten und haben kein Trinkwasser. Der Wind wird doller, und das Meer wird ganz wild und …«
»Warum denn?«
»Weil wir Menschen so viel Auto fahren und Flugzeug fliegen«, erkläre ich ihr, »und weil wir unsere Wohnungen heizen und Strom verbrauchen.«
»Hm.« Sie lehnt sich zurück. »Dann müssen wir halt damit aufhören.«
»Das ist nicht so einfach.«
»Wieso nicht?«
»Na ja, die Menschen haben sich daran gewöhnt. Den Strom brauchen wir ja auch in den Krankenhäusern und Schulen und in den Fabriken und abends fürs Licht. Ohne Heizung frieren wir im Winter, und zu Mamas Eltern oder an die Ostsee fahren wir ja auch mit dem Auto. Wir sind sogar schon mal mit dem Flugzeug geflogen – weißt du noch?«
»Nach Majorka, das war so toll, da will ich noch mal hin!« Klaras Augen leuchten, dann runzelt sie aber schnell wieder die Stirn. »Aber wenn so viele Menschen so arm sind«, überlegt sie, »und es hier immer wärmer wird, dann müssen doch die Bestimmer was dagegen tun, oder?«
»Genau – machen sie aber nicht.«
»Und was passiert dann, wenn es immerimmerimmer wärmer wird und es immerimmerimmer mehr Menschen gibt?«
Na super, Möller – was willst du deiner sechsjährigen Tochter denn jetzt antworten? Naturkatastrophen mit Tausenden Toten? Artensterben? Hunger, Dürre, Pandemien? Krieg um letzte Ressourcen? Gigantische Flüchtlingswellen? Rechtspopulisten, die nach und nach Demokratie und Menschenrechte abbauen?
»Die Welt wird sich sehr ändern«, sage ich leise. »Und besser wird sie dabei nicht.«
»Hm.« Klara starrt auf den Tisch, dann schaut sie mich an. »Weißt du noch, Papa, als ich mal geträumt habe, dass unser Haus brennt?« Sie wartet, bis ich nicke. »Da hast du mich geweckt, weil ich ganz doll geweint habe. Und dann hast du gesagt, dass ich niemals Angst haben muss, weil du mich immer beschützt.«
»Tja, Süße – das würde ich auch gern, aber …«
»Aber?« Sie blinzelt. »Du bist doch mein Papa!«
Klaras Augen sind riesig. Wenn alles gutgeht, dann sehen sie noch die nächste Jahrhundertwende. Und vielleicht ist ja doch noch Zeit, das Ruder herumzureißen. Wenn meine Generation es nur irgendwie schaffen könnte, dieses zerstörerische System zu stoppen, in dem wir leben – vielleicht besteht dann ja noch Hoffnung? Das wird schwer, sehr schwer, aber … wenn alles auf dem Spiel steht, dann müssen wir auch alles geben, oder? Mit voller Kraft. Jetzt. Oder nie.
»Okay!« Ich strecke ihr meine Hand hin. »Von Vater zu Tochter: Ich kümmere mich darum – versprochen!«
Nix zu lachen
»… sagt der Ketzer Philipp Möller, meine Damen und Herren!«, ruft Florian Schröder ins Publikum und hält mein Buch hoch. 500 Handpaare klatschen. »Gottlos Glücklich, warum wir ohne Religion besser dran wären – sicherlich auch ein phantastisches Weihnachtsgeschenk, da freut sich doch die Omi! Danke dir, Philipp!«
»Danke dir – und Ihnen«, rufe ich in den Applaus, verbeuge mich einmal und schlüpfe dann wieder hinter die Bühne.
»Applaus.« Im Dunklen klatscht ein Mann langsam in die Hände, und als meine Pupillen sich geweitet haben, schaue ich in zwei wache Augen. »Würdest du dich das auch bei der AfD trauen?«, will er wissen.
»Was denn?«
»So gnadenlose Kritik zu üben, wie den Kirchen gegenüber.« Der Mann ist zwar eine Ecke älter als ich, hat aber eine jungenhafte, spitzbübische Art. »Wir sprechen uns nach der Show.«
Mit diesen Worten lässt er mich stehen. Gute Frage, die ich momentan ganz ehrlich verneinen müsste. Aber jetzt schaue ich mir erst einmal die restliche Show aus dem Publikum an. Ein paar Comedians später betritt endlich der geheimnisvolle Spötter die Bühne. Albrecht von Lucke heißt er und spricht mit Florian über das so ziemlich einzig relevante politische Thema, dass es gerade gibt: den Umgang mit der AfD, zu dem Florian und er sehr unterschiedliche Standpunkte vertreten. Natürlich müsse man die AfD verarschen können, sagt der Moderator, denn spätestens seit dem islamistisch motivierten Massenmord der Redaktionsmitglieder des Satiremagazins Charlie Hebdo wüsten wir doch alle, was Satire darf: alles.
Das möge ja sein, hält Albrecht von Lucke wortgewaltig dagegen, aber schlau sei das trotzdem nicht, denn die AfD lebe von ihrer Opferrolle, und wenn »das Establishment« sie verarsche, vor allem Vertreter der »Lügenpresse«, die die Freunde der AfD als »Merkel-Schafe« bezeichnen, dann gebe man damit nur Wasser auf ihre Mühlen und verschaffe ihnen im abgehängten Teil der Bevölkerung nur zu mehr Wählerstimmen.[1]
Leicht ernüchtert applaudiert das Publikum den aufgebrachten Politologen von der Bühne und nimmt sehr dankbar den unterhaltenden Abschluss des Abends an: Nico Semsrott, von dem ich weiß, dass er auch spaßpolitisch unterwegs ist – bei DIE PARTEI.
Nach der Show treffe ich Florian in der Garderobe, der mir ein Bier in die Hand drückt und mich auf eine Terrasse führt, die direkt am Fuße des gigantischen Kanzleramts liegt. Lange muss ich meinen Kopf von links nach rechts drehen, um das gesamte, wuchtige Gebäude betrachten zu können. Auch einige der anderen Showgäste gesellen sich zu uns, und so stoßen wir bei herrlich frischer Dezemberluft auf den gelungenen Abend an.
»Aha!«, ertönt plötzlich die Stimme des Politologen. »Hier hat sich die Comedian-Bande also versteckt!« Mit wehendem Mantel und einer gerollten Zeitung in der Hand kommt er lächelnd auf uns zu. »Ihr seid mir ja ein paar tolle Hechte, echt beeindruckend, ehrlich! Hüpft hier über die Bühnen und macht eure Witzchen – doll, wirklich ganz doll!«
»Schön, dass Sie sich amüsiert haben«, kommentiert einer meiner Mitstreiter trocken.
»Darum geht’s doch gar nicht!«, schimpft Lucke in unser Lachen hinein und hebt wieder seine Zeitung. »Habt ihr in den vergangenen Wochen mal in so etwas hier reingeschaut?!« Wir nicken alle brav. »Dann versteh ich ehrlich nicht, wie ihr hier noch so ruhig stehen und eure Späßchen machen könnt!«, sagt er laut. »Es ist nicht die Zeit zum Witzemachen. Da draußen bricht gerade die europäische Sozialdemokratie zusammen, gleichzeitig werden die Rechten immer stärker, die AfD sitzt mit fast hundert Mann im Bundestag – und was macht ihr?« Er breitet die Arme aus. »Hüpft über die Bühnen und macht eure Scherze!«
Dann wendet er sich direkt an mich und stößt mir mit der Zeitungsrolle fast auf den Solarplexus. »Ich hab dich davor gegoogelt, Religionskritik und so weiter, ist ja alles schön und gut.«
»Okay«, sage ich und schlucke, bevor der Politologe, einmal in Fahrt, schon wieder loslegt.
»Aber du verschwendest damit deine Zeit und deine Energie und deinen Grips. Wir haben doch tausend politische Probleme, die viel größer sind als deine Religionskritik: den Rechtspopulismus, die globale Migration, Digitalisierung, Klimawandel, soziale Spaltung und so weiter … und da regst du dich noch immer über die Kirchen auf, die doch ohnehin längst hochgradig säkularisiert sind?!«
»Im Moment regt sich hier eigentlich nur einer auf.« Ich grinse ihn an. »Was sollte ich denn Ihrer Meinung nach machen, Herr von Lucke?«
»Politik!« Er schlägt seine Zeitung in die Hand. »Typen wie du müssen in die Politik! Typen wie ihr: junge, pfiffige Kerle mit Köpfchen und Humor. Aber ihr bespaßt lieber die Bühne und holt euch euren billigen Beifall ab, während da draußen die Rechten das Land erobern. Gleichzeitig verliert die SPD den Boden unter den Füßen, weil der Partei die charismatischen jungen Leute fehlen!«
»Jetzt übertreiben Sie mal nicht so«, schaltet sich der Moderator sanft ein, »so schlimm ist es …«
»Doch, so schlimm ist es! Die Populisten zu unterschätzen ist ein fataler Fehler, das wissen wir doch aus der deutschen Geschichte.« Von Lucke dreht sich langsam im Kreis und schaut uns an. »Ihr seid die junge Generation, energisch, eloquent und frech genug, denen die Stirn zu bieten. Und was macht ihr draus?« Während wir betreten schweigen, deutet er mit seiner Zeitung auf den Bundestag. »Da hinten müsst ihr hin, da spielt die Musik – und nicht in eurem komischen Zirkuszelt!« Er lächelt. »Sorry, nichts für ungut, das musste mal gesagt werden – tschüs, war nett mit euch.«
Wer macht das Spiel?
»Papa muss weg?« Anton schaut mich aus riesigen Augen an, als ich mit meinem Rollköfferchen im Flur stehe. »Papa nich gehn!«, jammert er und klammert sich an mein Bein. Klara schnappt sich das andere, und so stampfe ich mit zwei Kindern am Bein ins Wohnzimmer und lasse mich auf die Couch fallen.
»Ich bin doch morgen schon wieder da«, erkläre ich den beiden und streichle ihre Köpfchen, »und ich bringe euch auch etwas mit.«
»Was steht denn auf dem Programm?«, will Sarah wissen.
»Hab eine Lesung aus Gottlos Glücklich«, sage ich.
»Ist das wieder so ein Abend«, fragt sie zwinkernd, »wo du als Humanist mit Humanisten über Humanismus redest?«
»Sehr witzig!«
»Mal ehrlich – wird dir das nicht langweilig?«
Etwas beleidigt verlasse ich das Haus, was immer ein gutes Zeichen dafür ist, dass Sarah recht hat. Andererseits fuckt mich die ganze Sache mit der AfD so krass ab, dass ich durchaus mal drei Stunden gebrauchen kann, in denen ich einfach nur entspannt aus dem Fenster glotze.
Also: ab in den ICE, Ruheabteil, Tisch, Fensterplatz und Kopfhörer rein – Welt aus, Vivaldi an. Meine Augen fallen zu, und schon die ersten Takte seines Violinkonzerts in a-Moll sind über die schreckliche Verzahnung aller Probleme dieser Welt dermaßen erhaben, dass ich mich zurücklehnen und in Erinnerungen schwelgen kann. In Erinnerungen an eine Zeit, in der die Welt noch in Ordnung war – oder ich von all den Grausamkeiten einfach noch nichts wusste. An die Zeit, in der ich neben meinem Vater auf dem Klavierhocker saß und meine Beine baumeln lassen konnte, während er Sonaten übte und ich noch keinen blassen Schimmer davon hatte, dass insbesondere der Lebensstil unserer wohlhabenden westlichen Welt, mit Autos und Ölheizungen und Wiener Würstchen, maßgeblich zum Leid der restlichen Welt beiträgt. In der ich nicht ahnen konnte, dass ich mal Vater eines Kindes sein werde, das eine Brennpunktschule besuchen muss, weil geldgeile Immobilienspekulanten meine Heimatstadt im Würgegriff haben. Und vor allem eine Zeit, in der ich nicht wissen konnte, dass wenige Tage nach ihrer Einschulung eine verfassungsfeindliche Partei in den Bundestag einziehen wird, die beste Kontakte in die rechte und ultrarechte Szene pflegt … Verdammt nochmal – wie konnte das nur passieren?!