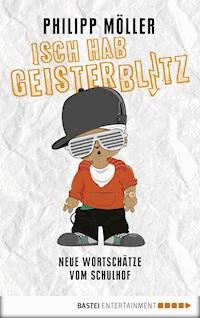9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Philipp Möllers Geschichten rund um das deutsche Bildungschaos und die deutsche Alltagskultur sind brisant und immer wieder urkomisch.
Isch geh Schulhof.
Heute ist Klassenausflug. Bowlen - damit die Kinder sich endlich mal so richtig austoben können. Als ich den Klassenraum betrete, stürmen die ersten schon auf mich zu.
"Herr Mülla, iebergeil!", ruft Ümit. "Isch mache Strike, ja? Schwöre, schmache eine Strike!" Mit wilden Bowling-Trockenübungen steht er vor mir. Wenn er nachher tatsächlich so bowlt, nehme ich mir besser einen Helm mit-
Aushilfslehrer? Ein lockerer Job, denkt Philipp Möller - bis zur ersten Stunde in seiner neuen Klasse: Musikstunden erinnern an DSDS, hyperaktive Kids flippen ohne ihre Tabletten aus und zum Frühstück gibt es Fastfood vom Vortag. Aber sind wir Erwachsenen so viel besser?
Bin isch Freak oda was?!
Die Schulglocke klingelt, das Hoftor fällt hinter mir zu. Meine Tage als Aushilfspauker sind vorbei. Und jetzt?
"Bin ich froh, diese Freak-Show endlich hinter mir zu haben", sage ich so lässig wie möglich. Mein Kollege Geierchen runzelt die Stirn: "Pass ma uff: Schule is 'ne Miniaturlandschaft unserer Jesellschaft. Und wenn de denkst, Möller, die Minifreaks war'n schon crazy - denn schau dir erstma die ausgewachsenen Exemplare an".
Leben wir tatsächlich in einer Nation der Übertreiber, Spinner und Durchgeknallten? Philipp Möller trifft trinkfreudige Burschenschaftler, kampflustige Veganer und erleuchtete Weltenlehrer und stellt sich immer häufiger die Frage: Wer sind eigentlich die wahren Freaks in unserem Land?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 790
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum
BASTEI ENTERTAINMENT Digitale Originalausgabe Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG Für die Originalausgaben: Copyright © 2012 ("Isch geh Schulhof") und Copyright © 2014 ("Bin isch Freak, oda was?!") by Bastei Lübbe AG, Köln Dieses Werk wurde vermittelt durch die Maria Hilft Agentur, Köln Für diese Ausgabe: Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln Projektmanagement: Christina Bleser Covergestaltung: Maria Seidel, Atelier Seidel Verlagsgrafik ISBN 978-3-7325-3789-1 www.bastei-entertainment.de www.lesejury.dePhilipp Möller
Isch geh Schulhof / Bin isch Freak, oda was?!
Über den Autor
Philipp Möller, Jahrgang 1980, ist Diplom-Pädagoge und lebt als freier Autor in seiner Heimatstadt Berlin. Nach dem Studium der Erwachsenenbildung wagte er den Quereinstieg als Lehrer und unterrichtete zwei Jahre lang an Berliner Grundschulen. Als Pressereferent der Giordano Bruno Stiftung engagiert er sich für Humanismus und Aufklärung. Seit Kurzem stellt er seine pädagogischen Fähigkeiten auch als Vater unter Beweis.
Philipp Möller
Isch gehSchulhof
Unerhörtes aus dem Alltageines Grundschullehrers
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Das vorliegende Buch beruht auf Tatsachen.
Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte wurden
Namen und Details verändert.
Copyright © 2012/2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Lisa Bitzer, Landau
Titelbild: © missbehavior.de
Umschlaggestaltung: Pauline Schimmelpenninck
Büro für Gestaltung, Berlin
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-8387-1616-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für meine Tochter
Inhalt
Über den Autor
1 Isch geh mit U-Bahn
2 Schmerzlich Willkommen
3 Geierchen
4 Kontrastprogramm
5 Das Tafellineal
6 Alles wird gut, oder?
7 Pirschelbär
8 Ein Sommer in Hartz iv
9 Neustart
10 Ein Käfig voller Narren
11 Sportlehrer in drei Minuten
12 Sonne, Mond und Sterne
13 Germany’s next Schulchor
14 Isch hab mit Flugzeug gegeht
15 Einzelkampf, Einzelkampf!
16 Neue Perspektiven
17 Esel reloaded
18 Sch’weiß keine Englisch
19 Geier, übernehmen Sie!
20 Schwule Dinosaurier
21 Voll Porno, Alta!
22 Miss November und der Dilettantismus
23 Aua, meine Röbelsäule!
24 Nicht anders, schlimmer
25 Irgendwann ist immer das erste Mal
26 Lebenslänglich Lehrer?
27 Geschichten aus der Parallelwelt
28 Der Mordsimulator
29 Danke, dass du uns Deutsch lernst!
30 Mach dir ’n Bier auf
31 Gehst du jetzt Hartz iv?
32 Lieber ein Ende mit Schrecken …
Nachwort
Danke
1
Isch geh mit U-Bahn
Der öffentliche Nahverkehr in Berlin ist immer eine Reise wert. Mit ein bisschen Glück kann man bei einer Fahrt mit den Verkehrsmitteln der Hauptstadt filmreife Szenen erleben. Als ich die U-Bahn betrete, bin ich mit meinen Gedanken jedoch bereits woanders – und zwar in der Schule. Denn heute trete ich meinen neuen Job als Grundschullehrer an.
Zwischen Musikanten, Verkäufern von Straßenmagazinen und Fahrgästen verschiedensten Umfangs, Alters und Milieus suche ich mir einen Sitzplatz und blicke erst wieder auf, als der Hauptdarsteller der nächsten Szene die Leinwand betritt – selbstverständlich mit einem Handy am Ohr.
»Hamoudi, was los? Was machst du?«, ruft er beim Betreten des Waggons lauthals in sein Mobiltelefon. Als er eine aufgebrezelte Blondine entdeckt, glotzt er ihr unverschämt ins Dekolleté und zwinkert ihr dann grinsend zu. Ihr demonstratives Desinteresse kommentiert er mit einem sehr unfeinen Wort und nimmt dann mir gegenüber Platz.
Na prima, denke ich, wieder einmal werde ich unfreiwilliger Zuschauer der endlosen Daily Soap Willkommen auf dem Planeten Hartz IV. Drehbuch und Regie: das Leben. Produzenten: die politische Sabotage an der deutschen Bildung, die noch immer andauernde Abwesenheit einer funktionierenden Integrationspolitik und der stetige Abbau unseres Sozialsystems.
Während der Protagonist in voller Lautstärke mit seinem Kumpel quatscht, beobachte ich ihn unauffällig. Auf seinem mit reichlich Haarwachs eingefetteten, glänzenden Haupthaar sitzt ein viel zu eng geschnalltes Basecap, am rechten Handgelenk blitzt eine überdimensionale Proleten-Uhr hervor, und auch die schneeweißen Markenturnschuhe sind für jedermann sichtbar. Eine wenig dezente Goldkette und das passende Armband komplettieren sein Outfit – man muss schließlich zeigen, was man hat!
Das gilt offensichtlich auch für seine Kronjuwelen. Die richtige Körperhaltung ist deshalb von großer Bedeutung für seine Rolle. Um rivalisierenden Männchen und paarungsbereiten Weibchen die eigenen Vorzüge zu präsentieren, spreizt er die Beine beim Sitzen weit auseinander. Den Ellenbogen des Telefonarms stützt er auf dem Oberschenkel ab, mit der freien Hand untermalt unser Held die Konversation mit entschlossen wirkenden Gesten.
»Ja, Mann«, ruft er ins Handy und fuchtelt mit der linken Hand wild in der Luft herum. »Hau ma rein! Sch’ruf sie an jetzt …«
Er legt auf, dann bemerkt er meinen Blick.
»Was guckst du?«, pöbelt er mich an, doch ich schaue schnell weg. Er lässt seine Kieferknochen bedrohlich mahlen, dann widmet er sich wieder seinen eigenen Angelegenheiten.
Weil seine Oberarme wahrscheinlich zu muskulös sind, um das Handy für längere Zeit ans Ohr zu halten, und die Benutzung von Headsets vermutlich als schwul gilt, entscheidet er sich, das folgende Telefonat über den Lautsprecher zu führen. So kommt es also dazu, dass ich und das gesamte Zugabteil den Dialog zwischen Mr. Was-guckst-du und der Frau, die er vorübergehend zu seinem Eigentum erklärt hat, in voller Länge mitverfolgen dürfen. Ein solches Glück wird einem nicht oft zuteil.
»S’los?«, begrüßt sie ihn liebevoll, woraufhin er unvermittelt ins Gespräch einsteigt.
»S’machst du?«
Während die männlichen Vertreter seiner Stilrichtung mindestens eine Silbe ihrer kurzen Satzfragmente stark überbetonen, signalisieren die weiblichen durch Einsilbigkeit und Monotonie gern Desinteresse.
»Sch’bin Solarion«, antwortet sie brav.
»Mit wen bist du?«
»Alleine.«
»Warum gehst du?«
»Vallah, sch’seh aus wie Kartoffel, ieberhässlisch!«
Das scheint ihm zu gefallen. Lächelnd schiebt er den Inhalt seiner Unterhose zurecht.
»S’machst du später?«, will er dann wissen.
»Sch’geh Disco.«
»Was?!«
Diese Nachricht lässt seinen Adrenalinspiegel sichtbar nach oben schnellen. Wie kann sie die Frechheit besitzen, ihn davon erst jetzt in Kenntnis zu setzen?
»Mit wen gehst du?«, fragt er sie eindringlich.
»Züsch, sch’geh nur mit Mehtschin!«
»Seit wann weißt du, dass du gehst?«
Diese Frage scheint sie grammatikalisch zu überfordern, sie gerät ins Schleudern.
»Dings, so halt«, antwortet sie nach einem Moment der Stille.
»Was ziehst du an, wenn du gehst?«
Es rauscht und klickt, die Verbindung ist beendet. Aufgeregt verliert der Held die Nerven und brüllt sein Handy an.
»Hallo? Hallo? Schon wieder keine Netz, vallah, irgendwann isch ficke diesem E-Plus!«
Dann flucht er laut, springt auf und drängelt sich zur Tür. Als der Zug quietschend zum Halten kommt, tritt er auf den Bahnsteig und bleibt dort erst einmal stehen, sodass sich alle anderen Fahrgäste umständlich an ihm vorbeischieben müssen. Mit den Händen in den Hosentaschen sieht er sich auf dem Bahnhof um. Die Bewegungen seiner Kaumuskeln demonstrieren Stärke und Entschlossenheit. Die Luft scheint rein, also setzt er sich in Bewegung und verlässt die Bühne.
Was für ein Auftritt.
Ja – das ist Berlin! Wer sich davon überzeugen möchte, dem seien der Erwerb einer Tageskarte und eine ausgedehnte Tour durch den westlichen Teil des Tarifbereichs B empfohlen. Der Besucher wird schnell feststellen, dass derlei Auftritte nicht nur denjenigen vorbehalten sind, denen Rechtspopulisten gern den Migrantenstempel aufdrücken, nein: Sie sind überall dort ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft, wo die gefährliche Mischung aus Bildungsarmut und Perspektivlosigkeit für Frustration, Rücksichtslosigkeit und Gewaltbereitschaft sorgen. Die Schule, an der ich heute meinen neuen Job als Lehrer antrete, liegt in einer der größten Metropolen des geheimnisvollen Planeten Hartz IV – in einem der zahlreichen Berliner Kieze, die von dieser gefährlichen Mixtur betroffen sind.
Als ich die Bahn wenige Stationen später verlasse, beschleicht mich das Gefühl, die Geschichte mit Hamoudi und der Frau in Solarion könnte erst der Anfang gewesen sein. Noch habe ich nicht die leiseste Ahnung davon, wie es sein wird, Kinder zu unterrichten, deren Schicksale ich bisher hauptsächlich aus dem Fernsehen kenne. Von den vernichtenden Urteilen verschiedener Studien über deutsche Bildungseinrichtungen habe ich zwar gelesen, doch nun stehe ich kurz davor, die Gesichter hinten diesen trockenen Fakten live und in Farbe kennenzulernen.
Um halb neun verlasse ich den U-Bahnhof und trete ins grelle Tageslicht. Bühne frei, es ist so weit: Ich bin Lehrer!
Oder wie die Kids sagen würden: Isch geh Schule.
2
Schmerzlich Willkommen
Als ich durch das Schultor gehe, beschleicht mich ein merkwürdiges Gefühl. Zum ersten Mal durchschreite ich diese Pforte nicht als Assistent der Schulleitung, sondern als Lehrer. Ab heute werde ich meine belegten Graubrote im Kreise meiner lieben Kollegen im Lehrerzimmer verspeisen, hinter dem Pult Prüfungen überwachen, die Tafel mit Zahlen und komplizierten Formeln vollkritzeln und als von allen Schülern geachtete Autoritätsperson in der Pause über den Hof flanieren.
Zumindest in meiner Vorstellung.
Bevor ich das Gebäude betrete, lasse ich meinen Blick noch einmal über die Betonwüste schweifen, die den Schülern hier als Schulhof zugemutet wird – die Achtziger lassen grüßen. Das Schulgebäude hingegen stammt aus einer Zeit, in der Schüler noch mit dem Rohrstock erzogen wurden. Ein frischer Märzwind weht mir ins Gesicht, und durch die nackten Äste der Bäume sehe ich ein Stück des grauen Himmels, der den Eindruck der gesamten Szenerie deprimierend vervollständigt.
Als ich die schwere Eingangstür der Grundschule öffne, schlägt mir der beißende Gestank von altem Urin entgegen. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Die Toilette befindet sich in der Eingangshalle, und so ist der Fäkalgeruch das Erste, was Schülern wie Lehrern jeden Morgen entgegenweht, wenn sie eine der wichtigsten Institutionen unserer Gesellschaft betreten. Zum Ambiente des Foyers passt dieser Morgengruß jedoch recht gut: Putz bröckelt von dringend renovierungsbedürftigen Wänden, und durch die verschmutzten Fenster fällt nur wenig Licht.
Der Klang meiner Schritte hallt durchs Treppenhaus. Weil die erste Stunde bereits begonnen hat, herrscht hier eine ungewöhnliche, fast unheimliche Stille. Auf der Hälfte der Treppe angekommen, empfängt mich das lebensgroße, von Kinderhand gemalte Bild eines Kampfhundes. Unweigerlich bleibe ich davor stehen und schaue dem Biest in die Augen. Auf dem Fußweg hierher habe ich wegen eines solchen Köters, der selbstverständlich ohne Leine und Maulkorb ausgeführt wurde, gerade noch die Straßenseite gewechselt.
Ein lauter Knall reißt mich aus den Gedanken, ich zucke zusammen. Die Glastür im ersten Stock wird aufgestoßen. Als ich mich umdrehe, sehe ich zwei Jungs die Treppe hinunterstürmen.
»Ey, du Opfer, wo gehst du?«, brüllt der hintere.
»Isch geh bei Klo, du Bastard«, antwortet der erste, ohne sich dabei umzudrehen.
Er bremst vor mir ab und rotzt mir unvermittelt vor die Füße.
»Was?«, fragt er dann und schaut mich angriffslustig an.
Nicht schlecht für jemanden, der ungefähr fünfzig Kilo leichter und zwei Köpfe kleiner ist als ich!
»Nichts, nichts«, versuche ich ihn zu beruhigen und weiche einen Schritt zurück.
Die Lehrerin der beiden, eine Dame mittleren Alters, betritt das Treppenhaus und ruft den Flüchtigen hinterher.
»Erhan und Raik, ihr kommt sofort …«
»Mann, Frau Gärtner, sch’ab doch gesagt, wir gehen Klo«, entgegnet ihr der eine, während der andere die Tür zur stinkenden Toilette aufreißt.
Meine Kollegin schließt die Augen und seufzt. Dann macht sie sich auf den Weg, die beiden Ausreißer wieder einzufangen. Mit einem Blick auf die Tür, die sie leise hinter sich geschlossen hat, wird mir klar, dass ich das Schicksal dieser Frau ab heute teilen werde. Denn die beiden Jungs sind offenbar Schüler der 4e – und das ist eine meiner Matheklassen.
Bevor ich meine erste Stunde als Lehrer antrete, statte ich meinem alten und neuen Chef einen Besuch in seinem Büro ab. Es kommt im klassischen Behörden-Look daher: abgewetzter, moosgrüner Teppich zu beigefarbenen Wänden, ausgeblichene Gardinen in zeitlosem Orange und alte Möbel, die Stahl und Holz in charmanter Kombination miteinander verschmelzen lassen. Die Regale sind vollgestopft mit Leitz-Ordnern und pädagogischer Literatur aus Zeiten, in denen Hosen noch Schlag und Telefone noch Wählscheiben hatten. Das Waschbecken voller Kalkspuren weckt bei mir jedes Mal die Vorstellung, ich beträte den Untersuchungsraum des Amtsarztes. Ein bisschen riecht es auch so.
Mitten in diesem Raum sitzt Herr Friedrich am Schreibtisch. Unser Schulleiter ist in den Sechzigern und versucht, mit dem kranzartigen Überrest seines Haupthaars die unvermeidbare Platte zu verdecken. Der Farbton seines Anzugs bewegt sich irgendwo zwischen Sand und Senf und passt sich damit stimmungsvoll seiner Umgebung an – ein typischer Fall von Büro-Camouflage. Die Gesichtsfarbe meines Vorgesetzten weist dagegen eine leicht ungesunde Rötung auf. Kommt die von dem uralten Röhrenmonitor, der wie eine riesige Strahlenkanone auf seinem Schreibtisch steht?
Weit nach vorn gebeugt starrt er mit zusammengekniffenen Augen durch seine Siebzigerjahre-Brille auf den Bildschirm und hackt dabei auf ein und dieselbe Taste der Tastatur. Bing, bing, bing, kommentiert das der Rechner: Fehlermeldung.
»Hach, das ist aber auch was hier! Immer diese …« Friedrich bemerkt mich und blickt auf. »Ach, unser neuer Kollege«, sagt er dann, steht in seiner typisch ungelenken Art, die mir von meinem alten Job noch sehr vertraut ist, auf und streckt mir die Hand entgegen. »Und, schon aufgeregt?«
Ich nicke. Kein Wunder, denn in ungefähr zwei Stunden werde ich als Mathelehrer vor einer vierten Klasse stehen – ohne auch nur eine Minute Unterrichtserfahrung zu haben!
Herr Friedrich klopft mir mit schlecht gespielter Lässigkeit auf die Schulter.
»Machen Sie sich keine Sorgen, das wird schon«, sagt er. »Immerhin kennen Sie die Schule ja schon.«
Das ist ja das Problem! In dem knappen halben Jahr, in dem ich als sein Assistent an der Ludwig-Feuerbach-Schule war, habe ich hin und wieder auch mal bei der Hausaufgabenbetreuung geholfen. Ich weiß daher, was mich erwartet: Kinder aus deprimierenden Familienverhältnissen, die sich kaum konzentrieren können und deren Schimpfwörter selbst mir als abgehärtetem Berliner die Schamesröte ins Gesicht steigen lassen.
Eigentlich war ich damals ganz froh, dass sich der Assistenzjob, der mir eine Weile die Miete finanziert hat, seinem Ende zuneigte. Doch dann bot mir Herr Friedrich vollkommen unerwartet eine Stelle als Lehrer an. Zu meiner Verwunderung erklärte er mir vor den Winterferien, dass er mich gerne als Quereinsteiger verpflichten wolle. Das Modell, das fachfremden Personen ermöglicht, die pädagogische Verantwortung für Schulkinder zu übernehmen, trägt den sperrigen Namen Personalkostenbudgetierung, kurz PKB. Ich zögerte, das Angebot anzunehmen. Sollte ich etwa doch Grundschullehrer werden, nachdem ich mich jahrelang erfolgreich dagegen gewehrt hatte, in die Fußstapfen meiner Eltern zu treten? Mit gemischten Gefühlen unterzeichnete ich schließlich den Arbeitsvertrag, der mich bis zu den kommenden Sommerferien, also etwas mehr als drei Monate lang, zum Lehrer machen würde.
Friedrich hatte mir damals versichert, dass mich eine erfahrene Lehrkraft in die Geheimnisse des Unterrichtens einführen werde.
»Frau Dremel wartet bereits im Lehrerzimmer auf Sie«, erklärt er mir nun. »Sie wird dann alles Weitere mit Ihnen besprechen.«
Frau Dremel hat die beiden Klassen, denen ich ab heute Mathematik beibringen soll, bislang vertretungsweise unterrichtet. Ab jetzt – mit der Übergabe des pädagogischen Staffelstabs an meine Wenigkeit – kann sie sich wieder verstärkt ihren eigentlichen Aufgaben als Klassenlehrerin widmen.
Die Tür zu Friedrichs Büro wird plötzlich aufgerissen, und zwei Schüler platzen herein.
»Herr Friedrisch«, pöbelt der eine, »er hat misch Hurensohn gesagt!«
»Was redet er, jaaaa? Dein Mutta is eine …«
»Wie oft hab ich euch schon gesagt«, unterbricht der Schulleiter die zwei Jungs ungeduldig, »dass ihr anklopfen sollt?«
»Viermal«, antwortet der kleinere Junge, dessen Jeans an den Knien aufgerissen sind. Seine dunklen Haare sind zu einer wilden Stachelfrisur hochgegelt. Das sprachliche Mittel der rhetorischen Frage kennen die Jungs wohl noch nicht.
»Was?«, fragt Friedrich verdutzt.
»Viermal du hast uns schon gesagt, wir sollen klopfen«, erklärt der Junge.
»Sie! Haben Sie uns schon gesagt«, verbessert der Schulleiter mit gequälter Stimme.
»Hä?«
Die Jungs gucken sich ratlos an.
»Na los, raus jetzt! Ich hab hier …«
Die beiden verkrümeln sich lachend. Streit geschlichtet – wenn auch eher aus Versehen. Warum die beiden außerhalb der Unterrichtszeit auf den Fluren herumtoben, scheint Herrn Friedrich nicht weiter zu interessieren.
»Also, wo waren wir?«, fragt er zerstreut.
»Frau Dremel?«
»Richtig! Sie wird Ihnen zeigen, wie weit sie mit den beiden Matheklassen ist. Viel Erfolg.«
Er kehrt mir den Rücken zu, die Audienz ist offensichtlich beendet. Super. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann wartet auf mich eine Schulung, die den vielversprechenden Titel Mathelehrer in neunzig Minuten tragen könnte. Ich mache mich also auf den Weg, um mir ein paar Patentrezepte einer erfahrenen Frontkämpferin abzuholen – und doch beschleichen mich erste Zweifel. Was andere im Rahmen eines mehrjährigen Studiums lernen, wird mir die gute Dame wohl kaum in wenigen Minuten vermitteln können – oder?
Als ich die Tür zum Lehrerzimmer öffne, sitzt Frau Dremel am großen Konferenztisch und starrt aus dem Fenster. Nach meiner Berüßung nimmt sie noch einen großen Schluck Kaffee und kramt dann zwei Mathebücher hervor.
»Hast du denn schon oft Mathe unterrichtet?«, fragt sie, während sie die richtige Seite heraussucht.
»Nein, noch nie.«
»Ach so?« Sie wirkt verständlicherweise etwas überrascht. »Was sind denn deine Fächer?«
»Gar keins, ich bin gar kein Lehrer.«
Vor Schreck klappt sie das Buch zu und guckt mich mit weit aufgerissenen Augen an. Hätte ich ihr das vielleicht schonender beibringen sollen?
»Wie jetzt?«, fragt sie und sieht mich an, als hätte ich ihr gerade erklärt, ich würde die nächsten Ferien bei meinen Verwandten auf dem Mond verbringen.
»Ich habe Erwachsenenbildung studiert und arbeite bis zu den Sommerferien als Vertretungslehrer.«
»Ist ja verrückt«, sagt sie und kratzt sich am Kopf.
Noch verrückter ist, dass ich in etwa fünfundsiebzig Minuten meine erste Doppelstunde in Mathe halten soll. Hoffentlich kann mir Frau Dremel bis dahin noch etwas beibringen …
»Also, pass auf«, sagt sie gewichtig, »mit der 4e bin ich auf Seite zweiunddreißig. Am Ende spiele ich mit denen oft Vier-Ecken-Rechnen. Bei der 5b sind wir auf Seite neunundzwanzig, und die hassen Vier-Ecken-Rechnen.«
Es entsteht eine kurze Gesprächspause.
»Hast du sonst noch Fragen?«, will sie dann wissen.
Ob ich sonst noch Fragen habe?
Meine Freundin Sarah, die Sprichwörter gern durcheinanderwürfelt, würde jetzt sagen: Ich glaub mich tritt ein Storch – natürlich hab ich noch Fragen! Vor allem die hier: Was soll ich im Unterricht mit den Schülern machen? Wie geht das, Lehrersein? Was mache ich hier eigentlich? Und wie komme ich wieder raus?!
Während mir tausend Gedanken gleichzeitig durch den Kopf schießen, wird mir klar, dass wir das alles wohl kaum innerhalb der nächsten Stunde besprechen können.
»Ach, eigentlich nicht«, lüge ich Frau Dremel daher an. »Den Rest werd ich schon mitbekommen.«
Sie sieht erleichtert aus, als sie aufsteht und nach ihrer braunen Ledertasche und ihrem Mantel greift.
»Viel Glück«, ruft sie, dann fällt die Tür hinter ihr zu, und ich bin allein.
Die restliche Zeit bis zur großen Pause nutze ich, um mir die Unterrichtsinhalte noch einmal anzuschauen. Als die Pausenglocke klingelt, klappe ich das Buch zu und tröste mich mit der Erkenntnis, dass ich in den ersten Stunden inhaltlich wahrscheinlich sowieso nicht viel schaffen werde. Viel wichtiger ist, dass die Schüler und ich uns erst einmal kennenlernen. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass das Verhältnis zwischen denen und mir extrem wichtig für den Verlauf und die Qualität des Unterrichts ist. Diese These habe ich vor ein paar Jahren während eines Jobs als Computertrainer für Grundschulkinder schon mal belegt.
Damals hatte ich so gut wie gar keine Ahnung von Unterrichtsgestaltung – kein Wunder, dass mein erster Versuch in eine Katastrophe ausartete. Mit dem Wunsch, eine entspannte Unterrichtsatmosphäre herzustellen, gab ich mich locker und cool. Wie ich schnell merkte, ist das eine grandiose Art, sich ohne Umwege ins Abseits zu katapultieren. Die Kids legten es mir nämlich als Schwäche aus, dass sie mich duzen durften, und tanzten mir während des Unterrichts gnadenlos auf der Nase herum. Nachdem ich den Schülern das Versenden von E-Mails beigebracht hatte und zum Dank von zwei Sechstklässlerinnen schriftlich gefragt wurde, ob ich schwul sei und schon mal »mit ein Mann gefickt« hätte, versuchte ich die Situation zu retten, indem ich so tat, als würde mich die Frechheit nicht stören – was die Sache nur noch schlimmer machte.
Ich nahm mir vor, es bei meinem nächsten Einsatz besser zu machen. In der zweiten Schule, an die ich als Computertrainer geschickt wurde, ging ich vollkommen anders an die Sache heran. Ich stellte mich als Herr Möller vor und machte der Klasse von Anfang an klar, wer in diesem Computerkurs der Boss war: ich. Diese autoritäre Art fiel mir anfangs überhaupt nicht leicht, aber ich war erstaunt, was sie bewirkte. Zwischen den Schülern und mir entstand ein respektvolles Verhältnis. Vor den Fragen meldeten sie sich ruhig, und schon bald erhielt ich positive Rückmeldungen von den Eltern der Kinder, genauso wie von meinen Vorgesetzten in der Computerschule.
Ob das auch klappt, wenn ich neunzig Minuten lang alleine mit siebenundzwanzig Viertklässlern in einen Raum eingepfercht bin?, denke ich, während ich mein Equipment zusammenpacke und mich auf den Weg zum Klassenzimmer mache.
Los geht’s, Möller!, spreche ich mir Mut zu. Du kannst das!
»Guten Morgen«, sage ich laut und deutlich, als ich exakt mit dem Stundenklingeln den Klassenraum betrete. Auf dem grauen und schmutzigen Linoleumboden stehen ungeordnet ein paar Tische und Stühle herum. Aus den Regalen an den Wänden quellen Materialien, Wände und Fenster sind unbeholfen mit den Gemälden der Kids geschmückt. Der Klassenraum der 4e steht der Hässlichkeit des restlichen Schulgebäudes in nichts nach. Im Raum herrscht absolute Anarchie: Fast alle Kids springen wild herum, sitzen oder stehen auf Tischen, essen Süßigkeiten, tauschen Monster-Karten aus, beschimpfen sich oder malen auf der Tafel herum.
»Hä? Was machst du hier, Herr Müller?«, fragt eine Schülerin, die ich aus der Hausaufgabenbetreuung kenne, als sie mich erblickt.
»Ich bin euer neuer Mathelehrer«, erkläre ich ihr, trete hinter den Lehrertisch und stelle meine Tasche darauf ab. Plötzlich habe ich die ganze Aufmerksamkeit der Kids.
»Vallah, Herr Mülla is unser neuer Mathelehrer!«
»Iebergeil, sch’wöre!«
»Endlisch mal eine Mann!«
Ich freue mich zwar über die Begeisterung, aber einige Schüler scheinen jeden Moment auszuflippen – ich muss also eingreifen.
»Wer bei drei nicht sitzt …«, fange ich an, frage mich aber bereits beim Herunterzählen, wie ich den Satz vollenden würde, wenn ich müsste.
Glücklicherweise scheinen die Kids darüber nicht nachzudenken, sondern drängeln sich zu ihren Plätzen durch. Als alle sitzen, stelle ich mich vor die Klasse und warte noch einen kleinen Moment, bis es wirklich leise ist.
»Guten Morgen, liebe Klasse 4e«, sage ich dann feierlich.
»Guten Morgen, Herr Mülla!«, antworten sie im Chor.
Das lief schon mal sehr gut. Doch eines stört mich: Ich heiße Möller und nicht Mülla, also schreibe ich meinen Namen in großen Druckbuchstaben an die Tafel und bitte ein Mädchen, den Namen vorzulesen.
»Herr Mülla«, sagt sie klar und deutlich.
Ich gehe zur Tafel, unterstreiche das Ö und fordere sie auf, es noch einmal zu probieren.
»Herr Mülla«, wiederholt sie unverändert.
»Ach so«, sage ich und deute auf das Ö. »Das hier ist also ein Ü?«
Die anderen fangen an zu kichern, aber weil ich die junge Dame nicht vorführen möchte, wende ich mich wieder der gesamten Klasse zu.
»Ihr seid doch schon in der vierten Klasse und kennt das Alphabet, oder?«
Eifriges Nicken.
»Also du«, ich zeige auf einen Jungen in der zweiten Reihe. »Wie heiße ich?«
Er zögert, sodass ich mich dazu entschließe, ihm eine Hilfestellung zu geben.
»Das hier ist ein Ö, wie in dem Wort Döner«, sage ich deutlich. Aber dieses Beispiel war wohl nicht so klug.
»Herr Mööö-ler?«, fragt er vorsichtig, woraufhin die ganze Klasse laut lacht.
»Nein«, sage ich mit fester Stimme, »mit kurzem Ö. Meinen Nachnamen spricht man: Möller!«
Dabei betone ich das kurze Ö. Eine Schülerin meldet sich.
»Können wir jetzt endlich Mathe machen, Herr Möller?«, fragt sie mit gelangweilter Stimme.
»Erst, wenn alle meinen Namen aussprechen können«, entgegne ich ruhig. »Also, jetzt sagen bitte alle gleichzeitig: Möller. Eins, zwei, drei …«
»Möller!«, ruft die ganze Klasse, einige der Jungs brüllen sogar.
»Gut, dann kennt ihr ja jetzt meinen Namen. Damit ich eure Namen möglichst schnell lerne, basteln sich jetzt bitte alle ein Namensschild.«
Noch bevor ich ausgesprochen habe, springen die Kids auf und drängeln sich an ihre Fächer im hinteren Teil der Klasse. Meinen nachgeschobenen Satz »Ihr habt genau eine Minute Zeit!« hört fast niemand mehr.
Memo an mich: Keine Anweisungen geben, die Chaos verursachen könnten!
Ich nehme am Lehrertisch Platz und warte. Dabei kann ich beobachten, dass die Kids meine Anwesenheit ziemlich schnell zu vergessen scheinen. Sie fangen an, sich zu beschimpfen, sich gegenseitig die Stifte wegzunehmen und andere zu schubsen. Offensichtlich muss ich sie kurz an mich erinnern.
»Noch dreißig Sekunden«, rufe ich in die Menge, woraufhin sich das Arbeitstempo etwas erhöht. »Wer fertig ist, setzt sich bitte auf seinen Platz.«
Da ich keine Uhr trage, werfe ich heimlich einen Blick auf mein Handy und stelle fest, dass schon ein Drittel der ersten Stunde vergangen ist. Als alle mit den Namensschildern fertig sind, setze ich endlich den Unterricht fort.
»Nachdem wir nun unsere Namen kennen, können wir ja mit Mathe anfangen.«
Ich schaue das zickige Mädchen an, das vorhin so erpicht darauf war, mit dem Unterricht zu beginnen. Auf dem Schild vor ihr prangt der Name Nina. Ihre blonden Haare sind zu einem strengen Zopf gebunden. Den Kopf hat sie leicht in den Nacken gelegt. Sie hat eine betont aufrechte Körperhaltung und drückt sich gewählt aus. Ihre Lippen presst sie, wenn sie nicht spricht, aufeinander. Ein ganz klarer Fall: Nina ist ein Alphatier. Ihr Outfit scheint den allgemeinen Kleidungsstil in der Klasse vorzugeben. Die mit Plastiksteinchen besetzten Blümchenmuster auf ihrer Jeans und ihrem Oberteil kann ich bei fast allen anderen Mädchen wiederfinden. Mal sehen, was von ihrem Arbeitseifer von eben noch übrig ist.
»Wollen wir dann anfangen, Nina?«
»Hä?« Meine Frage hat sie aus einem Gespräch mit ihrer Banknachbarin gerissen.
»Das heißt: Wie bitte?«, sage ich und ärgere mich noch im selben Moment über diesen Spießerspruch.
Nina verdreht die Augen. »Ist ja gut!«
Hier wird wieder klar, was ich bereits in der Uni gelernt habe: Die Persönlichkeit eines Menschen bildet sich ziemlich früh aus. Mir schwant, dass das auch für die kleine Diva hier gilt – und das wird vermutlich anstrengend.
»Gut, dann holt mal bitte eure Bücher raus«, gebe ich die nächste Anweisung und verursache damit erneutes Chaos, denn die Bücher befinden sich auch in den Fächern am anderen Ende des Klassenraums.
»Okay, das hat jetzt wieder zwei Minuten gedauert«, sage ich, als alle wieder sitzen. »Damit das nicht jede Stunde passiert, erwarte ich, dass ihr beim nächsten Mal eure Bücher am Platz habt, bevor die Stunde losgeht. Können wir dann anfangen?«
Die kleine Fatima meldet sich. Sie trägt ein rosafarbenes Kinderkopftuch, und ihre Körpersprache lässt auf eine sehr aktive Persönlichkeit schließen. »Herr Mülla?«
»Möller! Ja, was gibt’s denn?«
»Dieser Kevin, er hat misch Fotze gesagt«, sagt sie und zeigt auf ihren Sitznachbarn.
»Wie bitte? Stimmt das, Kevin?«, frage ich ihn streng.
Er schaut mich traurig an. »Ja, aber sie hat misch Wichser gesagt.«
»Ich möchte hier keine Schimpfworte hören! Von niemandem, klar?«
Die beiden nicken.
»Gut, dann können wir ja jetzt endlich … «
»Noch nicht!«, ruft ein Schüler aus der letzten Reihe, den ich erst jetzt als den Jungen erkenne, der mir heute früh vor die Füße gespuckt hat. »Sie haben mich noch gar nicht richtig kennengelernt. Ich bin Raik, und ich bin der Schlimmste von allen.«
In der Tat: Raik sieht so frech aus, dass ich eine Steinschleuder in seiner hinteren Hosentasche vermute. Die blonden Haare über dem feisten Gesicht stehen zu Berge, er schaut mich grinsend an, und seine Beine bewegen sich unruhig unterm Tisch. Ich halte seinem Blick einen Moment stand und überlege, wie ich auf seine Provokation am besten reagiere.
»Das ist ja interessant«, stelle ich betont unbeeindruckt fest. »Was ist denn so schlimm an dir?«
»Also, ich stör immer den Unterricht, mache nie Hausaufgaben, ich verprügel andere Kinder – auch im Unterricht –, und ich verspreche dir, dass ich dich noch zum Ausrasten bringe!«
»Na, da bin ich aber mal gespannt«, sage ich und will mit dem Unterricht fortfahren.
»Kannst du auch, du Arschloch!«, meint er.
Ich halte inne.
Mit einer plötzlichen Handbewegung schiebt Raik all seine Sachen vom Tisch. Dann legt er die Füße auf seinen Tisch, verschränkt die Arme hinterm Kopf und lächelt mich entspannt an.
»Ist der immer so?«, frage ich in die Klasse.
Einige der Kids nicken so heftig, dass ich Angst habe, sie verrenken sich dabei die Halswirbelsäule.
»Ich hab Frau Dremel schon öfter zum Heulen gebracht. Cool, wa?« Freude macht sich auf Raiks Gesicht breit.
»Geht so«, sage ich, trete langsam zu ihm heran, stütze mich auf seinen Tisch und beuge mich zu ihm herunter. »Was hältst du denn davon, wenn wir dich mal in eine andere Klasse setzen?«
Er erklärt mir, dass das nicht ginge, weil er bereits aus einer anderen Klasse komme. Auf meinen Vorschlag, ihn vom Unterricht auszuschließen, reagiert er ebenfalls lässig: Er freue sich jetzt schon aufs Computerspielen. Seine Mutter, erklärt er mir, würde ständig wegen ihm heulen, und seinen Vater kenne er nicht. Seine Tadel zählt er schon lange nicht mehr.
»Dann hilft vielleicht nur noch ein Schulwechsel«, greife ich zu meiner letzten Waffe.
Doch auf diese Aussage hat Raik offenbar nur gewartet. »Ich hab schon alle Grundschulen im Bezirk durch. Mich nimmt keiner mehr!«
Ich setze mich mit einer Pobacke auf seinen Tisch, verschränke die Arme und schaue ihn einen Moment lang an. Vielleicht drehe ich den Spieß einfach mal um?
»Weißt du was? Ich find dich eigentlich ganz cool. Ich glaube, wir werden uns gut verstehen.«
»Ach ja?«
Seine Augen funkeln. Er kippelt mit seinem Stuhl, stößt sich ohne Vorwarnung vom Tisch ab, fällt rückwärts auf den Boden, springt auf und rennt zum Tafeleimer. Mit einem Fuß auf dem Rand des gefüllten Tafeleimers, in dem siffige, von der Tafelkreide verfärbte Schwämme treiben, sieht er mich mit blitzenden Augen an.
»Und?«, will er von mir wissen. »Findest du mich jetzt immer noch cool?«
»Nein«, brüllen einige der anderen, »nicht schon wieder, Raik!«
»Bitte nicht, Mann!«
»Züüüüüsch, er is verrückt!«
Als ein paar Jungs aufstehen, um ihn von der Überflutung des Klassenzimmers abzuhalten, geht Raik auf den ersten los und boxt ihm brutal in den Magen. Ich komme gerade noch rechtzeitig, um ihn von weiteren Schlägen abzuhalten. Als ich ihn am Oberarm packe, reißt er sich los.
»Fass mich nicht an, du Wichser!«, brüllt er panisch. »Oder ich zeig dich an, klar?«
Eine plötzliche Stille entsteht. Alle sind auf meine Reaktion gespannt. Auch ich.
Nach einem Moment hat sich mein Puls wieder so weit beruhigt, dass ich Raik fragen kann, ob er mit dem Theater fertig sei.
»Das war gerade der Anfang«, sagt er giftig. »Und jetzt fang endlich mit deinem Scheißmatheunterricht an, du Idiot!«
Er macht auf dem Absatz kehrt und lässt mich stehen.
Na gut, erst mal ignorieren. Im Umgang mit ihm brauche ich auf jeden Fall professionelle Hilfe. Aber jetzt muss ich erst mal mit dem Unterricht beginnen.
Wie eigentlich? Mir fällt wieder ein, dass ich eigentlich gar kein Grundschullehrer bin. Immerhin weiß ich, dass ein guter Pädagoge seine Schüler dort abholt, wo sie gerade stehen. Wie wäre es also, wenn ich erst einmal den Leistungsstand der Kinder überprüfe?
Dem Mathebuch habe ich entnommen, dass die Schüler der vierten Klasse die Grundrechenarten im Tausenderbereich beherrschen sollten – allerdings nur schriftlich. Also mache ich mich erst mal ans kleine Einmaleins, damit kann man eigentlich nichts falsch machen.
Eigentlich.
»Wie viel ist vier mal fünf?«, frage ich die Klasse.
»Zwanzig«, ruft Florian, ohne sich zu melden. »Richtig, aber reingerufen. Zählt nicht!«
Schon der kleinste Anlass reicht aus, um die bedrohliche Gruppendynamik der 4e in Gang zu setzen. Erneut droht Chaos auszubrechen. Wie soll ich mir hier Gehör verschaffen?
Schnell, Philipp, lass dir was einfallen!
Ich entscheide mich dazu, die Kinder in voller Lautstärke zur Ordnung zu rufen.
»Ruhe bitte!«, belle ich etwas brachial, aber zielführend.
Na also. Dann stelle ich die nächste Aufgabe.
»Sechs mal sechs?«
Jason aus der ersten Reihe meldet sich blitzschnell. Er ist ein kleiner untersetzter Junge ohne Migrationshintergrund, der ziemlich traurig aus der Wäsche schaut.
»Sechsundsechzig?«, fragt er unsicher.
»Nein, leider falsch, Jason«, gebe ich zurück. »Weiß es jemand anders?«
So viele Gesichter, so viel Ratlosigkeit.
»Niemand? Sechs mal sechs?«
Nina meldet sich und schaut mich dabei langsam blinzelnd an. »Zwölf?«, fragt sie.
»Nein. Möchte es noch jemand probieren?«, frage ich und kann den verzweifelten Unterton meiner Stimme kaum noch verbergen. Ich atme tief durch und rufe mir in Erinnerung, dass ich hier vor einer vierten Klasse stehe. Die pure Ratlosigkeit der Schüler ist einem betretenen Schweigen gewichen.
»Okay, dann rechnen wir zusammen«, schlage ich vor, denn von der Uni habe ich noch vage in Erinnerung, dass dort mal die Rede vom sogenannten Lehrgespräch war, einer Dialogform des Frontalunterrichts. Mein Dozent bezeichnete diese Form damals wenig schmeichelhaft als Osterei-Pädagogik: Der Lehrer versteckt das Wissen, und die Kinder müssen es finden. Er fand das weder innovativ noch zeitgemäß, aber weil mir im Moment keine bessere Lösung einfällt, beschließe ich, dass es für den Anfang in Ordnung ist. Ich schnappe mir also ein Stück Kreide und schreibe sechs Sechsen an die Tafel.
»Welches Zeichen muss ich denn dazwischenschreiben, um auf das richtige Ergebnis zu kommen?«
Immer noch Stille. Die Kids weichen meinem fragenden Blick aus.
»Also«, fahre ich fort, »um das Ergebnis von sechs mal sechs zu errechnen, muss ich die sechs Sechsen miteinander …«
Ein Junge im Mittelfeld des Klassenraums meldet sich. Ranjad steht auf seinem Namensschild – ich kann nur vermuten, wie man das ausspricht. Ranjad hat dunkle Haut, und bei seinem Namen liegt die Vermutung nahe, dass seine Eltern aus Indien stammen. Er ist ordentlich gekleidet und wirkt trotz seiner vorbildlichen Körperhaltung sehr schüchtern.
»Ja, Ranjad. Was muss ich mit den Sechsen machen?«
»Plus rechnen«, sagt er unsicher.
Während ich fünf Pluszeichen zwischen die Zahlen schreibe, steigt der Lärmpegel hinter mir so rasant an, dass ich meine liebe Mühe habe, mich auf die Kreidekreuze zu konzentrieren.
»Richtig«, sage ich in den Tumult hinein, als ich mich wieder umgedreht habe. »Kannst du mir auch sagen, was dann rauskommt?«
Ranjad überlegt einen Moment, während er mit starrem Blick auf die Tafel die Sechsen zusammenzählt. Dabei bewegt er stumm die Lippen.
»Sechsunddreißig.«
»Sehr gut«, lobe ich ihn und blicke dann in die Runde. »Elf mal acht?«
»Ohaaaaa …«, entfährt es Michelle, während die anderen Kinder angestrengt und nicht gerade leise Zahlen zusammenrechnen. Schließlich meldet sie sich. Aufgrund ihrer Kleidung vermute ich, dass sie aus einer Familie stammt, die über keine nennenswerten finanziellen Mittel verfügt. Anders als viele ihrer Mitschülerinnen trägt sie keine glitzernden Accessoires, hat keine bunte Prinzessin-Lillifee-Schulmappe, und ihre Schuhe sehen so aus, als ob sie einmal ihrem größeren Bruder gehört hätten. Ihre dunkelblonden Haare sind zu einem langen Zopf geflochten.
»Neunzehn?«
»Nein, Michelle, das ist elf plus acht. Ich hab aber nach elf mal acht gefragt. Ranjad, du warst schon dran«, kommentiere ich sein eifriges Melden. »Sonst jemand? Elf mal acht?«
Ich komme mir vor wie ein Marktschreier, der versucht, faule Früchte zu verkaufen. Der Lärmpegel im Klassenraum steigt, aber es meldet sich niemand.
»Michelle, komm doch bitte mal an die Tafel und schreib elf mal die Acht an die Tafel.«
Sie kommt widerwillig nach vorn, nimmt sich ein Stück Kreide und beginnt, verschieden große Gebilde an die Tafel zu malen, die ich mit etwas Fantasie als Achten identifiziere. Dabei fängt sie mit einem unteren Kreis an und malt dann einen zweiten darüber. Bis sie fertig ist, kann es noch dauern. Ich werfe also einen Blick in ihr Matheheft.
Ordnung war zwar noch nie meine Stärke, und auch meine Handschrift gilt bis heute eher als einzigartig denn leserlich – aber das hier? Sämtliche Seiten sind durch intensives Radieren zerknittert, das Papier ist teilweise zerrissen, es gibt keine Überschriften, kein Datum, und die Karos wurden auch konsequent ignoriert. Mir schießt durch den Kopf, dass Michelles Zahlen so aussehen, als wäre sie als Linkshänderin zur Rechtshänderin umerzogen worden. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass das früher durchaus üblich war, weil Linkshänder angeblich im Bund mit dem Teufel standen und wie Homosexuelle als abnormal galten. Da soll mir noch mal jemand sagen, früher wäre alles besser gewesen …
Während Michelle noch mit dem Malen beschäftigt ist, steigert sich der Lärmpegel in der Klasse erneut. Ich muss eingreifen.
»Welche Zeichen gehören zwischen die Achten?«
Außer Ranjad meldet sich niemand. Die Schüler sehen vollkommen verwirrt aus.
»Das hatten wir vor zwei Minuten! Kann sich wirklich niemand mehr erinnern?«
Offensichtlich nicht. Verzweiflung macht sich in mir breit.
»Okay, Ranjad, sag es bitte laut und deutlich für alle!«
Michelle malt nach seiner Antwort zehn Kreuze zwischen ihre kopflosen Schneemänner und ist sichtlich erleichtert, als sie sich setzen kann. Ich schreibe ein Gleichzeichen hinter das Gebilde.
»Wer kann das ausrechnen? Acht plus acht plus acht plus acht … und so weiter.«
Als die Antworten auf mich einprasseln, steigt ein mulmiges Gefühl in mir auf.
»Hundertsiebzehn?«
»Einundzwanzig!«
»Achttausend?«
Die Pausenglocke läutet eine kleine Unterbrechung ein, die wir alle gut gebrauchen können. Während ich aus dem Fenster starre und überlege, wie ich weitermachen könnte, muss ich mehrmals um Ruhe bitten. Vorsichtshalber werfe ich noch einmal einen Blick ins Mathebuch, um sicherzugehen, dass ich wirklich den richtigen Schwierigkeitsgrad gewählt habe. Kein Zweifel: Das kleine Einmaleins muss in der vierten Klasse sitzen, schriftlich sollten Addition und Subtraktion mit niedrigen Tausenderwerten klappen. Dazu kommen Kenntnisse über Maßeinheiten in Länge, Geldwert, Zeit und Masse. Ich muss mir dringend einen Überblick verschaffen, wie es bei den Kindern um diese Basics bestellt ist, und schreibe daher an die Tafel: Bitte am Ende der Stunde die Mathehefte bei mir abgeben! Und weil ich gerade dabei bin, füge ich noch hinzu: Noch eine Minute Pause!
Einige der Kids haben den Hinweis wahrgenommen. Der Großteil scheint in den letzten Minuten allerdings komplett vergessen zu haben sich in der Schule zu befinden.
Als ich gerade dazu ansetzen will, den Sinn und Zweck der hier und heute stattfindenden Veranstaltung ins Gedächtnis zu rufen, springt mir Fatima zur Seite.
»Herr Mülla, du musst an diese Glocke klingeln!«
Dabei zeigt sie auf eine Art Müslischale aus Messing, die auf meinem Pult steht. Fatima bringt mir bei, wie man dem Metalltopf mit dem Holzstab einen Glockenklang entlockt.
»Das ist also eure Klassenglocke, ja?«, beginne ich den zweiten Teil der Doppelstunde.
»Das ist eine Klangschale«, korrigiert mich Nina. »Wenn Frau Gärtner die verwendet, müssen wir leise sein und uns hinsetzen.«
»Danke, Nina. Dann machen wir jetzt mit Mathe weiter. Ihr habt ja schon gesehen, dass ich etwas an die Tafel geschrieben habe. Was steht denn da?«
Ich bin zwar nicht als Deutschlehrer hier, aber neugierig, ob die Kinder genauso gut lesen können, wie sie rechnen.
»Erhan«, rufe ich einen Jungen auf, den ich bereits kenne, weil ich an diesem Morgen mit Raik und ihm zusammengetroffen bin. Er gehört zu den Jungs, die bereits in der Grundschule einen Schnurrbartschatten haben. Seine Augenbrauen sind über der Nase zu einer Monobraue zusammengewachsen, die seinen grimmigen Blick unterstreicht. Auf seinem T-Shirt steht Hausaufgaben gefährden meine Gesundheit.
»Lies mir doch bitte mal vor, was an der Tafel steht«, fordere ich ihn auf.
Obwohl er in der ersten Reihe sitzt, kneift er die Augen zusammen und setzt eine angestrengte Miene auf. Hat er Probleme mit dem Lesen? Oder sollte er mal zum Augenarzt?
»Biehtee amendeder … Suten?«
»Stunde«, helfe ich ihm.
»Stuhnde dei …«
»Die.«
»Die … isch kenne diese nächste Wort nisch.«
»Okay, war doch schon ganz gut«, sage ich, setze ein, wie ich hoffe, ermutigendes Lächeln auf, schüttele innerlich jedoch verzweifelt den Kopf. »Will jemand weiterlesen? Ja, bitte, Shanice.«
»Wir sollen alle unsere Mathehefte bei dir abgeben«, sagt sie stolz.
Na gut, stimmt wenigstens sinngemäß. Ich atme einmal durch und überlege kurz, ob ich noch einmal erklären soll, dass Lehrer in der Sie-Form angesprochen werden, aber nach Mülla-Möller, Einmaleins und Vorleseübung wird das jetzt wohl zu viel. Lieber konzentriere ich mich auf das, wofür ich hier bin: Mathematik. Mit der PISA-Studie im Hinterkopf, die unserem Schulsystem vor allem im Bereich der praktischen Anwendung des Gelernten unterirdische Leistungen bescheinigt, schlage ich im Buch das Kapitel Längen und Größen auf und beginne mit einer einfachen Frage.
»Bei der ersten Aufgabe sollt ihr schätzen: Wie hoch ist diese Tür ungefähr?«
Ich stelle mich in den Rahmen der Klassentür und zeige auf den oberen Rand.
»Zwei Zentimeter, zwei Meter oder zweihundert Meter?«
Mal wieder blicke ich in ratlose Gesichter.
»Na gut«, beginne ich, »dann gehen wir die Antworten mal durch. Ist diese Tür zwei Zentimeter hoch?«
»Nein, Herr Mülla«, meldet sich ein Junge namens Ümit ungefragt zu Wort, »nischmal ein Maus er konnte einem Tür gehen der zwei Zentimeter hoch ist!«
Die Klasse ist mit diesem besonderen Sprachstil offensichtlich gut vertraut, denn die Kids biegen sich vor Lachen. Ich bemühe die Klangschale und warte darauf, dass Ruhe einkehrt. Fehlanzeige. Noch ein Schlag, immer noch keine Ruhe. Die Schüler sind von der Idee einer winzigen Mäusetür derart entzückt, dass niemand auf die Glocke hört.
»Ruhe!«, rufe ich laut.
Das scheint zu wirken.
»Zwei Zentimeter sind es also nicht«, sage ich in die entstandene Stille hinein. »Wisst ihr, wie lang ein Meter ist?«
Die Kids nicken und erklären mir, dass ein großer Schritt eines Erwachsenen ungefähr so lang ist.
»Und wie hoch ist diese Tür dann ungefähr in Schritten gemessen: zwei Zentimeter, zwei Meter oder zweihundert Meter? Vincent?«
Als Vincent seinen Namen hört, fährt er zusammen und setzt einen Gesichtsausdruck auf, als sei er gerade aus dem Bett gefallen.
»Zwei Zentimeter?«
Ich schließe kurz die Augen und überlege, ob ich schreiend aus dem Raum rennen soll.
»Jemand anders? Fatima?«
»Zwei Meter!«
»Sehr gut, danke!« Endlich erlöst.
Mein Blick ruht einen Augenblick auf Fatima, die sich über das Lob zu freuen scheint. An ihrem Namen, vor allem aber an der Kopfbedeckung erkenne ich ihren Migrationshintergrund. Ihr Kinderkopftuch ist nicht aufwendig mit Nadeln gesteckt, sondern mit einem Gummizug befestigt. Beim Anblick der verhüllten Viertklässlerin frage ich mich einmal mehr, was ich von dieser Kopfbedeckung halten soll.
Einerseits gehört es natürlich zu den Grundrechten eines jeden Menschen, die Wahl der Kleidung selbst zu treffen. Ein einfaches Kopftuchverbot käme in meinen Augen einer Bevormundung gleich, die mit meinen Vorstellungen von persönlicher Freiheit nicht zu vereinbaren ist. Angesichts der Rolle, die Frauen in islamisch geprägten Gesellschaften oft einnehmen, erscheint mir die Verhüllung jedoch als klares politisches Symbol der Unterdrückung – und das kann ich unmöglich gutheißen.
Menschen, die das Tuch befürworten, werden jetzt vielleicht dagegenhalten, dass sich Kopftuchträgerinnen dieses Kleidungsstück als religiöses Symbol freiwillig auferlegen. Aber selbst wenn sie nicht mit körperlicher Gewalt dazu gezwungen werden, sondern wenn Mädchen von Geburt an lernen, dass Männer und Jungs ihnen überlegen sind, dass sie Eigentum ihres Vaters und später ihres Ehemannes sind und nur diesen ihre Haare zeigen dürfen – ist es dann verwunderlich, wenn sie später behaupten, sie würden sich ihrem Mann gern unterordnen und auch das Kopftuch mit Stolz tragen? Vor diesem Hintergrund scheint mir der Begriff freiwillig ziemlich deplatziert.
Als die Stunde zu Ende ist, verlassen die Kids brüllend die Klasse. Einen Moment lang sitze ich wie benommen am Lehrertisch. Ich bin, gelinde gesagt, geschockt. Die meisten der Kids beherrschen weder das Einmaleins noch sind sie in der Lage, einfache Rechenoperationen im Kopf durchzuführen. Das Verständnis für Längenmaße ist bei kaum einem Kind vorhanden. Ich habe sogar festgestellt, dass sie simple Verhältnisangaben wie größer, kleiner, über, hinter, mehr oder weniger ständig durcheinanderbringen. Die sprachlichen Kompetenzen sind ohnehin bei vielen eine Katastrophe. Und kaum einer meiner neuen Schüler kann sich länger als zwei Minuten auf eine Aufgabe konzentrieren. Sie lenken sich gegenseitig ab, fluchen, beschimpfen sich und mich, springen über Tische und Bänke, sobald man nicht hinsieht, und einige der Kids wirken regelrecht verwahrlost.
Erschöpft verlasse ich den Klassenraum und stoße fast mit einer dunkelblonden Frau mittleren Alters zusammen: meine Kollegin aus der Nachbarklasse. Sie reicht mir die Hand und stellt sich mir als Chrissi vor.
»Na, wie war dein erster Einsatz?«, fragt sie mich, als ein Horde brüllender Schüler an uns vorbeirennt. Schwere Glastüren fliegen scheppernd auf, ein kleiner Junge stürzt und kommt nur schwer wieder auf die Beine. Ein wenig erinnert mich das Ganze an die Filialeröffnung eines gigantischen Elektronikmarkts am Berliner Alexanderplatz – nur dass hier noch mehr Schimpfworte fallen.
»Ist das hier immer so?«, frage ich, als die Kinder an uns vorbei sind und man sein eigenes Wort wieder versteht.
»Ja«, sagt sie und zuckt mit den Schultern. »Nach den Ferien ist es allerdings noch schlimmer als sonst.«
»Versteh ich nicht … Die Kids müssten doch erholt sein.«
»Nicht wirklich«, meint Chrissi, und erzählt mir dann, was ihre Schüler in der vergangenen Unterrichtsstunde über ihr schönstes Ferienerlebnis berichtet haben. Zwei von ihnen waren verreist, alle anderen haben die gesamte Zeit in Berlin verbracht. Ein Mädchen hat erzählt, dass sie mit ihrem erwachsenen Bruder im Tierheim war, wo er sich einen Kampfhund ausgesucht hat. Als dieser dann aber zu Hause ihre kleine Schwester biss, mussten sie das Tier wieder zurückbringen. Auf die Frage, wie seine Ferien gewesen seien, behauptete ein anderer Junge, gar nichts gemacht zu haben. Nach einer Weile fiel ihm das Highlight dann doch wieder ein.
»Sch’ab mit meine Kuseng Mäckdonnilz gegeht«, imitiert Chrissi den Jungen. »Ist das nicht traurig? Was wir hier mühsam mit den Händen aufbauen, stoßen viele Eltern zu Hause mit dem Hintern wieder um. Ich muss meine Schüler jetzt erst mal wieder auf Schule einstellen. Und wie war dein erster Einsatz?«
Ich berichte ihr, was ich in der Mathestunde erlebt habe. Als ich die größten Schoten losgeworden bin, lächelt Chrissi mich aufmunternd und ein wenig mitleidig an.
»Keine Panik«, sagt sie, »daran gewöhnst du dich. Das, was du heute erlebt hast, ist der ganz normale Praxisschock.«
3
Geierchen
Im Lehrerzimmer lasse ich mich erschöpft auf einen der moosgrünen Stühle fallen, die vermutlich älter sind als ich. Wenn mich schon die ersten beiden Stunden so fertiggemacht haben, frag ich mich, wie ich bloß den Rest der Woche überstehen soll?
Mir gegenüber entdecke ich einen Kollegen, den ich aus meiner Assistenzzeit bereits kenne. Er ist klein und weitestgehend durchtrainiert, gute fünfzig, hat eine stramme Wampe, schulterlange blonde Haare und strahlend blaue Augen. An einer Goldkette hängt eine 2,99-Euro-Brille von Woolworth in Rosa. Ich lächele ihn etwas unsicher an und ernte ein fettes Grinsen seinerseits.
»Guten Morgen«, sage ich.
»Jut? Wat soll denn daran jut sein? Jeden Tach die gleiche Scheiße hier … Dit wirste noch früh jenug merken! Rauchste?«
Meine Antwort wartet er nicht ab, sondern schiebt seinen Stuhl beiseite und stiefelt breitbeinig um den Tisch herum.
»Na los, wir jehn eene quarzen, bevor dit Elend hier weiterjeht. Ick bin Rolf, och Herr Geier jenannt. Tach.«
Er zermalmt mir zur Begrüßung die Hand. Dann geht er zu seiner Jacke, die am Haken neben der Tür hängt, zieht sie sich über und greift in die Innentasche, aus der er ein Päckchen Zigaretten mit der Aufschrift Palenie powoduje Raka holt.
»Ick koof die Dinger immer in Polen, weeßte?«, erklärt er mir. »Bin doch nich blöde und schmeiß dem Scheißstaat mein Jeld in Rachen. Diese Arschlöcher. Quatschen, dit könnse, die Politiker, aber ’ne ordentliche Schulpolitik kannste verjessen!«
Gut, dass ich als Berliner mit seinem Slang vertraut bin, denn so schnell, wie er spricht, hätte ich als Unkundiger vermutlich echte Schwierigkeiten, ihn zu verstehen. Geier öffnet die Tür, und so habe ich kaum eine andere Wahl, als ihm zu folgen. Auf einem Schleichweg führt er mich nach draußen zu einem kleinen Platz hinter dem Schulgebäude. Dort angekommen, steckt er sich eine Zigarette an und inhaliert tief.
»Du warst doch der Kopierjunge vom Friedrich«, sagt er grinsend. »Biste jetzt vom Assi zum Lehrer befördert worden, oder wat?«
»Ja«, antworte ich ordnungsgemäß und leiere die kleine Geschichte meines beruflichen Werdegangs herunter. Ich erzähle ihm, wie ich nach dem Abschluss meines Studiums in den Job als Assistent der Schulleitung gestolpert bin, dort aber nur selten kopiert, sondern vor allem zwischen Herrn Friedrich und dem Kollegium vermittelt habe. Ich berichte auch von meinen Einsätzen in der Hausaufgabenbetreuung, wo ich erste Erfahrungen mit den Schülern sammeln durfte und dass mir Herr Friedrich schließlich den Job als Lehrer angeboten hat. Dann beende ich meine kleine Geschichte mit den Worten: »Ich bin also Quereinsteiger und unterrichte hauptsächlich Mathe.«
Eine Mischung aus Verzweiflung und Erstaunen steht ihm in sein gebräuntes Gesicht geschrieben.
»Biste verrückt?«, ruft er mit aufgerissenen Augen. »Tust dir dit hier freiwillig an?«
»Na ja. Ich hab gute Arbeitszeiten, das Gehalt ist, sagen wir: okay – und ich lern was fürs Leben.«
Er sieht mich wie jemand an, der im Winter barfuß über die Straße läuft.
»Wat willste denn hier lernen? Dit is hier Hartz IV pur! Die spinnen alle!«, ruft er. »Und die Kolleginnen erst. Wenn ick die schon sehe, diese alten frustrierten Schachteln – bäh! Früher war Schule noch jut. Aber heute? Kannste allet verjessen …«
Er schüttelt angewidert den Kopf und schnipst seine Kippe auf die andere Straßenseite. Dann dreht er sich um und stapft davon. »Komm, wir jehn rinn!«
Auf dem Rückweg durch die Flure treffen wir einen Schüler, der beim Anblick von Herrn Geier breit lächelt. Der Junge trägt ein ausgewaschenes Kapuzen-Sweatshirt und hat einige Pfunde zu viel auf den Rippen.
»Herr Geier, Herr Geier«, ruft er laut, doch mein neuer Kollege unterbricht ihn schnell.
»Wat, Herr Geier? Haste keen Klassenlehrer, den de vollquatschen kannst? Außerdem hab ick dir schon tausendmal jesacht, du sollst nicht so viel futtern, wirst immer fetta! Und nu hau ab, ick unterhalte mich gerade.«
Er tätschelt ihm die Wange.
»Okay, Herr Geier, danke«, entgegnet der dicke Junge und läuft fröhlich davon.
Geiers rüder Umgangston schockiert mich. In diesem Gebäude scheinen die Regeln des freundlichen Umgangs miteinander außer Kraft gesetzt zu sein.
»Wat kickste denn wie ’n Auto?«, raunzt er mich an, grinst aber dabei. »So läuft dit hier! Mit denen musste so sprechen, die verstehen dit sonst nich!«
»Äh … hast du denn nie Ärger für solche Kommentare bekommen, von Eltern oder der Schulleitung oder so?«, frage ich ihn verwundert.
»Wat?« Er baut sich vor mir auf und hebt den Zeigefinger. »Ick erklär dir jetz ma wat. Erstens: Ick würde nie – nie! – een Kind valetzn. Zweetens: Friedrich, diese Pfeife, der hat mir janüscht zu sagen! Ick bin viel länger hier wie er! Der soll erstma die Vertretungspläne richtig schreiben, denn sehn wa weiter! So. Und zu die Eltern hab ick schon jesacht: Kommse her …«
Er zieht mich am Schlafittchen zu sich herunter. Unser Größenunterschied von mindestens einem Kopf scheint ihn dabei nicht zu stören.
»Kommse her! Sie halten Ihre Klappe, und ick halte meine, klar?«
Ich bin erleichtert, als er mich wieder loslässt, und bringe meinen Hemdkragen in seine Ausgangsposition.
»Wat meinste, wat bei manchen zu Hause los is?«, fährt Geier in normalem Ton fort. »Ick bin ja der Einzije hier, der zu die Eltern nach Hause jeht, wenn die Kinder nich zur Schule kommen. Oder immer ohne Essen und so. Ick fahr da hin – ohne Vorwarnung! – und denn sag ick: Sie müssen sich um Ihren Sohn kümmern! Der schwänzt, prügelt sich ständig, macht keene Hausaufgaben, hat keen Sportzeug mit – wat is da los? Wat soll aus dem werden? Wat meinste, wie die kieken, wenn de da vor der Tür stehst. Bude sieht aus wie ’n Saustall, zu acht in een Zimmer und so. Wundert dich nüscht mehr!«
Ich weiß nicht, was ich darauf erwidern soll. Geier klopft mir wohlwollend auf die Schulter.
»Nu hau ma rinn«, sagt er kumpelhaft, »große Pause jehn wa Kaffe trinken.«
»Aber ich hab Aufsicht …«
»Mann, verstehst du denn janüscht? Die schlagen sich doch eh die Köppe ein – ob de nu dabei bist oder nicht!«
Er lässt mich stehen und taucht in der Masse der Kinder unter. Nur das Klimpern seines riesigen Schlüsselbunds ist noch zu hören, bis er in seiner Klasse verschwindet.
4
Kontrastprogramm
Nachdem Geier weg ist, muss ich mich beeilen, um rechtzeitig in meiner nächsten Klasse zu sein. So eine Pause ist schnell rum, und mein zweiter Auftritt geht bereits in einer Minute los. Diesmal in der 5b, wieder Mathe. Ob das noch schlimmer werden kann?
Als ich eintrete, begeben sich die Schüler unaufgefordert auf ihre Plätze. Ich gehe langsam zum Lehrertisch, lege meine Sachen ab und begrüße die Klasse.
Die Kinder antworten mir mit einem gut gelaunt klingenden »Guten Morgen, Herr Möller!«.
Wow. Die kennen meinen Namen bereits. Und können ihn sogar aussprechen! Nach ein paar Sekunden des Erstaunens habe ich mich rasch an die neue Situation gewöhnt. Schon nach kurzer Zeit sind wir mitten im Unterricht und lösen gemeinsam einige Aufgaben aus dem Mathebuch. Ich merke, dass es in dieser fünften Klasse ebenfalls viele leistungsschwache Schüler gibt, aber der große Unterschied zur 4e nebenan besteht in der Lernatmosphäre: Niemand feindet sich offen an, die Kinder stören den Unterricht nur sehr selten durch Zwischenrufe und lassen ihre Klassenkameraden ausreden, wenn diese dran sind.
Doch auch hier gibt es natürlich Problemkinder. Pasquale ist eines davon. Er sitzt in der ersten Reihe, direkt vor dem Lehrertisch, und hat auffällig mehr Fragen an mich als seine Mitschüler. Pasquale ist ungefähr einen Kopf größer als die anderen Jungs, hat eine tiefere Stimme und viele Pickel im Gesicht. Seine Bewegungen wirken etwas unbeholfen, und seine Mimik zeugt von wenig Selbstbewusstsein und jeder Menge Kummer.
»Herr Mülla«, jammert er, als ich in seine Nähe komme. »Isch versteh dis alles nich.«
Beim Anblick seiner müden Augen vergesse ich den Hinweis auf meinen richtigen Namen schnell und nehme mir etwas Zeit für ihn, da der Rest der Klasse gerade mit Rechnen beschäftigt ist. Nachdem ich ihm die erste Aufgabe mühsam erklärt habe, verrät er mir den Grund für seine Müdigkeit.
»Sch’war bis ölf wach jewesen«, sagt er kleinlaut und pult dabei am blutigen Nagelbett seines Daumens herum.
Seine Mutter sei schon vor ihm ins Bett gegangen, ohne sich darum zu scheren, dass er noch auf war. Auf die Frage nach seinem Vater fängt er vor Wut fast an zu heulen. Ich bin ratlos. Was soll ich dazu sagen? Immerhin habe ich genug damit zu tun, ohne Ausbildung als Mathelehrer zu arbeiten, aber ohne entsprechendes jugendpsychologisches Rüstzeug angemessen auf die Sorgen eines Frühpubertären einzugehen – das ist dann doch ein bisschen viel. Allerdings kann ich ihn jetzt auch nicht einfach so sitzen lassen, also wage ich einen Versuch. Ich erkläre ihm, dass Erwachsene eben arbeiten gehen müssten und sein Vater sicherlich lieber bei ihm wäre.
»Mein Vater hasst misch!«, schleudert mir Pasquale entgegen. »Und isch hasse ihn! Dieser …«
»Hey, schon gut«, beruhige ich ihn und lege ihm beschwichtigend eine Hand auf die Schulter. Dann erzähle ich ihm, dass ich mich in seinem Alter auch immer mit meinem Vater gestritten hätte.
»Wie alt bist du eigentlich?«, frage ich, um ihn etwas abzulenken.
»Dreizehn.«
Auch bei mir, erkläre ich, fing in diesem Alter der Pubertätsstress mit meinen Eltern an – dass ich zu diesem Zeitpunkt bereits in der siebten Klasse war, behalte ich aber besser für mich.
»Nach dem Unterricht reden wir noch mal in Ruhe, okay?«, schlage ich vor. »Bis dahin hilft dir Angelina bestimmt mit den Aufgaben.«
Seine Sitznachbarin nickt verständnisvoll. In der restlichen Stunde gehe ich mit den Schülern die Lösungen der Aufgaben durch und versuche Unklarheiten nach Möglichkeit von den Kids klären zu lassen. Insgesamt läuft der Unterricht in der 5b so gut, dass ich neuen Mut schöpfe – vielleicht ist der Lehrerberuf ja doch nicht so anstrengend, wie ich noch vor einer Stunde vermutet habe …
Als die Glocke klingelt und Pasquale mit den anderen in die Pause rennen will, rufe ich ihn noch einmal zu mir. Er beteuert, dass es ihm schon besser gehe, ich weise ihn aber noch einmal darauf hin, dass er früher ins Bett gehen müsse.
»Klar, Herr Mülla«, verspricht er und rennt in die Pause.
Als ich aus dem Klassenraum trete, warten drei Mädchen aus der Klasse, die ich eben unterrichtet habe, auf mich: Nesrin, Gülem und Büşra. Alle drei tragen moderne Kleidung, die weit vom Kopftuch-Look der kleinen Fatima aus der 4e entfernt ist. Im Gegenteil: Wahrscheinlich gehen sie regelmäßig shoppen und legen sich dabei den neusten Trend glitzernd-bunter Klamotten zu – selbstverständlich hauteng. Es wird wohl noch ein paar Jahre dauern, bis die Mädels verstehen, dass für einen solchen Look auch die richtige Figur vorhanden sein sollte. Nesrin und Büşra sind pummelig, Gülem dagegen stark übergewichtig. Die drei sitzen zusammen im hinteren Teil der Klasse und sind wahrscheinlich BFF – Best friends forever.
»Herr Möller«, fängt Nesrin an, während die anderen beiden hinter vorgehaltener Hand kichern. »Hamm Sie ein Freundin?«
Bü-rsa und Gülem platzen fast vor Lachen und beginnen miteinander zu tuscheln.
»Ja, habe ich. Wieso?«
Jetzt können sich die beiden anderen nicht mehr am Riemen reißen und lachen lauthals los.
»Was ist deine Freundin?«, fragt Nesrin weiter.
»Was meinst du damit?«, entgegne ich irritiert. »Sie ist eine Frau.«
Nesrin schüttelt energisch den Kopf. »Nein, isch meine: Welsche Sprache ist sie?«
Dass die Verständigung mit einem Kind in ihrem Alter so schwer werden könnte, hätte ich nicht erwartet. Ihr holpriges Deutsch bereitet mir ernsthafte Probleme. Mit dem Tempo einer Wegbeschreibung für Touristen erkläre ich ihr, dass meine Freundin aus Deutschland stammt und sogar Deutsch spricht.
»Und wo kommt ihr drei her?«, möchte ich von ihnen wissen.
»Wir sind Türkei«, unterbricht Büşra plötzlich ihren Lachanfall und schaut mich stolz an.
Auf die Frage, wo sie denn geboren seien, sagt Gülem: »Ja, okay, Dings, Deutschland – aber wir sind trotzdem Türkei!«
Dabei legt sie ihre dicke Hand aufs Herz.
Ich versichere den Mädels, dass ich meine Freundin lieben würde – egal, wo ihre Familie ursprünglich herkäme. Den irritierten bis ablehnenden Blicken der drei Grazien entnehme ich jedoch, dass in ihren Familien vermutlich andere Regeln gelten.
Auf meiner Heimfahrt mit der U-Bahn überkommt mich schlagartig eine bleierne Müdigkeit. Um kurz vor zwei erreiche ich mit einem Bärenhunger meine WG, bin aber so müde, dass die Nahrungsaufnahme warten muss. Ich kann gerade noch die Wohnungstür hinter mir schließen und meine Tasche in die Ecke pfeffern, dann lasse ich mich auf mein Bett fallen und schlafe augenblicklich ein.
Als ich wach werde, setzt draußen bereits die Dämmerung ein. Auf dem Sessel in meinem Zimmer sitzt meine Freundin Sarah. Sie hat sich die Leselampe angemacht und schmökert in einem Roman. Eine dunkelblonde Strähne hat sich aus ihrem Zopf gelöst und fällt ihr ins Gesicht. Immer wieder, auch nach all der gemeinsamen Zeit, erfreue ich mich an ihrem Anblick. Wir leben beide in Berlin, allerdings nicht in einer gemeinsamen Wohnung. Gerade warten wir darauf, dass Sarah einen Studienplatz zugewiesen bekommt. Sie möchte Grundschullehrerin werden – eine Wahl, die ich spätestens seit heute eindeutig mit gemischten Gefühlen betrachte.
»Na, wie war dein erster Tag in meinem zukünftigen Job?«, fragt sie, als sie bemerkt, dass ich wach bin, und streicht sich die widerspenstige Haarsträhne aus dem Gesicht.
»Es war …« Ich suche nach dem richtigen Begriff, während ich mich strecke. »… interessant. Trinken wir ’n Kaffee? Ich muss erst mal wieder wach werden.«
Wir gehen in die Küche, wo ich die Mokkakanne vorbereite und ihr währenddessen von der Katastrophenstunde in der 4e, den übermüdeten und überdrehten Schülern, den Isch-bin-Türkei-Mädels und Herrn Geier erzähle, über dessen schroffe Art wir uns gemeinsam amüsieren. Spontan verleihen wir ihm den Spitznamen Geierchen.
»Vielleicht sollte ich mir das mit dem Lehramtsstudium doch noch mal überlegen«, meint Sarah auf einmal nachdenklich.
»Was ich da heute erlebt habe, muss ja nicht überall so sein«, sage ich und gebe ihr einen Kuss. »Ist bestimmt ein echt toller Job – aber eben nur an der richtigen Schule.«
Nach mehr als drei Jahren Beziehung mit Sarah kann ich mit großer Sicherheit sagen, dass sie gut in diesen Beruf passt. Obwohl sie eher zierlich ist, kann sie sich verdammt gut durchsetzen. Außerdem mangelt es ihr nicht an Einfühlungsvermögen. Und nach dem heutigen Tag kann ich mit Sicherheit sagen: Ohne das geht’s nicht.
Am frühen Abend trudelt mein Mitbewohner Bernd ein, und wenig später ruft unsere Freundin Nuray an, die sich überreden lässt, auf ein Bier vorbeizukommen. Zusammen stoßen wir auf meinen ersten Tag als Lehrer an. Plötzlich fällt mir die Geschichte von Mr. Was-guckst-du aus der U-Bahn ein.
»Oh Mann, diese Proleten«, sagt Nuray kopfschüttelnd und seufzt. Sie ist als Tochter türkischer Einwanderer in Berlin geboren und aufgewachsen. Wegen ihrer dunklen Locken wird sie oft für eine Spanierin oder Italienerin gehalten. Probleme hatte sie wegen der Herkunft nur sehr selten. Ihre Schönheit und ihr gewinnendes Lächeln sind wahrscheinlich ihre stärksten Waffen im Kampf gegen Diskriminierung – was vielleicht ein bisschen schade, aber doch irgendwie tröstlich ist. Außerdem haben Nurays Eltern immer großen Wert auf Bildung gelegt, und so hat sie nach ihrem Abitur direkt mit dem Studium begonnen.
»Manchmal ist es mir richtig peinlich, dass manche meiner Landsleute sich so verhalten«, erklärt sie.
»Nur weil deren Eltern aus dem gleichen Land wie deine stammen?«, fragt Bernd entrüstet und stellt sein Bier lautstark auf den Tisch.