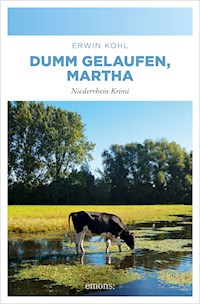5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Mord am Niederrhein
- Sprache: Deutsch
Am Ufer des Weseler Heideweihers wird ein toter Obdachloser gefunden. Weil jedoch keine Gewalteinwirkung erkennbar ist, wird der Fall schnell zu den Akten gelegt. Doch für den pensionierten Kommissar Heinrich Grimm und seine gewiefte Mutter Gertrud – ihres Zeichens Hobbydetektivin – ergeben sich brennende Fragen: Auf einem Zeitungsfoto des Tatorts ist eine Angel zu sehen, doch in dem Heidesee gibt es überhaupt keine Fische! Voller Elan gründet Gertrud ein Detektivbüro, um die Ermittlungen voranzutreiben. Wozu ist die Rentenzeit schließlich sonst da? Heinrich sieht das zwar etwas anders, doch schon bald lassen ihn weitere Indizien daran zweifeln, ob die Polizei diesem Fall alleine gewachsen ist … Dieser Kriminalroman ist früher bereits unter dem Titel »Schwarzes Wasser« erschienen. Jeder Band in dieser Reihe kann unabhängig gelesen werden und wird Fans von Miss Marple und der Kluftinger-Krimis begeistern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Am Ufer des Weseler Heideweihers wird ein toter Obdachloser gefunden. Weil jedoch keine Gewalteinwirkung erkennbar ist, wird der Fall schnell zu den Akten gelegt. Doch für den pensionierten Kommissar Heinrich Grimm und seine gewiefte Mutter Gertrud – ihres Zeichens Hobbydetektivin – ergeben sich brennende Fragen: Auf einem Zeitungsfoto des Tatorts ist eine Angel zu sehen, doch in dem Heidesee gibt es überhaupt keine Fische! Voller Elan gründet Gertrud ein Detektivbüro, um die Ermittlungen voranzutreiben. Wozu ist die Rentenzeit schließlich sonst da? Heinrich sieht das zwar etwas anders, doch schon bald lassen ihn weitere Indizien daran zweifeln, ob die Polizei diesem Fall alleine gewachsen ist …
***
Bitte beachten Sie, dass dieser Kriminalroman früher bereits unter dem Titel »Schwarzes Wasser« erschienen ist.
***
Über den Autor:
Erwin Kohl wurde 1961 in Alpen am Niederrhein geboren und wohnt noch heute mit seiner Frau in der herrlichen Tiefebene am Niederrhein. Neben der Produktion diverser Hörfunkbeiträge schreibt Kohl als freier Journalist für die NRZ / WAZ und die Rheinische Post. Grundlage seiner bislang 15 Kriminalromane und zahlreichen Kurzgeschichten sind zumeist reale Begebenheiten sowie die Soziologie der Niederrheiner und ihre vielschichtigen Charaktere.
Die Website des Autors: www.erwinkohl.de/
Bei dotbooks veröffentlichte Erwin Kohl seine humorvolle Krimireihe um »Grimm & Sohn« mit den Bänden:»Grimm & Sohn – Das kopflose Skelett«
»Grimm & Sohn – Der Tote im Heidesee«
»Grimm & Sohn – Das Hornveilchen-Indiz«
»Grimm & Sohn – Der tote Schornsteinfeger«
Auch bei dotbooks erscheint seine »Kommissar Trempe«-Reihe:»Kommissar Trempe – Zugzwang«
»Kommissar Trempe – Grabtanz«
»Kommissar Trempe – Flatline«
»Kommissar Trempe – Willenlos«
***
eBook-Neuausgabe Juli 2024
Dieses Buch erschien bereits 2010 unter dem Titel »Schwarzes Wasser« beim Droste Verlag.
Copyright © der Originalausgabe 2010 by Erwin Kohl, Wesel-Ginderich und Droste Verlag GmbH, Düsseldorf
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Kristin Pang, unter Verwendung von Motiven von shutterstock.com (paranormal) und Adobe Stock (Sergiy Bykhunenko, Curly, Mira Drozdowski, 1xpert)
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98952-157-5
***
Dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13, 4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/egmont-foundation. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Grimm & Sohn 2«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Erwin Kohl
Grimm & Sohn: Der Tote im Heidesee
Mord am Niederrhein 2
dotbooks.
Prolog
Diersfordt. Der Schein der Abendsonne verfing sich im Laub der alten Friedenslinde vor dem ehemaligen Pastorat. Die Feier drüben im Haus Constance – ihr Mann hatte wieder einmal alle eingeladen, die sie kannten. Nach dem üblichen Begrüßungs- und Smalltalkzeremoniell hatte sie ihn an der Theke zurückgelassen, war vor die Tür gegangen. Dort hatte er gestanden und geraucht. Sie gingen ein paar Schritte in den Wald gegenüber in Richtung Lindenberg. Unterwegs schütteten sie einander das Herz aus. Am Fuße des Herrenberges bogen sie ab, gingen einige Schritte hinauf zur Begräbnisstätte der ehemaligen Herrschaften von Diersfordt. Sie mussten ungestört sein.
»Gibt es keinen anderen Ausweg?« Über ihren Augen lag ein dunkler Schatten. Er sah sie nur mit steinernem Blick an. Seine Entscheidung trieb ihr eine Gänsehaut auf den Rücken. Noch einmal hatte er ihr seinen Plan erklärt, der die Mauern einreißen sollte, die sie umgaben. Er sollte für sie das Tor zur Freiheit weit aufmachen. Als sie sich auf den Rückweg machen wollten, vernahmen sie ein leises Husten. Dann raschelte es laut. Eine Gestalt erhob sich hinter ihnen aus dem Laub. Für zwei Sekunden standen sie sich gegenüber, trafen sich ihre Blicke, dann drehte der andere sich um und flüchtete zur nahen Mühlenfeldstraße.
»Der Penner hat alles mitbekommen.« Seine Stimme bebte leise. »Hast du ihn schon mal gesehen?«
Er blickte dem enteilenden Radfahrer hinterher, schien fieberhaft nachzudenken.
»Nein.«
Den Rückweg gingen sie Hand in Hand.
Kapitel 1
Vier Wochen später
Die Nacht wich einer klaren, frischen Morgendämmerung. Nur ihre beruhigende Stille hielt sich noch eine Weile wie eine schützende Hand über dem Ort.
Allmählich machten sich die ersten Frühaufsteher auf den Weg zur Arbeit. In der Nähe der Bocholter Straße übertönten sie den Gesang der Vögel. Wenige Minuten später hatte Heinrich Grimm wieder den Eindruck, allein auf der Welt zu sein. Er lief über die Kanonenberge in Richtung des Schwarzen Wassers, einem Weiher am Rande des Naturparks Hohe Mark. Er genoss das Gefühl, sog die klare süßliche Luft des ausklingenden Frühlings tief ein. Unvermittelt musste er schmunzeln. Er dachte daran, wie unterschiedlich er dieses Gefühl der Einsamkeit in der letzten Zeit beurteilt hatte.
Kaum mehr als ein halbes Jahr war inzwischen vergangen, seit Engels, Leiter des Kommissariats an der Reeser Landstraße, ihm die Urkunde überreicht hatte. Ein Stück Papier, ein lapidarer Text, eine eilig hingekritzelte Unterschrift. Das war alles gewesen, was von seiner Dienstzeit übrig geblieben war. Er war ausgemustert worden, noch dazu mitten in einem Mordfall. Frühpensioniert, weil er laut dem Bericht der Polizeipsychologin nicht mehr dazu in der Lage war, eine Waffe zu halten. Dabei hatte er seine Dienstwaffe in über dreißig Jahren Polizeidienst nur einmal benutzt. Einmal hatte sich der Zeigefinger seiner rechten Hand im Einsatz um den Abzugshahn gelegt. Einmal zu viel. Als er das Dienstgebäude verlassen hatte, um über die Jülicher Straße nach Hause zu gehen, war er sich unendlich einsam vorgekommen.
Den Winter über hatte er zum ersten Mal in seinem Leben unter Depressionen gelitten. Es wollte ihm nicht gelingen, sich im Alter von dreiundfünfzig Jahren als Pensionär zu fühlen. Erst als seine Therapeutin, die er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, der Weseler Staatsanwältin Annette Gerland, aufsuchte, ihn von seiner falschen Sichtweise überzeugen konnte, trat ganz langsam Besserung ein. Seine Seele hatte bis dahin in einem stockfinsteren Raum gelegen. In kleinen Dosen flößten ihm die Therapiegespräche Optimismus und Lebensfreude ein, öffneten nach und nach den dunklen Vorhang. Anfangs drangen nur einzelne Sonnenstrahlen hinein. Zu Beginn des Frühlings kam er sich wie eine Eiche vor, die ihr altes Laub abgeworfen hatte und dem frischen Grün entgegenfieberte. Mitten in dieser euphorischen Phase wandte Frau Dr. Wesseling ein, dass bisher lediglich seine Symptome gelindert wären, er die Ursache, den Auslöser aber nach wie vor verdrängen würde. In der kommenden Woche wollte sie mit ihm in die ehemalige Kaserne des Fort Blücher im Schatten der Rheinbrücke. An den Ort, an dem sein Leben sich so folgenschwer gewendet hatte. Obwohl er etwas anderes ahnte, redete er sich ein, bereit für diese Hürde zu sein.
Die Besucherparkplätze kurz hinter der Einmündung des Weges zum Schwarzen Wasser waren erwartungsgemäß leer. An den meisten Wochenenden reichte das knappe Dutzend Stellplätze nicht aus. Und das, obwohl sie sehr versteckt lagen und überhaupt nicht nach öffentlichem Parkplatz aussahen. Aber der fast sechs Kilometer lange Rundweg um den herrlichen Heideweiher über Holzbrücken, vorbei an riesigen Ameisenhaufen und herrlich gelegenen Aussichtspunkten, war bei Spaziergängern und Joggern sehr beliebt. Heinrich konnte den Lauf um das dunkle Gewässer nur einsam richtig genießen. Oder mit Annette. Ihre morgendlichen Joggingrunden führten sie hin und wieder hierher. Sie hatte sich heute frei genommen, war bereits unterwegs in die Eifel nach Schalkenmehren. Ihr Vater fühlte sich nicht gut. Annette meinte, er könne einfach nicht mehr alleine sein.
Bei der Weggabelung an der hölzernen Hinweistafel bog er links ab. Die meisten Läufer und Spaziergänger liefen von hier aus gesehen rechts um den See. Heinrich hatte die Erfahrung gemacht, dass es besser war, den anderen entgegenzulaufen. Auf diese Weise musste er niemanden erschrecken oder die Sorge haben, ein Spaziergänger würde unvermittelt einen Schritt zur Seite setzen und ihn behindern. Er hielt sich an diese Gewohnheit, obwohl er um diese Uhrzeit keinen Spaziergänger erwartete.
Mittlerweile hatte er die gegenüberliegende Seite des Sees erreicht, war dem geschwungenen Weg zwischen Moor- und Heidelandschaft auf der einen und dem ausladenden Uferbereich auf der anderen Seite gefolgt. Über einen mit dicken Holzbohlen belegten Steg, der die Form eines »S« hatte, gelangte Heinrich auf die Schlussgerade. Seine Laufschuhe gaben ein dumpfes Stakkato von sich. Kurz darauf sah Heinrich die Anhöhe rechts neben sich hinauf. Der Hügel war nur wenige Meter hoch, aber von dort hatte man einen wundervollen Ausblick über den dunklen See und die Tier- und Pflanzenwelt im Uferbereich. Als Heinrich sich in Höhe des Aufstiegs befand, eine Treppe aus eingegrabenen Baumstämmen, blieb er unvermittelt stehen. Die aufgehende Sonne tanzte in unzähligen Lichtreflexen durch das Laub der Birken und ließ die Gestalt auf einer der Bänke wie einen blassen Schatten erscheinen. Bei ihrer ersten Begegnung hatte er sich erschrocken, mittlerweile rechnete er fast damit, ihn hier und um diese Zeit anzutreffen. Vorsichtig stieg Heinrich den Hügel empor. Nach jedem Schritt hielt er einen Augenblick inne, beobachtete den Mann. Jeder Muskel war angespannt, konzentriert bemühte Heinrich sich darum, kein Geräusch zu verursachen. Auf der Kuppe angekommen, schlich er sich, immer noch gebückt, langsam von hinten an die Bank heran. Er freute sich diebisch. Er achtete darauf, seine Füße nur auf weiches Gras zu setzen, kein leises Knacken oder Rascheln sollte ihn verraten. Die Zielperson saß bewegungslos da und beobachtete den Uferbereich. Einen halben Schritt hinter der Bank streckte Heinrich im Zeitlupentempo den linken Arm aus, um den Mann leicht an der Schulter zu berühren. Wenige Zentimeter trennten ihn noch vom morgendlichen Erfolg.
»Morgen, Heinrich, setz dich.«
Enttäuscht zog der Angesprochene seinen Arm zurück und folgte der Anweisung. Dabei fasste er seinem Gesprächspartner in den Nacken.
»Morgen, Joschi. Wo ist es?«
»Was?«
»Das hintere Auge.«
Der Angesprochene drehte sich zur Seite, grinste breit.
»Brauche ich nicht, wenn ein Bulle angetrampelt kommt.«
Grimm schüttelte ungläubig den Kopf. Er konnte sich nicht vorstellen, dass Joschi ihn gehört hatte.
»Meine vorderen Augen reichen.«
Kumpelhaft legte er Heinrich den Arm um die Schulter und beschrieb mit dem anderen Arm eine weitläufige Bewegung in Richtung des gegenüberliegenden Ufers.
»Damit habe ich dich auf der anderen Seite kommen sehen. Zwanzig Minuten später bist du meistens hier.«
Er sah auf die Uhr.
»Heute dreiundzwanzig, wo warst du so lange?«
Heinrichs Augen hafteten an der sündhaft teuer aussehenden Armbanduhr, die so wenig zu Joschi passen wollte wie die knallrote Baseballkappe auf seinem Kopf. Die hatte er am Berliner Tor in der Innenstadt entdeckt und für gut befunden. Ein zusammengerollter olivgrüner Schlafsack und eine zerschlissene karierte Decke neben ihm im Gras deuteten daraufhin, dass er die Nacht hier am See verbracht hatte.
Vor einem Monat waren sie sich das erste Mal begegnet, drüben an den Teichen, an denen Heinrich gelegentlich angelte. Seit der Pensionierung suchte er zunehmend die Abgeschiedenheit. In die Stadt oder zum Auesee ging er immer seltener. In den ersten Wochen konnte er der Frage nach dem Urlaub noch mit einem dumpfen Grummeln oder angedeuteten Nicken begegnen. Irgendwann wurde, so glaubte er jedenfalls, seine Version der Geschichte von der unerwartet frühen Pensionierung erwartet. Ehemalige Kollegen aus dem Schutzbereich waren förmlich aus ihren Streifenwagen gesprungen, nur um ihm schulterklopfend zu beteuern, wie sehr ihn alle vermissten und vor allem wie beneidenswert gut er es nun habe. Dann, nach Weihnachten, hupten sie im Vorbeifahren oder ließen die Seitenscheibe herunter, um ihm etwas zuzurufen. Mittlerweile beschränkten sie sich darauf, lässig zu grüßen oder freundlich zu nicken. Seine Mutter legte unauffällig Prospekte von Busunternehmern mit Sonderangeboten für Senioren auf den Tisch. Die Gewerkschaft der Polizei lud ihn gelegentlich zu gemütlichen Nachmittagen der »Ehemaligen« ein und Annette hatte einmal den Vorschlag gemacht, er solle sich eine ehrenamtliche Tätigkeit suchen, um die Tage sinnvoll zu füllen. In wenigen Wochen stand sein vierundfünfzigster Geburtstag an und es kam ihm vor, als würde der Zug der Gesellschaft in voller Fahrt an ihm vorbeirauschen und er, jenseits der Schranke, hinterherwinken.
Joschi bemerkte den Blick seines morgendlichen Besuchers. Er nahm die Uhr ab und reichte sie Heinrich.
»Bitte schön, ein Geschenk des Hauses. Fast neu und hundertprozentig wasserdicht.«
»Was?«
Heinrich zuckte unwillkürlich zurück und betrachtete Joschi erstaunt. Er trug gewelltes dunkelblondes Haar mit starker Graueinfärbung. Der Dreitagebart bedeckte fast das ganze Gesicht. Die zurückliegenden graublauen Augen blinzelten ihn an, als schienen sie ein Geheimnis bewahren zu wollen.
»Ich habe beschlossen, ganz ohne Wohlstandsballast auszukommen. Ich hab’ sie von meinem letzten Geld gekauft und nun möchte ich sie dir schenken. Ich möchte nur noch ich selber sein, verstehst du das?«
»Ehrlich gesagt, nein.«
»Macht nichts. Trage die Uhr in Ehren, vielleicht wird sie mal wichtig für dich.«
Er zwinkerte mit dem linken Auge.
»Sieh mal dort.«
An einem Grashalm am Holzzaun zwei Meter vor ihnen hatte sich eine kinderhandgroße Libelle niedergelassen. Die beiden Flügelpaare glänzten bläulich in der Sonne. Auf ihrem Körper befanden sich Punkte in verschiedenen Gelbtönen, wie an einer Schnur aufgereiht.
»Eine Moosjungfer. Ein Weibchen übrigens. Erkennt man an den großen dunkelgelben Flecken auf dem Körperrücken. Die dürftest du nicht kennen, stimmts?«
Heinrich wunderte sich darüber, dass er diese Art noch niemals gesehen hatte. Er saß oft stundenlang mit seiner Angel am Ufer und beobachtete die Natur. Und das nur einen knappen Kilometer Luftlinie entfernt. Eine derart farbenprächtige und schöne Libellenart wäre ihm sofort aufgefallen.
»Du hast Recht. Aber warum ist das so? Der Teich, an dem ich angeln gehe, ist doch auch ein natürliches Gewässer.«
Joschi lachte. Er genoss offenbar seine Neugier.
»Die Moosjungfer lebt nur an möglichst fischfreien Gewässern. Warum weiß ich nicht. Aber das Schwarze Wasser ist einfach zu nährstoffarm und säurehaltig, als dass Fische darin leben könnten. Deshalb bekommen Angler sie nicht zu Gesicht.«
»Hm … schade eigentlich. Aber du lenkst ab. Warum gibst du dein Geld für eine Uhr aus, die du auch noch verschenken willst, und gehst stattdessen betteln?«
Joschi senkte den Kopf. Für eine Weile schwieg er.
»Weißt du, wenn man alles im Überfluss hat, wird auch alles beliebig und reizlos. Nichts ist wirklich von Wert, außer das Leben selbst. Ich habe all die Jahre unterwürfig dem Luxus geopfert, bis ich eines Tages an der Himmelstür stand. Spätestens dort wird einem klar, was wirklich zählt. Auch wenn du es nicht verstehen kannst: Dieses Leben macht mich glücklich so. Außerdem: Ich bettele nicht! Ich helfe alten Menschen beim Einkauf, sammle Pfandflaschen aus Grünstreifen und Parks oder winke gestresste Wohlstandsmenschen zum nächsten freien Parkplatz. Das ist ein Unterschied!«
Joschi wollte empört klingen, der Versuch endete in einem stillen Lächeln. Heinrich hatte ihm fast andächtig zugehört. Er musste sich eingestehen, dass ihn die Konsequenz, mit der Joschi seinen Weg ging, beeindruckte. Gleichzeitig dachte er daran, wo Joschi wohl im Winter die Tage und Nächte verbringen würde. Verschwendete er überhaupt einen Gedanken daran oder ließ er sich ganz einfach treiben? Joschi bat ihn noch einmal mit Nachdruck, die Uhr anzunehmen.
»Okay, vielen Dank, Joschi. Wenn du mal Hilfe brauchst …«, Heinrich suchte tatsächlich in seiner Jogginghose nach einer Visitenkarte. Wieder einmal wurde ihm schmerzhaft bewusst, dass er noch nicht mit seinem vergangenen Leben abgeschlossen hatte. Peinlich berührt sah er Joschi an, der das Treiben amüsiert beobachtete.
»Einmal Bulle, immer Bulle, was? Lass mal, wenn ich dich brauche, finde ich dich schon.«
Auf dem Rückweg dachte er darüber nach, warum zwei so unterschiedliche Menschen wie Joschi und er sich so gut verstanden. Ihre einzige Gemeinsamkeit war ihre Liebe zur Natur. Doch es musste noch etwas geben, das sie verband. Ihre Begegnung am Schwarzen Wasser, draußen vor den Toren der Stadt, war kein Zufall. Sie waren wohl beide Menschen am Rande der Gesellschaft. Er spürte sein Selbstmitleid, das er so sehr hasste. Eine für sich belanglose Aktion wie die Suche nach einer Visitenkarte genügte, seine anfänglich geradezu euphorische Stimmung zu trüben. Er ärgerte sich darüber, lief immer schneller, als wolle er den Gedanken davonlaufen, die Ausschüttung der Dopamine erzwingen. Dabei bemühte er sich, positiv zu denken. Rief sich die Worte seiner Therapeutin ins Bewusstsein. Carpe diem – nutze den Tag.
»… für die schönen Dinge des Lebens«, hatte sie das Zitat des römischen Dichters Horaz ergänzt. Es funktionierte, er war längst wieder in den normalen Laufschritt zurückgekehrt.
Kapitel 2
Am nächsten Tag
Annette und Heinrich waren zum Auesee gejoggt, hatten diesen wie immer einmal umrundet und auf dem Rückweg vom Bäcker Vollkornbrot mitgebracht. Der sonnige Frühlingsmorgen mit seiner klaren, lauwarmen Luft in Verbindung mit dem Lauf durch die erwachende Natur hatte bei beiden für höchste Glücksgefühle gesorgt. Als Annette die Duschkabine bestieg, zog er sich schnell aus und folgte ihr. Eine Hand auf ihrem Rücken, die andere auf ihrem Po, drückte er sie fest an sich. Immer wieder klatschten ihre umschlungenen Körper gegen die Wände der engen Zelle.
Als er wenige Minuten später aus der Dusche kam und durch den schmalen Flur ins Schlafzimmer ging, erschrak er. Wie selbstverständlich legte seine Mutter einen Stapel akkurat gefalteter Handtücher in den Schrank. Eher beiläufig warf sie ihm einen kurzen Gruß zu.
»Was hast du denn hier zu suchen?«
Heinrich wurde wütend. Er konnte es nicht ausstehen, dass seine Mutter permanent seine Privatsphäre missachtete.
»Danke, Mutter, heißt das! Schließlich habe ich für dich gewaschen und gebügelt.«
Heinrich schüttelte den Kopf. Sie nutzten den großen Waschkeller für beide Parteien, was, so glaubte er damals, weiterhin kein Problem darstellen dürfte. Nach dem Tod seiner Frau vor neun Jahren drängte es seine Mutter jedoch zunehmend in die angestammte Rolle zurück. Er zog die Schlafzimmertür hinter sich zu.
»Kannst du dir vielleicht vorstellen, dass hier zwei erwachsene Menschen sind, die … ich meine … es wäre doch möglich …«
»War nicht zu überhören«, unterbrach sie ihn trocken. Heinrich rang nach Worten.
»Und trotzdem kommst du einfach hier herein? Hast du nicht den geringsten Respekt vor meinem Privatleben?«
Mutter Grimm räumte unbeeindruckt die Unterwäsche ihres Sohnes in die Kommode am Fenster.
»Mutter, so geht das nicht weiter!«
Sie fuhr plötzlich herum, stemmte die Arme in die Hüfte und sah ihn missbilligend an.
»Also erstens habe ich draußen vor der Tür gewartet, bis ihr fertig wart, und zweitens kann ich mich mit dem Haushalt nicht nach dem Liebesleben meines Sohnes richten.«
Heinrich wollte noch anmerken, dass es sein Haushalt sei, da öffnete sich die Schlafzimmertür einen Spalt.
»Ich bin so weit, kommt ihr frühstücken?«
Die Stimmung zwischen Mutter und Sohn war gedrückt. Annette schmunzelte in sich hinein. Das Verhalten von Frau Grimm amüsierte sie. Nur wenn Mutter Grimm sich mal wieder in polizeiliche Dinge einmischte, verstand sie keinen Spaß.
»Heinrich, was hältst du davon, wenn wir uns heute Nachmittag nach einer Wohnung für meinen Vater umsehen?«
In der vorigen Woche hatte sie ihren Vater gebeten, sich die Entscheidung noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen. Gestern Abend hatte er angerufen und gesagt, dass er sich in der Eifel einsam fühle und in die Nähe seiner Tochter nach Wesel ziehen wolle. In kurzen Sätzen klärte sie Gertrud Grimm auf, die seltsamerweise noch nichts davon mitbekommen hatte.
»Wir haben doch den kompletten Speicher frei. Da könnte er ja einziehen. Heinrich müsste ihn nur leer räumen und ein wenig herrichten. Ich könnte für ihn mitkochen und das bisschen Wäsche mehr …« Sie winkte lässig ab.
»Und auf das bisschen Privatsphäre kann er bestimmt verzichten. Sicher fühlen würde er sich auch, er wäre ja praktisch unter ständiger Beobachtung.«
Sie warf ihrem Sohn einen unheilvollen Blick zu.
»Lass mal, Mutter, Annettes Vater soll zuerst einen guten Eindruck von Wesel bekommen. Später können wir dich ihm immer noch vorstellen.«
Um Viertel vor neun machte es sich Heinrich mit einer Tasse Kaffee und einer Tageszeitung im Sessel gemütlich, nachdem er den Tisch abgeräumt hatte. Zusätzlich schaltete er Radio KW ein, den Lokalsender. Für zehn Uhr hatte er sich mit Joschi am Schwarzen Wasser verabredet. Die biologische Station Wesel hatte eine Sensation angekündigt. Die in der Mitte des letzten Jahrhunderts verschwundene Wasserlobelie sollte wieder angesiedelt werden. Dazu hatten sie den Uferbereich im südlichen Teil des Gewässers von Schlamm und Schlick befreit. Dass der dort lebende Kammmolch ein wenig von seinem Revier abgeben musste, war, so die Meinung der Biologen, vertretbar. In der Bevölkerung war die Anteilnahme eher verhalten, umso beachtlicher erschien das enorme Medieninteresse. Joschi wollte in aller Frühe eine der Bänke auf dem Aussichtspunkt reservieren. Er lag genau gegenüber der Stelle, an der an diesem Morgen die ersten Exemplare dieser seltenen Wasserpflanzenart der Natur übergeben werden sollten. Heinrich freute sich über die Abwechslung. Er blätterte durch die Zeitung, überflog zunächst die Überschriften. Gelegentlich weckte ein Artikel seine Aufmerksamkeit und er las ihn. Im Lokalteil angelangt, fiel sein Blick sofort auf den Aufmacher von Camel. »Umgehung umgeht Bürgerinteresse« titelte der Lokalredakteur plakativ. Der Bericht selbst über den Protest der Büdericher Bürger gegen die geplante Umgehungsstraße enthielt überwiegend heiße Luft und bekannte Phrasen des dubiosen Reporters. Heinrich wollte umblättern, als der Radiosprecher etwas von einer Leiche erzählte und einer Schaltung nach Wesel. Heinrich drehte lauter.
»… ist heute Morgen im Vorfeld zur Präsentation dieser seltenen Pflanze eine Leiche am Ufer des Schwarzen Wassers gefunden worden. Einzelheiten hierzu will die Weseler Polizeidienststelle am Nachmittag bekannt geben. Wir halten Sie wie immer auf dem Laufenden. Jürgen Knorr, Radio KW.«
Heinrich warf die Zeitung auf den Tisch und sprang hoch. Sollte Joschi wieder dort geschlafen haben, war er möglicherweise in Gefahr. Zwar hatte der Sprecher nichts von einer Gewalttat gesagt, aber auszuschließen war dies nicht. Als er die Treppe herunterkam, stand seine Mutter mit Jacke und Schuhen bekleidet im Flur.
»Gehst du in die Stadt?«
»Nein, ähem … ich mache einen Spaziergang. Am Schwarzen Wasser soll es sehr schön sein.«
»Vor allem, wenn dort eine Leiche gefunden wird, nicht wahr?«
»Ach tatsächlich?«
Heinrich schüttelte den Kopf und verließ schnellen Schrittes das Haus.
Kapitel 3
Bereits an der Einmündung zur Flürener Heide war die Straße abgesperrt. Heinrich grüßte seine ehemaligen Kollegen freundlich und lief strammen Schrittes an der Absperrung vorbei. Sie sahen ihm unschlüssig hinterher. Heinrich atmete auf. Unterwegs hatte er sich gefragt, wie sie wohl reagieren würden. Statt der erwarteten unangenehmen Fragen ließen sie ihn unbehelligt durch. Dies dürfte seiner Mutter nicht möglich sein, dachte er zufrieden.
Wenige Meter vor dem kleinen Parkplatz bog ein Leichenwagen auf die schmale Straße. Heinrich musste auf den Grünstreifen ausweichen. Ihn überkam dieses beklemmende Gefühl, das er nie vergessen würde.
Er hatte in seinem Berufsleben mehr als einen Mordfall gelöst. Die Suche nach Indizien, das Erkennen und Lesen der Spuren am Tatort, all dies war für ihn wie ein Rätsel gewesen, welches es zu lösen galt. Es war eine Herausforderung, der er sich stellte. Er war seinem Beruf mit einer Mischung aus Professionalität und Passion nachgekommen. Er hasste diesen Beruf und er liebte ihn. Aber immer dann, wenn der graue Zinksarg an ihm vorbeigetragen wurde, geriet all dies für einen Augenblick in Vergessenheit. In diesen Momenten versanken die Gedanken an Spuren, Alibis und Motive im Meer der Endlichkeit. Schon sehr früh in der Ausbildung wurde ihnen beigebracht, sich eine möglichst neutrale Sichtweise zu bewahren. Jeder Fall sollte ein solcher bleiben, durfte sich nicht in die Psyche des Ermittlers graben. Graue Theorie, wusste er heute.
Der kleine Waldparkplatz war bis zur letzten Lücke gefüllt. Heinrich erkannte die zivilen Einsatzfahrzeuge der Weseler Kriminalpolizei. Außerdem befanden sich je ein Geländewagen vom Forstamt und von der biologischen Station neben Autos, die er bis auf einen altersschwachen Ford Mustang nicht kannte.
Da Heinrich nicht genau wusste, wo der Tote gefunden worden war, und weil er sich mit Joschi verabredet hatte, lief er geradewegs zum Treffpunkt. Von weitem erkannte er auf der Anhöhe einige Journalisten, die mit mächtigen Teleobjektiven hantierten. Hastig klomm er den Hügel hinauf. Die Reporter beachteten ihn nicht. Außer ihnen war niemand dort. Heinrich schob sich in eine Lücke an den maroden Holzzaun. Vor einigen Jahren hatte die biologische Station Wesel diesen Zaun rund um das Gewässer errichtet, um seltene Tier- und Pflanzenarten im Uferbereich zu schützen. Auf der anderen Seite des dunkel schimmernden Heideweihers erkannte er Manuela Warnke, seine Nachfolgerin, und Adriano, seinen langjährigen Partner. Sie unterhielten sich mit einem älteren Herrn, der ihm bekannt vorkam. Erst jetzt fiel ihm auf, dass die Kripo augenscheinlich von einer natürlichen Todesursache ausging. Weder war der Tatort gesichert noch gab es Hinweise, dass die Kriminaltechnik anwesend war. Im Augenwinkel bemerkte Heinrich die musternden Blicke der Journalisten. Er kam sich wie einer jener Schaulustigen vor, die er einmal in seiner aktiven Zeit als »Tatortparasiten« bezeichnet hatte. Dabei dürfte er wohl der Erste sein, neben Joschi natürlich, der einen Grund hatte, hierherzukommen. Aus dem Hintergrund winkte ihm der Redakteur einer Lokalzeitung zu.
Wieder auf dem Hauptweg angekommen, überlegte Heinrich, Joschi zu suchen, verwarf den Gedanken aber sofort wieder. Joschi liebte die Abgeschiedenheit, die leise Hintergrundmusik der Natur, wie er es ausdrückte. Die Medienvertreter hatten ihn vertrieben, da war Heinrich sicher. An der Weggabelung traf er Annette.
»Wir waren doch heute Morgen schon joggen. Ist da jemand neugierig?«, grinste sie ihn an.
Heinrich schürzte die Lippen. Er konnte nicht verhehlen, dass er in diesem Moment gerne wieder in seinem alten Beruf gewesen wäre.
»Komm schon«, sie hakte sich bei ihm unter, »hier gibt es nichts für dich zu ermitteln. Selbst wenn du noch im Dienst wärst.«
»Habe ich mir schon gedacht. Deshalb bin ich auch nicht hier.« »Ist klar. Wie komme ich bloß darauf? Dumm von mir.« Heinrich seufzte theatralisch.
»Ich war verabredet.«
»Ach so. Und – wie heißt sie?«
Annette schien Spaß daran zu finden.
»Joschi. Habe ich dir mal von ihm erzählt?«
»Joschi …«
Sie befanden sich in Sichtweite des Parkplatzes, als Annette plötzlich stehen blieb und ihren Freund mit ernstem Blick ansah.
»Der obdachlose Naturliebhaber, ich erinnere mich. Der Tote von heute Morgen war augenscheinlich ebenfalls obdachlos. Wir wissen noch nicht einmal, wer er ist. Er trug keinerlei Ausweispapiere bei sich. Ist das Schwarze Wasser eine Art Treffpunkt für Wohnungslose?«
»Nicht, dass ich wüsste …«
Kapitel 4
Heinrich wurde unruhig. Er suchte nach einem plausiblen Grund. Einer logischen Erklärung, die seine schlimmste Befürchtung widerlegen könnte. So sehr er sich auch anstrengte, stieß er auf zwei übermächtige Fakten: Joschi war nicht zu ihrer Verabredung erschienen und Heinrich war hier nie einem anderen Obdachlosen begegnet! Er berichtete Annette von seinen Befürchtungen. »Du weißt, was das bedeutet?«
Annettes Stimme war mitfühlend. Heinrich nickte stumm.
Eine halbe Stunde später betrat Heinrich in Begleitung von Manuela Warnke das Leichenschauhaus an der Wilhelm-Roelen-Straße in Walsum-Aldenrade. Ein Mitarbeiter der Rechtsmedizin, der sich höflich als Thorsten Kreutzer vorstellte, führte sie durch kühle, weiß geflieste Flure in einen von grellem Neonlicht durchfluteten Saal, an dessen Stirnseite Kühlfächer in die Wand eingelassen waren. Kreutzer zog in Hüfthöhe eine Bahre hervor. Obwohl Heinrich bewusst war, dass die Leichen in diesem Fall nicht mit einem Tuch verhüllt waren, erschrak er beim Anblick des Toten. Sekunden später war das Gesicht erkennbar, das letzte kleine Fünkchen Hoffnung erlosch. Heinrich ließ die Augen nur wenige Sekunden auf dem leblosen Antlitz ruhen, dann wandte er sich nickend ab. Während Kreutzer die Bahre zurückschob, senkte Heinrich den Kopf. Seine Knie zitterten leicht. Wenngleich er den Toten kaum kannte, fühlte er sich in diesem Augenblick auf eine seltsame Weise mit ihm verbunden.
Unterwegs zum Auto fragte ihn Manuela Warnke, was er über Joschi wisse. Ihm fiel auf, wie erschreckend wenig dies war. Nicht einmal seinen Namen kannte Heinrich. Gleichzeitig bedrückte ihn die Gewissheit, dass er jemanden verloren hatte. Auch wenn sie sich nicht öfter als ein Dutzend Mal begegnet waren, hätte Joschi ein Freund werden können. Wenn er die Dauer aller Treffen zusammenrechnete, hatten sie nicht einmal einen ganzen Tag zusammen verbracht und dennoch spürte er eine seltsame Leere. Vielleicht lag es an seinem langen Polizistenleben. Daran, dass der Job mit seinen Abertausenden Überstunden keinen Raum gelassen hatte für Freundschaften. Vielleicht vermochte er deren Wert dadurch erst richtig einzuschätzen.
»Wann hast du diesen Joschi das erste Mal gesehen?«
Adriano saß vor ihm auf dem Beifahrersitz, drehte sich halb zu Heinrich um.
»Hm … Das war im Mai. Vor drei bis vier Wochen.«
»Hat er nie gesagt, wo er herkommt oder wer er ist?«
»Nein.«
Manuela beobachtete ihn durch den Innenspiegel. Heinrich versuchte aus ihren Augen zu lesen, ob sie ihm glaubte. Sofort schien ihm der Gedanke absurd. Warum sollte sie ihm nicht glauben? Erst jetzt fiel ihm auf, dass er nicht einmal wusste, woran Joschi gestorben war. Er fragte die Ermittler danach.
»Die Todesursache ist unklar, Dr. Bahman vermutet Herzversagen. Wir haben ein Medikament mit dem Namen Strophanthus bei ihm gefunden. Laut Bahman ein Herzmittel auf Pflanzenbasis. Wird in der Homöopathie angewendet. Daraus lässt sich schließen, dass der Tote herzkrank war. Was wiederum die Vermutung bezüglich der Todesursache untermauert.«
Heinrich Grimm legte nachdenklich die Stirn in Falten. Joschi hatte nie erwähnt, dass er krank war. Ihn beschlich das Gefühl, dass er mehr als nur eine Unstimmigkeit übersehen hatte. So hatte er nach jeder Begegnung mit Joschi empfunden, das fiel ihm jetzt auf. Er hatte nicht ernsthaft nach Erklärungen gesucht, weil er diese manische Angewohnheit ja gerade ablegen wollte. Die »innere Uniform«, wie seine Therapeutin es nannte, wollte er an den Nagel hängen.
Sie passierten die Kreuzung Tenderingsee in Höhe der Ortschaft Voerde. Heinrich fühlte sich innerlich zerrissen. Einerseits würde er liebend gerne Dr. Bahman einige Fragen stellen, auf der anderen Seite wollte er das Geschehene akzeptieren. Er hatte sich immer darüber aufgeregt, wenn sich seine Mutter in die Ermittlungen einmischte. Er versuchte, seine Irritation als den kümmerlichen Rest seiner Berufskrankheit mit Namen Neugierde einzustufen. In Wesel angekommen, war er immer noch traurig, spürte aber auch mentale Stärke. Wenige Minuten später befand er sich in seinem ehemaligen Büro. Adriano schrieb das Protokoll, das er unterzeichnen musste.
»Eigentlich wäre damit alles klar«, fluchte der Oberkommissar, »aber jetzt dürfen wir noch ein Leichenermittlungsverfahren aufmachen, nur weil dieser Penner keinen Ausweis bei sich …«
Erschrocken bemerkte Adriano seinen Fauxpas und entschuldigte sich bei Heinrich, der ihn entsetzt ansah. Heinrich unterschrieb das Protokoll und verließ nach kurzem Gruß das Büro. Der Mann hinter der Theke der Zentrale winkte freundlich, als er den Türöffner bediente.
Auf seinem Weg über die Jülicher Straße fragte Heinrich sich, ob Joschi irgendwelche Angehörigen hatte, die es zu verständigen galt. Gab es außer ihm überhaupt irgendeinen Menschen, der Joschi vermisste?
Zu Hause angekommen gab er seiner Mutter Bescheid, dass er keinen Appetit hatte und verzog sich nach oben in seine Wohnung. Er kochte einen Kräutertee und setzte sich mit einem Buch in den Sessel am Fenster. Nach fünf Minuten legte er das Buch beiseite. Ihm fehlte die Konzentration. Er machte es sich auf dem Sofa bequem, wollte eine Stunde schlafen. Auch das sollte ihm nicht gelingen. So schob er den Sessel ans Fenster, setzte sich wieder hinein und sah abwechselnd nach draußen und auf die Uhr. Zwei Stunden und dreizehn Minuten vergingen, bis er die vertrauten Schritte auf der Treppe hörte.
Annette begrüßte ihn mit einem Kuss und setzte sich zu ihm.
»Ich kann verstehen, dass du dir heute mit mir keine Wohnungen ansehen möchtest. Macht es dir was aus, wenn ich alleine in die Stadt fahre?«
Heinrich hatte es satt, länger aus dem Fenster zu starren. Froh über die Abwechslung begleitete er seine Freundin.
Kapitel 5
Am nächsten Morgen saß Heinrich lustlos am Frühstückstisch. Die Joggingrunde mit Annette war ihm heute ungewöhnlich schwergefallen.
Sie hatten gestern drei Wohnungen besichtigt, aber keine davon hatte Annette gefallen. Gegen Abend aßen sie noch beim Italiener an der Doelenstraße. Die ganze Zeit über vermieden sie es, über Joschis Tod zu reden. Heinrich war froh über die Ablenkung. Er war natürlich noch traurig, begann aber, nachdem er eine Nacht darüber geschlafen hatte, rationaler damit umzugehen. Beim Laufen hatten sie in losen Stücken darüber gesprochen. Annette meinte, es ginge gar nicht so sehr um die Person Joschi, sondern vielmehr um ihn. Durch Joschi war er aus sich herausgekommen, hatte andere Dinge schätzen gelernt, wieder aktiv am Leben teilgenommen. Anfangs war er ein wenig pikiert gewesen. Nach einigen Minuten hatte er zugegeben, dass sie nicht ganz falsch lag.
Da Heinrich den heutigen Tag noch nicht verplant hatte, nahm er sich vor, mehr über Joschi in Erfahrung zu bringen. Vielleicht gelang es ihm, Angehörige ausfindig zu machen, die sich wenigstens um eine ordentliche Beerdigung kümmern konnten. Inzwischen war Annette aus dem Bad gekommen. Der Duft von Seife und einem unaufdringlichen Parfüm wehte herüber, als sie ihm gegenüber Platz nahm. Diese Komposition zauberte unweigerlich ein Lächeln auf Heinrichs Gesicht. Seine Mundwinkel hoben sich, als würden sie von unsichtbaren Fäden gezogen. Sie sackten jedoch schlagartig ab, als seine Mutter mit der aktuellen Ausgabe des Rheinischen Boten in der Hand ins Zimmer stürzte. Wie immer hatte sie im Vorbeigehen an die offene Tür geklopft.
»Herein«, giftete Heinrich sie an.
»Ich habe angeklopft«, gab sie schnippisch zurück.
»Da warst du schon drin.«
»Natürlich. Ich muss doch erst nachsehen. Wenn keiner da ist, brauche ich nicht anklopfen.«
Sie antwortete in einem Tonfall, der die Selbstverständlichkeit ihres Handelns unterstützen sollte. Annette verschluckte sich vor Lachen an ihrem Orangensaft und hustete einmal kräftig. Heinrich schüttelte den Kopf. Immer häufiger kam ihm der Gedanke an Flucht. Eine Wohnung in der Stadt, nur mit Annette. Er hatte schon seit langem mit seiner Freundin darüber reden wollen. Paradoxerweise hatte er diesen Plan bislang aus Sorge um seine Mutter nicht in die Tat umgesetzt. Diese legte das Brötchen von seinem Teller in den Korb zurück und breitete die Lokalausgabe des Boten vor ihm aus. Dann zog sie eine Lupe aus der Kitteltasche und positionierte sie mit dem Glas auf einen Bildausschnitt. Heinrich las die Titelzeile und wusste sofort, von wem der Artikel stammte: Am Schwarzen Wasser lauerte der Tod