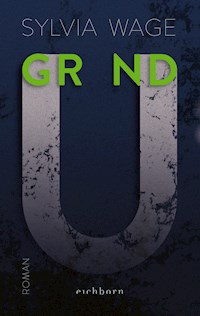
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein tiefer Brunnen im Keller des Elternhauses. Ein Brunnen, den die Erzählfigur dieser Geschichte, wie sie behauptet, im Alter von elf Jahren selbst gegraben hat. Ein Brunnen, in den sie als Teenager den Vater hinabstieß und jahrzehntelang gefangen hielt.
Im Plauderton, mit Lakonie und Leichtigkeit wird diese Familiengeschichte erzählt, parallel zu den Geschehnissen im Haus. Vom herrschsüchtigen Vater, vom Trinken der Mutter, den Lebenswegen der Schwestern und dem eigenen. Aber können wir dem Erzählten überhaupt Glauben schenken?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Der Brunnen
Die Schwestern
Lügen
Glas
Wir haben ein Problem
Theas Nicken
Unsichtbarkeit
Stellst du dich absichtlich so blöd?
Wozu der Brunnen?
Frühstück im Oktober
Steine und Katzen
Aus Gründen
Die schöne Elisabeth
Der Vater im Brunnen
Thea, die Meisterin der kopflosen Puppen
Das Versagen
Urlaub
Spazieren gehen
Als ob es Schläge bräuchte
Geisterwacht
Spinnen
Hochkommen
Spaten, Eimer, Rucksack
(Un)Sinn
Schaufel für Schaufel
Tanzen
Spurlos
Gaffer
Sturm
Liebe
Weihnachten ohne Vater, aber mit Gans
Liebe II
Feliz año
Nachbarschaft
Reisegepäck
Vergessen
Hinab
Elli
Niemand verschwindet spurlos
Thea
Der erklärte Tod
Drüberstreichen
Alles Lüge
Schreckliche Menschen
Katharsis
Über das Buch
Ein tiefer Brunnen im Keller des Elternhauses. Ein Brunnen, den die Erzählfigur dieser Geschichte, wie sie behauptet, im Alter von elf Jahren selbst gegraben hat. Ein Brunnen, in den sie als Teenager den Vater hinabstieß und jahrzehntelang gefangen hielt. Im Plauderton, mit Lakonie und Leichtigkeit wird diese Familiengeschichte erzählt, parallel zu den Geschehnissen im Haus. Vom herrschsüchtigen Vater, vom Trinken der Mutter, den Lebenswegen der Schwestern und dem eigenen. Aber können wir dem Erzählten überhaupt Glauben schenken?
Über die Autorin
Sylvia Wage, 1974 geboren in Zwickau, gelebt in Dresden, gestrandet in Berlin. Tätig in der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Pharma und Biotech. Literarisch engagiert – regional und virtuell. Veranstaltet Lesungen, Lesekreise und Autorentreffpunkte, administriert das literarische Blognetzwerk Wababbel und ist gelegentlich prägendes Mitglied im Berliner Literaturlabel zuckerstudio waldbrunn. Sylvia Wage ist Bonner Literaturpreis-Trägerin 2016 und Blogbuster-Preisträgerin 2020.
SYLVIA WAGE
ROMAN
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Eichborn Verlag in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, KölnText- und Bildredaktion: Matthias Teiting, LeipzigUmschlaggestaltung: Johannes Baptista LudwigEinband-/Umschlagmotiv: © Johannes Baptista Ludwig/Gestaltung LudwigeBook-Erstellung: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-0953-8
luebbe.delesejury.de
DER BRUNNEN
MEIN VATER LAG TOT auf dem Grund des Brunnens.
Das ist ein guter Anfang. Für ein Märchen. Denn anständige Märchen beginnen stets grausam. Der Held, natürlich reinen Herzens und gut bis in die Fußknöchel, sieht sich der Vernichtung gegenüber. Mordanschläge, eskalierende Väter, dämonische Stiefmütter, Vertreibung und Hass, Verlust der liebenden Mutter/Eltern, Abwertung, Degradierung, Abscheu.
Eine hoffnungslose Ausgangslage scheint ein guter Anfang für eine Geschichte, was mir recht ist, denn wenn ich mit einem dienen kann, dann mit Hoffnungslosigkeit.
Mein Vater lag tot auf dem Grund des Brunnens.
Es war sechs Uhr morgens, und ich starrte auf seinen abgemagerten Körper. Er lag auf der Seite, in Feinrippunterhemd und Jogginghose. Beides fleckig, beides zu groß. Er lag da, den Daumen im Mund, wie es kleine Kinder tun, genau so, wie er jeden Morgen dalag, wenn ich hereinkam und nach ihm sah. Nur, dass er heute tot war. Ich wusste es, noch bevor mein Blick auf ihn fiel, noch bevor ich die wenigen Schritte zum Brunnen ging, noch bevor ich das Licht anschaltete. Der Tod begrüßte mich, als ich die Hand auf die Klinke der Kellertür legte, er nickte mir freundlich zu, und ich nickte zurück.
Mein Vater lag tot auf dem Grund des Brunnens.
Und ich zögerte. Nur einen Lidschlag lang, aber später werde ich sagen, dass es ein sehr tiefes Zögern war und ich in diesem Moment wirklich alles hätte anders entscheiden können und – wenn ich ein guter Mensch wäre – es auch anders entschieden hätte. Doch da mir nie die Gelegenheit gegeben wurde, ein guter Mensch zu werden, griff ich in meine Jackentasche, holte das Telefon heraus und rief meine Schwestern an.
DIE SCHWESTERN
GUT. ICH HABE gelogen.
Es war gar kein Brunnen.
Aber das Loch im Keller sah nun mal genau so aus, wie man sich einen Brunnen im Märchen vorstellt, in welchen die Helden hinabsteigen, um in eine andere Welt zu gelangen. Ganz genau so.
Rund dreieinhalb Meter tief und mit einer hübschen hüfthohen Umrandung aus Natursteinen. Der Flaschenzug darüber war vielleicht ein bisschen zu modern für einen märchenhaften Brunnen, aber auf den ersten Blick fiel das kaum auf.
Das Loch hatte alles, was ein Brunnen braucht, mal abgesehen vom Wasser. Es war nicht einmal sonderlich feucht oder klamm auf dem Grund. Das Stroh, auf dem die Matratze meines Vaters lag – eine recht gute Matratze, wie ich hinzufügen möchte, zwar schon ein wenig in die Jahre gekommen, aber anständigem Federkern mache das nichts aus, hatte mir Tante Bärbel versichert, als sie eines Morgens mit eben dieser Matratze vor dem Haus stand –, jedenfalls, das Stroh musste nur alle halbe Jahre getauscht werden, so trocken war es da unten.
Aber trotz des fehlenden Wassers gefällt mir die Idee eines Brunnens besser. Loch. Loch kann alles sein. Eine Höhle. Oder etwas, das Holzwürmer in Tische fressen. Loch an Loch und hält doch, was ist das? Ins Loch wird man gesteckt und kommt wieder raus. Doch niemand kehrt als der zurück, der er einst war, wenn er in einen Brunnen hinabgestiegen ist.
Ich dachte also über Löcher nach, und meine Schwestern standen neben mir und schauten über die Brunnenumrandung hinab zu Papa. Ich konnte noch nie sehr lange bei einer Sache bleiben, stets huschten meine Gedanken hin und her, als wären sie Glühwürmchen auf Koks. Wuschwusch – flitzten sie, vom Kleinen zum Großen, von hier nach da, aber irgendwann fiel mir das Schweigen meiner Schwestern auf.
Beide starrten mit nahezu identischem Gesichtsausdruck auf den dürren, ausgemergelten Körper am Grund des Brunnens. Kein Entsetzen, keine Überraschung lag in ihren Gesichtern, nur Leere. Und kein Laut kam von ihnen. Es war still wie an einem kühlen Morgen, einem, der gerade noch Nacht ist, kurz bevor die Dämmerung die Vögel weckt.
Obwohl der Ausdruck meiner Schwestern äußerlich so völlig gleich schien, war ihre Energie doch grundverschieden. Während Elli, ich wusste es genau, schon erste Überlegungen zur Lösung des Problems anstellte, versuchte Thea, Schmerz zu empfinden. Trauer. Über den Verlust des Vaters.
Vielleicht hätte ich Thea nicht anrufen sollen.
Aber ein gutes Märchen braucht nun mal völlige Hoffnungslosigkeit – und niemand konnte mir so zielgenau jede Hoffnung nehmen wie Thea.
»Woher zum Teufel kommt dieser Brunnen?«, fragte Elli in die Stille und das Wuschen meiner Gedankenglühwürmchen hinein.
»Ich habe ihn gegraben«, sagte ich.
»Wann? Verfickte Scheiße! Wann?«
»Als ich elf war.«
LÜGEN
UND DAS WAR natürlich wieder eine Lüge. Ich lüge andauernd, aber das brauchen gute Geschichten: Lügen und Hoffnungslosigkeit.
Leider war diese Lüge zu offensichtlich: Nicht einmal der Held eines wirklich guten Märchens kann mit elf Jahren einen dreieinhalb Meter tiefen Brunnen im Keller eines Einfamilienhauses auf einem Hügel am Rande einer nichtssagenden Kleinstadt graben. Schon gar nicht unbemerkt von seinen Schwestern.
Korrekt war also: Ich begann mit dem Graben, als ich elf war. Genau wie mit dem Lügen.
Natürlich werde ich vorher schon gelogen haben, geflunkert. Geschummelt. Wie Kinder das eben tun. Nein, Mami, ich habe den Kuchen nicht gegessen, nicht den Fernseher eingeschaltet, keinesfalls die Gummibärchen vom Dirk mit der dicken Brille geklaut.
Jedoch: In dem Augenblick, in dem ich mit der frisch gestohlenen Pflanzschaufel in den Keller unseres Hauses ging, durch die Waschküche, an dem Eingeweckten in Gläsern und den übrig gebliebenen Kohlen vorbei, ganz nach hinten, wo meine Großmutter ihr Zeug sammelte, bis mein Vater in seinem Ordnungssinn das Gerümpel verbot und ganz hinten nur noch ein recht ansehnlich großer, leerer Raum war, der Boden gestampfte Erde, hart und trocken; in dem Augenblick, in dem ich begann, mit der Pflanzschaufel den Boden abzukratzen, an ein Graben war nicht zu denken, vorerst, und mir mit dem Dreck die Hosentaschen füllte, um dann ebenso leise und unbemerkt wieder aus dem Keller hinauszuschleichen, dann draußen meine Taschen zu leeren: In diesem Augenblick begann die erste echte Lüge. Und außerdem begann mein Leben.
»Scheiße noch mal«, sagte Elli, »was soll das heißen? Mit elf? Wieso gräbst du mit elf Löcher in den Keller?«
»Einen Brunnen«, sagte ich, »kein Loch.«
»Hat das Ding Wasser?«
»Nein …«
»Dann ist es ein Loch.«
Über meine große Schwester muss man wissen, dass sie schon früh Verantwortung übernehmen musste und sich diese nie wieder nehmen ließ. Elli hatte das Sagen, Elli traf die Entscheidungen, und Elli verlangte Antworten.
»Wen interessiert der Brunnen?« Thea kreischte. Und fing an zu weinen. Beides gleichzeitig. Auch etwas, das nur Thea konnte. Direkt aus dem Nichts in ein Kreischheulen zu verfallen. »Papa …«, keifte Thea. »Papa!«
Während Thea also heulte, stellte ich mir vor, ich würde meiner Therapeutin davon erzählen. Ich hatte eine sehr nette Therapeutin, sie war mütterlich-rundlich mit hübschen blonden Locken und einer Brille, die es schwer machte, ihr in die Augen zu sehen. Ich stellte mir vor, auf der Couch zu liegen und ihr zu erzählen, wie mein Papa mausetot am Grund des Brunnens lag und meine eine Schwester mich anfauchte, warum ich hier einen Brunnen gegraben hätte, und die andere dramatisch kreischte wie eine Dreijährige, die kein Eis bekommt – und meine Therapeutin würde lächeln und sagen: »Sie immer mit Ihren Geschichten.«
Und ich würde fragen: »Warum glauben Sie mir nicht? So war es, ganz genau so.«
Dann würde sie für einen Moment die Brille abnehmen und sich die Augen reiben, aber so abgewandt, dass ich keinen Blick hineinwerfen könnte, und mir voller Ernst erklären, dass Menschen so nicht reagierten. »Schock«, würde sie sagen. »Ihre Schwestern wären geschockt. Sie könnten die Situation weder erfassen noch glauben, und in dem Versuch, die Lage zu beherrschen, würden sie sich zuallererst um Ihren Vater bemühen, also unter anderem … aber viel wichtiger ist die Frage: Warum erzählen Sie solche Geschichten? Was macht das mit Ihnen?«
Ja, ich habe eine sehr nette Therapeutin. Leider hat sie keine Ahnung von Menschen.
Thea heulte noch immer, Elli war davon genervt, traute sich aber nicht, Thea anzufahren oder gar sie zum Schweigen zu bringen. Deswegen lehnte sie mit verkniffenem Mund an der Brunnenumrandung und sah mich böse an.
»Ich hasse dich«, sagte sie zu mir. »Ich habe dich schon immer gehasst.«
Dass meine Therapeutin keine Ahnung von Menschen hat, zeigt sich zum Beispiel darin, dass sie bemängeln würde, in meiner Geschichte würden die Schwestern sich nicht – nach einer angemessenen Zeit für das Überwinden des Schocks, versteht sich – um meinen Vater kümmern. Sagen wir: Elli, die Große, sich nicht in den Brunnen hinablassen würde, um nach dem Puls des Vaters zu tasten, und Thea, die Kleine, zum Telefon greifen, um den Notarzt und die Polizei zu verständigen, oder mindestens: dass nicht beide auf mich einbrüllten, warum ich dies getan hätte bzw. nicht getan hätte – und bei all dem, was meine Therapeutin sich da zusammendenken würde, fiele ihr für keinen Moment ein, dass meine beiden Schwestern gar nicht im Keller sein dürften.
Nehmen wir an, Sie – Sie wären Ende dreißig/Anfang vierzig, hätten eine Karriere und eine Familie. Ein Haus und einen Mann oder keinen Mann, dafür aber einen wichtigen Termin, und Kinder haben Sie auch noch. Und einen Hund. Dann ruft eines Morgens um sechs Uhr, Sie schlafen noch oder vielleicht sind Sie gerade dabei, Kaffee aufzusetzen, jedenfalls, es ist noch früh, der Schlaf sitzt Ihnen in den Augen, den Knochen, dem ganzen Körper, und dann ruft Sie das Geschwisterchen an und sagt: »Hey du, komm mal rum, Papa ist tot.«
Ein Papa, der, und das ist jetzt wichtig, vor über zwanzig Jahren verschwand. Dessen Fallakte längst verstaubt in irgendeinem Archiv liegt, ein Papa, den Sie sehr vermisst haben oder zumindest sich verpflichtet fühlten, ihn zu vermissen, jedenfalls ein Papa, von dem man nicht wissen kann, ob er tot ist, und auch wenn er es wäre, kein Grund bestünde, ›mal eben rumzukommen‹, weil es letztlich einfach nur dieses Geschwisterchen ist, das immer mit seinen seltsamen Geschichten und Lügen daherkommt und nichts hat – keine Familie, keine Karriere, kein Haus. Keinen Hund.
Natürlich würden Sie nicht lachend den Hörer auflegen, egal wäre Ihnen die Sache auch nicht, aber Sie würden zuerst ein paar Fragen stellen. Ungläubig. Und zwischen Besorgnis und Verärgerung schwanken, Sie würden zusehen, dass Sie recht bald rausfahren könnten, in das Elternhaus auf dem Hügel am Rande der nichtssagenden Kleinstadt, natürlich würden Sie nachsehen, was da nun wieder los ist, allein schon, weil die Mutter ja auch da ist, und wenn das Geschwisterchen mal wieder durchdreht …
Sie würden Termine verschieben, Babysitter besorgen, vielleicht jemand anderen vorschicken, Sie würden die Schwester anrufen, ob sie auch schon gehört hat, was da wieder los ist. Sie würden vieles. Vielleicht. Je nach Temperament und Charakter.
Aber Sie würden nicht: meine Worte hören, ohne eine weitere Frage zu stellen ein klares, direktes ›Komme‹ aussprechen, auflegen, sich krankmelden/die Kinder dem völlig überforderten und verärgerten Partner übergeben (heute musst du, mir ist egal wie, krieg’s hin, Notfall), den aufmerksamen Blicken des Hundes keine Beachtung schenken, in die erstbesten Jeans schlüpfen, in das Auto springen und hierherfahren.
Niemand würde.
Meine Schwestern taten aber genau das.
Und auch das hatte wie alles seinen Grund.
GLAS
IN UNSEREM HAUS stand mitten auf dem Wohnzimmertisch ein Glas. Ein großes, rundes, bauchiges Glas, nur dass darin kein Goldfisch schwamm, sondern es übervoll war mit Süßigkeiten. Es gab Bonbons, Karamell und Himbeere, Pfefferminz mit Schokoladenkern und Pfefferminz in Rosa, außerdem weiße Mäuse mit roten und schwarzen Augen, Lollis mit und ohne Streifen, Kaugummis, manchmal sogar solche, mit denen man gigantische Blasen machen konnte, Toffees in goldenem Zellophan und dunklem Papier, Schokoladenbrocken, Mäusespeck, Gummibärchen und Brause, alle Arten von Brause.
Wann immer Kinder unser Wohnzimmer betraten, konnten sie es nicht fassen: Süßigkeiten mitten auf dem Tisch. Den ganzen Tag lang, und man durfte sich nehmen, wann immer man wollte. Sogar kurz vor dem Abendessen!
Die Erwachsenen, die bei uns vorbeikamen, konnten es auch nicht fassen.
»Die verderben sich doch den Magen«, sagte Tante Bärbel kopfschüttelnd. Oder: »Dann essen die doch nur noch Süßkram!«
Aber mein Vater lächelte nur und sagte: »Man lernt nicht durch Grenzen, sondern durch das Ausschöpfen der Möglichkeiten.« Er sagte das mit seiner tiefen, sonoren Stimme, und dann nickten die meisten Besucher und ließen die Sache gut sein.
»Bitte was?«, fragte allerdings Tante Bärbel, die auf die sonore Stimme meines Vaters wenig gab, und mein Vater stützte sich auf den Sessel, atmete ein und erklärte: »Selbstverständlich könnte ich ein Verbot aussprechen. Ein Regelwerk vorgeben. Aber was, glaubst du, würden die drei dann machen? Für sie wäre der Süßkram nur umso begehrenswerter. Sie würden heimlich naschen, sich die Backen genauso vollstopfen und sich danach nicht mal die Zähne putzen. Aber wenn man etwas immer haben kann, dann wird es irgendwann egal. Und wer einmal von Pfefferminzbonbons und Mäusespeck gekotzt hat, hat seine Lektion auf ewig gelernt.«
»Na ich weiß nicht«, sagte Tante Bärbel, auch ein bisschen pikiert wegen dem ›kotzen‹, und meine Mutter fragte, ob denn jemand einen Kaffee wolle, sie habe den guten im Haus. Und dann schob sie das Glas ein bisschen zur Seite, als wünschte sie, es möge kein Gesprächsthema mehr sein.
Das Glas stand also auf dem Tisch, jeden Tag, immer randvoll, und die Nachbarskinder, auch die, die einige Ecken weit weg wohnten, streunten um unser Haus herum, damit einer von uns sie hereinbat und sie in das Glas greifen ließ. Elli und Thea taten ihnen den Gefallen nur zu gern, insbesondere Thea lud fremde und wildfremde Kinder zu uns ein, meine Mutter sagte manchmal, dass, wenn es nach Thea ginge, es bei uns zugehen würde wie im Bienenstock.
»Sie ist halt ein kontaktfreudiges Kind«, erklärte Tante Bärbel, und im Vergleich zu mir war das sicher eine korrekte Anmerkung, wobei von weit größerer Bedeutung war, dass Thea einfach unfassbar gern Süßes aß. Die Sache mit dem Glas auf dem Tisch mitten im Wohnzimmer unseres unbedeutenden Hauses auf dem Hügel dieser unbedeutenden Kleinstadt war nämlich, dass keiner von uns, niemand, absolut niemand, also Thea nicht, Elli nicht und ich schon gar nicht, jemals in dieses Glas gegriffen hätte, wenn kein Fremder oder Wildfremder im Haus war.
Und wenn – wenn dann Kinder hier waren und sich erst die Münder und dann die Taschen mit all den Herrlichkeiten vollstopften, dann taten wir es ihnen bei Weitem nicht gleich. Wir nahmen uns lediglich eine Kleinigkeit. Eine Maus. Oder zwei Päckchen Brause, eines mit Zitrone und eines mit Waldmeister. Denn Gäste, so hatte uns Mama erklärt, Gäste lässt man nicht allein essen.
Es blieb Thea gar nichts anderes übrig, als so oft wie möglich verschiedenste Kinder anzuschleppen, nur so konnte sie sich mehrmals am Tag eine Anstandsportion aus dem Glas nehmen.
Wann genau mein Vater das Glas auf den Tisch gestellt hatte, kann ich nicht sagen, aber ich wüsste nicht, dass es jemals nicht da stand. Mein Vater suchte die Süßigkeiten aus und füllte das Glas auf. Jeden Abend um die gleiche Zeit. Er ging zum Schrank, griff sich verschiedene Tüten, überlegte, schaute noch einmal ins Glas, was darin war und was nicht, und dann füllte er es Stück für Stück, Rascheln für Rascheln, Knistern für Knistern. Er selbst aß nie etwas Süßes. Nicht aus dem Glas und nicht aus den Tüten. Das nannte er Disziplin.
Als Kind, sagte er, sei er ganz verrückt nach Süßkram gewesen. (Offenbar kam Thea da ganz nach ihm.) Er habe Süßkram – er sagte das Wort Süßkram voller Abscheu – so sehr begehrt, dass er einmal sogar welchen gestohlen habe. Das sollten wir uns vorstellen: er, unser Vater, ein Dieb. Er habe damals niemanden gehabt, den es scherte, ob er den ganzen Tag mit Bonbons im Mund herumlief und sich die Zähne ruinierte oder ein Dieb wurde. Wir seien da besser dran, um uns kümmere man sich. Uns brachte man Disziplin bei. Disziplin und Benehmen.
Woran ich mich nicht mehr erinnere, und das tut mir leid, weil ich fest daran glaube, es wäre wichtig für mich und auch für Thea, wenn wir uns daran erinnern könnten, aber es ist verschollen und verschwunden, und ich kann also nicht mehr sagen, warum ich an jenem Tag so unfassbar wütend auf Thea war. Aber ich war es. Und das war nicht gerecht, denn sie war kleiner als ich, sie war jünger als ich, und ihr fehlte schon damals das Gespür für diese ganz gewissen Grenzen. Aber ich war wütend, und ich forderte sie heraus, in das Glas zu greifen. An einem Nachmittag, an dem wir allein waren, also nur Thea, Elli und ich im Haus, und da Elli sich verzogen hatte, gab es nur Thea, mich, das Wohnzimmer, das Glas und meine Wut.
»Du traust dich nicht«, sagte ich.
»Wohl!«, kreischte Thea.
»Nie und nimmer traust du dich.«
»Ich trau mich! Aber ich habe, habe … Disziplin.«
»Feigling.«
»Arschnase.«
»Zimperliese.«
»Hurenbock!«
»Hurenbock? Pfff, wo hast du denn das her? Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Ich nehme mir jedenfalls dauernd was aus dem Glas. Warum auch nicht? Merkt doch eh keiner.«
»Du lügst!«, sagte Thea. Aber ich sah ihr an, dass sie mir glaubte. Zumindest ein ganz kleines bisschen. Zumindest genug, dass sie zum Tisch ging, in das Glas griff, zögerlich erst und dann entschlossen, sich das winzigste, unscheinbarste Bonbon herausnahm, es auswickelte und blitzschnell in den Mund schob. Triumphierend drehte sie sich nach mir um. Und dann sah sie, dass ich nicht sie ansah, sondern die Wohnzimmertür. Und in der Wohnzimmertür stand der Vater.
»Na, schmeckt’s dir, Thea?«, fragte er.
Die nächsten drei Nächte waren Elli, ich und der Vater allein im Haus, es war erstaunlich still, so ohne Thea und Mama, wobei das Fehlen von Thea sicher deutlich mehr zur Stille beitrug, und nun ja, wir verbliebenen drei redeten nicht sehr viel miteinander. Das taten wir eigentlich nie, aber vielleicht war es doch das bedrückende Gefühl, dass Mama bei Thea im Krankenhaus war und die Nächte sorgenvoll an ihrem Bett saß. Zur Überwachung, sagten die Ärzte, weil mit einer schweren Gehirnerschütterung sei nicht zu spaßen.
WIR HABEN EIN PROBLEM
»THEA, HÖR AUF zu heulen.« Elli reichte es jetzt.
Thea hörte schlagartig auf – verschränkte aber die Arme vor der Brust und sagte: »Es ist doch aber Papa!«
»Eben«, sagte ich, und jetzt sahen mich beide erst an und dann sehr schnell irgendwo anders hin.
»Wir haben ein Problem«, sagte Elli, und an sich war es vollkommen überflüssig, dies auszusprechen; sie sagte es nur, damit meine Stimme nicht mehr im Raum hing. »Irgendjemand eine Idee zur Lösung?«
Thea verdrehte die Augen. »Am Ende zählt doch eh nur, was du willst.«
Wir ließen ihr Schmollen ein paar Minuten so stehen, dann wurde Thea unsicher und sagte: »Wir müssen die Polizei rufen.«
»Wozu?«, sagte Elli.
»Na, weil man das so macht: die Polizei rufen.«
Machte man das so? Wahrscheinlich schon. Wenn man ein rechtschaffener Mensch ist und entdeckt, dass das Geschwisterchen einen Brunnen gegraben hat und auf dem Grund dieses Brunnens der eigene Vater liegt – dann ruft man die Polizei. Und sagt Sätze wie: »Ich verstehe nicht, wie das geschehen konnte. Wir waren doch eine ganz normale Familie!«
Wenn ich auch nur für einen Moment geglaubt hätte, dass meine Schwestern rechtschaffene Menschen seien, dann hätte ich die Polizei auch gleich selbst rufen können. Oder meine Sachen packen und mich davonstehlen. Oder die Leiche entsorgen. Jedenfalls hätte ich mir die Anrufe sparen können und all das Menschliche, was jetzt hier unten stattfand, gleich mit.
»Wieso hast du uns eigentlich angerufen?«, fragte Elli, der wohl Ähnliches durch den Kopf ging.
»Weil ich die Leiche nicht allein entsorgen kann.«
Auch das wieder eine Lüge – mir wäre schon etwas eingefallen, es drängte ja nicht. Ich hätte Papa in kleine Häppchen zerlegen können und Stück für Stück verteilen, ich hätte seinen inzwischen so leichten Körper vielleicht sogar im Ganzen aus dem Haus bringen können oder – die einfachste Lösung – den Brunnen über ihm zuschütten. Und die Sache vergessen.





























