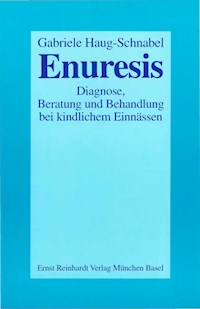Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
In der pädagogischen Arbeit mit Kindern ergeben sich immer wieder Fragen wie die folgenden: Welche Bedingungen beeinflusst die Entwicklung? Wie kann auf die speziellen Entwicklungsbedürfnisse der Kinder eingegangen werden? Dieses Buch von Dr. Gabriele Haug-Schnabel und Dr. Joachim Bensel beschreibt die neuesten Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie, Säuglings- und Hirnforschung sowie der Verhaltensbiologie. Eine besonders wichtige Rolle nimmt die Betreuungs-/Bezugsperson als Entwicklungsbegleiterin ein. Das perfekte Grundlagenwerk, um umfassendes Entwicklungswissen kompakt anzubieten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriele Haug-Schnabel / Joachim Bensel
Grundlagen der Entwicklungspsychologie
Die ersten 10 Lebensjahre
12. vollständig überarbeitete und deutlich erweiterte Auflage 2017
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2005
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlagkonzeption und -gestaltung: SchwarzwaldMädel, Simonswald
Umschlagabbildung: © »Kopffüßler« von Inés Brombacher (3 Jahre)
Fotos im Innenteil: © Hartmut W. Schmidt, Freiburg
Satz und Gestaltung: Hauptsatz Susanne Lomer, Freiburg
ISBN Print 978-3-451-32960-9
ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-81074-9
Inhalt
Vorwort
1 Grundlegende Aspekte von Entwicklung
1.1 Was ist Entwicklung?
1.2 Kinder in ihrer Entwicklung stärken – Ergebnisse der Resilienzforschung
1.3 Andere Kulturen – andere Entwicklungsziele
1.4 Partizipation ermöglichen als Teil der Entwicklungsbegleitung
1.5 Anlage-Umwelt-Diskussion: Was machen die Gene, was die Umwelt?
1.6 Die sogenannte »normale« Entwicklung
1.7 Erfolgreiche Entwicklungsförderung setzt an den Stärken an
1.8 Frühe Förderung kognitiver Prozesse durch zugewandte Interaktion
1.9 Was hat Erziehung mit Entwicklung zu tun?
1.10 Erkenntnisse der Hirnforschung im Hinblick auf Lern- und Bildungsprozesse
1.11 Sexuelle Bildung: Die Entwicklung kindlicher Sexualität positiv unterstützen, begleiten und fördern
1.12 Sprechen – Sprache – Kommunikation
1.13 Entwicklung von Konfliktfähigkeit
1.14 Zur Entwicklung des Zeitverständnisses
1.15 Emotionale Entwicklung
2 Das erste Lebensjahr: Die Säuglinge
2.1 Säuglingskompetenzen und intuitives Elternverhalten
2.2 Bindung
2.3 Gemeinsame Aufmerksamkeit als Baustein in der Entwicklung kultureller Intelligenz
2.4 Wahrnehmen und Spielen: Mundeln, Hantieren, Riechen, Betrachten
2.5 Wie lernen Babys?
2.6 Frühe sozial-kognitive Entwicklung
2.7 Frühe Sprachentwicklung
2.8 Frühe Motorische Entwicklung
2.9 Biologische Reifung oder Trainingseffekt?
3 Das zweite Lebensjahr: Die Einjährigen
3.1 Die Entdeckung des »Ich«
3.2 Kooperation und Hilfsbereitschaft
3.3 Kognitive Entwicklung: Neues seit Piaget
3.4 Motivationsentwicklung, Handlungsorganisation und Selbstkontrolle
3.5 Motorische Entwicklung: Die Welt wird weitläufiger
3.6 Umgang mit Trennungen
3.7 Erste Kompetenzgefühle
3.8 Spielen – integrativer Bestandteil der kindlichen Gesamtentwicklung
3.8 Sprachentwicklung: Erst verstehen, dann sprechen
4 Das dritte Lebensjahr: Die Zweijährigen
4.1 Professionelle Eingewöhnung zur Begleitung des Entwicklungsschrittes »Erweiterung der Lebenswelt«
4.2 Spielentwicklung: Der Erwerb funktionellen Wissens
4.3 Zwei Seiten einer Medaille: Die Trotzphase oder die Entstehung von Autonomie
4.5 Visuelle Perspektivenübernahme
4.6 Entwicklung von Empathie
4.7 Sprachentwicklung: Ab jetzt verständigt man sich sprachlich!
4.8 Partizipation – Wir fangen klein an
5 Das vierte Lebensjahr: Die Dreijährigen
5.1 Motorische Entwicklung: Das Kind fordert sich selbst heraus
5.2 Sprachentwicklung: Das Frage-Alter beginnt
5.3 Sauberkeitserziehung heißt heute Unterstützung der Ausscheidungsautonomie – und das hat viele Gründe
5.4 Körperbewusstsein und Geschlechtsidentität
5.5 Das Spiel mit Gleichaltrigen
5.6 Die magischen Jahre
6 Das fünfte Lebensjahr: Die Vierjährigen
6.1 Beweglichkeit und Geschicklichkeit
6.2 Sozialkompetenz
6.3 Bedürfnisaufschub und Willensstärke sind Bausteine für emotionale Intelligenz – der Marshmallow-Test
6.4 Theory of Mind – »Du denkst ja anders als ich!«
6.5 Partizipation ist der Schlüssel zur Bildung
6.6 Literacy
6.7 Moralentwicklung
6.8 Besonderheiten der kognitiven Entwicklung Vierjähriger
7 Das sechste Lebensjahr: Die Fünfjährigen
7.1 Ein besonderes Alter
7.2 Problemlösen, analoges Denken und Schlussfolgern
7.3 Zunehmende Differenzierung und Spezialisierung in allen Bereichen
7.4 Interesse an Zahlen und Mathematik
7.5 Selbstbildungsprozesse – im Beziehungsnetz
7.6 Geschlechterbewusste Pädagogik: Als Mädchen, als Junge behandelt werden
7.7 Umgang mit Aggressionen: Konflikte gehören zum Zusammenleben
7.8 Zeitverläufe werden zum Thema
8 Das siebte bis zehnte Lebensjahr: Die Sechs- bis Neunjährigen
8.1 Schulbeginn – ein erneuter Übergang
8.2 Das Thema Schulfähigkeit
8.3 Hort und Ganztagsbetreuung – Chance auf Entwicklungsbegleitung jenseits von Lernunterstützung
8.4 Das Denken von Grundschulkindern
8.5 Kindgemäße Angebote der Schule an die Kinder
8.6 Die soziale Entwicklung im Grundschulalter – Bedeutung von Peergruppen und Freundschaften
8.7 Sprache wird zum Informationsträger
8.8 Selbstwert und Umgang mit Emotionen
8.9 Jungen und Mädchen in der Grundschule
8.10 Partizipation fördert die kindliche Resilienz
8.11 Die Bedeutung von Bewegung und Naturerfahrung
Literatur
Autoren
Vorwort
Liebe pädagogische Fachkräfte, Studierende, Kindertagespflegepersonen, Spielgruppenleitungen, kindheitsinteressierte Leserinnen und Leser,
seit mehr als zehn Jahren ist unser Buch zur Entwicklung von Kindern in den ersten Lebensjahren auf dem Markt, und das Interesse an den Entwicklungsvorgängen der frühen und mittleren Kindheit ist nach wie vor ungebrochen hoch.
Die Bedeutung von Entwicklungswissen für eine passende Begleitung von Kindern in den Bereichen Bildung, Betreuung und Erziehung hat auch durch den massiven Ausbau an Betreuungsplätzen für Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr in Krippe, altersgemischter Einrichtung und Kindertagespflege und durch den Ausbau der Ganztagsbetreuung in Schule und Hort nicht nur bei den mit diesen Altersgruppen arbeitenden Fachkräften in Aus-, Fort- und Weiterbildung, sondern auch in der kindheitsinteressierten Öffentlichkeit zugenommen.
Von einem frühen Einstieg in außerfamiliäre Betreuungsangebote kann ein wichtiger Entwicklungsimpuls ausgehen. Eine hohe Qualität von Einrichtungen, speziell in sozialen Brennpunktgebieten und in Kitas mit hohem Migrantenanteil, ist dabei aber entscheidend, da die NUBBEK-Ergebnisse (Tietze u. a. 2013) zeigen, dass nur, wenn die Qualität stimmt, auch ein Fördereffekt für die kindliche Entwicklung, speziell von Kindern mit Migrationshintergrund, zu erwarten ist.
Individuelle Entwicklungswege von Kindern mit unterschiedlichen familiären und kulturellen Ausgangssituationen benötigen für eine adäquate Begleitung durch ihre Bezugspersonen einen inklusiven und diversitätsbewussten Blick. Dieser Blick wurde für die vorliegende vollständig überarbeitete und deutlich erweiterte Auflage noch einmal bewusst geschärft.
Die große Variabilität im Entwicklungsverlauf ist in der Wissenschaft als Normalität erkannt worden. Der sich hieraus ableitende Auftrag an alle in der pädagogischen Praxis ist es, über regelmäßige Beobachtung zu erfassen, wo ein Kind in seiner Entwicklung, bezüglich seiner aktuellen Themen und Interessen gerade steht und welche professionelle Begleitung und Ermutigung es braucht, um in seine Zone der nächstmöglichen Entwicklung eintauchen zu können. Auf die Beobachtungen müssen Konsequenzen folgen, die sich in einem veränderten Tagesablauf, einer neuartigen Gruppenformation, Materialvielfalt oder einer mitwachsenden Gestaltung und Nutzung von Innen- und Außenbereichen zeigen können.
Dafür braucht jeder erwachsene Bildungs- und Entwicklungsbegleiter neben echtem Interesse an jedem Kind eine gehörige Portion Grundlagenwissen.
Lesen Sie also los!
Ihre
Gabriele Haug-Schnabel & Joachim Bensel
1 Grundlegende Aspekte von Entwicklung
Wer kindliche Entwicklungswege verstehen möchte, darf es nicht bei der Betrachtung einzelner Entwicklungsaspekte belassen, sondern muss sich für die Gesamtheit der komplexen biopsychosozialen Vorgänge interessieren. Daher möchten wir Sie in diesem Kapitel zunächst mit einigen grundlegenden Aspekten von »Entwicklung« vertraut machen, ausgehend von Fragen wie zum Beispiel: »Was ist Entwicklung?« »Wird die Entwicklung durch die Anlage oder die Umwelt bestimmt?« »Gibt es überhaupt eine normale Entwicklung?« Diese Fragen haben seit jeher Psychologen und andere Berufsgruppen, die über kindliche Entwicklung arbeiten, beschäftigt. Ein weiterer grundlegender Aspekt von Entwicklung ist der Zusammenhang von Erziehung und Entwicklung. Es ist bekannt, dass der Erziehungsstil und die Haltung zum Kind seine Entwicklung beeinflussen – welche konkreten Wirkungen werden hierbei erzielt? Neueste Erkenntnisse der Hirnforschung eröffnen interessante Perspektiven, die zum Verständnis kindlicher Lern- und Bildungsprozesse beitragen.
1.1 Was ist Entwicklung?
Entwicklung ist ein über die Zeit ablaufender Prozess, der von verschiedensten inneren und äußeren Einflüssen immer wieder angestoßen und von diesen in Abfolge und Geschehen bestimmt wird. Von Entwicklungsvorstellungen erwarten wir, dass sie erklären können, wie Individuum und Lebenskontext zusammenwirken, und uns verdeutlichen, wie zurückliegende und gegenwärtige Anpassungsleistungen an Anforderungen und Aufgaben die zukünftige Entwicklung beeinflussen werden.
Wer Kinder bei ihrer Entwicklung von der Geburt bis zum zehnten Geburtstag begleitet, hat einen spannenden Weg vor sich, denn es passiert Überwältigendes. Biologische, psychologische und soziale Anteile am Geschehen werden in diesen Lebensjahren dauernd neu organisiert, sobald sich ein Individuum mit bedeutenden Entwicklungsaufgaben und -übergängen auseinandersetzt und so seine Entwicklung bei steigenden Anforderungen voranschreitet. Innerhalb bestimmter Entwicklungsabschnitte steht ein Kind vor Problemen und Aufgaben, die es im Sinne erweiterter Lernprozesse bewältigen muss und die somit Teil seiner psychosozialen Entwicklung sind. Es gibt allgemeine Aufgaben und Anforderungen, die alle betreffen, wie das eigene Geschlecht und die körperliche Reifung kennen und akzeptieren zu lernen, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen oder Entwicklungsübergänge wie den Start in die außerfamiliäre Betreuung oder Einschulung zu bewältigen. Hierzu gehören aber auch individuell unterschiedliche Aufgaben, wie zum Beispiel als Einzelkind, in einer die Familie ergänzenden Institution, in einem für mich und meine Familie neuen, bislang fremden Kulturkreis, mit besonderem individuellem Bedarf oder einer Spezialbegabung groß zu werden. Eine Entwicklungsaufgabe gilt als bewältigt, wenn sich ein Kind so weit entwickelt hat, dass es nun über erweiterte, differenziertere und verlässlichere Vorstellungen über sich und seine Umwelt verfügt. Dieser Zuwachs an Vorstellungskraft regt Aktivitäten an und befähigt zu Tätigkeiten, die es dem Kind ermöglichen, Besonderheiten einer Situation wahrzunehmen und diese – je nach bisheriger Erfahrung damit – zu erhalten oder zu verändern. Es bedarf entsprechender Gelegenheiten (z. B. anregender und die Selbstbildung ermöglichender Umgebungen) als Bildungsvoraussetzungen sowie eigener Potenziale wie auch sozialer und emotionaler Kompetenzen, um Entwicklungsaufgaben erfolgreich bewältigen zu können (Petermann u. a. 2004).
Alltägliche Anforderungen und sich im Miteinander ergebende Herausforderungen stellen Kinder vor Entwicklungsaufgaben. Sie sollten altersgemäß bewältigt werden, damit sich ein physisches wie psychisches Wohlbefinden einstellt, unterstützt und bestärkt durch bestätigende Reaktionen der Umgebung. Die Entwicklungsaufgaben sind vielfältig (siehe Tabelle 1). Für ein Kleinkind ist zum Beispiel die Fähigkeit, auf Anweisungen der Eltern zu hören, sein Tun abzuändern, zu warten oder etwas zu unterlassen, eine bedeutsame Entwicklungsaufgabe.
Tabelle 1: Beispiele für Entwicklungsaufgaben (nach Petermann u. a. 2004, S. 287)
Entwicklungsperiode
Entwicklungsaufgabe
Frühe Kindheit (0 – 2 Jahre)
• Soziale Bindung
• Objektpermanenz
• Sensumotorische Intelligenz und schlichte Kausalität
• Motorische Funktionen
Kindheit (2 – 4 Jahre)
• Selbstkontrolle (vor allem motorisch)
• Sprachentwicklung
• Fantasie und Spiel
• Verfeinerung motorischer Funktionen
Schulübergang und frühes Schulalter (5 – 7 Jahre)
• Geschlechterrollenidentifikation
• Einfache moralische Unterscheidungen treffen
• Konkrete Operationen
• Spiel in Gruppen
Mittleres Schulalter
(8 – 12 Jahre)
• Soziale Kooperation
• Selbstbewusstsein
• Erwerb der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben etc.)
• Spielen und Arbeiten im Team
Wer Entwicklung nachvollziehen und verstehen möchte, kann nicht nur Einzelfaktoren in den Blick nehmen und diese weiterverfolgen. Wer wirklich hinter die Entwicklungskulissen schauen möchte, um angepasste wie auch fehlangepasste Entwicklung angemessen zu erfassen, muss sich für komplexe biopsychosoziale Vorgänge und deren Wechselwirkungen während des Entwicklungsverlaufs interessieren. Denn eine bestimmte Konstellation von Bedingungen kann ein Risiko darstellen und deshalb sogenannte Maladaptionen (Fehlanpassungen) begünstigen, während andersartige Sozialisationsbedingungen eine gut angepasste Entwicklung fördern oder Schritte in Richtung Fehlanpassung mildern können. Man spricht von risikoerhöhenden und risikomildernden Bedingungen, die den Entwicklungsverlauf beeinflussen und zum Beispiel ausschlaggebend dafür sein können, ob und wie stark sich benachteiligende (riskante) genetische Anlagen überhaupt auswirken.
Man unterscheidet zwei Gruppen von Risikofaktoren:
Bedingungen, die sich auf biologische oder psychologische Merkmale des Individuums beziehen, wie zum Beispiel genetische Belastung, geringes Geburtsgewicht oder schwieriges Temperament, undBedingungen, die psychosoziale Merkmale der Umwelt des Individuums betreffen. Dazu zählen Armut, Kriminalität, psychische Erkrankung eines Elternteils oder ständige Disharmonie in der Familie.Mit den Ergebnissen der Risikoforschung können lediglich beschreibende Aussagen über Zusammenhänge zwischen Risikofaktoren und kindlicher Entwicklung formuliert werden, kausale Schlussfolgerungen sind nicht möglich. Zu welchem Ergebnis eine Risikobelastung führt, lässt sich nur in einem interaktionistischen Ansatz, der das Zusammenwirken von Risikofaktoren und weiteren Person-Umwelt-Merkmalen berücksichtigt, verständlich machen. Eine zentrale Rolle im Rahmen interaktionistischer Modelle spielen protektive Faktoren (Schutzfaktoren), die sich risikomildernd auswirken. Ein Schutzfaktor ist ein Merkmal, das bei einer Gruppe von Individuen die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Störung oder Auffälligkeit im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ohne diesen Schutzfaktor herabsetzt. Auch mit mehreren Schutzfaktoren versehene Individuen haben keine Garantie auf einen störungsfreien Entwicklungsverlauf, sind aber auf jeden Fall deutlich mehr gefeit vor Schädigungen als Individuen, die ohne oder mit wenigen Schutzfaktoren auskommen müssen. Schutzfaktoren puffern Risikoeffekte ab; fehlen sie, können Risikoeffekte ungeschwächt zum Tragen kommen. Das Zusammenspiel von Risiko- und Schutzfaktoren und dessen Auswirkung auf die Entwicklung eines Menschen ist Gegenstand der Resilienzforschung, die vor allem durch die bekannte Pionierstudie von Emmy Werner auf Hawaii aus dem Jahr 1971 populär wurde.
1.2 Kinder in ihrer Entwicklung stärken – Ergebnisse der Resilienzforschung
Kinder werden als resilient (widerstandsfähig) bezeichnet, die in einem sozialen Umfeld aufwachsen, das durch Risikofaktoren wie zum Beispiel Gewalt, Alkoholismus oder Armut geprägt ist, oder die traumatische Kriegs- oder Fluchterfahrungen durchgemacht haben und sich dennoch erfolgreich entwickeln.
Warum sind manche Kinder besonders widerstandsfähig und lassen sich trotz allem nicht unterkriegen, was lässt sie mit Belastungen erfolgreicher umgehen als andere Kinder? Die Resilienzforschung untersucht, ob für diese besonders gelungene Bewältigung von Hürden die genetische Ausstattung, die Persönlichkeit eines Kindes, seine Bezugspersonen oder sein Lebensumfeld verantwortlich sind. Eines ist heute schon klar: Resilient wird man nicht von alleine. Wenigstens eine liebevoll zugewandte und verlässliche Bindungsperson, ob innerhalb oder außerhalb der Familie, sollte jedem Kind während seiner Kindheitsjahre zur Seite stehen. Robustheit, Energie, ein hohes Maß an Aktivität sowie ein sozial verbindliches Wesen sind gute persönliche Voraussetzungen für Widerstandsfähigkeit. Resilienz zeigt sich in Verhaltensweisen, die sehr viel psychische Sicherheit brauchen, wie Durchhalten, Verantwortung übernehmen, sich selbst behaupten, Humor beweisen, Probleme lösen, Herausforderungen annehmen und den eigenen Erfolg spüren. Es braucht sehr viel psychischen Rückhalt, damit ein Mensch realistisch planen und handeln kann und die dazu erforderliche Motivation, Ausdauer und Weitsicht entwickelt. »Er ist nach allem, was wir wissen, wohl so konstruiert, dass er viele Jahre lang in psychischer Sicherheit von älteren und weiseren Gehirnen lernen muss« (Grossmann 2015, S. 31). Resilienz entsteht auch durch resiliente Vorbilder, durch deren vorgelebten Umgang mit Schwierigkeiten und Misserfolg. Entwicklungsbegleiter müssen zugewandt, einfühlsam und zuverlässig verfügbar sein, sie sollten Achtung und Liebe spüren lassen, damit ein Kind an sich zu glauben beginnt (Haug-Schnabel & Schmid-Steinbrunner 2015).
Die Theorie der Resilienz ist mittlerweile auch in der Kindheitspädagogik angekommen und wird in einer weitergefassten Definition nicht nur als Bewältigung von Hochrisikosituationen verstanden, sondern auch als eine Kompetenz, die sich aus verschiedenen Einzelfähigkeiten zusammensetzt, die notwendig sind, um zum Beispiel Entwicklungsaufgaben und weniger kritische Alltagsituationen zu bewältigen (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff 2014). Resilienz wird als eine dynamische Fähigkeit verstanden, die sich aus der Stärkung – oder Schwächung – der Resilienzfaktoren, aus realen Bewältigungserfahrungen und der erlebten sozialen Unterstützung entwickelt. Demzufolge lässt sich diese Fähigkeit auch im Kita-Alltag stärken, indem die zugrunde liegenden Fähigkeiten gezielt gefördert werden und auf diese Weise Kinder gekräftigt mit Krisen und Belastungen umgehen oder Entwicklungsaufgaben bewältigen können. Resilienzförderung im Alltag der Kindertagesbetreuung konzentriert sich dabei auf die sechs Resilienzfaktoren Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit, Soziale Kompetenzen, Problemlösen und Stressbewältigung (siehe Tab. 2).
Tabelle 2: Resilienzfaktoren (nach Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff 2015, S. 192ff.)
Resilienzfaktor
Teilaspekte
Professionelle Assistenz des Erwachsenen
Selbst- und Fremdwahrnehmung
Eigene Gefühle wahrnehmen
Spiegeln; Unterstützung bei der Differenzierung des Gefühlsspektrums
Klären »diffuser« Gefühle
Diffusität ansprechen, Gefühlskategorien zur Klärung anbieten
Sich angemessen einschätzen können; angemessenes Selbstbild
Nachfragen: Wie siehst du dich? Wie erlebst du dich?
Einschätzung der eigenen Wirkung auf andere
Spiegeln durch Fremdwahrnehmung (Wie wirkt die Körperhaltung, Mimik auf das Gegenüber?)
Abgleich der eigenen Wahrnehmung mit der eines anderen
Ansprechen, gezielter Vergleich
Gestik und Mimik des anderen wahrnehmen und richtig interpretieren
Nachfragen: Was siehst du? und Abgleich
Motive des anderen verstehen
Reflexion von Kommunikationssituationen: Warum handelt jemand so?
Eigene Wahrnehmung der Situation »platzieren« können
Selbststeuerung
Erregung »hoch«- und »herunter«fahren können
Innehalten: Erregung spüren; nonverbale Mitschwingung bei Aktivierung und Beruhigung; Gefühle verbal und nonverbal teilen; Reflexion: Was führt zur Erregung?; Co-Regulation: Erregungs- und situationsadäquate Regulationsstrategien zeigen (Vorbildfunktion!)
»Filter« bei übermäßiger Erregung
Struktur anbieten; konkrete selbstregulative Handlungen erarbeiten und einüben
Sich selbst motivieren / aktivieren können
Aktivierungsstrategie reflektieren und ggf. anregen
Selbstwirksamkeit
Sich als Urheber eigener Handlungen sehen
Rückmeldung geben; gemeinsame Reflexion über Handlungsabläufe und -vollzug; Ermutigung
Positive Erwartungen bzgl. des eigenen Handelns aufbauen
Angemessene Anforderungen in der »Zone der nächsten Entwicklung« anbieten
Kennen und Zeigen der eigenen Stärken
Reflexion über Stärken; Ermöglichen des Zeigens in der Handlung
Soziale Kompetenzen
Dialogfähigkeit (Zuhören; Wechsel in der Kommunikation gestalten; Bezugnahme auf den anderen)
Darauf achten, dass eigene Worte wahrgenommen werden; Wechsel als Regel einführen, Unterbrechungen thematisieren; auf den Bezug achten
Fähigkeit zur Konfliktlösung (Wahrnehmen und Verstehen von Konfliktsituationen; Perspektivenübernahme; Wahrnehmen und Kontrollieren eigener Impulse, adäquates Handeln in der Situation)
Selbst- und Fremdwahrnehmung abgleichen; Einüben / Ansprechen (Wie hat sich … wohl gefühlt?); Handlungsbegründungen, Handlungsalternativen besprechen und einüben
Selbstbehauptung (Wahrnehmen und Interpretieren eigener Impulse; adäquates Handeln in der Situation)
Selbstwahrnehmung, Rückmeldung geben; Handlungsbegründungen, Handlungsalternativen besprechen und einüben
Sich Unterstützung holen
Unterstützung anbieten, Reflexion von Hilfesituationen
Problemlösen; kognitive Flexibilität
Systematische Reflexion von Handlungsabläufen
Nachfragen: Was ist passiert? Wie hast du das gemacht? In Problemlösesituationen einzelne Schritte durchsprechen, Kreativität fördern
Suche nach alternativen Lösungen
Ungewöhnliches Denken und Handeln merken und verstärken
Probleme als Herausforderungen sehen
Überwindungsperspektive eröffnen, Ermutigung
Adaptive
Bewältigungsstrategien /Stressbewältigung
Erkennen, was individuelle Stressoren sind
Individualität des Stresserlebens herausstellen, Reflexion von subjektiven Stressauslösern und Bewältigungsformen, Gestalten individuell angemessener Anforderungen
Aktivierung eigener Lösungspotenziale
Kennen eigener Kompetenzen, Ermutigung zum Einsetzen von Problemlösefähigkeiten, ggf. Stressbewältigungsmöglichkeiten anbieten, Lob für das Angehen einer Herausforderung
Ggf. Einfordern /-holen von Unterstützung
Unterstützung anbieten, Reflexion von Hilfesituationen
Eltern und pädagogische Fachkräfte, die die personalen Ressourcen der Kinder fördern wollen, müssen ganz andere pädagogische Konzepte verfolgen als bei der Vermittlung eher kognitiv ausgerichteter vorschulischer Inhalte und Fertigkeiten. Programme wie »Kinder Stärken« sind wissenschaftlich überprüfte Verfahren, deren Effektivität nachgewiesen werden konnte. PRiK (Prävention und Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen) und PriGs (Prävention und Resilienzförderung in Grundschulen) sind wesentliche Bausteine des »Kinder Stärken«-Programms und setzen bei der Förderung der Kinder selbst an (Fröhlich-Gildhoff u. a. 2012, 2016b). Aber auch jenseits gezielter Programme gibt es im Kita-Alltag viele Ansatzstellen zur Förderung von Resilienz und Lebenskompetenzen (Haug-Schnabel u. a. 2015).
Schutzfaktoren werden einem Kind nicht als Paket in die Wiege gelegt und bleiben dann lebenslang wirksam. Sie müssen immer wieder neu aktiviert und gefördert werden, vom Kind selbst und von seiner sozialen Umgebung. Dem Kind eigene Besonderheiten, wie zum Beispiel ein positives Temperament, verträgliche Charaktereigenschaften, eine gute Intelligenz und ein positives Selbstkonzept, können bereits als Schutzfaktoren wirken; doch brauchen auch diese kindbezogenen positiven Merkmale zu ihrer Entfaltung, Aktivierung und Förderung einen Rahmen, der von anderen – zuerst von den Bezugspersonen, später auch von Gleichaltrigen – geschaffen werden muss.
Gerade die ersten Lebensjahre eines Kindes sind von besonderer Bedeutung für seine weitere Entwicklung. Deshalb muss in allen Lebenswelten und somit von all seinen Bezugspersonen sein Kohärenzgefühl, eine wesentliche Ressource, mit der die Grundhaltung eines Menschen zur Welt wie auch seinem eigenen Lebensweg gegenüber beschrieben wird, gestützt und gestärkt werden. Krause und Lorenz (2009) haben die drei Komponenten des Kohärenzgefühls für die pädagogische Praxis verständlich gemacht. Unter »Verstehbarkeit« fasst man die Erwartung und die Fähigkeit eines Menschen, ihm bekannte wie auch für ihn völlig unbekannte Eindrücke als geordnete, strukturierte Information aufnehmen und verarbeiten zu können. Mit »Handhabbarkeit« wird die Überzeugung beschrieben, dass man Schwierigkeiten und Krisen, vor die man in seinem Leben gestellt wird, lösen kann. Die »Bedeutsamkeit« ist persönlichkeitsstärkend und daher besonders wichtig. Hierunter verstehen wir das Ausmaß, inwiefern ein Mensch sein Leben als »reich« empfindet und deshalb auch als lohnend, sich Problemen und Anforderungen zu stellen.
Wenn wir Kinder heute für das Leben von morgen vorbereiten, sie begleiten und erziehen, »machen wir das auf der Basis von gestern« (Haug-Schnabel & Schmid-Steinbrunner 2015, S. 11). Unsere Babys werden in eine sich rasant verändernde Welt geboren. Sie werden heute deutlich anders als vor Tausenden von Jahren groß. Wie gewaltig diese Unterschiede im Kindheitsverlauf rund um die Erdkugel aktuell sein können, führt uns der Dokumentarfilm »Bébés« (Babys) von Thomas Balmes beeindruckend vor Augen. Jede Kultur hat ihre eigenen Erziehungsziele für die nächste Generation im Blick. Nichtsdestotrotz stammen die genetische Ausstattung des modernen Menschen, seine Entwicklungspotenziale und seine auf Beantwortung wartenden, hierauf abgestimmten biologisch bedingten Bedürfnisse aus stammesgeschichtlicher Vorzeit. Vor allem in Kulturen mit sogenannten westlichen, gebildeten, industrialisierten, reichen und demokratischen Milieus (Henrich u. a. 2010) werden von den Kindern früh hohe physiologische und psychologische Anpassungsleistungen in Richtung individuelle Autonomie verlangt, wie zum Beispiel allein einzuschlafen und sich selbst mit bereitgestelltem Spielmaterial zu beschäftigen. Gleichzeitig müssen sie auf bislang Selbstverständliches wie intensiven Körperkontakt, Stillen nach Bedarf und jederzeitige Erreichbarkeit ihrer Bezugspersonen verzichten. Von den Kindern werden früh Selbstregulation, psychologische Autonomie und differenzierte sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten verlangt, das bedeutet, dass neuartige Formen von Anpassung erwartet werden, die spezielle Wege der Unterstützung nötig machen, um psychischen und körperlichen Schaden abzuwenden.
Jedes Kind, unabhängig davon, aus welcher Kultur es kommt, hat das Recht, in resilienzfördernden, es stärkenden Umgebungen zu leben und mit kompetenter Unterstützung seine Entwicklungsaufgaben zu bewältigen.
1.3 Andere Kulturen – andere Entwicklungsziele
Menschen in allen Ländern und Kulturen der Erde neigen dazu, ihre Erfahrungen und Vorstellungen zu generalisieren und wahrgenommene Abweichungen in anderen Kulturen als befremdlich oder unpassend zu betrachten. Auch die Wissenschaft in westlichen Kulturen hat lange Zeit ihre Forschungserkenntnis aus nicht repräsentativen Studien an sogenannten WEIRDs gewonnen (Henrich u. a. 2010), das heißt, mit Probanden aus
Western (westlichen), Educated (gebildeten), Industrialized (industrialisierten), Rich (reichen) und Democratic (demokratischen) Milieus.Erst in letzter Zeit bekommt die kulturvergleichende Psychologie, insbesondere die Entwicklungsforschung, viel Aufmerksamkeit, da sie versucht, diese westlich-schiefe Sichtweise etwas zu begradigen; zumal es in Zuwanderungsländern wie Deutschland zunehmend wichtiger wird, zu verstehen, wie andere Kulturen denken und handeln, um eine gelungene Inklusion tatsächlich bewerkstelligen zu können.
Barbara Rogoff und ihr Forschungsteam haben bereits in den 1990er Jahren dargestellt, wie groß die Kulturunterschiede schon auf der Ebene der Informationsweitergabe sind (Rogoff u. a. 1993; Chavajay & Rogoff 1999). Während in westlichen Mittelschichtfamilien, etwa in den USA, Kinder räumlich und sozial von den Erwachsenen getrennt in einer eigenen Kinderwelt aufwachsen, sieht das Erfahrungsmilieu dörflicher Gemeinschaften in traditionalen Kulturen, zum Beispiel in Indien oder Guatemala, völlig anders aus. Dort gibt es keine Trennung von Kinder- und Erwachsenenwelt. Der Nachwuchs passt sich von Anfang an dem Arbeitsalltag der Familie – der in unmittelbarer Nähe stattfindet – und somit an die künftig auch für ihn anstehenden Aufgaben an. Die Kinder lernen vor allem durch Beobachtung und Nachtun der Tätigkeiten von Erwachsenen oder älteren Kindern. Erwachsene machen höchstens Handgriffe nonverbal vor. Schon im zweiten Lebensjahr übernehmen Kinder verantwortlich Aufgaben, und niemand nimmt daran Anstoß, dass sie zum Beispiel sogar mit Messern hantieren. Allerdings sind die Erwachsenen ständig in der Nähe und aufmerksame Beobachter des kindlichen Tuns.
Gezielte Lerneinheiten bei den westlichen Mittelschichteltern, oft im Rahmen kleiner Spielepisoden, sind dagegen stark sprachbetont und enthalten viel Instruktion und Belehrung, vergleichbar kleinen Unterrichtseinheiten, wie man sie später in der Schule findet.
Eltern aus WEIRD-Kulturen haben andere Entwicklungsziele als Eltern aus traditionalen Dorfgemeinschaften. Das schnelle Erreichen sprachlicher und kognitiver Reife besitzt einen hohen Wert in unserer Gesellschaft, da dies mit einem späteren Schul- und letztlich auch Berufserfolg assoziiert wird. Die individuelle Karriere, die persönliche Leistung ist zentrales Motiv.
Für ein erfolgreiches Leben aus Sicht einer traditionellen Dorfgemeinschaft spielt das Erreichen anderer Kompetenzen eine wichtigere Rolle. Hier hat das Sich-als-Teil-der-Gruppe-Begreifen einen hohen Stellenwert, Individualität ist weniger wichtig. In vielen ländlichen Milieus, zum Beispiel in Dörfern Afrikas, steht zudem die frühe motorische Selbstständigkeit im Fokus elterlicher Aufmerksamkeit (Keller 2011). Auch hier sind die Motive nachvollziehbar: Eine kleine Gemeinschaft ist auf einen starken Gruppenzusammenhalt angewiesen, und frühe motorische Geschicklichkeit bindet die Kinder schneller in die stark manual geprägten Alltagstätigkeiten ein und lässt sie auch eher gefährlichen Situationen selbstständig ausweichen oder entkommen.
Unterschiedliche Entwicklungsziele bewirken unterschiedliche Förderschwerpunkte. Ihre Kinder fördern wollen Eltern aller Kulturen. Babys aus westlichen Mittelschichtfamilien werden aus diesem Grund von Anfang an mit Objekten stimuliert (Objektstimulation) (ebd.). Es ist kaum ein Babybett ohne Mobile und Kuscheltier zu finden. Später spielen (Bilder-)Bücher und Spiele eine große Rolle. Unter Babybögen liegend, können findige Säuglinge durch Manipulation Lichter anschalten, Bewegungen produzieren und Geräusche auslösen. Neben der starken kognitiven Stimulation lernen sie sich auf diese Weise als unabhängiges Wirkzentrum kennen, was zu einer frühen Selbstbewusstheit des Kindes führt. Dreiviertel aller untersuchten 19 Monate alten deutschen Kinder erkennen sich bereits im Spiegel, im Vergleich zu 15 Prozent der gleichaltrigen Kinder aus Kamerun. Gleichzeitig erlaubt dieses Angebot dem Säugling, sich früh alleine zu stimulieren – ohne soziale Gemeinschaft. Wenn die Bezugsperson sich mit dem Baby beschäftigt, tut sie dies meist exklusiv mit intensivem Blickkontakt und besonderer sprachlicher Intensität.
Objekt- und kognitive Stimulation spielen in traditionalen Dorfgemeinschaften, wie den von Heidi Keller und ihrem Team untersuchten Nso in Kamerun, keine große Rolle. Stattdessen wird viel Wert auf motorische Stimulation gelegt. Dazu werden die Babys nicht nur rhythmisch auf- und abwärts bewegt, sondern erfahren synchron vokale Äußerungen oder musikalische Elemente. Diese Form der Interaktion hat eine eher soziale, symbolische Struktur, die das Entwickeln einer Wir-Identität fördert, die elementar ist für gemeinsame Anstrengungen von Familien und Clans, das Überleben in traditionellen Dorfgemeinschaften zu sichern (ebd.). Ein Ablegen des Säuglings ist kaum vorstellbar, was aber nicht bedeutet, dass er mehr exklusive Aufmerksamkeit als im Westen erhält. Stattdessen läuft das Baby – oft am Körper getragen – einfach in unmittelbarer körperlicher Nähe der Bezugspersonen bei den Alltagstätigkeiten mit oder wird von seinen älteren Geschwistern betreut. Bei den Nso wird die motorische Entwicklung als so wichtig angesehen, dass sie durch weitere Trainingseinheiten unterstützt wird, denn möglichst frühe Mobilität und Partizipation an familiären Alltagsaufgaben sind wichtige Entwicklungsziele. Zum Training werden die Säuglinge bereits in den ersten Lebensmonaten in Behälter gesetzt und mit Decken abgestützt, um das Sitzen zu üben, und bekommen mit sechs bis sieben Monaten ein Lauftraining, indem sie zwischen zwei Stangen gestellt werden und sich, daran festhaltend, in diesem Bereich fortbewegen können (ebd.).
Befragt man die Eltern aus den entsprechenden Kulturen, was sie von den Fördermaßnahmen der jeweils anderen Kultur halten, offenbaren sich interessante Unterschiede. Die meisten westlichen Mütter vertreten die Meinung, dass jedes Kind sein eigenes Entwicklungstempo hat und Sitzen, Stehen und Laufen keinesfalls trainiert werden sollten. Westliche Kinderärzte warnen gar vor einem zu frühen Sitzen, um den Rücken nicht zu belasten. Diese Form der motorischen Förderung wird als problematisches Training betrachtet, die körperliche Stimulation in der Interaktion als übertrieben bezeichnet, während die beschriebene kognitive Stimulation in westlichen Kinderzimmern als Förderung und nicht als Training verstanden wird (ebd.). Das Fehlen exklusiver Aufmerksamkeit in der 1:1-Sprach- und Blickstimulation und das nicht Vorhandensein von Spielzeug irritiert die befragten deutschen Mütter. Die afrikanischen Mütter wundern sich dagegen über den wenigen Körperkontakt und die geringe motorische Stimulation (insbesondere über die langen Liegezeiten auf dem Rücken) und äußern sich besorgt.
Heidi Keller (2011) hat deutlich gemacht, dass kulturelle Modelle Sozialisationsziele definieren, also übergreifende Vorstellungen, die sich Eltern für die Entwicklung und Erziehung ihrer Kinder vornehmen, wie zum Beispiel anderen Menschen zu helfen, den Eltern zu gehorchen (als Ausdruck einer relationalen Orientierung) oder Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu entwickeln (als Ausdruck einer autonomen Orientierung). Diese Sozialisationsziele wiederum bilden den Rahmen für die Vorstellungen, die Eltern über Erziehung und Entwicklung haben, also wie Eltern mit ihren Kindern umgehen sollten, um Entwicklung zu unterstützen, und was sie vermeiden sollten.
Sozialisationsstrategien sind angepasst an ihre ökosozialen Kontexte; das heißt, ob überwiegend Autonomie oder Verbundenheit betont wird, ist abhängig von soziodemografischen Merkmalen, wie dem Einkommen, dem Bildungsniveau und einigen anderen damit verbundenen Daten, wie der Anzahl der Kinder in der Familie. Aus diesem Grund ist Autonomie sehr wichtig für westliches Großstadtleben, wo soziale Interaktionen in erster Linie zwischen Fremden stattfinden, wo Konkurrenz selbst zwischen Familienmitgliedern nicht ungewöhnlich ist und wo stabile Ich-Grenzen psychische Gesundheit definieren (Keller 2008). Relationalität (Verbundenheit) dagegen ist lebensnotwendig in traditionellen Dorfgemeinschaften, wo Kooperation in der Familie und in der Kleingruppe essenziell ist und die gemeinsame Anstrengung, das Überleben zu sichern, die Wir-Identität abbildet.
Es gibt also kein allgemein besseres oder schlechteres kulturelles Modell, um Kinder zu sozialisieren, sondern nur Modelle, die besser oder schlechter in den jeweiligen Umgebungsbedingungen funktionieren. Wohlbefinden wird durch den Einklang der alltäglichen Lebenspraxis mit den kulturellen Modellen gewährleistet, und Migranten sind häufig mit kulturellen Modellen konfrontiert (z.B. in Kita oder Schule), die im Gegensatz zu den eigenen Modellen stehen (ebd.). Die überwiegende Mehrzahl zum Beispiel der türkischen Migranten in Deutschland kommt aus traditionellen dörflichen Strukturen, in denen relationale Sozialisationsstrategien vorherrschen. Diese Familien geraten nun in eine öffentliche Welt, die eine starke Betonung von Autonomie und Individualität vertritt.
So besteht auch für pädagogische Fachkräfte die Gefahr von normativen Bewertungsmaßstäben. Das Verhalten von Kindern wird möglicherweise nach Kriterien bewertet, die nicht denen der Eltern entsprechen. Als Folge davon kommen die Fachkräfte unter Umständen zu einer defizitären Interpretation von unvertrauten Verhaltensmustern. Deshalb muss es darum gehen, Vertrauen zu schaffen und auch Familien aus anderen Kulturkreisen ernst zu nehmen, denn Vertrauen ist die zentrale Grundlage für eine gelingende kultursensitive Bildungs- und Erziehungskooperation (Borke & Keller 2014). Kitas, Schulen und andere mit Eltern und ihren Kindern zusammenarbeitende Institutionen müssen zum Beispiel auf ein türkisches Kind und seine Familie anders zugehen als auf eine deutsche, eine afrikanische oder eine japanische Familie. Dazu müssen sie die unterschiedlichen Sozialisationsziele der verschiedenen Kulturen aber erst einmal kennen und sich dafür interessieren. Erst dann können sie versuchen, eine Brücke zu schlagen, die die Entwicklungsbegleitung für das Kind auch in der neuen Umwelt stimmig macht.
1.4 Partizipation ermöglichen als Teil der Entwicklungsbegleitung
Es geht bei einer professionellen Entwicklungsbegleitung, ein inzwischen etablierter Begriff in der Entwicklungsforschung (vgl. Krenz 2010), nie darum, die Kinder »altersgemäß« zu beschäftigen und ihnen »etwas beizubringen«. Es geht darum, dass die pädagogischen Fachkräfte beobachten, wie Kinder – eben dieses zweijährige Mädchen, dieser sechsjährige Junge – sich die Welt erschließen, wie sie am Leben und Lernen auf ihre Art partizipieren.
Deshalb ist es auch der Auftrag pädagogischer Fachkräfte, als professionelle Begleiter höchst individueller Entwicklungsverläufe, zu erkennen: Welche Frage stellt sich ein Kind gerade, was bedeuten seine Handlungen und Äußerungen? Erst auf der Basis regelmäßiger Beobachtung der Aktivitäten der Kinder können vielfältige Anregungen zum Mehr-Verstehen und Weiterdenken gegeben und Entwicklungsverläufe unterstützt werden. Auf diese Weise erlebt ein Mädchen oder ein Junge in jedem Alter Selbstwirksamkeit und fasst Zutrauen in seine Entwicklungsfortschritte. Stärke fühlt, wer sich im sozialen Beziehungsgeschehen selbstständig, handlungsfähig und »beantwortet« erlebt, wer an seinem Entwicklungsverlauf teilhaben kann, partizipieren darf, also seinen Alltag mitgestaltet, an seinen Bildungsprozessen teilhat und in allen – sie oder ihn betreffenden Entscheidungen – altersgemäß mitbestimmt. Eine partizipative Entwicklungsbegleitung bedeutet in der Praxis, »gemeinsam mit den Kindern in ausdauernden Veränderungsprozessen individuell und auf die jeweilige Situation bezogen auszuloten, wo Grenzen, Freiheiten und Verantwortungsbereiche liegen« (Könen 2016, S. 1).
Die UN-Kinderrechtskonvention schreibt in Artikel 12 unter dem Stichwort »Berücksichtigung des Kinderwillens« das Recht des Kindes auf Partizipation fest. Und das bedeutet: Die Meinung des Kindes muss angemessen, seinem Alter und seiner Reife entsprechend, berücksichtigt werden. »Jedem Kind eine Stimme geben! Zuhören, was es zu sagen hat, nach dem Sinn des Gesagten fragen, den individuellen Reichtum des Erlebens, Handelns, Denkens und Fragens der Kinder wahrnehmen und ihm Ausdruck verleihen« (Schäfer & von der Beek 2013, S. 21).
Mit dem Zugeständnis »Unsere Großen (Schulabgänger) dürfen entscheiden, ob sie um 9.30 Uhr im Zimmer oder im Flur frühstücken« ist noch kein Partizipationsanspruch abgedeckt. Partizipation hat, soll sie gelingen, viel mit Vorstellungen über die Beziehungsgestaltung zwischen Fachkraft und Kind zu tun. Es geht um vermitteltes Zutrauen und möglichst vielfältig um tägliche Chancen, sich gemeinsam und, wenn möglich, altersübergreifend aktiv als Entdecker und Gestalter einer Situation – die mich, die uns betrifft – zu erleben. Gute Partizipationsangebote erkennt man daran, dass sie den Kindern Freiraum lassen und den Erwerb komplexer Fähigkeiten im Blick haben (Hüther & Quarch 2016). Es geht um ein Mitspracherecht auch in Sachen Bildung, also um Bildungsbeteiligung.
Das Thema Partizipation und seine adäquate Umsetzung im Alltag der öffentlichen Kinderbetreuung werden dort zum heiß diskutierten Gesprächsthema, wo es um die Berücksichtigung unterschiedlicher kultureller Orientierungen geht. Während in westlichen Mittelschichtfamilien psychologische Autonomie und damit einhergehende Entscheidungsfreiheit ein wichtiges Entwicklungsziel darstellen, steht in dörflichen Lebensgemeinschaften in nicht-westlichen Gesellschaften, aus denen 80 bis 90 Prozent der Migrantenfamilien in Deutschland stammen, familiäre Hierarchie, das heißt Respekt vor Älteren und Gehorsam, im Mittelpunkt der Erziehung (Keller 2015). Welche kultursensitive Antwort findet die Frühpädagogik auf die Frage, wie pädagogische Fachkräfte auch Kindern aus verbundenheitsorientierten Kulturen Teilhabe ermöglichen können, die durch zu viel Entscheidungsfreiheit und Mitbestimmung im Kita-Alltag überfordert sind, weil sie von zuhause gewohnt sind, dass wichtige Entscheidungen durch ihre erwachsenen Bezugspersonen getroffen werden und nicht zur Diskussion stehen?
1.5 Anlage-Umwelt-Diskussion: Was machen die Gene, was die Umwelt?
Die Frage, ob die Entwicklung eher durch genetische Veranlagungen oder durch die unter bestimmten Umweltbedingungen gemachten Erfahrungen beeinflusst wird (»Anlage-Umwelt-Diskussion«), beschäftigte Wissenschaftlergenerationen. Nach heutigem Entwicklungswissen liegt die Lösung nicht in einem »Entweder-oder«, sondern in einem »Sowohl-als-auch«:
Ein Kind ist aktiv und entwickelt sich aus sich heraus.Ein Kind ist auch selektiv, es sucht nach bestimmten Erfahrungen gemäß seinen Interessen und Neigungen, immer abhängig von seinem Entwicklungsstand.Die Umwelt stellt das Angebot an Erfahrungen bereit, die das Kind machen kann.Das Kind seinerseits bestimmt, was es annimmt.Ein Kind kann quantitativ und qualitativ nur so viel an Umweltangeboten annehmen, wie es ihm von seinem Entwicklungsstand her möglich ist.Ein Angebot jenseits seiner Bedürfnisse bleibt bestenfalls ungenutzt, kann aber schlimmstenfalls auch seine Entwicklung beeinträchtigen.Die heute gängigen Interaktionsmodelle erklären Entwicklung sowohl durch spezielle Merkmale der Umwelt und des Kindes als auch durch wechselseitige Einflüsse zwischen beiden. Das Kind selbst wie auch seine Umwelt bestimmen den individuellen Entwicklungsverlauf aktiv mit. Derartige Modelle, erarbeitet aus bereits vorliegenden wissenschaftlichen Erklärungsversuchen (Theorien) und Untersuchungsergebnissen, erleichtern es uns, ein immer besseres Abbild der Realität zu schaffen und so auch von den komplexen Entwicklungszusammenhängen immer mehr zu verstehen.
Ein Beispiel hierfür sind die Untersuchungen über interaktive Erziehungsstile gegenüber Jungen und Mädchen. Jungen und Mädchen provozieren ihre Eltern durch ihr unterschiedliches Verhaltensangebot zu unterschiedlichem Verhalten und reagieren auch wiederum unterschiedlich auf das elterliche Verhaltensangebot und mögliche Freiräume (Bischof-Köhler 2011a). Korrekter wäre es, nicht einfach von »den Jungen« oder »den Mädchen« zu sprechen, sondern immer zu betonen, dass es manche Jungen oder manche Mädchen sind, die in einer bestimmten Situation ein entsprechendes Verhalten eher zeigen. Malatesta und Haviland konnten bereits 1985 durch die Auswertung vieler Untersuchungen eine Anzahl unterschiedlicher Dispositionen auflisten, in denen sich die Geschlechter von Geburt an unterscheiden können. Bereits im nonverbalen Kontaktverhalten von Säuglingen gibt es geschlechtstypische Prädispositionen, die aber keineswegs für jeden weiblichen oder männlichen Säugling zutreffen müssen. Diese »Vorgaben« stoßen jeweils einen interaktiven Prozess bei den Bezugspersonen an und lenken so das Geschehen in eine bestimmte Richtung. Elterliches Verhalten ist intuitiv und sicherlich auch zusätzlich bewusst durch den Wunsch gesteuert, die Interaktion mit dem Kind zu optimieren. »Und da eben alles dafür spricht, dass Jungen und Mädchen von vornherein unterschiedliche Verhaltensangebote machen und in je eigener Weise auf soziale Einflüsse reagieren, ist die nach Geschlechtern differenzierende Sozialisation von Anfang an nicht nur Ausdruck elterlichen Gestaltungswillens, sondern auch Reaktion auf den Eigencharakter des zu gestaltenden ›Materials‹. Eine optimale Interaktion erfordert bei Jungen offensichtlich einen erhöhten Aufwand, jedenfalls aber sicher ein qualitativ anderes Verhalten als bei Mädchen« (ebd., S. 102).
Eltern behandeln ihre weiblichen und männlichen Babys nicht allein deshalb unterschiedlich, weil sie aus ihnen – bewusst oder unbewusst – eine typische Frau oder einen richtigen Mann machen wollen. Die jeweiligen Entwicklungsverläufe beider Geschlechter im ersten Lebenshalbjahr machen unterschiedliche Antworten auf Mädchen und Jungen auch aus dem jeweiligen individuellen Verhaltens des Kindes heraus erklärbar und voneinander abweichende Entwicklungsanregungen verständlich.
Jungen – es handelt sich jeweils um Durchschnittsaussagen, von denen das einzelne Kind deutlich abweichen kann – sind in den ersten Wochen unausgeglichener und schwieriger zu beruhigen als Mädchen; sie schlafen auch weniger. Dadurch fordern sie generell mehr Aufmerksamkeit, ohne den Müttern aber immer zurückzumelden, dass sich ihre Anstrengungen gelohnt und ihre Interventionen das Richtige getroffen haben. Die Belohnung bleibt aus, was eine Verhaltensänderung der Mütter von Jungen für die nächste Zeit voraussagen lässt. Die emotionale Labilität der männlichen Babys ruft zwar mehr Startaufmerksamkeit hervor, aber Interaktionen mit ihnen verlaufen nicht selten kritisch und stellen damit wahrscheinlich höhere Anforderungen an die Bezugspersonen.
Mädchen