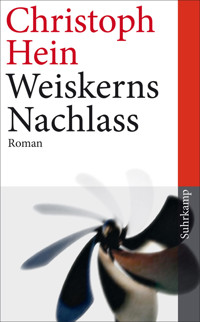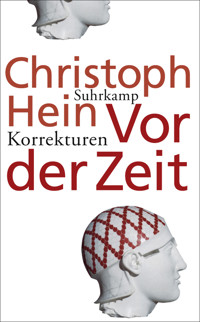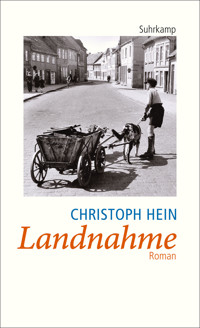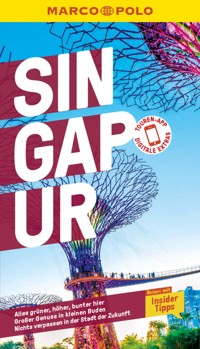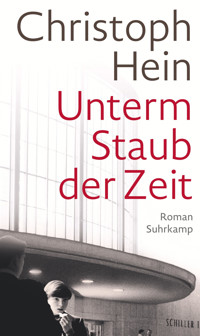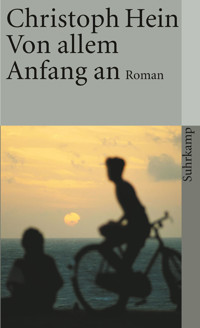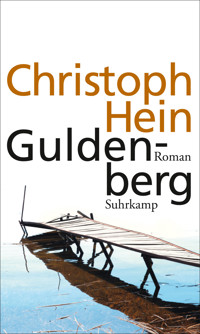
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In dem kleinen Städtchen Bad Guldenberg ist die Welt noch in Ordnung. Jedenfalls, bis im Alten Seglerheim eine Gruppe minderjähriger Migranten untergebracht wird. Die Guldenberger sind sich einig: Diese Fremden passen einfach nicht in den Ort und sorgen nur für Unruhe. Mehr und mehr heizt die Stimmung sich auf, es kommt zu Pöbeleien, und als dann noch das Gerücht die Runde macht, eine junge Frau sei vergewaltigt worden, sind sich alle schnell einig, dass es einer der jungen Migranten gewesen sein muss. Und das wollen die Guldenberger nicht hinnehmen …
Christoph Heins neuer Roman zeichnet das Sittengemälde einer Gesellschaft, die aus den Fugen gerät. Von Menschen, die sich als Opfer sehen und dabei Täter werden. Von Rassismus, wie er uns jeden Tag überall begegnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Christoph Hein
Guldenberg
Roman
Suhrkamp
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2021
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5248.
Erste Auflage 2022 suhrkamp taschenbuch 5248 © Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2021
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
Umschlagfoto: Pixabay
eISBN 978-3-518-76774-0
www.suhrkamp.de
Guldenberg
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Informationen zum Buch
1
Die Farbe der Stadt, ihr Geschmack, ihr Geruch hatten sich verändert. Die Gleichgültigkeit der Bewohner füreinander war geblieben, die kühle Freundlichkeit untereinander, doch eine Unruhe, eine hektische, nervöse Anspannung hatte sich im Ort verbreitet. Das gemächliche Selbstverständnis der kleinen Stadt, das von einem geschichtslosen Alltag und dem gewöhnlichen Rhythmus eines erschöpften Schlendrians geprägt war, wich einer auffälligen Verunsicherung, spürbar in einem überspannten gegenseitigen Misstrauen.
Guldenberg war diese Erregung nicht gewohnt, man lebte hier anders als anderswo in der Welt. Man hatte davon gehört, dass in den großen Städten wie Berlin oder Paris gelegentlich Scheiben eingeschlagen wurden. Von sexuellen Übergriffen und gar Vergewaltigungen hatte man schaudernd in der Zeitung gelesen, aber das waren Vorfälle aus einer anderen Welt, derlei gab es in Guldenberg nicht.
Vor drei Jahrzehnten, erinnerten sich die Älteren, war der Vater eines Mädchens verhaftet, in die Kreisstadt gebracht und dort zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er seine minderjährige Tochter missbraucht hatte, aber das war eine Familie aus der Siedlung gewesen, Zugezogene aus Norddeutschland. Damals waren alle erleichtert gewesen, dass auch die Mutter mit dem Mädchen unmittelbar nach der Verurteilung ihres Mannes die Stadt für immer verließ. Sie waren als Fremde gekommen und waren Fremde geblieben, und solche Leute gehörten einfach nicht nach Bad Guldenberg.
Auch Brände und Brandstiftungen hatte es vor vielen Jahren gegeben, in der Zeit nach dem Krieg. Die elektrischen Leitungen waren marode gewesen und nicht erneuert worden, da es kaum Baustoffe gab und das wenige, was man kaufen konnte, aus schlechtem Material gefertigt war. So war es zu zwei Bränden in der Stadt gekommen, die durch einen verschmorenden Sicherungskasten ausgelöst worden waren. Bei den fünf Brandstiftungen war nie ein Täter gefasst worden, stets wurden die wildesten Vermutungen angestellt, Nachbarn wurden beschuldigt und Konkurrenten, doch keiner der Fälle aufgeklärt, stattdessen waren lebenslange, unauflösbare Feindschaften entstanden, die sich von Generation zu Generation weitervererbten, so dass auch fünfzig Jahre später zwei Familien in der Stadt kein Wort miteinander wechselten, obwohl keiner von ihnen den Grund für das Zerwürfnis erinnerte.
Die ganz alten Leute entsannen sich, dass ihre Stadt vor sechzig, siebzig Jahren in jedem Frühsommer von einer Großfamilie Zigeuner heimgesucht worden war, die zum Entsetzen der Einwohner auf einer Wiese vor der Sporthalle der Schule, der früheren Bleicherwiese, kampierte und ihre mitgeführten Pferde an die Bauern in Guldenberg und in den umliegenden Dörfern zur Arbeit auf den Äckern auslieh.
Die Zigeuner brachten das Leben der Einheimischen in Unordnung. Man störte sich an der unverständlichen Sprache und der Art, wie die Fremden kampierten und geradezu in aller Öffentlichkeit hausten und scheinbar keinerlei Scham kannten. An den Fenstern ihrer Wohnwagen gab es keine Gardinen, es schien ihnen nichts auszumachen, ihre Lebensweise und ihre Armseligkeit vor aller Augen auszubreiten. Die Bewohner der Stadt fühlten sich von dieser Freizügigkeit geradezu belästigt, und alle schlugen drei Kreuze, wenn die Fremden im Frühherbst nach dem Einbringen der Ernte endlich wieder verschwanden.
Auf irgendeine Art war es vor Jahren dem damaligen Bürgermeister gelungen, sie für alle Zeit loszuwerden. Es war ein gewisser Kruschkatz, der länger Bürgermeister von Guldenberg gewesen war als jeder andere. Drei, vier Jahre nach seinem Tod wurde in einer Stadtratsversammlung der Antrag eingebracht, den kleinen, noch unbenannten Weg, der in Richtung Lutherstein führte, nach ihm zu benennen. Der Antrag fand zwar nicht die erforderliche Mehrheit der Stadträte, bekundete aber dennoch die anhaltende Dankbarkeit der Bürger.
Und nun sollten Jahrzehnte später wieder Fremde nach Guldenberg kommen. Das verursachte Unbehagen unter den Bewohnern. Es würde wieder ungehörige und verachtenswerte Auftritte in der Stadt geben, die den Werten und dem Lebensstil ihrer Bürger unangemessen waren und Unfrieden stiften würden. Wieder sollten sich Leute von irgendwoher, die keiner eingeladen hatte, in Guldenberg einnisten, Ausländer, die die Lebensart und Gesinnung der Einwohner nicht kannten und die, wie einst die Zigeuner, die Stadt eines Tages auf Nimmerwiedersehen wieder verlassen würden.
2
Adil war nach Bad Guldenberg gekommen, weil jener Mann es so bestimmte, den er mit Herr Schmitt anzusprechen und der ihm seine Papiere abgenommen hatte. Er hatte Herrn Schmitt gebeten, ihn nach Berlin zu schicken, wo der Freund seines großen Bruders wohnte, aber der Mann hatte abgelehnt: »Guldenberg, verstehst du? Ich sage dir doch, du kommst nach Guldenberg. Die haben freie Plätze. Es soll ein schöner Ort sein. Dort wird es dir gefallen.«
Adil hatte weiter darauf gedrängt, nach Berlin zu dürfen, aber Herr Schmitt hatte nur den Kopf geschüttelt. Wieso er ihn duzte, wusste Adil nicht. Immerhin war er schon siebzehn und sah sogar älter aus. In seinem Sprachführer hatte er gelesen, dass Deutsche andere Erwachsene, die sie nicht kennen, zunächst siezten. Es sei eine Frage des Respekts. Die Anrede »Du«, so stand in dem Buch, sei nur bei Kindern und guten Freunden angebracht; oder man duzte jemanden, wenn man ihn geringschätzte.
Bereits am nächsten Morgen packte er seine Sachen und nach dem Mittagessen kam der kleine Bus, der ihn und fünf weitere junge Männer zu ihren neuen Quartieren bringen sollte. Nach Guldenberg kam außer ihm nur Enis, die anderen vier wurden in eine andere Stadt gefahren.
Er und sein älterer Bruder Tarek hatten bis nach Berlin reisen wollen, wo ein Freund Tareks lebte, bei dem sie hätten unterkommen können, und Adil hatte überlegt, einfach trotzdem zu versuchen, irgendwie nach Berlin zu kommen. Aber er hatte keine Adresse von Tareks Freund, er kannte nur seinen Vornamen oder vielleicht auch nur den Necknamen, Yassir, wie sein Bruder ihn genannt hatte, sein älterer Bruder, sein toter Bruder Tarek. Berlin, hatte er gehört, sei riesengroß, noch größer als Paris oder Beirut, wie sollte er da einen Yassir finden, den er nur einige Male bei Tarek gesehen hatte und der sich möglicherweise gar nicht an ihn erinnerte.
So hatte er die Entscheidung von Herrn Schmitt resigniert angenommen, war mit seinem Rucksack und der neuen Tasche mit den Begrüßungsgeschenken in den Bus gestiegen, hatte sich in die letzte Reihe gesetzt und sein Gepäck auf den Nebensitz gestellt. Er wollte keinesfalls, dass dieser Enis sich zu ihm setzte. Die anderen würde er wahrscheinlich nie wiedersehen, da erübrigte sich jedes Gespräch mit ihnen.
Enis war mehr als zwei Jahre jünger als er und eigentlich noch ein Kind, jedenfalls benahm er sich wie ein Baby. Obwohl er fünfzehn war, heulte er jeden Abend in seinem Bett. Er könne nicht einschlafen, habe er erklärt, als die Zimmernachbarn seiner Heulerei überdrüssig geworden waren. Jede Nacht flennen, das machten vielleicht Mädchen oder kleine Kinder, aber doch kein Fünfzehnjähriger. Mit Enis wollte er nichts zu tun haben, und er würde ihm auch in diesem Guldenberg aus dem Weg gehen. Enis war zwar ein Landsmann, aber er kam aus dem Norden, und deren Sprache verstand ohnehin kein Mensch.
Der Busfahrer musste in Guldenberg zwei Mal anhalten und nach dem Weg fragen. Schließlich parkte er vor einem zweistöckigen Haus am Stadtrand. Er stieg aus und sprach mit zwei Frauen, die aus dem Haus traten. Dann kam er mit einer der beiden Frauen zurück, sie stieg mit ihm in den Bus, lächelte die Jugendlichen an und las dann zwei Namen von einem Zettel ab, die Namen von Adil und von Enis. Sie sagte, sie wären jetzt in ihrem neuen Quartier angekommen, dem Alten Seglerheim, und bat die beiden, mit ihrem Gepäck auszusteigen. Als sie auf der Straße standen, wurde die Tür hinter ihnen geschlossen, der Bus fuhr los, um die übrigen jungen Männer irgendwo anders abzuliefern.
Die Frau gab Adil und Enis die Hand und sagte, sie heiße Marikke Brummig, aber sie sollten nur Marikke zu ihr sagen, hier würden sich alle beim Vornamen nennen.
»Ist das in Ordnung für euch?«
Beide nickten.
»Und das hier ist Ezra. Sie kommt aus Jerewan, aus Armenien, und spricht Arabisch. Sie ist nicht immer bei uns, sie kommt an zwei Tagen pro Woche. Wenn es sprachliche Probleme gibt, kann sie uns helfen. Und sie wird euch auch etwas Deutschunterricht geben.«
»Inshallah«, sagte Ezra und lächelte die beiden Jungen an.
»Mashallah«, erwiderte Adil, und Enis nickte lediglich verlegen.
»So, dann kommt ins Haus, damit ich euch euer Zimmer zeigen kann. Dann könnt ihr gleich die anderen kennenlernen. Die sind auch alle so alt wie ihr. Ihr teilt euch ein Zimmer. Einverstanden?«
»Ich allein schlafen«, sagte Adil.
»Das geht leider nicht, Adil. Das Alte Seglerheim ist bestens ausgestattet, aber wir sind ja kein Hotel. Wir haben vier Schlafräume, ein Zweibettzimmer, zwei für drei Betten und eins für vier. Und für euch zwei habe ich eins der Dreibettzimmer hergerichtet. Das dritte Bett ist vorläufig noch leer, aber wir bekommen noch zwei weitere Einquartierungen.«
»Ich gehen nicht mit Enis in ein Zimmer.«
»Warum nicht? Kommt ihr nicht miteinander aus?«
Er antwortete nicht. Das konnte er sich, wie er meinte, sparen, sie und die anderen würden noch früh genug mitbekommen, dass dieses Baby jede Nacht heulte.
»Na schön. Dann schläfst du, Enis, in dem anderen Dreibettzimmer, und du, Adil, hast für zwei oder drei Tage das Zimmer ganz für dich allein. So – ihr habt sicher Hunger?«
Adil und Enis nickten und liefen Frau Brummig und Ezra hinterher, die ihnen ihre Zimmer zeigten. Ezra übersetzte ihnen die Erklärungen von Marikke Brummig, die die beiden nicht verstanden.
In Adils Zimmer standen ein einfaches Holzbett und ein Doppelstockbett aus Metall. Er warf seinen Rucksack auf das Holzbett und stellte die Tasche auf den Tisch. Die beiden Frauen zeigten ihnen die anderen Räume des Hauses, den Speiseraum, das Bad und den Aufenthaltsraum. Und dann gab es noch einen verglasten Raum, von dem aus man über eine große Wiese auf einen See blicken konnte.
»Hier saßen früher die Leute vom Segelclub beisammen. Bevor sie in das größere Vereinsheim umgezogen sind. Ich nenne es das Gartenzimmer.«
Dann stellte sie ihnen zwei weitere Mitarbeiterinnen vor, Josephine und Friederike, zwei ihrer Schutzengel, wie Frau Brummig sagte, und vier ihrer Mitbewohner, die anderen waren gerade in der Stadt unterwegs. Frau Brummig und die drei Frauen strahlten sie aufmunternd an und redeten unaufhörlich auf sie ein, die vier Mitbewohner dagegen musterten sie misstrauisch und schwiegen.
Der Speiseraum lag neben der kleinen Küche, auf dem Tisch standen zwei Schalen und ein Korb mit Pitabrot. Frau Brummig forderte die beiden Neuankömmlinge auf, sich zu setzen, und bat Friederike, die aufgewärmte Suppe zu bringen.
Nach Einbruch der Dunkelheit waren die anderen vier Bewohner des Heims zurückgekommen. Die zehn jungen Männer saßen im großen Aufenthaltsraum, rechts auf den beiden Sesseln und den Stühlen am Tisch die syrischen Jugendlichen, auf der großen Eckcouch links die vier jungen Afghanen. Der Fernseher lief, aber der Ton war abgedreht, stattdessen plärrte Popmusik aus dem Radio. Einige folgten dem Fußballspiel im Fernsehen, drei saßen über ihre Lehrbücher gebeugt, nur zwei der jungen Afghanen unterhielten sich leise miteinander.
Enis hatte es sich in einem der Sessel bequem gemacht und sah fern. Ab und zu versuchte er mit einem der anderen Syrer ins Gespräch zu kommen, doch man antwortete ihm kaum, an einem Gespräch war keiner interessiert.
Adil saß in dem anderen Sessel und starrte vor sich hin. Irgendwann fragte er unvermittelt laut auf Arabisch in die Runde: »Wie ist es? Was ist hier? Was kann man machen?«
Für einen Moment wurde es ganz still im Raum, nur die Stimme der Sängerin aus dem Radio war zu hören, und es dauerte einige Sekunden, bevor jemand reagierte.
»Nichts«, sagte der Älteste der syrischen Jungs, »nichts ist hier. Nichts kann man machen.«
Und dann schnaubte er verächtlich.
»Verstehe«, sagte Adil. »Aber was macht ihr? Lernen, nur lernen immer?«
Einer, der über ein Buch gebeugt gewesen war, sah auf und meinte: »Du kannst in die Stadt gehen und dich von den Deutschen dumm anreden lassen. Wenn du Pech hast, hauen sie dir eine rein. Schau dich immer gut um, wenn du aus dem Haus gehst. Und nie allein gehen, niemals. Was hier los ist, erlebst du ab abends, wenn es dunkel ist, wenn sie kommen. Sie ziehen am Haus vorbei und schreien.«
»Schreien? Was schreien sie denn?«
»Was sie schreien? Das hörst du schon noch.«
»Ja, und es fliegen schon auch mal Steine«, sagte sein Nebensitzer.
»Schöne Aussichten.« Adil nickte. »Was ist mit Arbeit?«
»Arbeit? Davon reden sie nur. Da ist nichts. Keine Arbeit für uns und kein Money.«
»Dafür gibt es ab und zu Zoff«, flüsterte einer, der sich Hakim nannte, »Zoff mit diesen Dummköpfen von hier und Zoff mit den Afghanen da. Vor allem mit Walid. Der ist gefährlich. Ein Schläger, ein King.«
Adil blickte verstohlen zur Eckcouch hinüber. »Der mit dem gelben Halstuch?«
»Genau der. Der hat ein Klappmesser. Zwanzig Zentimeter ist die Klinge lang.«
»Das da drüben sind alles Afghanen. Denen darf man nicht trauen. Zum Glück schlafen sie in einem anderen Zimmer.«
»Warum müssen wir mit Afghanen zusammenwohnen? Das sind doch Bauern ohne Kultur und Gangster«, sagte Adil leise, aber aufgebracht.
Drei der afghanischen Jugendlichen beäugten ihn misstrauisch, als sie seinen erregten Tonfall hörten.
»Inschallah«, sagte Adil laut in ihre Richtung.
Dann schwieg er und auch die anderen verstummten. Sie starrten gelangweilt auf den Bildschirm, wo jetzt lautlos ein Zeichentrickfilm lief, oder beugten sich wieder über ihre Bücher.
All You Need Is Love, Love, Love, tönte es aus dem Radio.
3
»Ah, die Herren Donnerstag-Skatbrüder. Wie ich sehe, wieder pünktlich auf die Minute. Bitte, die Herren, hier ist das Blatt. Und drei Pils, drei Kurze, wie immer? – Kommt umgehend.«
»Wir bitten darum. Lass uns nicht wieder ewig warten.«
»Da ihr es immer eilig habt, habe ich die drei Bierchen für euch schon gestern gezapft.«
»So schmeckt es bei dir auch. – Hör mal, Schiffer, die Blätter kleben schon aneinander. Hast du kein neues Spiel?«
»Das Blatt hat kein anderer jemals in die Hand bekommen, nur ihr. Ihr solltet euch öfter mal die Hände waschen. Wenigstens jeden Donnerstag, bevor ihr zu mir kommt.«
»Nöl uns nicht voll, Schiffer. Geh an deinen Zapfhahn, wir warten. – Übrigens, ich hab am Wochenende mit Veronika eine kleine Spritztour gemacht, zum Lutherstein und dann den Fluss entlang. Wir kamen auch beim Muldefelsen vorbei. Die Villa von Haubrich-Becker ist so gut wie fertig.«
»Er will wohl kommenden Monat einziehen. Hab ich gehört.«
»Ich habe mir den Prachtbau auch angesehen, Bernhard, bin vor zwei Wochen rausgefahren. Wer es nicht besser weiß, könnte meinen, es sei das Bundeskanzleramt.«
»Nein, die in Berlin können sich so was gar nicht leisten. So großkotzig tritt nur ein HB auf.«
»Wenn er's hat, warum nicht. Nur kein Neid. Der eine steckt sein Geld in ein Haus, der andere in Autos und andere stecken es in die Weiber. Jedem, wie es ihm gefällt.«
»Ja, schon. Aber die Haubrich-Beckers sind nur zwei, was wollen die mit einem solch riesigen Prachtbau? Geschätzt sind das zwölf Räume oder mehr.«
»Vielleicht brauchen sie zwei Bäder, eine Sauna, ein Musikzimmer, ein Billardzimmer und einen Innenpool. Dafür ist das Haus nicht zu groß, Bernhard. Und für einen Haubrich-Becker war noch nie etwas zu protzig.«
»Das schöne Grundstück hat er doch nur bekommen, weil es mit der Villa am Markt nicht geklappt hat, unserem Konzerthaus. Erst haben sie ihm die Villa versprochen, und dann, als die Gelder aus Brüssel geflossen sind, haben sie es sich plötzlich anders überlegt.«
»Ja, da haben sie ihn wirklich übel über den Tisch gezogen. Allerdings hatte der Stadtrat ihm ja lediglich eine Bemühungszusage gegeben. Wie konnte er sich zwei Jahre lang mit einem so dürftigen Happen zufriedengeben? Bemühungszusage, damit kann man sich den Arsch wischen. Das ist rechtlich ohne Bedeutung.«
»Er ist wohl doch nicht so schlau, wie er tut. Hat wohl Zeit und einiges Geld damit verloren. Er musste einen Architekten beauftragen, Rekonstruktionspläne erstellen und vorlegen, und dann noch der Denkmalschutz. Hat alles ein Schweinegeld gekostet, und dann war alles für die Katz.«
»Drei Pils, drei Kurze. Zum Wohl.«
»Schiffer, sag mal, ich würde gern was essen. Aber keine Gulaschsuppe. Gibt's noch was anderes?«
»Ja, also heute habe ich Gulaschsuppe auf der Speisekarte. Und dann, lass mich überlegen, dann habe ich noch Gulaschsuppe im Angebot.«
»Wieso gibt's bei dir immer nur Gulaschsuppe?«
»Ich kann nichts anderes. Gulaschsuppe habe ich bei meiner Oma gelernt. Und meine Gulaschsuppe ist gut. Bei mir war mal ein Ungare, der sagte, so eine gute Gulaschsuppe wie bei mir bekommt man in ganz Ungarien nicht.«
»Schiffer, seit fünf Jahren gibt es bei dir Gulaschsuppe. Gulaschsuppe und nichts anderes.«
»Bezahl mir eine Köchin, dann bekommst du jeden Tag, was du möchtest. Ich kann mir keine Köchin leisten. Und ich kann mich nicht in die Küche stellen. Ich muss zapfen und meine überaus verwöhnten Gäste bedienen.«
»Aber jeden Tag, Schiffer, den der Herr werden lässt, gibt es bei dir Gulaschsuppe. Das ist doch nicht normal. Das ist schon pervers.«
»Das stimmt nicht, Bernhard, nicht jeden Tag. Montags habe ich zu, da hat es bei mir noch nie Gulaschsuppe gegeben. – Lasst euch das Bier schmecken. Ich habe noch andere Gäste. Gäste, die mich nicht laufend anstrudeln.«
»Linus, mein Enkel, sagte mir, im Alten Seglerheim sind neue Flüchtlinge angekommen.«
»Wie viele von denen haben sie unserer armen Stadt denn aufgebrummt?«
»Wusste er nicht. Er hat nur drei, vier von ihnen auf dem Hof gesehen, nicht ganz schwarz, mehr so arabisch dunkel, sagte er.«
»Und wie lange sollen die hierbleiben?«
»Kötteritz sagte im Stadtrat, die Stadt habe maximal ein Jahr für sie zu sorgen. Wir mussten sie aufnehmen, weil das Seglerheim leer stand und der Kreis sie dort unterbringen kann.«
»Nach dem vor fünf Jahren beschlossenen Plan hätte das Heim längst umgebaut sein müssen. Dann hätten wir jetzt eine Pflegestation und diese Flüchtlinge wären uns erspart geblieben.«
»Das verdanken wir diesem Walter Lichtenberger, dass das ewig verschleppt wurde. Aber kein Wunder, wenn die Stadt einen Bankrotteur zum Dezernenten für Stadtentwicklung macht. Erst hat er seine Balkon-Firma ruiniert und nun macht er die Stadt platt.«
Der Wirt kam mit einem Tablett leerer Gläser in der Hand am Tisch vorbei: »Was ist, Sigurd? Hast du nun Hunger oder nicht? Ich stelle jetzt den Suppentopf auf die Kochplatte, die da drüben wollen nämlich was Feines essen.«
»Was Feines essen möchte ich auch. Aber so was gibt es hier ja nicht.«
»Dann geh in ein Sternerestaurant. Ich bin nur ein armer Kneipier, bei dem die Gäste jammern, sobald etwas mehr als zwei Euro kostet.«
»Ich kenne dein Küchengeheimnis, Schiffer. In eine Gulaschsuppe kann man ordentlich scharfen Paprika und Pfeffer kippen, das macht Durst und bringt Umsatz.«
»Ach, du denkst immer nur das Schlechteste von den Leuten, Bernhard.«
»Ich war mein Leben lang Geschäftsmann, Schiffer, ich kenne die Menschen. Denk von jedem das Schlechteste, und du fällst niemals auf die Schnauze.«
»Und ich denke von meinen Gästen immer nur das Beste, und das bringt mir Typen wie euch ins Haus.«
»So ist es und so soll es sein. – Sehr zum Wohl.«
4
Frau Hartwig, die Sekretärin, klopfte kurz an und öffnete im selben Moment die Tür. Sie trat nicht ins Zimmer, steckte lediglich den Kopf hinein und sagte: »Chef, der Herr Kremer ist da, Polizeiobermeister Kremer.«
»Schick ihn rein, Lieschen. Ich will ihn nicht warten lassen.«
Konstantin Kötteritz erhob sich, um seinen Besucher zu begrüßen.
Kremer erschien in seiner blauen Uniformjacke, statt der Diensthose trug er eine verwaschene Jeans, seine Schirmmütze hatte er im Auto gelassen.
»Danke, dass du gekommen bist.«
»Eher ging es nicht, Konstantin, ich kann keine Extratouren machen. Musste es an einen Termin in Ballstaedt dranhängen. Ist halt inzwischen alles nicht mehr so einfach. – Was ist denn so dringend?«
»Setz dich. Kaffee, Tee? Was kann ich dir anbieten?«
»Nichts. Sag einfach, worum es geht. Ich muss um zwei wieder in Wildenberg sein.«
Er setzte sich, knöpfte die Jacke auf und sah den Bürgermeister erwartungsvoll an. Der nahm wieder hinter seinem Schreibtisch Platz und berichtete: »Es gab einen Anschlag auf mich. Oder vielmehr auf meine Familie und mein Haus. Ein halber Ziegelstein wurde uns durchs Wohnzimmerfenster geworfen. Die Kinder waren zum Glück schon im Bett, meine Frau und ich standen in der Küche. Der Ziegel landete direkt auf dem Fernsehsessel, genau dort, wo meine beiden Kleinen keine halbe Stunde vorher noch gesessen hatten. Und die Haustür wurde beschmiert. Türkenwichser stand dort, in roter Farbe.«
»Ja, ich hörte schon so etwas. Du hast die Straftat nicht angezeigt. Wieso nicht?«
»Ich wollte zuvor deinen Rat, Bernhard.«
»Meinen Rat? Kannst du haben. Mein Rat ist: erstatte Anzeige. Die landet irgendwann auf meinem Schreibtisch, wir schauen uns das Papier jeden Monat einmal an, und nach einem halben Jahr schließen wir die Akte. Was denkst du denn, was wir zu tun haben! Oder hast du jemanden gesehen? Hast du einen Verdacht?«
»Gesehen habe ich niemanden, aber die Tat hat wohl eindeutig einen fremdenfeindlichen Hintergrund.«
»Kann sein, muss aber nicht. Auf einen vagen Verdacht hin stufen wir das nicht gleich als fremdenfeindlich ein. Schick mir deine Anzeige, die kommt dann in den Kasten strafbare Sachbeschädigung ohne Personenschaden. Wenn der Verdacht Fremdenfeindlichkeit sich bestätigen sollte, sind wir angewiesen, das Ganze eine Kategorie höher einzustufen, aber dafür gibt es – nach dem, was du mir erzählt hast – keinen wirklich stichhaltigen Ansatzpunkt. Du hast einen vagen Verdacht, na schön, aber das reicht nicht.«
»Ich werde seit Monaten beschimpft, und das weißt du.«
»Du bist der Bürgermeister, Konstantin. Amtspersonen werden hierzulande überall beschimpft. Wer keine Hitze verträgt, sollte nicht in der Küche stehen.«
»Du hast es doch selbst erlebt, Bernhard, du warst bei der letzten Bürgerversammlung dabei. Diese Diffamierungen übersteigen alles, was ich bislang hinzunehmen hatte.«
Bernhard Kremer lächelte verlegen und grinste. Dann sagte er: »Ja, aber du hast dich vielleicht in letzter Zeit auch ein bisschen zu sehr für die Zigeuner eingesetzt.«
»Zigeuner? Unsere Migranten sind keine Sinti oder Roma. Und es sind auch keine Türken. Es sind Afghanen und Syrer, unbegleitete Minderjährige.«
»Mag sein, ich kenne mich da nicht aus. Für die Leute hier sind das alles Zigeuner.«
»Es sind Jugendliche, Bernhard.«
»Ja, aber nicht von hier.«
»Sie können nicht zurück. In ihrer Heimat ist Krieg. Einige von ihnen sind sogar Vollwaisen.«
»Das sehen die Leute hier aber anders. Doch wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Ich habe schließlich andere Aufgaben. Ich weiß nur, dass ein paar Mitbürger hier in Guldenberg wie auch in Wildenberg das ganz anders sehen. Die sagen, wir haben ein schönes Städtchen, man kann hier gut leben, und das sollte so bleiben. Ruhig, vertraut und gemütlich.«
»Und was ist deine Meinung?«
»Meine Meinung? Nun, ich bin nur Polizeiobermeister, Besoldungsgruppe A8. Ich hege die berechtigte Hoffnung, im September Polizeihauptmeister zu werden, also A9. Das ist dann zwar immer noch Mittlerer Dienst, aber etwas besser honoriert. Ich hoffe noch immer, eines Tages in den Höheren Dienst aufzusteigen, dabei könnte eine eigene Meinung jedoch sehr hinderlich sein. Ist bei uns alles schon vorgekommen, Konstantin.«
Konstantin Kötteritz zuckte zusammen, dann biss er sich auf die Lippen und sagte nur: »Gemütlich, ruhig und nett. Und wie geht das mit dem Ziegelstein auf meinem Sessel zusammen? Findest du das auch noch gemütlich?«
Kremer hob abwehrend beide Hände hoch: »Ich will nicht mit dir streiten, Konstantin. Mit dem Mund bist du mir allemal über. Das war schon in der Schule so. Also, keine Diskussion über ein Thema, von dem ich ohnehin nichts verstehe. Sag mir, was du von uns erwartest. Was ich für dich tun kann.«
»Ich möchte, dass ein Polizeiwagen zwei-, dreimal an meinem Haus vorbeifährt. Zu ganz unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten. Nur zur Sicherheit.«
Kremer atmete überrascht tief durch. Er griff in die Jackentasche, holte eine Zigarettenpackung hervor, hielt sie vor sich hoch und fragte: »Darf ich?«
»Eigentlich nicht, aber ich will ja was von dir.«
Er zog eines der Schubfächer an seinem Schreibtisch auf und holte einen Aschenbecher hervor, den er vor seinen Besucher auf den Tisch stellte: »Bitte!«
Kremer nickte, zündete sich eine Zigarette an und fragte, nachdem er einen tiefen Zug genommen hatte: »Zwei-, dreimal im Jahr?«
Kötteritz schüttelte den Kopf.
»Du meinst jeden Monat?«, fragte er entsetzt.
»Ich meine zwei-, dreimal am Tag.«
Kremer lachte auf: »Wo lebst du denn, Konstantin? Wenn dein Kämmerer uns jährlich fünfzigtausend für die uns entstehenden Mehrkosten überweist, können wir darüber reden. Fünfzigtausend, das ist jetzt nur eine grobe Schätzung. Vielleicht sind es nur vierzigtausend. Oder aber achtzigtausend.«
»Es geht um meine Kinder, Bernhard. Der Ziegelstein hätte sie erschlagen können.«
»Ja, aber ich kann nicht zwei Beamte dreimal täglich an deinem Haus vorbeifahren lassen. Das kann kein Revier leisten. Das fällt schon unter Personenschutz. Und für diese Aufgaben ist die Sicherungsgruppe zuständig. Dafür müsstest du dich ans Landeskriminalamt wenden oder gleich ans Bundeskriminalamt.«
»Was soll ich tun, Bernhard? Kann ich denn überhaupt etwas tun? Ich habe Angst um meine Kinder!«
»Vor vier Jahren hatten wir noch unser schönes Revier hier. Das habt ihr aufgelöst, wir wurden nach Wildenberg verlegt. Das prächtige Polizeirevier Guldenberg steht seitdem leer.«
»Ich war gegen die Schließung. Ich habe wochenlang gegen diesen Unsinn angekämpft. Es war eine Entscheidung der Landespolizei, des Innenministeriums.«
»Im Revier hab ich was anderes gehört. Von einem Kuhhandel mit der Landesregierung. Guldenberg hat die Fördermittel vor vier Jahren nur bekommen, weil es der Schließung zugestimmt hat.«
»Das ist nicht wahr. Ich war stets gegen die Schließung, denn eine Stadt braucht ein eigenes Polizeirevier.«
»Wie auch immer, Konstantin. Wenn wir noch hier wären, könnte ich problemlos jeden Tag den einen oder anderen Wagen einen kleinen Umweg machen lassen, damit sie nach deinem Haus sehen. Das wären allenfalls ein paar hundert Meter Umweg. Aber von Wildenberg aus ist das völlig unmöglich. Ausgeschlossen! Wir sind seit Jahren unterbesetzt, ich kann nicht jeden Tag meine Leute und einen Einsatzwagen für ein paar Stunden auf eine Spazierfahrt schicken. Ich kann den Kollegen sagen, sie sollen an jedem Dienstag, wenn sie ohnehin hier unterwegs sind, an deinem Haus vorbeifahren. Aber das ist auch alles, Konstantin.«
»Das nützt mir gar nichts, Bernhard. An dem einzigen Tag, wo ein Polizist in Guldenberg nach dem Rechten sieht, werden diese Banditen wohl kaum etwas gegen mich unternehmen. So verblödet werden sie nicht sein. Die warten ab, bis euer Wagen wieder für eine Woche verschwunden ist.«
Bernhard Kremer sah ihn achselzuckend an, drückte sehr sorgfältig seine Zigarette im Aschenbecher aus, schüttelte den Kopf und stand auf.
»Mehr kann ich dir nicht anbieten. Tut mir leid. Du bist nicht der einzige Amtsträger im Kreis, der dieses Problem hat. Eigentlich betrifft es alle, die sich in Sachen Zigeuner – entschuldige: Migranten – etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt haben.«
»Und was soll ich tun?«
»Auf die Leute hören. Nicht nur auf sie einreden, sondern ihnen auch zuhören. Ansonsten schick mir deine Anzeige, und dann stell meinetwegen irgendwo einen Antrag auf Personenschutz. Aber nicht bei uns, dafür sind wir nicht zuständig.«
Er ging einen Schritt auf ihn zu und reichte ihm die Hand.
Konstantin Kötteritz schüttelte den Kopf: »Nein, damit kann ich mich nicht zufriedengeben. Ich werde bedroht, meine Kinder sind in Gefahr, du musst etwas unternehmen!«
Kremer zog die ausgestreckte Hand zurück und steckte sie in die Jackentasche: »Lass mich wissen, was ich für dich tun kann – aber bitte im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich kann mir deinetwegen keine Dienstpflichtverletzung erlauben.«
Sie sahen sich einen Augenblick lang an, dann nickte Bernhard Kremer dem Bürgermeister zum Abschied zu und verließ wortlos das Zimmer.
5
Guldenberg war in den vergangenen Jahren sichtbar aufgeblüht. Die Straßen der gesamten Innenstadt waren erneuert oder zumindest ausgebessert worden, nur in den Randbezirken gab es noch Straßen mit aufgerissenem Asphalt und Schlaglöchern, doch auch hier hatte die Stadt Zusagen für Gelder vom Land erhalten. Die Fassaden und Dächer der Gebäude waren innerhalb eines Jahrzehnts in Ordnung gebracht worden. Die beiden kommunalen Wohnungsgesellschaften wie auch fast alle privaten Hauseigentümer hatten umfängliche Fördermittel für die Restaurierung in Anspruch nehmen können.
Die Häuser am Markt erstrahlten wieder im alten Glanz der Gründerjahre, das einzige Jugendstilhaus des Ortes im Ornamentstil der Wiener Secession war mit Hilfe und unter Aufsicht der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die dafür Spenden gesammelt und sogar eine größere finanzielle Unterstützung durch die ortsansässige Schwecker Werkzeugmaschinen GmbH erreicht hatte, in seinen ursprünglichen Zustand gebracht worden und begeisterte nicht nur die Besucher Bad Guldenbergs mit seiner nun wieder farbig leuchtenden Fassade, auch die Bürger der Stadt waren stolz auf dieses Prunkstück am Markt.
Stefan Haubrich-Becker, Gründer und Geschäftsführer des Töffli-Werks sowie einer der beiden Vorstände des privaten Mulde-Heilbads, einer riesigen Wellnessanlage am Stadtrand, hatte sich, als die Villa noch dem Verfall preisgegeben zu sein schien, bemüht, den Jugendstilbau zu erwerben. Die ursprüngliche Fassade – dekoriert mit vegetabilen Ornamenten und geometrischen Motiven und durch Putzstreifen und Quadratraster geometrisch gegliedert – war zu dieser Zeit nur noch erahnbar. Ein farbiger Freskenfries hatte sich einst unter dem Dach entlanggezogen und war von Wind und Wetter ausgeblichen und zerbröselt. Das Haus wies nur noch einen einheitlichen zementgrauen Farbton auf, und der einzige Balkon im ersten Stock, von einem Blumenranken-Eisengitter begrenzt, war von der Baupolizei bereits vor Jahren gesperrt und die Balkontür durch Mauerwerk aus grauen Betonsteinen und ein Fenster ersetzt worden.